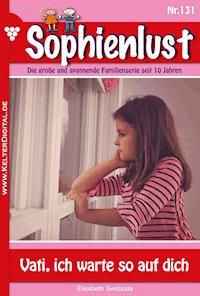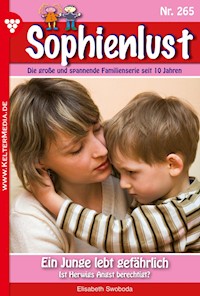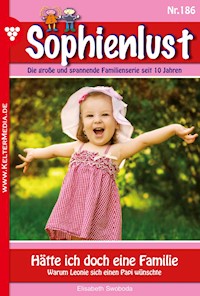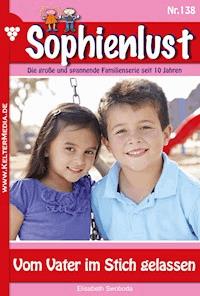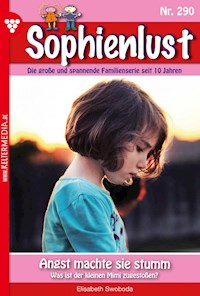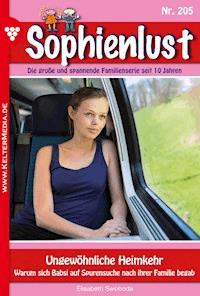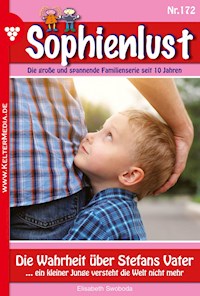Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Sophienlust
- Sprache: Deutsch
Die Idee der sympathischen, lebensklugen Denise von Schoenecker sucht ihresgleichen. Sophienlust wurde gegründet, das Kinderheim der glücklichen Waisenkinder. Denise formt mit glücklicher Hand aus Sophienlust einen fast paradiesischen Ort der Idylle, aber immer wieder wird diese Heimat schenkende Einrichtung auf eine Zerreißprobe gestellt. Diese beliebte Romanserie der großartigen Schriftstellerin Patricia Vandenberg überzeugt durch ihr klares Konzept und seine beiden Identifikationsfiguren. »Und selbstverständlich ist Bernd auch in Englisch Klassenbester.« Manfred Richter führte wieder einmal das große Wort. Seine Stimme war so laut, dass den anderen Gästen gar nichts anderes übrig blieb, als ihm zuzuhören, obwohl niemand unter ihnen war, der sich für das Thema sonderlich erwärmen konnte. Sie saßen in dem gemütlichen Gastraum einer Pension auf der Tauplitzalm beisammen und warteten auf das Abendessen. Da gerade Weihnachtsferien waren, handelte es sich durchweg um Familien mit Kindern, die zum größten Teil froh waren, der Schule für knapp zwei Wochen entronnen zu sein. Die Eltern hätten ganz gern Erfahrungen über die Erfolge und Misserfolge ihrer Sprösslinge ausgetauscht, aber sie schwiegen, denn mit Bernd Richter konnte sich keiner der anderen Kinder messen. »So? Wirklich?«, murmelte seine Nachbarin, eine ungefähr fünfzigjährige Dame, die mit ihrer Enkelin Gerda in die Steiermark gekommen war. Gerda war ebenso wie Bernd Richter elf Jahre alt. An dem gleichen Tisch wie die Richters und Frau Hofer mit ihrer Enkelin, saß noch ein Ehepaar mit Zwillingen, zwei dreizehnjährigen Jungen. Der Wirt hatte dieses Arrangement vorgeschlagen in dem Bestreben, es seinen Gästen recht zu machen. Er hatte angenommen, dass die Kinder schnell Freundschaft miteinander schließen würden, da sie gleichmäßig zusammenpassten. Doch Manfred Richters großsprecherische Art vereitelte diese Annahme. Statt sich wohlzufühlen, litten die anderen, nur, ohne dass Herr Richter das zu bemerken schien. Er war sichtlich in seinem Element. Außer diesem einen großen Tisch gab es in der Gaststube nur noch kleinere Tische für je eine Familie. Aber obwohl die Inhaber der kleinen Tische nicht unmittelbar
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 149
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sophienlust – 176 –Er musste immer der Beste sein
… doch plötzlich gerät Bernds Leben aus den Fugen
Elisabeth Swoboda
»Und selbstverständlich ist Bernd auch in Englisch Klassenbester.« Manfred Richter führte wieder einmal das große Wort. Seine Stimme war so laut, dass den anderen Gästen gar nichts anderes übrig blieb, als ihm zuzuhören, obwohl niemand unter ihnen war, der sich für das Thema sonderlich erwärmen konnte.
Sie saßen in dem gemütlichen Gastraum einer Pension auf der Tauplitzalm beisammen und warteten auf das Abendessen. Da gerade Weihnachtsferien waren, handelte es sich durchweg um Familien mit Kindern, die zum größten Teil froh waren, der Schule für knapp zwei Wochen entronnen zu sein. Die Eltern hätten ganz gern Erfahrungen über die Erfolge und Misserfolge ihrer Sprösslinge ausgetauscht, aber sie schwiegen, denn mit Bernd Richter konnte sich keiner der anderen Kinder messen.
»So? Wirklich?«, murmelte seine Nachbarin, eine ungefähr fünfzigjährige Dame, die mit ihrer Enkelin Gerda in die Steiermark gekommen war. Gerda war ebenso wie Bernd Richter elf Jahre alt.
An dem gleichen Tisch wie die Richters und Frau Hofer mit ihrer Enkelin, saß noch ein Ehepaar mit Zwillingen, zwei dreizehnjährigen Jungen. Der Wirt hatte dieses Arrangement vorgeschlagen in dem Bestreben, es seinen Gästen recht zu machen. Er hatte angenommen, dass die Kinder schnell Freundschaft miteinander schließen würden, da sie gleichmäßig zusammenpassten. Doch Manfred Richters großsprecherische Art vereitelte diese Annahme. Statt sich wohlzufühlen, litten die anderen, nur, ohne dass Herr Richter das zu bemerken schien. Er war sichtlich in seinem Element.
Außer diesem einen großen Tisch gab es in der Gaststube nur noch kleinere Tische für je eine Familie. Aber obwohl die Inhaber der kleinen Tische nicht unmittelbar neben Manfred Richter saßen, konnten sie ihre Ohren nicht verschließen. Seine Stimme war zu durchdringend. Der einzige Vorteil, den sie hatten, bestand darin, dass sie wenigstens nicht antworten mussten.
Obwohl Frau Hofers ›So? Wirklich?‹ durchaus nicht einladend geklungen hatte, floss der Redestrom von Bernds Vater unvermindert weiter.
»Ja, Bernd war so gescheit, dass er schon mit fünf Jahren in die Schule hätte eintreten können«, betonte Manfred Richter. »Leider ist das nicht erlaubt. Eigentlich eine Frechheit, wie sehr die Gesetze die Bürger einschränken«, ereiferte er sich.
»Ich halte das für richtig«, wagte Frau Hofer aufzumucken. »Ein fünfjähriges Kind würde schon allein durch die strenge Schulordnung überfordert sein. Eine ganze Stunde hindurch still sitzen zu müssen …«
»Nur eine Frage der Disziplin«, unterbrach der Abteilungsleiter seine Nachbarin. »Bernd hätte es spielend geschafft. Er war in der Volksschule seinen Mitschülern haushoch überlegen. Seine Lehrerin versicherte mir, dass ein so begabtes Kind eine Seltenheit sei. Es gibt kein Fach, in dem er abfällt. Er kann gut zeichnen, er hat ein musikalisches Gehör, und in Mathematik hat er seine Aufgaben immer spielend gelöst. Er ist auch ein hervorragender Turner. Dafür habe ich gesorgt. Früher war er ein wenig feige, denn seine Mutter verhätschelte ihn zu sehr. Er war wasserscheu und wollte nicht schwimmen lernen. Bis ich ihn eines Tages ins Wasser stieß. Im Hallenbad vom Sprungbrett. Da musste er dann schwimmen. Eine Weile strampelte er herum, und dann plötzlich schwamm er wunderschön.«
»Er hätte ertrinken können«, warf Frau Heindel, die Mutter der Zwillinge, empört ein.
»Unsinn. Ich lasse meinen Sohn doch nicht ertrinken«, verwahrte sich Manfred.
Gerda und die Zwillinge stritten sich, allerdings nur im Scherz, um einen Stoß Gläseruntersätze. Gerda baute daraus kunstvolle Kartenhäuschen, die aber nie über die zweite Etage hinauswuchsen, denn einer der Zwillinge wurde unweigerlich von Zerstörungswut gepackt.
Bernd beteiligte sich nicht an diesem Spiel. Er saß ruhig zwischen seinen Eltern und las ein Buch.
»Zwei gegen einen ist unfair!«, rief Gerda den Zwillingen zu. »Was ist, Bernd? Magst du nicht das dumme Buch weglegen und mir helfen?«
Bernd sah von seinem Buch auf. Man merkte, dass ihn Gerdas Aufforderung in einen Zwiespalt versetzt hatte. Einerseits hätte er sich gern an dem Spaß, den die anderen Kinder hatten, beteiligt, andererseits wollte er sich nicht von dem Buch trennen.
»Zwei Seiten noch, dann ist das Kapitel zu Ende«, sagte er. »Dann tue ich mit euch mit.«
»Karl May«, teilte Manfred Richter unaufgefordert der Tischrunde mit. »Ich bin ja nicht sehr dafür, dass Bernd so etwas liest, aber in den Ferien muss man eben ein Auge zudrücken. Lieber wäre es mir gewesen, wenn er sein Englischbuch mitgenommen hätte, um die nächsten Lektionen vorauszulernen.«
»Vorauslernen? Das tun nur Streber!«, rief einer der Zwillinge.
»Sei nicht vorlaut«, wies seine Mutter ihn mechanisch zurecht.
»Nun, im Grunde hat es Bernd ja nicht nötig vorauszulernen«, stellte Manfred Richter ungerührt fest. »Mit seiner schnellen Auffassungsgabe in Englisch ist für ihn ein Kinderspiel, auch wenn die Anforderungen im Gymnasium höher sind als in der Grundschule. Aber Bernd wird uns nicht enttäuschen. Er wird sich auch im Gymnasium durchsetzen. Seit der ersten Grundschulklasse hat er nur die besten Noten heimgebracht. Er konnte auf Anhieb lesen und machte nie Rechtschreibfehler. Schon mit sechs Jahren verfasste er für seine Mutter ein Muttertagsgedicht. Erinnerst du dich, Ursula?«
»Ja, ich erinnere mich«, sagte Frau Richter leise. Im Gegensatz zu ihrem Mann verhielt sie sich recht schweigsam.
»Bernd ist so vielseitig begabt, dass es mir schwerfällt zu entscheiden, welche seiner Begabungen besonders gefördert werden soll«, fuhr der stolze Vater fort. »Seine Berufswahl …« Er war gezwungen innezuhalten, denn der Wirt schleppte gemeinsam mit seinem erwachsenen Sohn vollbeladene Tabletts heran. Mit spürbarer Erleichterung begannen die Gäste sich dem Essen zu widmen, wobei auch an den anderen Tischen leise geführte Gespräche aufflackerten.
»Na, Filzchen«, wandte sich die junge Ärztin Dr. Anja Frey an ihr Stieftöchterchen Felicitas, »wann wirst du für mich etwas dichten?«
Filzchen wollte etwas sagen, doch ihr Vater, Dr. Stefan Frey, kam ihr zuvor. »Nimmst du diese Angeberei etwa ernst?«, fragte er seine Frau erstaunt.
Anja schüttelte lachend den Kopf. »Nein, natürlich nicht«, entgegnete sie. »Aber wir haben eben nur ein ganz und gar durchschnittliches Kind.«
»Filzchen ist doch nicht durchschnittlich«, widersprach Stefan ihr. »Beim letzten Sprechtag sagte die Lehrerin, dass sie zu den Besten ihrer Klasse gehöre.«
Anja, die gerade einen Schluck von ihrem Apfelsaft genommen hatte, stellte das Glas hastig zurück auf den Tisch und hielt sich die Hand vor den Mund.
»Was hast du? Du willst doch nicht etwa ersticken?«, fragte Stefan.
»Nein, ich …, aber …, mit vollem Mund kann man so schwer lachen«, prustete Anja. »Die Lehrerin sagte, dass sie zu den Besten ihrer Klasse gehöre«, wiederholte sie mit Betonung. »Das klang beinahe wie …, wie …!«
»Vergleichst du mich etwa mit diesem widerlichen Menschen?«, fragte Stefan argwöhnisch, stimmte aber dann in Anjas Lachen ein. »Ja, diese Angeberei scheint ansteckend zu sein«, gab er zu. »Ich werde mich also in Zukunft in Acht nehmen.«
»Das brauchst du nicht«, erwiderte Anja. »Selbstverständlich sind wir beide stolz auf unser Filzchen, aber unser Stolz beschränkt sich auf ein natürliches Ausmaß. Wir haben unser Kind eben lieb.«
»Lieb genug, um es nicht ins Wasser zu stoßen, damit es schwimmen lernt«, sagte Stefan und fügte nach einer kurzen Pause hinzu: »Ich fürchte, dieser Winterurlaub wird doch nicht so schön, wie ich mir vorgestellt hatte. Wenn ich denke, dass ich mir noch eine Woche lang dieses dumme Geschwätz anhören muss …«
»Aber doch nur bei den Mahlzeiten. Sonst brauchen wir uns ja um diese Familie nicht zu kümmern. Iss deine Suppe, Filzchen«, befahl Anja, da sie merkte, dass das Kind die Ohren gespitzt hatte, um dem Gespräch der Eltern zu folgen.
*
Anja war einem Irrtum verfallen, als sie gemeint hatte, dass sich die Familie Frey um die Familie Richter ja nicht zu kümmern brauche. Manfred Richter war es, der trotz Stefans deutlicher Zurückhaltung die Bekanntschaft mit dem Arzt anknüpfte.
»Ich sehe, Sie sind mit einem Hund hier«, eröffnete er am nächsten Morgen das Gespräch, und da sich der Spaniel Stoffel gerade zärtlich an Stefans Hosenbeine schmiegte, konnte der Arzt diese Tatsache nicht gut leugnen. »Er gehört meiner Tochter«, sagte er knapp und wollte sich damit entfernen.
Doch Manfred ließ sich nicht so schnell abschütteln. »Das habe ich mir gedacht«, erwiderte er. »Ja, die Kinder und ihre vierbeinigen Freunde. Bernd hat mich auch herumgekriegt.«
»So?«
»Ja. Sein sehnlichster Wunsch war ein Hund. Zu Weihnachten bekam er ihn. Beinahe bereue ich es schon. So ein Tier ist doch recht lästig, aber was wollen Sie? Bernds Bitten war ich nicht gewachsen.« Er lachte und zuckte mit den Schultern.
Aha, er kehrt den fürsorglichen und nachgiebigen Vater heraus, dachte Stefan Frey und ärgerte sich ein wenig, weil er Manfred Richter beim besten Willen nicht sympathisch finden konnte. Rasch fragte er: »Zu Weihnachten bekam Ihr Sohn einen Hund? Und so schnell trennte er sich wieder von ihm?«
»Trennen? Nein. Wieso?«
»Nun, Sie haben ihn nicht in den Urlaub mitgenommen.«
»Aber ja, wir haben ihn mit. Er ist in Bernds Zimmer. Ich erlaube nicht, den Hund zum Essen mitzunehmen. Ein Hund in der Gaststube …« Er unterbrach sich, denn es fiel ihm plötzlich ein, dass die Arztfamilie den Spaniel immer in die Gaststube mitbrachte, wo er während der Mahlzeiten brav unter dem Tisch lag und sich nicht rührte. »Bei Ihrem Hund ist das selbstverständlich etwas anderes«, fuhr Manfred Richter schnell fort. »Der ist bereits abgerichtet. Aber unser Blacky ist noch jung und unberechenbar. Er muss erst erzogen werden.«
Der Arme! Ein Glück, dass Hunde von Natur aus schwimmen können, fuhr es Stefan Frey durch den Sinn, aber er ließ sich von diesen Gedanken nichts anmerken. »Ich werde jetzt nach meiner Frau und nach meiner Tochter sehen«, sagte er entschuldigend zu Manfred Richter. »Die beiden müssen sich beeilen, sonst kommen wir zu spät zum Skiurs.«
»Und Sie? Fahren Sie nicht Ski?«, erkundigte sich Bernds Vater, während sein Blick über Stefans Kleidung glitt. Der Arzt trug wohl einen Pullover und eine Skihose, aber keine Skischuhe, sondern Fellstiefel.
»Nein«, entgegnete der Arzt. »Ich habe mir vorgenommen, in diesem Urlaub gründlich zu faulenzen. Ich verbringe die meiste Zeit auf der Sonnenterrasse. Zum Glück haben wir schönes Wetter. Ab und zu unternehme ich auch einen Spaziergang mit Stoffel.«
Stoffel schien diese Worte verstanden zu haben, denn er blickte anbetend zu seinem Herrchen auf und wedelte mit dem Schwanz. Stefan Frey bückte sich und tätschelte Stoffels Rücken. »Ja, dir passt das, im Schnee herumtoben zu dürfen«, meinte er dabei. »Wenn wir Frauchen und Filzchen bei der Skischule abgeliefert haben, werden wir hinauf zum Waldrand gehen und nachsehen, was es dort Neues gibt. Aber dass du ja nicht versuchst, unschuldigen Hasen nachzujagen. Sonst muss ich dich an die Leine legen.«
Er nickte Herrn Richter abschiednehmend zu, doch dieser sagte nach einem leichten Zögern: »Sie fahren also nicht Ski, sondern gehen bloß spazieren. Wäre es … Ich meine, ich will nicht unverschämt sein, aber Sie könnten mir einen riesengroßen Gefallen erweisen. Das heißt, nicht mir, sondern eigentlich Bernd.«
Stefan Frey blickte Manfred Richter fragend an.
»Der Junge macht sich Sorgen um Blacky«, fuhr Bernds Vater fort. »Auf die Skipisten können wir den Hund nicht mitnehmen, deshalb lassen wir ihn hier in der Pension. Gestern hatten wir deswegen Schwierigkeiten. Beinahe wäre es zu einem Streit mit dem Wirt gekommen. Dieses niederträchtige Vieh hat nämlich den Bettvorleger aus Bernds Zimmer halb aufgefressen. Nicht richtig gefressen – aber mit den Zähnen in tausend Stücke zerlegt.«
»Vermutlich war ihm langweilig geworden, allein im Zimmer«, sagte Stefan Frey.
»Möglich«, erwiderte Manfred Richter. »Aber wir sind zum Skifahren hergekommen und nicht, um unseren Hund zu unterhalten. Ich habe dem Wirt den Schaden bezahlt – er hat übrigens unverschämt viel für diesen alten Teppich verlangt. Und heute werde ich Blacky trotz Bernds Protesten im Badezimmer einschließen. Dort kann er nichts anstellen.«
»Den Hund ins Badezimmer einzusperrren wäre grausam«, meinte der Arzt.
»Dieser Meinung sind auch Bernd und meine Frau. Aber was soll ich machen? Ich hätte mich einfach weigern sollen, Bernd zu Weihnachten diesen Hund zu schenken. Aber jetzt ist es zu spät. Bernd will ihn nicht mehr hergeben. Deshalb wollte ich Sie bitten …, da Sie ohnedies nichts Besonderes vorhaben …, vielleicht könnten Sie Blacky bei Ihren Spaziergängen mitnehmen?«
»Ich …, äh …« Es war Stefan Frey unmöglich, in der Schnelligkeit eine Erklärung zu finden, warum er das nicht tun konnte. Also gab er sich geschlagen und murmelte: »Gut, ich werde auf Ihren Blacky aufpassen, während Sie Ski fahren.«
»Danke. Ich bin Ihnen sehr zu Dank verpflichtet«, sagte Manfred Richter und fügte sofort hinzu: »Wann kann ich Ihnen den Hund bringen?«
»In einer halben Stunde werde ich auf der Sonnenterrasse sein«, erwiderte Stefan Frey und ergriff nun endgültig die Flucht.
Doch es war bereits zu spät. Anja und Filzchen hatten sich schon zur Skischule begeben. Das ärgerte Stefan, denn er hatte vorgehabt, die beiden zu begleiten und Anjas Skier zu tragen. Seine Laune war daher nicht rosig, als er eine halbe Stunde später auf der Terrasse in einem Lehnstuhl saß und auf Herrn Richter und Blacky wartete. Zu seinem Erstaunen kam jedoch nicht nur das Familienoberhaupt, sondern die ganze Familie Richter anmarschiert. Bernd hielt in den Händen ein winziges, sich windendes Etwas.
Stefan hatte sich über die Rasse, der Blacky angehören mochte, nicht den Kopf zerbrochen. Jetzt sah er, dass es sich um einen kohlrabenschwarzen Zwergpudel handelte. Bernd setzte ihn vorsichtig auf den Boden, wo er wie toll herumhüpfte. Stoffel schnupperte vorsichtig an dem kleinen quicklebendigem Ding, das beinahe wie ein schlampig gewickeltes Wollknäuel wirkte. Dann knurrte er.
»Oh, hoffentlich beißt er Blacky nicht!«, äußerte Bernd besorgt. »Er würde ihn mit einem Biss töten.«
»Nein, du brauchst keine Angst zu haben.« Stefan Frey lächelte dem Jungen beruhigend zu. »Stoffel beißt nicht. Die beiden werden sich schnell aneinander gewöhnen.«
Doch Bernd war noch nicht überzeugt. »Vielleicht sollte ich doch lieber bei Blacky bleiben«, meinte er und warf seinem Vater einen bittenden Blick zu.
»Das kommt überhaupt nicht infrage«, entgegnete Manfred Richter barsch.
»Wir haben für heute eine größere Tour geplant, und ich bin froh, dass ich jemanden gefunden habe, der auf den Hund aufpasst.«
»Sie werden doch wirklich gut auf Blacky aufpassen?«, fragte Bernd ängstlich und seufzte: »Ich glaube, ich werde den ganzen Tag an Blacky denken müssen.«
Stefan Frey horchte auf. »Wieso den ganzen Tag?«, erkundigte er sich in einem Tonfall, der sich nicht durch überströmende Freundlichkeit auszeichnete.
»Ich …, wir …, wir haben gedacht, dass es Ihnen nichts ausmachen würde«, erwiderte Manfred Richter mit einer Unverfrorenheit, über die der Arzt nur staunen konnte. »Da Sie doch sowieso keinen Sport betreiben und außerdem noch auf den Spaniel aufpassen müssen …«
»Manfred!« Stefan Frey erlebte nun zum ersten Mal, dass Frau Richter von sich aus das Wort ergriff. »Manfred, ich habe geglaubt, dass du Herrn …« Sie zögerte und sah ihren Mann fragend an.
Dieser geriet nun doch in eine leichte Verlegenheit, denn er konnte Stefan Frey seiner Frau nicht vorstellen. Einfach deshalb nicht, weil er dessen Namen nicht kannte. Er hatte es zustande gebracht, einem wildfremden Menschen seinen Hund aufzuhalsen.
»Dr. Frey«, sprang Stefan hilfreich ein.
»Richter«, murmelte Ursula, und Stefan nickte. Ihr Name war für ihn nichts Neues, denn bei dem lautstarken Gespräch am Nebentisch hatte es sich nicht vermeiden lassen, dass er die Namen sämtlicher daran beteiligter Personen aufgeschnappt hatte.
»Hast du Herrn Dr. Frey denn nicht gefragt, ob es ihm recht ist, Blacky bis zum späten Nachmittag zu behalten?«, äußerte Ursula Richter nun.
»Was macht es denn schon aus? Wenn du dich nur nicht überall einmischen würdest«, knurrte Manfred Richter. »Du warst es, die Bernd unbedingt diesen blödsinnigen Wunsch erfüllen wollte«, warf er seiner Frau vor.
Bernds blaue Augen verdunkelten sich. Er sah aus, als ob er jeden Moment in Tränen ausbrechen würde.
»Fang jetzt nur nicht an zu heulen«, schimpfte sein Vater. »Ein angehender Mann weint nicht. Aber deine Mutter lässt dir natürlich alles durchgehen, genau wie dein lächerliches Getue um dieses Vieh.«
Stefan Frey merkte, dass Manfred Richter drauf und dran war, seine Frau für Blackys lästiges Dasein verantwortlich zu machen. Er verspürte jedoch nicht die geringste Lust, Zeuge des heraufdämmernden Familienkrachs zu werden. Deshalb sagte er mit gezwungener Höflichkeit: »Es macht mir nichts aus, den ganzen Tag über auf Blacky aufzupassen. Im Gegenteil – unser Stoffel kommt auf diese Art wenigstens zu einem Spielkameraden. Er wird deinem Blacky bestimmt nichts zuleide tun, Bernd.«
»Na, seht ihr«, sagte Manfred Richter, und die drei zogen ab.
Stefan Frey nahm Blacky auf den Schoß und streichelte ihn ein wenig gedankenverloren. Stoffel beobachtete diesen Vorgang mit wachem Misstrauen, was dem Arzt zu der Bemerkung veranlasste: »Du hast keinen Grund zur Eifersucht, mein Braver. Heute Abend geben wir Blacky wieder seinem Besitzer zurück. Möchtest du mit ihm spielen? Ich fürchte nur, dass er dazu noch zu klein ist.«
Als Anja und Filzchen zu Mittag zu der Pension zurückkehrten, waren sie beide einigermaßen erhitzt. Besonders Filzchen hatte glühende Wangen. »Ich kann Bogen fahren, richtige Bogen!«, rief sie ihrem Vater schon von Weitem zu. »Und ich kann auch stehen bleiben, ohne mich dabei hinzusetzen!«
»Na, das sind ja gewaltige Fortschritte.« Stefan Frey lachte und maß seine Tochter mit liebevoller Bewunderung. Filzchen sah niedlich aus in ihrem hellgrünen Skianzug und dem weißen flaumigen Mützchen.
Doch das Kind achtete nicht mehr auf seinen Vater. Sein Blick war auf Blacky gefallen. »Nein, ist das ein komischer kleiner Hund«, meinte es. »Hat Stoffel ihn aufgetrieben, um mit ihm zu spielen?«
»Nein, die Sache verhält sich anders. Aber kommt, wir wollen ins Haus gehen. Meine beiden tüchtigen Skiläuferinnen sind gewiss hungrig.«
Stefan bückte sich und nahm Blacky hoch, was dieser mit einem tütenden Kläffen quittierte.
»Warum lässt du den armen kleinen Hund nicht in Ruhe?«, fragte Filzchen. »Ich glaube, er mag dich nicht. Schau, wie er sich wehrt. Er will wieder hinab. Gib acht, er wird dich beißen! Zu mir sagst du immer, dass ich fremde Hunde nicht anfassen soll.«