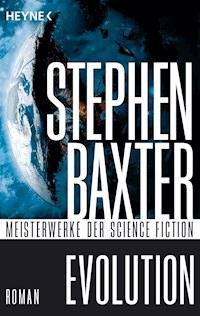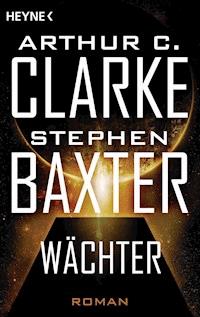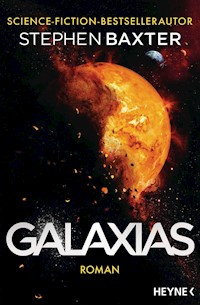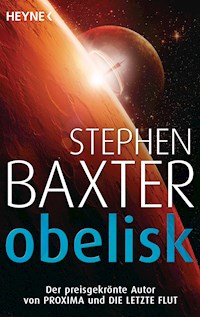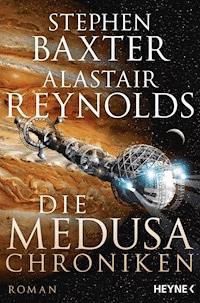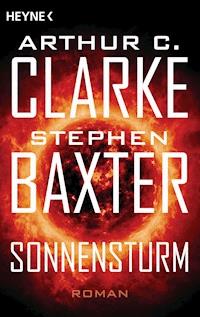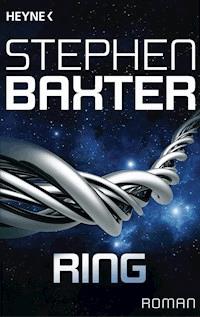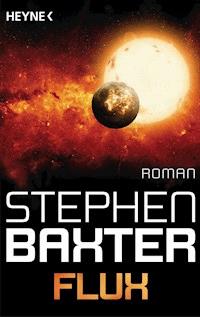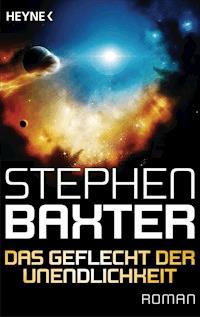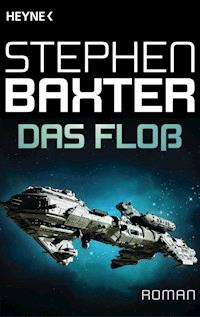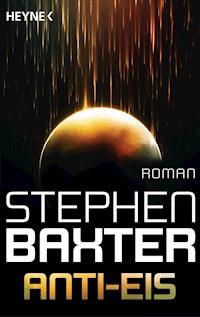7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Eine Prophezeiung aus der Zukunft verändert die Vergangenheit
Wir schreiben das Jahr 300 nach Christus. Kaiser Konstantin plant, das Christentum als offizielle Staatsreligion anzuerkennen. Da wird eine Verschwörung mit dem Ziel, den Kaiser zu ermorden, aufgedeckt. Eine Verschwörung, deren Wurzeln jedoch nicht in der Vergangenheit liegen, sondern in der Zukunft: In dem Versuch, den Lauf der Geschichte nachträglich zu verändern. Doch wer steckt dahinter? Und was ist das Ziel?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 583
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
DAS BUCH
Britannien, im Jahre 4 v. Chr.: In einer eisigen Winternacht wird in einem Rundhaus der Junge Nectovelin geboren, doch es ist eine Nacht des Todes und der Prophezeiungen. Kurz bevor seine brigantische Mutter infolge der schweren Geburt stirbt, spricht sie in lateinischen Versen von einer erneuten Invasion der Römer und beauftragt Nectovelin, die Wurzel der Knechtschaft auszureißen – ein Vermächtnis, das fortan das Leben des Jungen bestimmt. Als knapp vierzig Jahre später die Römer unter Claudius in Britannien landen, wird Nectovelin zum Augenzeugen der Invasion. Unter dem Eindruck der Prophezeiung wirft er sich dem Feind wagemutig entgegen – doch er verliert sein Leben und das Land seine Freiheit. Während die römische Lebensart sich ausbreitet und den Britanniern ihre Götter abhanden kommen, scheint sich die Wahrhaftigkeit der Prophezeiung zu verlieren. Über einhundert Jahre nach Nectovelins Geburt begibt sich Severa, eine ferne Nachfahrin, erneut auf die Suche nach den rätselhaften Versen. Doch sie kämpft nicht um Freiheit, sondern um Profit – denn der uralte Text prophezeit eine steingewordene Schlinge im Norden des Landes: Hadrians Wall. Geschickt manipuliert sie den Herrscher, das Bauvorhaben zu verwirklichen, investiert in die familieneigenen Steinbrüche – und scheitert. Denn die wahre Prophezeiung birgt die Stimme der Zukunft vor der vergehenden Zeit in sich – Worte, die aus der Ewigkeit abgeleitet sind – und die Suche nach Freiheit über schmerzliche vier Jahrhunderte hinweg …
DER AUTOR
Der Engländer Stephen Baxter, geboren 1957, zählt zu den weltweit bedeutendsten Autoren naturwissenschaftlich-technisch orientierter Science Fiction. Aufgewachsen in Liverpool, studierte er Mathematik und Astronomie und widmete sich dann ganz dem Schreiben. Baxter lebt und arbeitet in Buckinghamshire. »Imperator« ist der Auftakt zu seiner neuen, atemberaubenden Saga Die Zeit- Verschwörung.
Inhaltsverzeichnis
ORTSNAMEN:
Banna, Birdoswald Caledonien, Schottland Camulodunum, Colchester Durovernum, Canterbury Eburacum, York Dolaucothi Londinium, London Mona, Anglesey Rutupiae, Richborough
Gesoriacum, Boulogne Massilia, Marseilles Mediolanum, Mailand
FLÜSSE:
Tamesis, Themse Sabrina, Severn Tinea, Tyne Ituna, Solway Cantiacer-Fluss, Medway
WICHTIGSTE BRITANNISCHE VOLKSSTÄMME:
Atrebaten Briganten Catuvellaunen Cantiacer Durotriger Icener Ordovicer Siluren
ORACULUM NECTOVELINIUM
(DIE PROPHEZEIUNG DES NECTOVELIN, 4 V. CHR.)
Aulaeum temporum te involvat, puer, at libertas habes: Cano ad tibi de memoriam atque posteritam, Omni gentum et omni deorum, imperatori tres erunt. Nomabitur vir Germanicus cum oculum hyalum; Scandabit equos enormes quam domuum dentate quasi gladio. Tremefacabit caelum, erit filius Romulum potens Atque graeculus parvus erit. Nascitur deus iuvenus. Ruabit Roma cervixis islae in laqueui cautei. Emergabit in Brigantio, exaltabitur in Romae. Pudor! comprecabit deum servi, sed ipse apparebit deum. Ecclesiam marmori moribundi fiet complexus imperii. Reminisce! Habemus has verita et sunt manifesta: Indico: omnis humanitas factus aequus sunt, Rebus civicum dati sunt ab architecto magno, Et sunt vita et libertas et venatus felicitae. O puer! involvaris in aulaeum temporum, fere!
DIE PROPHEZEIUNG DES NECTOVELIN
(FREIE ÜBERSETZUNG UNTER BEIBEHALTUNG DES AKROSTICHONS)
Ach Kind! Verwoben in den Wandteppich der Zeit, und dennoch frei geboren,/Cum fortia sing ich dir von dem, was ist und was sein wird, und/Obendrein von allen Menschen, Göttern, und von drei mächt’gen Kaisern. / Nebst einem Mann, germanisch ist sein Name und seine Augen sind aus Glas, / Schreiten einher haushohe Pferde mit säbelgleichen Zähnen./Turbulente Himmel verkünden die Ankunft von Roms großem Sohn;/ Auch wird man ihn als kleinen Griechen kennen./ Und während Gott als Kind geboren wird, / Rammt römische Gewalt der Insel Hals in eine steingewordne Schlinge. / Erhoben in Brigantien, wird später er in Rom gepriesen, / Paladin eines Sklavengottes, am Ende selbst ein Gott./ Eingebunden in das Reich, bleibt von der Kirche toter Marmor nur./ Ruf ins Gedächtnis dir die Wahrheiten, die wir für selbstverständlich halten – / Ich sage dir, dass alle Menschen gleich und frei erschaffen sind, mit / Rechten, unveräußerlich, vom Schöpfer ihnen zugeeignet; / Etwa dem Recht auf Leben, Freiheit und aufs Glücksbestreben./ O in die Zeit verwobnes Kind, versuch die Wurzel auszureißen!
PROLOG
4 v. CHR.
I
Es war ein schwerer Tag, an dem Bricas Kind, Cunovics Neffe, sich ins Leben quälte, ein schwerer, langer Tag der Geburt und des Todes. Und es war der Tag, wie Cunovic später glaubte, an dem die eisigen Finger des Webers an den Fäden des Zeitteppichs zu zupfen begannen.
Die Wehen setzten im hellen Schein der Mittagssonne ein, aber der Wintertag war kurz, und die Tortur zog sich bis in die Dunkelheit hinein. Cunovic saß die ganze Zeit mit seinem Bruder Ban, dem Vater des Kindes, und der übrigen Familie dabei. Im verrauchten Halbdunkel unter dem dicken Strohdach drängten sich Bricas Mutter Sula und die Frauen der Familie in der Tageshälfte des Hauses, wo sie Brica beruhigende Worte zuflüsterten und ihr die Stirn mit warmen Tüchern abwischten. Die wachsamen Gesichter ihrer Angehörigen ähnelten eingefangenen Monden, die innerhalb der runden Mauern des Hauses hingen, dachte Cunovic versonnen. Doch als sich die schwierige Geburt immer mehr in die Länge zog, wuchs Bans stumme Sorge, und selbst die Kinder kamen ins Grübeln.
Der Druide war der einzige Fremde, der Einzige, der nicht durch Blutsbande mit dem ungeborenen Kind verwandt war, ein dünner Mann mit einem leichten, singenden Akzent, wie man ihn seinen Worten nach auf Mona sprach, jener im Westen gelegenen Insel der Gebete und Studien, wo er zur Welt gekommen zu sein behauptete. Jetzt wanderte er im Haus umher und intonierte dabei einen unablässigen Sprechgesang; seine halb geschlossenen Augen bewegten sich unruhig. Er war niemandem eine Hilfe, dachte Cunovic missmutig.
Als Erster verlor der alte Nectovelin, Cunovics Großvater, die Geduld. Mit einem Knurren kam er auf die Beine, ein Berg aus Muskeln und Fett, und durchquerte die Hütte. Sein schwerer Lederumhang – er roch nach Blut, Schweiß und Fett, nach Hunden, Pferden und Vieh – streifte Cunovic, und er humpelte, wobei er sein linkes Bein deutlich schonte; angeblich handelte es sich um eine Verletzung aus dem Krieg gegen Caesar vor fünfzig Jahren. Er schob den ledernen Türvorhang beiseite und marschierte hinaus. Die anderen Männer, die stumm in der Nachthälfte des Hauses gesessen hatten, erhoben sich steifbeinig und folgten Nectovelin einer nach dem anderen.
Als Ban ebenfalls aufstand, seufzte Cunovic und schloss sich ihm an. Nectovelin war alt; er würde der Urgroßvater des Kindes sein, das in dieser Nacht zur Welt kommen sollte. Aber Cunovics ganzes Leben lang hatte Nectovelin mit seiner Größe, seiner Kraft und seinem Vermächtnis von jugendlichem Kampfesmut die Familie geführt, und das erst recht seit dem Tod seines einzigen Sohnes, des Vaters von Cunovic und Ban. So war es auch in dieser Nacht: Wenn Nectovelin voranging, folgten ihm die anderen.
Die Nacht draußen war frisch und wolkenlos, die Sterne wie Knochensplitter. Die Männer standen in kleinen Gruppen beisammen und unterhielten sich mit leiser Stimme; einige von ihnen kauten Rindenstücke. Der Dampf ihres Atems legte sich wie ein Helm um ihre Köpfe. Die Hunde, die in dieser Nacht nicht ins Haus durften, zerrten an ihren Leinen und versuchten winselnd, zu den Männern zu gelangen. Trotz der eisigen Kälte lag eine schwere Feuchtigkeit in der Luft; dies war ein mooriges Gebiet.
Cunovic erspähte seinen Bruder ein wenig abseits von den anderen, am Rand des Grabens um die kleine Gruppe dicht beieinanderstehender Häuser. Er ging zu ihm hinüber. Reif knirschte unter den Ledersohlen seiner Schuhe.
Die Brüder schauten in die Stille hinaus. Die kleine Gemeinschaft, die sich Banna nannte, befand sich auf einem Höhenzug mit Blick nach Süden über ein steilwandiges, bewaldetes Tal. Es war eine mondlose Nacht, aber das Sternenlicht funkelte auf dem Wasser des Flusses am Fuß der Felswand, und Cunovics Blick schweifte über die sinnlich wogenden, dunklen Hügel weiter südlich. Hier war das Volk der Briganten zu Hause. Morgens sah man Rauchfahnen von Häusern aufsteigen, die eine Landschaft voller Menschen und deren Vieh sprenkelten. Sie lebten schon sehr lange hier, wie man an den verwitterten Grabhügeln inmitten uralter, verwachsener Gehölze sah, die sich an diesem Rand der Felswand drängten. Doch nun war kein Licht zu sehen, denn die Häuser hielten ihre Helligkeit und Wärme im Innern wie geschlossene Münder.
Cunovic wartete, bis sein Bruder bereit war, mit ihm zu reden. Ban war erst zwanzig, fünf Jahre jünger als er.
»Ich bin froh, dass du hier bist«, sagte Ban schließlich. »Ich könnte deine Gesellschaft gebrauchen.«
Cunovic war gerührt. »Ich weiß, ich war häufig fort. Ich dachte, wir würden uns auseinanderleben …«
»Niemals.«
»Und außerdem bin ich keine große Hilfe. Schließlich habe ich keine Kinder. Ich habe das noch nicht durchgemacht.«
»Aber du bist da«, sagte Ban ernst. »So wie auch ich für dich da sein werde. Wahrscheinlich vermisst du die Annehmlichkeiten deiner Reisen. In einer solchen Nacht wäre ein kurzes Bad in einem Becken mit dampfendem Wasser nicht zu verachten.«
Cunovic grunzte. »Glaub nicht alles, was du hörst. Der König der Catuvellaunen hat sich ein Badehaus bauen lassen. Der Entwurf stammt von einem römischen Architekten, und er hat sich dafür dumm und dämlich bezahlt. Aber die Händler aus Gallien meinen, für sie sei es nicht mehr als ein Schlammloch, in dem sich die Schweine suhlen könnten. Obwohl man einem König so etwas natürlich nicht ins Gesicht sagt.«
Das brachte Ban zum Lachen, aber Cunovic registrierte unbehaglich, dass einige der lateinischen Begriffe, die er gedankenlos eingestreut hatte – Architekt, Entwurf, ja sogar bezahlt –, seinem Bruder wenig sagten.
»Immerhin hast du es geschafft, von hier wegzukommen«, sagte Ban. »Deine Handelsgeschäfte laufen gut. Ist es nicht ein seltsames Gefühl, wieder hier zu sein? Du bist ein ausgewachsener Hund, der zum Wurf zurückkehrt, Bruder.«
Cunovic ließ den Blick über die schlafende Landschaft schweifen. »Nein«, sagte er schlicht. »Im Süden gibt es verspielte kleine Hügel und Täler, die so eng beieinanderliegen, dass man nicht über die nächste Kuppe hinausschauen kann. Das Erdreich ist voller Kalk. Die Sommer sind zu heiß, die Winter zu schlammig. Und Nächte wie diese gibt es dort überhaupt nicht …« Und er sog die eisgeschwängerte Luft mit einem reinigenden Atemzug tief in die Lungen.
»Ah.« Ban lächelte. »Du vermisst Coventina.«
Coventina war die Göttin dieses Ortes. Man konnte die Kurven ihres Körpers in den wogenden Hügeln sehen, ihr Geschlecht in den grünen Schatten der Täler. »Ja, ich vermisse das alte Mädchen«, gab Cunovic zu.
Ein lautes Schnauben nah an seinem Ohr ließ ihn zusammenfahren. Es war Nectovelin. »Dein Zuhause nennst du das. Aber du warst nicht hier, um beim Bau des neuen Hauses zu helfen, nicht wahr? Ich glaube, wir wissen, wo dein Herz ist, Cunovic.«
II
Nectovelin schlich sich irgendwie immer an einen heran. Trotz seines massigen Körpers und seines Hinkebeins konnte er sich sehr leise bewegen, und er hielt sich stets im Windschatten. Er hatte nach wie vor die Instinkte eines Kriegers, dachte Cunovic, wagenspurentiefe Furchen, die sich tief in seine Persönlichkeit eingegraben hatten und mehr über seine Vergangenheit verrieten als all seine Prahlereien.
Es verletzte Cunovic jedes Mal, dass dieser eindrucksvolle Mann, sein Großvater, so wenig von ihm zu halten schien. »Du täuschst dich in mir, weißt du«, sagte er. »Vielleicht habe ich mich nicht eigenhändig am Hausbau beteiligt, aber mit den Geschenken, die ich heimgeschickt habe, konntet ihr immerhin einen Teil der Baukosten bestreiten, nicht wahr?«
Nectovelin räusperte sich und spuckte aus. »Du redest wie dieser Druide, bei dem sich meine Eingeweide kräuseln. Aber Worte sind wie Staub. Schau dich doch nur an! Du trägst einen wollenen Leibrock wie dein Bruder, aber dein Gesicht ist glatt, deine Haare sind gekämmt – du hast sie dir sogar in den Nasenlöchern und an den Ohren ausgezupft, wenn ich mich nicht irre. Das Haus deines Körpers zeigt, was du sein möchtest.«
Cunovic trat einen Schritt näher an den alten Mann heran, eine bewusste Herausforderung, und Nectovelin versteifte sich kaum merklich. »Und du bist ein Heuchler«, sagte Cunovic leise. »Ich entsinne mich nicht, dass du meine silbernen Broschen und meine Weinkrüge abgelehnt hättest, mit denen du erst gestern fünf Stück Vieh von Macha gekauft hast, diesem anderen alten Brummbär aus dem Tal. Mag sein, dass es dir nicht gefällt, Großvater. Vielleicht ist es nicht mehr so wie in den alten Zeiten. Aber so geht es heutzutage nun einmal zu in der Welt.«
Nectovelin starrte ihn finster an, reglos wie ein Wolf, sein Gesicht eine Maske, in der sich Schatten sammelten.
Ban kam ihnen zu Hilfe. Er trat zwischen Bruder und Großvater. »Nicht heute Nacht, ihr beiden. Ich habe schon genug am Hals.«
Nectovelin starrte ihm noch einige Herzschläge lang unverwandt in die Augen, und Cunovic schaute bereitwillig als Erster weg. Dann rückten die drei voneinander ab, und die Spannung ließ nach.
In unbehaglichem Schweigen drehten sie sich zum Haus um. Es gehörte zu einem Dutzend Häuser, die von einem unregelmäßigen Graben umgeben waren, und sein kegelförmiger Umriss wirkte im Dunkeln niedrig und beinahe formlos. Aber es kam auf die Einzelheiten an. Die dicken Stützpfosten stammten von Bäumen, die man schon als Schösslinge dazu ausersehen und entsprechend markiert hatte, und sie waren so gut befestigt und ausbalanciert, dass kein zentraler Pfeiler benötigt wurde. Der große, offene Innenraum war nach uraltem Brauch so angelegt, dass er die Zyklen des Tages und der Jahreszeiten widerspiegelte. Der einzige Eingang zeigte nach Südosten, zur aufgehenden Sonne bei der Tagundnachtgleiche. Wenn man im Haus herumging und der Spur des Sonnenlichts durch den Tag folgte, gelangte man von der Morgenseite des Hauses zur Linken, wo Kinder spielten, Tuch gewoben und Korn gemahlen wurde, zur Nachtseite, wo Nahrung zubereitet wurde und wo sich die Schlafplätze befanden. So lag auch Brica jetzt gleich links vom Eingang auf ihrem Lager aus Fellen, denn dies war der Ort der Geburt, während die älteste ihrer Großmütter rechts neben der Tür saß, bereit, in die tiefere Kälte des Todes hinauszugehen.
Nach Cunovics Erfahrung hielten viele hochnäsige, die Römer nachäffende Bewohner des Südens solche Häuser für nichts weiter als große Misthaufen, aufgestapelt von Männern, die geistig auf der Stufe von Kindern standen. Aber da irrten sie sich. Briganten konnten jede beliebige Hausform bauen. Die meisten ihrer Scheunen und Getreidespeicher waren aus praktischen Gründen rechteckig, und manchmal bauten sie mit Stein, genau wie die Römer. Aber sie zogen runde, aus lebendigem Holz errichtete Häuser vor, die ihre Denkweise, die Zyklen ihres Lebens und ihre ins Land eingebettete Göttin widerspiegelten.
All diese Gedanken gingen Cunovic ungeordnet durch den Kopf. Er war stolz auf sein Haus und den Beitrag, den er dazu geleistet hatte: ein brigantisches Haus im alten Stil, teilweise mit neuem Geld bezahlt. Von hier stammte er; er würde immer ein Brigant sein.
Doch als Hunde-, Pferde- und Lederhändler hatte er es nicht nur mit brutalen Königen im Süden Britanniens zu tun, sondern auch mit kultivierten Menschen aus dem Mittelmeerraum, dem Herzen der riesigen und geheimnisvollen römischen Welt. Er hatte lernen müssen, anders zu sein. In Nectovelins Welt der Familie und der Treue wurde man von Bändern aus Eisen festgehalten, von der Geburt bis zum Tod. Cunovic bewegte sich in einer viel freieren Welt, einer Welt, in der er tun konnte, was ihm beliebte, solange er Geld verdiente. Er hatte gelernt, damit zurechtzukommen. Doch vor stolzen alten Männern wie seinem Großvater fühlte er sich manchmal, als zerreiße es ihn innerlich.
Der Türvorhang raschelte schwer; ein wenig mehr Fackelschein fiel heraus, und Cunovic hörte Bricas Schreie und den besessenen Sprechgesang des Druiden.
Ban stapfte unruhig und mit fahrigen Bewegungen auf und ab. »Es wird schlecht ausgehen. Es dauert schon zu lange.«
»Das weißt du nicht«, sagte Cunovic. »Überlass das den Frauen.«
»Vielleicht liegt es am Gebrabbel des Priesters«, knurrte Nectovelin. »Wer kann sich schon konzentrieren, wenn einem derart die Ohren vollgejammert werden – und sei es nur darauf, ein Junges in die Welt zu pressen.«
In Cunovics Kindheit war es die Aufgabe der Priester gewesen, die Menschen über den Kreislauf der Jahreszeiten oder über Krankheiten des Viehs und des Getreides zu unterrichten – überliefertes Wissen, das durch Generationen weitergegeben worden war, Wissen, für dessen Aneignung ein Novize auf Mona angeblich mindestens zwanzig Jahre seines Lebens benötigte. In den letzten Jahren hatten sich die Dinge jedoch geändert. Cunovic hatte gehört, dass die Römer der Priesterklasse in Gallien eine Verschwörung gegen die Interessen ihres Reiches vorwarfen und sie von dort vertrieben. Nun liefen die Priester also herum und hetzten die Menschen gegen die Römer auf. Außerdem behauptete Nectovelin immer, dass sich die Druiden mit ihren fremden Ideen nur zwischen die Menschen und ihre Götter drängen wollten. Wer brauchte einen Priester, wenn die Göttin überall in der umliegenden Landschaft sichtbar war?
Aber Cunovic konnte es nicht lassen, den alten Mann zu ärgern. »Wenn er im Weg ist, wirf ihn hinaus, Großvater. Es ist dein Haus.«
»Das geht nicht«, erwiderte Ban hastig. »Angeblich wird man verflucht, wenn man einen Druiden hinauswirft.«
»Ob das nun stimmt oder nicht«, sagte Nectovelin, »es gäbe Ärger, weil genug Menschen es glauben. Keine Sorge, mein Enkelsohn. Wir werden den Priester ebenso verkraften wie den römischen Pisswein, den dein Bruder nach Hause bringt. Und wir werden mit dem weitermachen, was wichtig ist – für deinen Jungen zu sorgen.« Ein widerwilliges Lächeln zerknitterte sein narbiges Gesicht. »Brica hat mir erzählt, dass ihr ihn nach mir benennen wollt.«
»Nun ja, du bist auf den Tag genau siebzig Jahre alt, Großvater. Was bleibt uns da anderes übrig?«
»Dann wollen wir hoffen, dass er so ein starker Bursche wird wie ich und die Gelegenheit bekommt, ein paar große Römernasen zu brechen, denn ich weiß, dass er zum Kämpfen geboren ist.«
Cunovic sagte: »Und wenn es ein Mädchen ist, das dir auch nur annähernd ähnlich sieht, Nectovelin, wird sie noch Furcht einflößender sein.«
Sie lachten gemeinsam.
Dann schrie Brica, ein Laut, der die stille Nachtluft durchbohrte. Und sie begann hastig zu reden, ein hohes, schnelles, seltsames Gebrabbel, das Cunovic das Blut gefrieren ließ.
Ban schrie auf und rannte zum Haus zurück. Cunovic lief mit ihm, und Nectovelin stapfte schwerfällig hinter den beiden her.
III
Im Innern des Hauses lag Brica auf ihrem Lager aus Fellen. Die Frauen, die im Kreis um sie herumsaßen und nach den langen Wehen offenkundig erschöpft waren, lehnten sich hilflos zurück.
Die Blässe von Bricas Gesicht stand in lebhaftem Kontrast zu dem purpurroten Fleck zwischen ihren Beinen, als weiche dort alle Lebenskraft aus ihr. Aber Cunovic sah einen kleinen Kopf, beschmiert mit grauer Flüssigkeit und noch verformt von dem mühsamen Weg durch den Geburtskanal. Sula, die Großmutter des Säuglings, dessen Körper sich noch in Brica befand, stützte ihn mit ihrer starken Hand. Wie seine Mutter sah das Kind sehr blass aus, und es hatte einen rötlichen Haarschopf.
Und Brica, deren Augen sich ebenso unruhig bewegten wie zuvor die des betenden Druiden, gab diesen rasenden Monolog von sich. Die Frauen waren entsetzt; einige von ihnen hielten sich die Ohren zu, um die Laute nicht hören zu müssen. Selbst der Priester war mit großen Augen in den dunklen Teil des Hauses zurückgetaumelt.
Cunovic nahm den Anblick gebannt in sich auf. Bricas Monolog war unverständlich und sehr schnell, ein hässliches Bellen – aber er war überzeugt, einzelne Wörter zu erkennen.
Sula, die den Kopf ihres Enkels hielt, blickte in müder Verzweiflung zu Ban auf. »Oh, Ban, das Kind ist schwach, sein Herz flattert wie das eines Vogels, und es will immer noch nicht herauskommen. Sie ist bald zu müde, um weiter zu pressen.« Sie musste die Stimme heben, um sich über Bricas Gebrabbel hinweg verständlich zu machen.
»Dann müsst ihr sie aufschneiden«, sagte Ban.
»Das wollten wir gerade«, sagte Sula. »Aber dann fing sie mit diesem Geschnatter an, und nun kann keine von uns mehr einen klaren Gedanken fassen!«
Nectovelin knurrte. Mit zwei Schritten war er bei dem Druiden, schloss seine riesige Hand um einen Knäuel Stoff vom Gewand des Priesters und zog ihn ganz nah zu sich heran. »Du! Ist das dein Werk? Sind das Flüche, was sie da von sich gibt?«
»Nein, nein! Beim Leben meiner Mutter!« Der dünne, bleiche Druide mit dem schütteren Haar mochte um die vierzig Jahre alt sein, und er zitterte in Nectovelins kraftvollem Griff.
»Nectovelin!« Cunovics Ton war so scharf, dass sein Großvater sich umdrehte. »Das wird nichts nützen. Es hat nichts mit ihm zu tun. Lass ihn in Ruhe.«
»Und woher weißt du das?«
»Weil ich verstehe, was sie sagt. Das sind nicht die Worte von Göttern – jedenfalls nicht die unserer Götter.«
»Was dann?«
»Latein. Sie spricht Lateinisch.«
Eine Stille trat ein, nur unterbrochen von Bricas unaufhörlichem Geplapper.
Nectovelin ließ das Gewand des Druiden los, der beschämt zu Boden sank. »Wie ist das möglich?«, sagte Nectovelin mit schwerer Stimme. »Wer von uns beherrscht denn die lateinische Sprache?«
»Keiner außer mir«, erwiderte Cunovic, »abgesehen von ein paar Wörtern, die ihr von mir oder den Händlern aufgeschnappt habt.« Und schon gar nicht die stille Brica, die sich in ihrem ganzen Leben wahrscheinlich nicht weiter als eine Tagesreise von ihrem Geburtsort fortgewagt hatte.
»Was hat das dann zu bedeuten?«
»Ich habe keine Ahnung …«
Cunovic verstand allmählich immer besser, was Brica sagte. Es waren nur ein paar Zeilen, wie Knittelverse, die sie unablässig wiederholte. Ihm kam der Gedanke, dass jemand ihre Worte niederschreiben sollte. Er sollte es tun, schließlich war er das einzige des Schreibens kundige Mitglied der Familie. Er suchte seinen Beutel, zog eine Tafel und einen Griffel heraus und begann zu kritzeln. Die Kinder beobachteten ihn mit großen Augen; die Buchstaben, die im Wachs erschienen, mussten ihnen wie Zauberei vorkommen.
Nectovelin machte ein finsteres Gesicht und wandte sich an Ban. »Angesichts einer solchen Geburt und einer Mutter, die Lateinisch plappert, liegt bereits ein Fluch auf seinem Leben. Nenne ihn, wie du willst, Ban. Er wird kein Krieger sein.«
In Ban schien etwas zu zerbrechen. »Du überheblicher alter Mann!«, brüllte er. »Kannst du denn selbst in einem solch fürchterlichen Moment an nichts anderes denken als an dich? Ich habe keine Zeit für dich und deinen uralten Krieg. Caesar ist längst tot, und das wirst du auch bald sein, und dann wird man dich und deine Prahlereien vergessen!«
Einen schrecklichen Augenblick lang dachte Cunovic, der riesige Nectovelin werde seinen Enkel niederschlagen. Aber Nectovelin starte Ban nur so lange an, bis dieser den Blick abwandte. Verachtung verhärtete sein zernarbtes Gesicht, und er verließ das Haus.
»Wir müssen sie aufschneiden.« Inmitten des Mysteriums von Bricas Geschnatter und des streitsüchtigen Gebarens der Männer sprach müder Pragmatismus aus Sulas Stimme. »Ban hat recht. Wir müssen das Kind befreien, bevor sie alle beide sterben.« Die anderen Frauen nickten und rückten näher.
Sula hob ein Messer aus Feuerstein in die Höhe. Dieses Geschenk der Erde war das traditionelle Werkzeug für solch verzweifelte Momente, und seine sorgfältig gearbeitete Schneide war schärfer als das beste brigantische Eisen, ja sogar besser als römischer Stahl, wie Cunovic wusste.
Brica schrie auf, als sich die steinerne Klinge in ihr Fleisch bohrte. Ban biss sich auf die Lippe; er war sich der Gefahren bewusst.
Bricas Sturzbach lateinischer Wörter versiegte jedoch immer noch nicht; Cunovic kritzelte weiter auf seine Tafel. Die Wörter waren seltsam, rätselhaft und unzusammenhängend: haushohe Pferde … kleinen Griechen … toter Marmor …
Cunovic dämmerte allmählich, dass dies eine Beschreibung der Zukunft – oder einer Zukunft – war, eine Schilderung von Ereignissen, die erst eintreten konnten, wenn er und Brica und sie alle schon längst tot waren. Voller Furcht stellte er sich einen Zauberer in einer dunklen Zelle vor, irgendwo in der Vergangenheit oder der Zukunft, der dafür sorgte, dass sich in diesem Augenblick, in dem Geburt und Tod im Gleichgewicht waren, die fremdartigen Wörter in den Kopf der hilflosen Brica ergossen – einen Zauberer, einen Weber, der die Fäden der Geschichte verwob, Fäden, die Menschenleben waren. Aber warum?
Cunovic wusste nicht, ob er dem Guten oder dem Bösen diente, indem er diese Wörter niederschrieb – doch nachdem er einmal angefangen hatte, merkte er, dass er nicht aufzuhören wagte. Und als die Worte im Wachs Gestalt annahmen, Worte in einer Sprache, die Brica unmöglich kennen konnte – Worte in der Sprache des mächtigsten Reiches der Erde –, versuchte Cunovic, seine eigene abergläubische Furcht zu unterdrücken.
ERSTER TEIL
INVASOREN 43–70 N. CHR.
I
Agrippina und ihre drei Begleiter ritten auf den Dünenstreifen zu, der die Küste säumte.
Der Mittag nahte. Die vom Sonnenlicht getränkte Luft schmeckte herb wie bei einem Gewitter, und Agrippina spürte, wie sich ihre Haut in der sanften Brise straffte. Sie roch bereits das Salz in der Luft und meinte, das Rauschen der Wellen zu hören. Die vier hatten einen Landstreifen überquert, der bei Flut unter Wasser stand, um zu dieser Beinahe-Insel zu gelangen, und nun umgab sie das Meer von allen Seiten.
Am Rand der Dünen stiegen sie von den Pferden und ließen sie frei, damit sie nach Futter suchen konnten. Das Pferd, das Agrippina und ihren Bruder Mandubracius trug, ein geduldiger alter Wallach, den sie ritt, seit sie fünfzehn war, würde sich nicht weit entfernen. Dasselbe galt bestimmt auch für Nectovelins muskulöses Tier: Nicht einmal ein Schlachtross würde ihrem kriegerischen Vetter den Gehorsam verweigern. Cuneddas Stute jedoch war weitaus launischer, obwohl sie den Ritt zum Strand ebenso genossen hatte wie ihr Reiter.
Sie überquerten die Dünen mit Essenspaketen, Lederflaschen mit Wasser und zusätzlicher Kleidung. Jeder von ihnen trug eine Waffe, ein Messer im Gürtel. Dies war das Land der Cantiacer; zwar handelte es sich bei ihnen offiziell um Verbündete von Cuneddas Volk, den Catuvellaunen, aber die Beziehungen zwischen diesen eigentümlichen südlichen Stämmen waren unbeständig, und es zahlte sich immer aus, auf der Hut zu sein. Nectovelin schleppte das schwere Lederzelt, in dem sie schlafen würden; es war zusammengelegt und verschnürt. »Bei Coventinas verschrumpelter Zitze«, fluchte er, »das Ding ist heute noch schwerer als sonst.«
Agrippina blieb ein wenig zurück und ließ Nectovelin voranstapfen. Der kleine, zehnjährige Mandubracius eilte hinter ihm her. Dadurch gewann sie einen der seltenen Augenblicke allein mit Cunedda. Sie beugte sich zu ihm und ließ sich von ihm einen Kuss rauben.
»Aber ein Kuss wird reichen müssen«, sagte sie und löste sich von ihm.
Cunedda lachte und ließ sie los. »Wir haben noch genug Zeit.« Sein südlicher Dialekt ähnelte ihrer eigenen brigantischen Sprache, klang jedoch ein wenig anders – exotisch genug, um das Ohr zu erfreuen.
Cunedda war vierundzwanzig, nur ein Jahr älter als Agrippina. Ihre Haut war hell, seine dunkel, und er hatte pechschwarzes Haar und tiefbraune Augen. Heute trug er einen ärmellosen wollenen Leibrock, und die Sommersonne ließ seine Haut in einem unwiderstehlichen Honigbraun schimmern, von dem Agrippina mit ihrer blassen Haut und dem rotblond gesträhnten Haar nur träumen konnte. Sie fand, dass Cunedda wie ein Bewohner des Mittelmeerraums aussah, einer jener redegewandten Jungen, die ihr in ihrer Jugend in Massilia so beharrlich und fruchtlos nachgestellt hatten. Und er war ein Prinz aus dem königlichen Geblüt der Catuvellaunen, ein Enkel des toten Königs Cunobelin, was ihn für sie noch faszinierender machte.
Sie roch den salzigen Schweiß auf seiner bloßen Haut und sehnte sich danach, ihn in den Armen zu halten. Aber das konnte sie nicht, nicht jetzt. Sie gingen weiter.
»Schau dir den alten Nectovelin an, wie er dahinstampft«, sagte Cunedda. »Er ist wie ein entwurzelter Baum aus dem Wald.«
»Er geht wie ein Krieger«, sagte sie. »Schließlich war er ja auch nie etwas anderes.«
»Er hat die Haarfarbe eurer Familie, dieses ergrauende Rot. Ist er wirklich dein Vetter?«
»In gewissem Sinn. Mein Großvater, Cunovic, war der Bruder seines Vaters Ban.«
»Er sieht nicht gerade aus wie der ideale Begleiter für einen netten Tag am Strand.«
Agrippina zuckte die Achseln. »Es war seine Idee. Hauptsache, er lernt dich ein wenig kennen, Cun! Außerdem – wenn überhaupt, hat er heute das Sagen …«
Cunedda hielt sich einerseits zu Handelszwecken in diesem Teil der Welt auf, um sein Tonwarengeschäft zu fördern; zugleich befand er sich jedoch auch im Auftrag des catuvellaunischen Hofes in Camulodunum nördlich der großen Flussmündung als Gesandter bei den Cantiacern. Der Brigant Nectovelin war für diesen Tag zu seinem Leibwächter bestellt worden.
Es war nicht sonderlich ungewöhnlich, hier im Süden Briganten finden, die für die Catuvellaunen arbeiteten, die vorherrschende Macht in diesem Teil der Insel, schon bevor sich der längst verstorbene Cassivellaunus bei der römischen Invasion vor neunzig Jahren Caesar persönlich entgegengestellt hatte. Nectovelins Dienste für Cuneddas Familie hatten den jungen Mann überhaupt erst in Agrippinas Leben gebracht.
Und sie hoffte, dass sie Nectovelin heute dazu bewegen konnte, die Tatsache zu akzeptieren, dass Cunedda hier bleiben würde.
Sie überquerten die Dünenkuppe und sahen das Meer vor sich, ein blassblaues Tuch unter der sengenden Sonne. Für Agrippina, die das Mittelmeer mit eigenen Augen gesehen hatte, wirkte es beinahe mediterran, aber dies war oceanus, der Ozean, eine von der Flut aufgeblähte Bestie, vor der die abergläubischen Römer große Angst hatten. Ein paar Meilen vor der Küste lag eine flache Insel knapp über dem Meeresspiegel.
»Hier sind wir nah genug am Wasser«, knurrte Nectovelin. Er ließ das schwere Zelt in den Sand fallen. Agrippina sah, dass der unter dem Zelt gefangene Schweiß auf seinem Rücken den Leibrock schwarz gefärbt hatte.
Mandubracius jauchzte auf. »Fangt mich, wenn ihr könnt!« Er rannte mit blitzenden Beinen zum Meer, eine Explosion zehn Jahre alter Energie. Er war so blass, dass er wie ein Gespenst aussah, als gehöre er kaum zu dieser Welt.
Nectovelin hob die Stimme nur ein wenig. »Hiergeblieben, mein Junge.«
Mandubracius blieb sofort stehen. Er drehte sich um und trabte zurück.
Cunedda staunte. »Er ist wie ein gut abgerichteter Hund.«
»Oh, meine Hunde richte ich besser ab«, sagte Nectovelin.
Mandubracius kam schwitzend und ein wenig keuchend, aber ohne jeglichen Groll zu ihnen.
Nectovelin deutete auf das Zelt. »Da. Bau das auf.«
»Das habe ich noch nie gemacht.«
»Dann musst du lernen, wie es geht.«
Mandubracius zupfte an der Lederplane. »Aber es ist heiß. Wir sind eine Ewigkeit gelaufen. Und es ist schwer. Schau, ich kann’s nicht mal hochheben!«
Nectovelin schnaubte. »Bei Coventinas rotzverkrustetem linkem Nasenloch, so was habe ich ja noch nie gehört. Während du hier wie ein Welpe herumstehst, hätte ein römischer Legionär schon eine komplette Festung ausgehoben. Na los, an die Arbeit. Ich gehe meine Füße baden.« Er marschierte davon.
Cunedda sagte zu Mandubracius: »Ich helfe dir …«
»Wenn er nicht weiterweiß«, sagte Agrippina sanft. »Lass es ihn zunächst allein versuchen. Komm. Geh mit mir ans Meer.«
Sie folgten Nectovelin, während Mandubracius mühsam das steife Leder auseinanderfaltete.
II
Nectovelin löste seine Sandalen und gab den Blick auf Füße frei, die eine Masse aus Haaren und vom Pilz befallenen Zehennägeln waren. Er trat ins Wasser und seufzte, als die kühlen Wellen über seine Zehen schwappten. Agrippina stieß ihre Sandalen ebenfalls von sich und folgte ihm. Cunedda, der schwerere Stiefel und Strümpfe im römischen Stil trug, setzte sich in den feuchten Sand, um sie auszuziehen.
Dann standen die drei wie steinerne Statuen nebeneinander im Wasser und schauten ostwärts zu der grasbewachsenen Insel, dem ruhigen Ozean und dem fernen, unsichtbaren Europa dahinter.
»Du überraschst mich, Nectovelin«, sagte Cunedda vorsichtig.
»Weshalb?«
»Du hast dem Jungen einen römischen Soldaten als Vorbild hingestellt. Was, wenn er irgendwann einmal einem Römer im Nahkampf gegenübersteht?«
»Ich zeichne ihm ein überlebensgroßes Bild der Römer. Aber wenn Mandubracius sieht, was für kleine Jammergestalten sie in Wirklichkeit sind, wird er keine Angst vor ihnen haben.«
»Dazu wird es sowieso nie kommen«, meinte Agrippina. »Die Römer werden weder gegen die Catuvellaunen noch gegen die Briganten oder sonst jemanden kämpfen.«
»Caesar hat es getan«, erwiderte Nectovelin.
»Und ich habe gehört, wie Caratacus von einem Aufmarsch römischer Truppen in einer gallischen Küstenstadt gesprochen hat«, ergänzte Cunedda. »Er und sein Bruder hatten für den Fall, dass die Römer herübergekommen wären, sogar ein paar tausend Mann an der Küste zusammengezogen. Natürlich sind sie nicht gekommen, und dieses Jahr ist es ohnehin zu spät für einen Feldzug, also sind alle wieder nach Hause gegangen. Aber trotzdem …«
»Aber trotzdem sind das alles bloß Gerüchte. Im Unterschied zu Caesars Zeit gibt es jetzt regen Handelsverkehr.« Sie zeigte auf einen Schatten am Horizont, ein gedrungenes Schiff mit schweren Segeln. Wahrscheinlich war es ein Handelsschiff aus Gallien, ein massiver Kahn aus zusammengenagelten Spanten, mit eisernem Anker und Segeln aus ungegerbtem Leder. »In Massilia heißt es, ein Einfall in Britannien lohne sich für die Römer nicht, weil sie so viel an den Zollgebühren verdienen.«
»Caesar hat hier Krieg geführt.«
»Außerdem haben die Römer Angst vor dem Ozean«, meinte Cunedda. »Ist es nicht so? Sie würden es ohnehin niemals wagen, das Meer zu überqueren.«
»Caesar hat es überquert«, sagte Nectovelin schlicht. »In Wahrheit will niemand glauben, dass die Legionäre wiederkommen könnten, weil heutzutage alle an den goldenen Zitzen Roms liegen. Du bist Töpfer, nicht wahr, mein Junge?«
»Ja.« Tatsächlich war Cunedda viel mehr als das; er hatte sein Erbe gut genutzt, betrieb nun ein florierendes Gewerbe und beschäftigte zwanzig Kunsthandwerker.
»Und an wen verkaufst du deine Tonwaren? An die Römer?«
»Nicht nur an die Römer …«
»Auch an diejenigen, die sie nachäffen. Die Trinovanten, die Icener, die Atrebaten. Diejenigen, die unter ihrem Schutz leben. Jedenfalls nicht an uns Briganten.« Nectovelin stupste Cunedda mit dem Finger vor die Brust. »Wenn die Römer nicht wären, könntest du nicht davon leben, habe ich recht?«
»Immer mit der Ruhe, alter Mann«, sagte Agrippina. »Vergiss nicht, er bezahlt deinen Lohn.«
Cunedda erwiderte: »Aber was ist denn schlecht daran, den Römern das Geld abzunehmen? Ich hätte gedacht, du würdest das gutheißen.«
»Wieso kümmert es dich, was ich denke? Du bumst meine Base, stimmt’s?«
Cunedda errötete.
»Dann hast du es also die ganze Zeit gewusst?«, fuhr Agrippina auf.
Nectovelin tippte sich an die Stirn. »Glaubst du, ich hätte das reife Alter von siebenundvierzig Jahren erreicht, wenn ich blind und taub wäre? Außerdem hat Bala es mir erzählt.«
Agrippina blieb die Luft weg. Bala von den Cantiacern war einmal ihre Freundin gewesen; sie hatten sich wegen Cunedda zerstritten. »Dieses niederträchtige Miststück. Ich reiße ihr die Kehle heraus!«
Cunedda lachte. »Jetzt klingst du wirklich wie Nectovelins Base.«
Nectovelin hielt sich ein Nasenloch zu und blies das andere aus. In seinem Bart blieb eine Schleimspur zurück, die er mit dem Ärmel wegwischte. »Deshalb seid ihr also an den Strand gekommen. Um mich rumzukriegen.«
Agrippina hängte sich voller Zuneigung bei ihm ein. »Ach, nun mach keine Schwierigkeiten, du alberner alter Schwindler. Du weißt, du warst immer fast so etwas wie ein Vater für mich, seit mein eigener Vater gestorben ist.«
»Aber du hast meine Erlaubnis nicht gebraucht, um die Beine breit zu machen.«
»Sei nicht vulgär! Nein, aber ich möchte, dass du zu uns gehörst, dass du ein Teil unserer Beziehung bist.«
Nectovelin musterte Cunedda. »Du hättest eine schlechtere Wahl treffen können.«
»Danke«, sagte Cunedda trocken. »Aber ich dachte, du magst uns Catuvellaunen nicht.«
»Nimm’s nicht persönlich. Ich mag keinen von euch weichärschigen Südbritanniern.« Er sah sich mit wütender Miene an dem sonnenbeschienenen Strand um. »Das hier ist das Arschloch Britanniens. Deshalb hat Caesar hier sein römisches Schwert reingesteckt.«
»Wenn das hier ein Arschloch ist«, sagte Cunedda bedächtig, »bist du dann der Darminhalt, der es durchquert, alter Krieger?«
Nectovelin runzelte die Stirn, und Agrippina dachte einen schrecklichen Moment lang, er wäre beleidigt. Aber er zwinkerte Agrippina zu. »Nette Erwiderung. Aber ich war geistreicher, oder?«
»Oh, du bist ein richtiger Cicero«, sagte Agrippina trocken. »Wahrscheinlich hast du doch ein bisschen was von einem Römer in dir …«
»Wie Cassivelaunus, als Caeser ihn sich geschnappt hatte.«
Sie brachten es alle fertig, darüber zu lachen.
Auf einmal sagte Nectovelin: »Aber wenn du ihr wehtust …«
»Werde ich nicht«, versprach Cunedda.
»Hast du Angst vor mir, Junge?«
»Nicht vor dir«, sagte Cunedda tapfer. »Aber vor ihr.«
Nectovelin schaute finster drein. Dann brach ein weiteres Lachen seine strenge Miene auf, und er klopfte Cunedda auf die Schulter.
Agrippina machte ein paar Schritte nach vorn, und das tiefere Wasser plätscherte äußerst angenehm gegen ihre bloßen Beine. »Schaut.« Mit ihrem Zeigefinger zog sie die Küstenlinie nach. »Diese Bucht ergäbe einen guten Hafen. Sie wird von dieser Insel und den Kiesbänken dort drüben im Süden geschützt.«
Cunedda sagte: »Auf diese Idee ist auch schon jemand anders gekommen.« Er zeigte auf einen Haufen Netze und eine Schar Möwen am Strand, die sich um Fischabfälle balgten. »Ich verstehe gar nicht, wieso es hier nicht von Schiffen wimmelt.«
»Weil die Bucht noch zu neu ist«, sagte Nectovelin. »Vor ein paar Jahren gab es hier einen schweren Sturm. Dabei wurde eine Sandbank durchbrochen. Diese Insel hat es bei meiner Geburt noch gar nicht gegeben.«
Cunedda nickte. »Dann war der Hafen zu Caesars Zeit also noch nicht hier?«
»Nein. Er ist nicht einmal in der Nähe gelandet.« Nectovelin erzählte ihnen von Caesars schwieriger Landung unterhalb der weißen Kalkklippen an der Südküste.
Agrippina dachte mit leisem Unbehagen an eine pikante Information, die sie bei einem Händler in Durovernum aufgeschnappt hatte, der Hauptstadt der Cantiacer, des hiesigen Volksstamms. Die Cantiacer hatten zwar noch keinen Namen für diesen neuen Hafen, die Römer aber sehr wohl: Sie nannten ihn Rutupiae. Dank ihrer unaufhörlichen, besessenen Landvermessung und Kartografie und der vorsichtigen Spionagetätigkeit ihrer Händler hatten die Römer die mögliche Bedeutung dieses Ortes noch vor den Einheimischen erkannt.
Agrippinas Blick wurde von einem anderen Umriss am Horizont abgelenkt. Vielleicht ein weiteres Handelsschiff mit Ledersegeln aus Gallien. Heute schien reger Verkehr zu herrschen. Aber die Luft war dunstig, und sie konnte es nicht richtig erkennen.
»Schaut«, sagte Cunedda, »Mandubracius winkt uns. Er hat das Zelt aufgebaut!«
In diesem Augenblick sackte das formlose schwarze Gebilde, das der Junge errichtet hatte, in sich zusammen.
Nectovelin räusperte sich. »Er hat sein Bestes getan. Retten wir ihn.« Er verließ als Erster das Wasser und ging über den Strand voran.
III
Sie verbrachten den Tag mit Spielen, Gesprächen, Essen und Trinken. Es war fast schon Hochsommer, das Licht schwand nur langsam vom Himmel. Nectovelin trank sogar – wenn auch widerstrebend – von dem römischen Wein, den Cunedda mitgebracht hatte.
Agrippina war froh über Mandubracius’ Anwesenheit. Er war ein gutherziges, liebevolles Kind und wollte nicht mehr, als dass alle sich wohl fühlten. Tatsächlich fragte sie sich, ob sie es unbewusst so geplant hatte, dass Mandubracius zur Verbesserung der Stimmung dabei war, wenn sie Nectovelin ihre Beziehung zu Cunedda eingestünde.
Als Erster erlag Mandubracius der Müdigkeit, dann Nectovelin, und sie zogen sich ins Zelt zurück.
Cunedda und Agrippina entfernten sich ein wenig vom Schein des Feuers. Sie hatten ein paar zusätzliche Kleidungsstücke dabei, die sie auf dem kühlen Sand ausbreiteten, und sie legten sich nebeneinander nieder und schauten zu, wie die Sterne allmählich herauskamen. Die Wellen plätscherten leise.
Cunedda nahm ihre Hand. »Glaubst du, er schläft wirklich? Ich habe gehört, dass alte Soldaten niemals schlafen.«
»Du machst dich über ihn lustig, aber er ist tatsächlich ein Krieger. Schließlich wurde seine Geburt von einer Prophezeiung begleitet!«
»Im Ernst? Erzähl«, bat Cunedda fasziniert.
Also erzählte ihm Agrippina, dass Nectovelins Mutter während der schweren Geburt angeblich angefangen hatte, vor sich hin zu brabbeln. »Brica konnte nicht mehr erklären, wieso sie auf einmal lateinische Sätze daherplapperte, denn sie starb bei der Geburt – aber das Kind, Nectovelin, hat überlebt.« Ihr Großvater Cunovic hatte eine recht gute Abschrift der »Prophezeiung« auf Pergament niedergelegt und sie Nectovelin gegeben, als dieser älter geworden war.
»Ich liebe solche Geschichten«, sagte Cunedda. »Wie lautete sie?«
»Das weiß ich nicht genau. Sie enthielt ein paar Worte über die Römer, über Freiheit und eine Menge Zeug, das überhaupt keinen Sinn ergab. Cunovics Ansicht nach war es eine Art Orakel, das jemand Nectovelins Mutter eingegeben hatte – ein Gott oder vielleicht ein Zauberer aus der Zukunft, der sich an der Vergangenheit zu schaffen machte. Ein ›Weber‹, wie Cunovic ihn nannte. Ich glaube, die Prophezeiung hat ihm ziemliche Furcht eingeflößt. Er hat es nicht gewagt, seine Abschrift zu vernichten, war aber froh, als er sie Nectovelin übergeben konnte … soweit ich weiß, trägt Nectovelin sie seither mit sich herum, obwohl er sie nicht lesen kann!«
»Und doch hat sie ihn geprägt.«
»Ja. Wegen der Prophezeiung glaubt Nectovelin, es sei ihm bestimmt, ein Krieger zu sein und gegen die Römer zu kämpfen – so wie sein Urgroßvater gegen Caesar gekämpft hat. Wahrscheinlich hat es nicht gerade geholfen, dass dieser Urgroßvater ihm auch seinen Namen gab.
Allerdings war er fast sein ganzes Leben lang ein Krieger ohne Krieg. In Brigantien gibt es nur hin und wieder ein paar kleine Viehdiebstähle, und das ist einfach zu magere Kost für einen Krieger! Und zum Bauern hat er sowieso nie getaugt. Er war ständig launisch und aggressiv. ›Als lebte man mit einem Gewitter zusammen‹, hat meine Mutter immer gesagt. Er hatte nie Kinder, weißt du – Geliebte, aber keine Kinder. Und als er hörte, dass ihr jungen Catuvellaunen abenteuerlustig würdet, kam er hierher, um ein bisschen zu kämpfen, obwohl er da schon in den Dreißigern war. Ein paar Trinovanten den Schädel einzuschlagen, das war ganz nach seinem Geschmack. Aber er ist immer noch ruhelos. Man merkt es ihm an …«
Seit den Zeiten des Cassivellaunus, als die Römer jenseits des Meeres vor sich hin gebrütet hatten, waren die Catuvellaunen damit beschäftigt gewesen, ein eigenes Reich zu errichten.
Die Catuvellaunen rühmten sich immer noch ihres »Sieges« über Julius Caesar, obwohl Cassivellaunus in Wirklichkeit nicht mehr als ein Patt gegen die überforderten Römer erreicht hatte. Bevor Caesar Britannien endgültig verlassen hatte, hatte er darauf bestanden, dass die Catuvellaunen ihre Nachbarn, die Caesar freundlich gesonnenen Trinovanten, respektierten. Nun, daraus war nichts geworden; binnen kurzem hatten die Catuvellaunen mit unverschämter Dreistigkeit Camulodunum, den Hauptsitz der Trinovanten, eingenommen und zu ihrer eigenen Hauptstadt gemacht.
Unter der anschließenden jahrzehntelangen Regentschaft von Cassivellaunus’ Enkel Cunobelin hatten sich die Catuvellaunen damit begnügt, in ihrem kleinen Reich auszuharren. Agrippina hatte den Eindruck, dass Cunobelin ein kluger und pragmatischer Herrscher gewesen war, der es geschafft hatte, die widerstreitenden Kräfte des volkseigenen Stolzes und der fortwährenden Bedrohung durch die römische Macht auszugleichen – und dabei durch den lukrativen Handel mit Rom reich zu werden.
Doch dann war Cunobelin gestorben. Sein Reich war in die Hände zweier seiner vielen Söhne übergegangen, Caratacus und Togodumnus – beides Onkel von Cunedda, obwohl sie nicht viel älter waren als er. Für sie lag Caesars Einfall in grauer Vorzeit. Und unter ihnen hatten die Catuvellaunen eine aggressive Expansion begonnen.
Im Verlauf der darauf folgenden Überfälle und kleinen Scharmützel war Nectovelin rasch aufgestiegen und hatte einen Platz in den Räten der Fürsten gefunden.
Während sein Reichtum wuchs, hatte Nectovelin einige Angehörige aus Brigantien zu sich geholt, die ihm helfen sollten, das Geld auszugeben. Aber er war nicht immer erfreut über die Resultate gewesen, zum Beispiel, als Agrippinas Mutter das Angebot angenommen hatte, ihre junge Tochter im Reich erziehen und ausbilden zu lassen, so wie zwei von Cunobelins jüngeren Söhnen. Die Römer behaupteten, dies stärke die Verbindungen zwischen den Völkern, aber nüchternere Denker bezeichneten es als »Geiselnahme«. Dennoch hatte Agrippinas Mutter die Vorteile einer römischen Ausbildung erkannt. Sie hatte ihrer Tochter sogar einen römischen Namen gegeben.
Infolgedessen hatte Agrippina drei Jahre ihres Lebens in Massilia an der Südküste Galliens verbracht, wo sie Latein gebüffelt, Lesen und Schreiben gelernt, Rhetorik und Grammatik und die anderen Elemente einer römischen Ausbildung in sich aufgenommen und das mediterrane Licht aufgesaugt hatte. Das hatte sie in jeder Hinsicht verändert, wie sie wusste. Und doch hatte sie nicht gezögert, nach Hause zu kommen, als die Zeit um war.
»Ich bin gegen Nectovelins Willen nach Massilia gegangen«, sagte Agrippina. »Aber ohne ihn wäre ich nicht hier im Süden gewesen. Ich hätte dich nicht kennengelernt. Und nichts von alledem wäre ohne die Prophezeiung geschehen.«
Cunedda schüttelte den Kopf. »Eine seltsame Geschichte. Was für ein dramatischer Augenblick das gewesen sein muss – die qualvollen Wehen, die Frauen um Brica herum, die Brüder, der vor sich hin brütende Großvater –, und dann sprudeln auf einmal diese lateinischen Wörter aus ihr heraus! Und das Echo dieses einen, in der Vergangenheit verlorenen Augenblicks hat sich durch Nectovelins ganzes Leben fortgepflanzt.«
Diese romantischen Gedanken erinnerten Agrippina daran, weshalb sie sich so heftig in Cunedda verliebt hatte. Sie krümmte die Finger und strich ihm mit den Nägeln sanft über die Handfläche. »Aber obwohl sie sein Leben geprägt hat, kann Nectovelin seine eigene Prophezeiung nicht lesen.«
»Du könntest sie ihm vorlesen.«
»Ich habe es ihm einmal angeboten. Er hat so getan, als hätte er es nicht gehört. Er kann es nicht ausstehen, wenn ich römische Schriften lese. Ich hätte ihm ebenso gut mit einem Legionsadler vor der Nase herumwedeln können.« Sie unterdrückte ein Seufzen. Sie hatte mit ihrem Vetter schon oft darüber diskutiert. »Worte verleihen einem solche Macht. Wenn er lesen könnte, wäre er jedem Römer ebenbürtig, sogar Kaiser Claudius selbst.«
Er blickte zu ihr auf. Die Sterne spiegelten sich in seinen Augen. »Liebe Pina. Ein Kopf voller Worte und Träume!«
»Träume?«
»Wir müssen über die Zukunft sprechen. Über unsere Zukunft.« Er zögerte. »Pina – Claudius Quintus hat mir eine Stellung in Gallien angeboten.«
Diese plötzliche, unerwartete Neuigkeit versetzte ihr einen argen Dämpfer. Sie wusste, dass Quintus eine von Cuneddas wichtigsten Kontaktpersonen in seinem Tonwarengeschäft war.
»Quintus expandiert«, fuhr Cunedda fort. Er wusste nicht genau, was in ihrem Kopf vorging. »Meine Arbeit gefällt ihm. Er wird sich als Partner an dem neuen Unternehmen beteiligen, aber ich werde die Geschäfte führen, genauso wie hier.«
»Und du hast es nicht der Mühe für wert befunden, mir etwas von all dem zu sagen?«
»Ich wollte erst sicher sein, dass der alte Nectovelin mich nicht sowieso von dir fernhält. Aber er scheint mich zu akzeptieren, nicht wahr? Also müssen wir nun entscheiden, was wir tun wollen. Denk darüber nach, Agrippina. Wenn ich nach Gallien gehe, stehen mir die Handelswege des ganzen Reiches weit offen. Und ich muss nicht jedes Mal, wenn ich eine neue Produktreihe herausbringe, einen weiteren schafsköpfigen Britannier anlernen!«
»Jetzt klingst du selbst wie ein Römer«, sagte sie.
Er sah sie an. Offenkundig versuchte er, ihre Stimmung einzuschätzen. »Und, ist das so schlimm? Du bist doch in Gallien aufgewachsen.«
»Aber ich bin zurückgekommen«, erwiderte sie leise.
Er runzelte die Stirn. »Hör zu, wenn es dich unglücklich macht, lassen wir es bleiben. Ich finde schon einen anderen Weg, aus Quintus’ Vertrauen in mich Nutzen zu ziehen.«
»Das würdest du für mich tun?«
»Natürlich. Ich wünsche mir eine gemeinsame Zukunft mit dir, Pina. Aber es muss eine Zukunft sein, die wir beide wollen …«
Sie seufzte und legte sich zurück. Genau da lag das Problem: Was wollte sie? In Gallien hatten ihre Freundinnen und Freunde, so nett sie gewesen waren, stets herabgeschaut auf sie, eine Barbarin von einem Ort außerhalb der Zivilisation. Doch nun schien es auch in Brigantien keinen Platz mehr für sie zu geben, denn dort konnte niemand die Erfahrung mit ihr teilen, wie beim Lesen in ihrem Geist Funken sprühten. Außerdem gab es auch praktischere Probleme. In Britannien konnte eine Frau einem Mann ebenbürtig oder sogar überlegen sein. Ihr eigener Volksstamm wurde von einer Frau namens Cartimandua regiert. In Rom würde sie jedoch nie mehr sein können als jemandes Gemahlin – und selbst wenn dieser Jemand so wunderbar war wie Cunedda, war das wirklich genug?
»Ich habe dich durcheinandergebracht«, sagte Cunedda leise. »Tut mir leid. Wir reden morgen darüber.« Er legte seine warme Hand auf ihre Wange. »Kannst du den Himmel lesen, Agrippina? Siehst du an deinem Geburtsort dieselben Sterne? Da.« Er suchte einen hellen Stern heraus. »Das ist der Hund. Wenn wir ihn frühmorgens zum ersten Mal sehen, wissen wir, dass der Sommer vor der Tür steht. Er ist der Anführer des Rudels, verstehst du. Und im Winter halten wir Ausschau nach dem da« – er zeigte auf einen anderen Stern –, »denn wenn er im Osten aufgeht, wissen wir, dass wir den Winterweizen ausbringen müssen. Wir glauben, dass einmal ein Mädchen an einen Strand gespült wurde – vielleicht an einen ganz ähnlichen Strand wie diesen hier –, nachdem sie aus einem fernen Land hergeschwommen war. In ihrem Bauch trug sie die Saat, aus der später der erste König der Catuvellaunen hervorgehen sollte. Aber in jener ersten Nacht fror sie, und es war dunkel. Sie zündete ein Feuer an, und die Asche stieg hoch in die Luft. Und so entstanden die Sterne.«
»Bei uns gibt es ähnliche Geschichten«, sagte sie. »Und ja, wir lesen den Himmel.«
Er strich ihr mit der Hand über die Seite, eine erregende Berührung. »Erzähl mir von Brigantien.«
Sie lächelte im Dunkeln. »Brigantien ist ein großes Land, das sich von einem Meer bis zum anderen erstreckt, von Osten nach Westen und von Norden nach Süden. Man kann tagelang reiten, ohne an seine Grenzen zu gelangen. In unserer Sprache bedeutet der Name ›hügelig‹. Ich bin in einem Ort namens Eburacum geboren, was ›Ort der Eiben‹ bedeutet. Unser heiliges Tier ist der Eber. Und Nectovelin wurde in Banna geboren, auf einem Höhenzug mit Blick auf ein Flusstal, das aussieht, als wäre es mit einem Löffel ausgehöhlt worden. Es ist ein schöner Ort.«
»Und die aufregende Coventina, diese große Göttin, über die Nectovelin seine Scherze macht?«
»Sie ist überall in der Landschaft. Man kann ihre Brüste in den wogenden Hügeln sehen, ihre Schenkel in den tief eingeschnittenen Tälern …« Sie reagierte auf die Bewegungen seiner streichelnden Hand. »Oh, Cunedda …«
Ein Ruder klatschte ins dunkle Wasser.
IV
Agrippina setzte sich abrupt auf.
Cunedda war überrascht. »Was ist?«
Sie legte ihm einen Finger auf die Lippen. Als sie aufs Meer hinausschaute, sah sie nichts. Aber da war es wieder, das unverkennbare Klatschen eines ungeschickt gehandhabten Ruders, der dumpfe Laut von Holz auf Holz – und ein unterdrückter Fluch, eine Männerstimme.
»Das habe ich gehört.« Cunedda flüsterte jetzt. »Du hast scharfe Ohren.«
Ein Knurren aus der Dunkelheit. »Hört auf mit dem Gequassel.« Nectovelin war ein Schatten vor der Nacht. Agrippina fragte sich, ob er etwa die ganze Zeit wach gewesen war.
»Glaubt ihr, das sind Piraten?«, fragte Cunedda nervös.
»Wer landet sonst mitten in der Nacht?«, gab Agrippina zurück.
Nectovelin grunzte leise. »Ja, wer wohl?«
»Was meinst du?«
»Wer immer das sein mag, sie brauchen nicht zu wissen, dass wir hier sind«, meinte Cunedda. »Wir sollten das Feuer löschen.«
»Schon geschehen«, sagte Nectovelin. »Aber sie werden den Rauch riechen …«
»Hallo!« Die kleine Stimme wehte vom Strand herauf. Es war natürlich Mandubracius. Er hielt eine Fackel in der Hand, und als er zum Meer hinunterging, war es, als schwebe er in einer Blase aus flackerndem Licht, eine schmale, geisterhafte Gestalt.
Auf dem Wasser herrschte einen Moment lang völlige Stille. Aber dann kam eine Antwort. »Hallo?« Eine Männerstimme mit starkem Akzent.
Nectovelin fluchte derb. »Ich dachte, er schliefe noch. Meine Schuld, meine Schuld.«
Cunedda wollte aufstehen. »Wir sollten ihn aufhalten.«
»Nein.« Nectovelin hielt ihn am Arm fest. »Vielleicht lassen sie ihn laufen. Besser, wir gehen dieses Risiko ein, als dass wir uns jetzt zu erkennen geben.«
Agrippina hatte das Gefühl, als wäre ihr Herz durch ein ledernes Band mit dem kleinen Jungen verbunden, der über den Strand lief. »Er ist nur ein Kind. Er ist neugierig, das ist alles.«
»Pst«, sagte Nectovelin nicht allzu barsch.
Mandubracius erreichte die Wasserlinie. Im flackernden Licht seiner Fackel konnte Agrippina nun undeutlich das gelandete Boot ausmachen. Es war größer, als sie es sich vorgestellt hatte, mit flachem Kiel, offenbar um die Landung am Strand zu erleichtern. Sie sah Männer an Bord, Gesichter, die im matten Fackelschein wie Münzen glänzten. Einer von ihnen stieg ins Wasser und sprach mit Mandubracius. Raues Gelächter ging durch die Menge an Bord des Landungsboots. Mandubracius schien Angst zu bekommen. Er warf die Fackel weg und wollte die Flucht ergreifen.
Aber der Mann, der im Wasser stand, zog ein kurzes, plumpes Schwert und streckte Mandubracius damit nieder.
Sofort schloss sich Nectovelins Hand fest um Agrippinas Mund. Vom Boot kam ein scharfes Wort, vielleicht ein Tadel. Agrippina glaubte, einen Namen zu hören: Marcus Allius. Und dann erlosch das Licht.
All dies in einem einzigen kurzen Augenblick.
»Hör mir zu«, sagte Nectovelin, und Agrippina hörte den Kummer in seinem rauen Flüstern. »Allein in diesem Boot sind bestimmt fünfzig Mann, und es werden weitere Boote kommen, Hunderte vielleicht, die überall in diesem Hafen landen. Wenn wir es mit ihnen aufzunehmen versuchen, werden wir ebenfalls sterben. Aber wir müssen am Leben bleiben und erzählen, was wir gesehen haben.« Agrippina wehrte sich weiterhin, aber Nectovelins Griff wurde noch fester. »Glaub mir, ich empfinde genauso wie du. Mehr als das – es ist meine Schuld. Und ich werde nicht ruhen, bis ich seinen Tod gerächt oder mein Leben für seines gegeben habe. Aber nicht jetzt, nicht heute Nacht!«
Er löste seinen Griff allmählich und gab ihren Mund frei.
Schwer atmend, der Sand rau auf ihrer Haut, flüsterte sie: »Also gut.«
Cunedda rang ebenfalls nach Luft, und seine Augen waren weit aufgerissen. Er nickte.
»Dann folgt mir«, sagte Nectovelin. »Duckt euch und versucht, keine Spuren zu hinterlassen. Wir holen die Pferde, und dann – nun, wir werden sehen. Kommt jetzt.«
Er trat den Rückzug über die Düne an. Agrippina folgte ihm, und Cunedda bildete die Nachhut.
Agrippina war sich der großen Gefahr bewusst, in der sie alle schwebten. Sie konzentrierte sich darauf, Nectovelins Anweisungen zu befolgen, und bemühte sich, keinen einzigen Halm des trockenen Dünengrases zu knicken. Aber sie wurde die Bilder dieser wenigen Momente nicht los, als die Fackel ins Wasser gefallen war: der glänzende Brustharnisch des Mannes mit dem Schwert, die Helme der im Boot aufgereihten Männer – und der in die Höhe gereckte Legionsadler.
V
Von seiner Bank im Heck des Landungsboots aus sah Narcissus die erste Welle der Boote, die auf den Strand fuhren. Unter den Sternen war nichts von dem dunklen Land dahinter zu erkennen, nichts als die Buckel von ein, zwei Dünen – und vielleicht die Asche eines einsamen Feuers am Strand.
Um Narcissus herum legten sich die nach Schweiß, Leder und Pferden stinkenden Legionäre unter den leisen Kommandos eines Zenturios in die Riemen. Die Ruderer hielten das Boot gegen die Flut an seinem Platz, denn Vespasians Befehl lautete, dass der Sekretär des Kaisers erst landen dürfe, wenn der General zu dem Urteil gelangte, dass der Landekopf einigermaßen gesichert war.
Die Verzögerung betrug vielleicht eine halbe Stunde – so kam es Narcissus, der in der Dunkelheit und der Stille saß, jedenfalls vor. Die Länge einer Stunde hing von der Länge des Tages ab, zwölf Stunden zerteilten das Intervall von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. In den Berichten längst verstorbener karthagischer Forscher hatte er jedoch gelesen, dass der Tag in diesen nördlichen Regionen eine ganz andere Dauer haben konnte als in Rom; im Sommer seien die Tage länger, im Winter kürzer. Dass selbst die Zeit hier unbeständig war, verstärkte Narcissus’ Gefühl der Unwirklichkeit auf diesem wogenden Meer, im Dunkeln, umgeben von den Grunzlauten nervöser, ängstlicher Soldaten. Er war weit weg von seiner Heimat, gestand er sich ein.
Allerdings hatte er keineswegs die Absicht, sich vor diesen Männern eine Schwäche anmerken zu lassen. Viele von ihnen waren selbst höchstens halb zivilisierte Barbaren aus Germanien und Gallien und hatten erwartungsgemäß größere abergläubische Angst vor dem Ozean als vor allem, womit ihre entfernten Verwandten an der britannischen Küste sie unter Beschuss nehmen konnten. Und nach den würgenden Lauten und dem Gestank von Erbrochenem zu urteilen, kamen viele von ihnen weitaus schlechter mit der sanften Dünung zurecht als Narcissus, der sich zumindest eines starken Magens rühmen konnte.
Außerdem tröstete ihn das intensive Gefühl, einen entscheidenden historischen Moment mitzuerleben. Es fand es sogar bedauerlich, dass er auf diese Weise im Dunkeln landen musste, aber seine Anwesenheit an der Spitze der Invasion war nun einmal unumgänglich. Irgendwo da draußen waren die Flaggschiffe, die großen Triremen. Bei Tag boten diese imposanten Gebilde, die sich mit ihren glitzernden Rudern am Horizont abzeichneten, einen wundervollen Anblick, der jeden transozeanischen Barbaren in Angst und Schrecken versetzte; Narcissus wünschte, er könnte sie jetzt sehen.
Endlich leuchtete am Ufer ein Licht auf; eine Laterne, die hin und her geschwenkt wurde. »Es ist soweit, Leute«, knurrte der Zenturio. »Ehe ihr’s euch verseht, werdet ihr den Fuß auf gutes, trockenes Land setzen. An die Ruder! Eins, zwei. Eins, zwei …«
Seine rhythmischen Kommandos weckten unangenehme Erinnerungen an das Schiff, auf dem Narcissus an der gallischen Küste entlanggesegelt war; das erbarmungslose Dröhnen der Trommel eines Schlagmanns hatte dafür gesorgt, dass die Rudersklaven auf ihren Bänken im Takt blieben. Narcissus war ein Freigelassener, ein ehemaliger Sklave. In seiner Position hatte er sich an den Umgang mit Sklaven gewöhnen müssen. Aber die große Nähe zu solch extremer Knechtschaft, wo Hunderte von Männern als Bestandteile einer Maschine benutzt wurden, war enervierend gewesen.
Das flach gehende Landungsboot fuhr knirschend auf Sand, und der Zenturio sprang in knöcheltiefes Wasser. Während ein paar seiner Leute das Boot ruhig hielten, bot der Zenturio dem Sekretär den Arm. So schritt Narcissus ans britannische Ufer, fast ohne sich die Füße nass zu machen.
Der General war anwesend, um ihn zu empfangen. Narcissus erwartete auch nicht weniger als eine persönliche Begrüßung durch Titus Flavius Vespasianus, den Legaten der zweiten Legion Augusta und Oberbefehlshaber der nächtlichen Operation am Strand –, denn obwohl Narcissus offiziell nur der für die amtliche Korrespondenz zuständige Sekretär des Kaisers war, hatte er das Ohr von Claudius.
»Sekretär. Willkommen in Britannien. Ich bitte um Entschuldigung, dass ich dich warten ließ.« Vespasian war ein stämmiger, dunkler Mann von Mitte dreißig. Der Sohn eines asiatischen Bauern hatte eine schroffe Art und einen unvorteilhaften provinziellen Akzent, aber er sah aus, als wäre er in seiner Rüstung zur Welt gekommen. Vespasian führte Narcissus ein kleines Stück den Strand hinauf, weg von der feuchten Uferzone. Zwei von Vespasians Stabsoffizieren folgten ihnen in gebührendem Abstand.
»Ich nehme an, die Landung ist ohne Gegenwehr erfolgt«, sagte Narcissus.