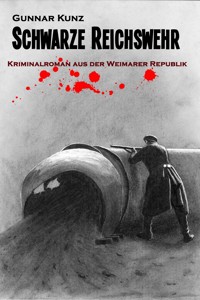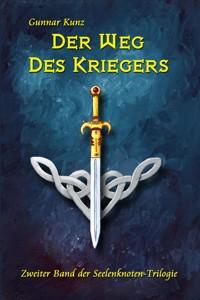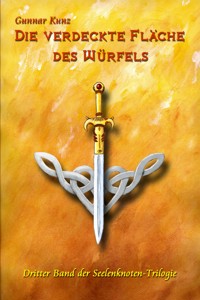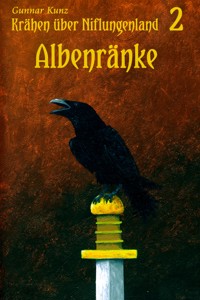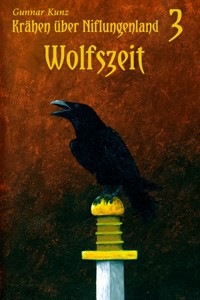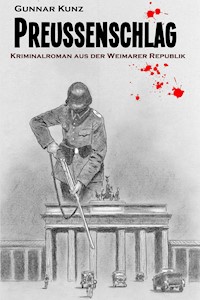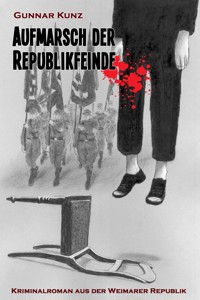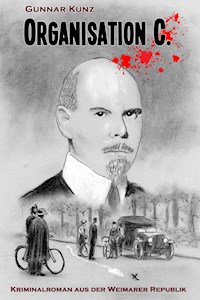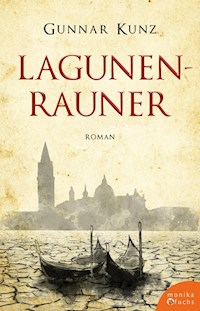7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kriminalroman aus der Weimarer Republik
- Sprache: Deutsch
Berlin, 1930. Die Weltwirtschaftskrise hat Deutschland erreicht, Banken brechen zusammen, es gibt drei Millionen Arbeitslose. Die Nationalsozialisten feiern bei Wahlen große Erfolge. In Waidmannslust wird ein Mann ermordet. Bei ihren Nachforschungen lernen Kommissar Gregor Lilienthal, sein Bruder Hendrik und seine Frau Diana die okkulte Seite ihrer Zeit kennen und müssen sich mit Ariosophie und Germanenorden, Welteislehre und Hohlwelttheorie, der Ludendorff-Bewegung, Spiritismus und Phrenologie befassen. Undurchsichtige Verdächtige gibt es zuhauf. Schließlich geschieht ein weiterer Mord direkt vor Hendriks Augen, und ein Verräter im Polizeipräsidium bringt ihn in Lebensgefahr ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 300
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Gunnar Kunz
Dolchstoß!
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Dolchstoß!
Prolog
1.
2.
3.
Nachwort
Empfehlenswerte Literatur zum Thema:
Weitere Bücher aus der Serie:
Impressum neobooks
Dolchstoß!
Kriminalroman aus der Weimarer Republik
von Gunnar Kunz
Impressum:
Copyright 2022 by Gunnar Kunz, Berlin
Tel. 030 695 095 76
E-Mail über www.gunnarkunz.de
Alle Rechte vorbehalten
Einbandgestaltung: Rannug
Dieses E-Book, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne Zustimmung des Autors nicht vervielfältigt, wieder verkauft oder weitergegeben werden. Danke, dass Sie die Arbeit des Autors respektieren!
Prolog
Balthasar Kruse wäre nicht einverstanden gewesen mit dem, was die spätere Morduntersuchung über ihn zutage förderte. Zum einen definierte er sich nicht über seinen Beruf; seine Arbeit als Kanzleiassistent diente ihm lediglich dazu, den Lebensunterhalt zu sichern. Zum anderen sah er sich auch nicht als Fantast, sondern hielt sich im Gegenteil viel darauf zugute, dass er sich mit seinen Erkenntnissen auf dem Boden der Wissenschaft bewegte, jedenfalls so, wie er sie verstand. Das Einzige, was er akzeptiert hätte, wäre der Hinweis auf seine Liebe zur Natur, speziell zu Blumen gewesen.
Er schätzte wohldurchdachte Gartenanlagen mit Beeten, die so angelegt waren, dass die Farben der Blüten miteinander harmonierten. Abstufungen von Gelb und Orange, dazwischen ein Tupfer Rot, anderswo Blau in allen Schattierungen und als verbindendes Element eine überwältigende Fülle von Grün – das war für ihn der Inbegriff von Landschaftskunst. Auch die Gartenarbeit selbst bereitete ihm Freude. Andere mochten sie als Plackerei ansehen, schweißtreibend und schmutzig, doch ihm gefiel es, mit seinen Händen zu arbeiten, den Boden aufzulockern, den Geruch der Erde in der Nase zu spüren und das, was er an langen Winterabenden geplant hatte, in die Tat umzusetzen. Und, nicht zu vergessen, in ein paar Wochen die Belohnung für seine Mühen in Gestalt eines farbenprächtigen Gartens zu erhalten, Labsal für die Seele.
Obwohl es kühl war an diesem Morgen Ende März, arbeitete er mit bloßem Oberkörper, grub mit einem Spaten die Erde hinterm Haus um und entfernte Wurzeln und Steine. Er wollte mit Kornblumen und Klatschmohn anfangen, die man getrost schon jetzt aussäen konnte, zumindest wenn man mit einem grünen Daumen gesegnet war. Später würde er vielleicht so etwas Exotisches wie Paradiesvogelblumen hinzufügen. Oder sollte er es mal mit Lotosblumen versuchen?
Schritte waren zu hören.
Balthasar Kruse unterbrach seine Arbeit, drehte sich um, stützte sich auf seinen Spaten und grüßte die Person, die sich ihm näherte, mit einem Nicken. »Sieht aus, als würde es Regen geben, was? Aber vielleicht schaffe ich diesen Teil des Gartens noch vorher.«
Er wandte sich wieder dem angefangenen Beet zu, machte eine Handbewegung, die das Anwesen umfasste, und erläuterte, was er für die Zukunft noch alles plante, welche Vision vom Garten ihm vorschwebte und welche Wirkung auf den Betrachter er sich erhoffte. Dass ihm der Besucher dabei dichter auf den Leib rückte, hielt er für Interesse an seinen Ausführungen. Bis sich ein Arm um seine Gurgel legte, ihn zurückriss und ein Dolch in seinen Rücken gerammt wurde, wieder und wieder. Balthasar Kruse versuchte zu schreien und sich zu wehren, seinem Entsetzen Ausdruck zu verleihen, doch schon wurde ihm die Kehle durchgeschnitten, und er brach neben dem Spaten zusammen.
Sein Blut tränkte den Boden, dem er so viel Aufmerksamkeit gewidmet hatte. Vielleicht hätte er aus diesem Umstand Trost gezogen, wäre er noch zu einem Gedanken in der Lage gewesen. Vielleicht hätte er sich gesagt, dass ein Teil von ihm in dem, was sich in den kommenden Wochen aus der Erde arbeiten würde, weiterlebte.
Andererseits hielt er sich für einen Mann von einiger Bedeutung, und es hätte ihm nicht gefallen, in einem Drama, in dem er bereits vor dem ersten Akt von der Bühne verschwand, lediglich Statist zu sein. Und die Vorstellung, dass den Ginsterbüschen und Gräsern sein Leben oder Sterben gleichgültig war, hätte ihn zutiefst gekränkt.
1.
Freitag, 28. März – Montag, 7. April 1930
Sektierer sind immer Fanatiker.
Eberhard Buchner, 1903
1
Die Speisen haben vermutlich einen sehr großen Einfluss auf den Zustand des Menschen. Wer weiß, ob wir nicht einer gut gekochten Suppe die Luftpumpe und einer schlechten den Krieg oft zu verdanken haben, dachte Hendrik, während die Bedienung einen Teller mit einem Stück Kirschkuchen vor ihn hinstellte. Wieder so ein Gedanke von Georg Christoph Lichtenberg, der einen wenig beachteten Aspekt des Lebens beleuchtete.
Hendrik nahm einen Bissen von seinem Kuchen und sah sich dabei im Speisewagen um. Zehn, zwölf Personen saßen an den Tischen, aßen und unterhielten sich oder sahen aus dem Fenster der vorbeihuschenden Landschaft zu. Aus dem Küchenabteil drang Bratenduft herüber.
Es war das erste Mal, dass Hendrik eine Mahlzeit im Zug einnahm, und er musste zugeben, dass es ihm gefiel. Komfortabler, als er gedacht hatte. Die Speisewagen der Mitropa waren nach englischem Vorbild entworfen, zusammen mit den Schlafwagen ergänzten sie sich zu fahrenden Hotels.
Bei der Abfahrt, als Kisten und Kessel mit Getränken, vorgekochten Gerichten, Tabakwaren und Tischwäsche hereingereicht wurden, war es ihm gelungen, einen Blick ins Küchenabteil zu werfen. Auf sechs Quadratmetern drängten sich neben dem Herd etliche Gestelle mit Töpfen und Pfannen, Kästen mit Besteck und Schränke, in denen sich vermutlich das Geschirr oder weitere Lebensmittel befanden.
Hendrik überschlug die Anzahl der Reisenden, vermutete, dass etwa ein Viertel von ihnen den Speisewagen nutzen würde und der Koch im Laufe eines Arbeitstages zwei oder drei Besetzungen zu versorgen hatte, und kam auf rund hundertfünfzig Mittagessen pro Tag, zu Hauptreisezeiten vielleicht mehr.
Ein Paar in abgewetzter Kleidung durchquerte den Wagen und bemühte sich, nicht allzu offensichtlich auf die gefüllten Teller zu sehen. Wohl dem, der Arbeit hat, dachte Hendrik schuldbewusst. Nicht jeder konnte es sich leisten, hier zu speisen. Die Wirtschaftskrise, die Amerika im letzten Jahr getroffen hatte, riss die halbe Welt in den Abgrund, die deutsche Wirtschaft machte da keine Ausnahme. Geldgeber aus den USA hatten ihre Kredite zurückgezogen, wodurch zahllose Unternehmen Konkurs anmelden mussten.
Hatte Albrecht Doehring nicht genau das vorausgesagt? Niemand wollte dem Bankier, den Hendrik im Zuge der Ermittlungen seines Bruders im Fall Rasmus Gehler kennengelernt hatte, damals glauben, doch alles, was er prophezeit hatte, war eingetroffen.
Mittlerweile gab es drei Millionen Arbeitslose, von denen nur ein Teil in den Genuss der Arbeitslosenversicherung kam. Die schlechte Entwicklung der Konjunktur, die desaströse Situation der Landwirtschaft und die ungünstige Lage auf dem Baumarkt boten keinen Anlass zu Optimismus. Der Berliner Magistrat hatte im Januar dreißig Krankenhaus-, Schul- und Bäderbauten stillgelegt. Dabei war die Bauindustrie eine Schlüsselindustrie, von deren Aufträgen eine Reihe weiterer Industrien lebten. Auch die Gastronomie musste einen Rückgang der Umsätze um durchschnittlich zweiunddreißig Prozent verkraften. Die Bank für deutsche Beamte war wie so viele andere Banken zusammengebrochen – einige tausend Anleger hatten dabei ihr Hab und Gut verloren –, ebenso der Bauer-Konzern, der drei Berliner Warenhäuser umfasste, die Presto-Fleischwerke meldeten Konkurs an, Demonstrationen der Erwerbslosen nahmen zu. Erst vor drei Wochen war es im Zuge reichsweiter kommunistischer Aufmärsche zu Krawallen gekommen, die in Berlin elf Schwerverletzte zur Folge hatten, wobei auch Unbeteiligte zu Schaden gekommen waren.
Wohl dem, der Arbeit hat, dachte Hendrik erneut und war froh darüber, dass er seine Tätigkeit an der Universität nicht hingeworfen hatte, wie es ihm so manches Mal durch den Kopf gegangen war. Dieses Jahr empfand er den Unterricht auch weniger als Last als die vergangenen Jahre. Sicher, ein Großteil seiner Studenten war nach wie vor bereit, lieber hohlen Phrasen nachzulaufen statt selbst zu denken. Vor zwei Wochen erst hatten einige von ihnen ein Schreiben an den Reichspräsidenten gesandt, in dem sie ihn »namens der Toten von Langemarck« aufforderten, den Young-Plan, der die Reparationslasten Deutschlands an die Alliierten regelte, nicht zu unterschreiben. Ein Ansinnen, dem Hindenburg natürlich nicht nachgekommen war. Doch zumindest leiteten inzwischen Rektoren die Geschicke der Universität, die nicht deutschnational dachten und handelten. Wilhelm His und Erhard Schmidt hielten sich einerseits aus der Politik heraus und erteilten andererseits jeder Form von Radikalismus eine Absage. Der Mathematiker Schmidt war im letzten Jahr konsequent gegen den Terror jener rechtsradikalen Studentenschaft vorgegangen, die nach einer Kontroverse mit der Universitätsleitung unter »Heil Hitler!«- und »Juda verrecke!«-Rufen durch die Universität stapften, Vorlesungen störten und andere Studenten misshandelten, sodass ihre jüdischen Kommilitonen es vorzogen, aus den Fenstern zu springen und sich in Sicherheit zu bringen.
Verwunderlich war diese Radikalisierung nicht, immerhin mussten die meisten Studenten mittlerweile ihren Lebensunterhalt selbst verdienen, weil ihre Eltern sie nicht mehr ausreichend unterstützen konnten, und hatten zudem keine Aussicht, eine ihrer Ausbildung entsprechende Arbeitsstelle zu finden. Viele wandten sich an das Studentenhilfswerk in der Hoffnung, Arbeit und billige Zimmer vermittelt zu bekommen, häufig vergeblich.
Aber Hendrik wollte jetzt nicht über die Universität nachdenken, er hatte schließlich Semesterferien. Er versuchte, sich auf das Gespräch zwischen Diana und ihrem Bruder zu konzentrieren, die ihm gegenübersaßen. Die Blicke der anderen Gäste, die immer wieder zu ihnen herüberwanderten, galten ausnahmsweise nicht Dianas schräger Aufmachung, obwohl sie aus Gründen, die sich sowohl jeder Logik als auch jeglichem gesunden Geschmacksempfinden entzogen, einen Strandanzug im Matrosenstil trug. Nein, es waren Michaels Armprothese und seine fehlenden Beine, die Neugier und hier und da auch Abscheu erregten.
Hendrik hätte die Leute am liebsten angeherrscht, ihre Blicke für sich zu behalten. Dianas Bruder spürte die Aufmerksamkeit, die er auf sich zog, das konnte man an der Art sehen, wie er die Kiefer zusammenpresste. Und er war immer noch labil. Als sie ihn vorhin aus dem Sanatorium abgeholt hatten, war Hendrik über sein Aussehen erschrocken gewesen. Sicher, so ein Morphiumentzug war kein Zuckerschlecken, aber er hatte doch erwartet, ihn in besserer Verfassung vorzufinden als bei seiner Einlieferung. Hohlwangig war er geworden und bestürzend apathisch. Dass der Entzug Michaels eigentliche Probleme nicht gelöst hatte und somit weitere Schwierigkeiten ins Haus standen, war abzusehen.
Diana tat, als ob sie den Zustand ihres Bruders nicht bemerkte. »Du kommst zu einer dramatischen Zeit zurück«, sagte sie gerade und versuchte, ihn auf den neuesten Stand in der politischen Entwicklung zu bringen. Im Sanatorium war er von allem, was die Außenwelt betraf, abgeschottet gewesen. »Das Kabinett Hermann Müller ist zurückgetreten.«
»Wegen geradezu lächerlicher Meinungsverschiedenheiten«, warf Hendrik ein.
»Ja, sie konnten sich über haushaltspolitische Fragen nicht einigen und waren dadurch handlungsunfähig. Es ging vor allem um die Rettung der Arbeitslosenversicherung durch Beitragserhöhungen. Zuletzt stritten die Parteien um Viertelprozente. Am Ende haben es die Sozialdemokraten verbockt und eine Regierungskrise heraufbeschworen, um vor ihren Wählern die Hände in Unschuld waschen zu können.«
»Reichspräsident Hindenburg hat heute früh den Führer der Zentrumsfraktion, Heinrich Brüning, mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt, und zwar ohne koalitionsmäßige Bindungen. Das Schauspiel wochenlanger Feilscherei bei Fraktionsverhandlungen wird uns also erspart bleiben. Brüning wird sich seine Mitarbeiter nach eigenem Gutdünken aussuchen.«
»Und Berlin? Was hat sich in Berlin getan?«, fragte Michael, der bisher wenig zum Gespräch beigetragen hatte.
»Oberbürgermeister Böß ist weg. Der Sklarek-Skandal hat ihn mürbe gemacht.«
»Verdient hat er so ein Ende seiner Amtszeit nicht«, meinte Hendrik.
Diana nickte. »Die Kommunalwahlen im vergangenen Jahr waren nicht zuletzt das Ergebnis der Stimmungsmache während des Skandals. Die politische Mitte wurde geschwächt, die radikalen Flügel gingen gestärkt daraus hervor. Das Stadtparlament ist kaum arbeitsfähig. Anderswo sieht es ähnlich aus. Überall im Land haben die Nationalsozialisten bei den Kommunalwahlen zugelegt, zumeist allerdings auf Kosten von Hugenbergs Deutschnationalen.«
»Die zutiefst zerstritten sind.«
»Ja, viele Parteimitglieder wehren sich gegen Hugenbergs diktatorischen Führungsstil.«
»Das gescheiterte Volksbegehren gegen den Young-Plan im letzten Jahr hat sich als Bumerang erwiesen. Seine Leute werfen ihm vor, mutwillig gegen jede Vernunft und auch gegen den Reichspräsidenten gehandelt zu haben. Es hat etliche Austritte aus der deutschnationalen Reichstagsfraktion und aus der Partei gegeben.«
»Graf Westarp hat den Fraktionsvorsitz niedergelegt.« Diana unterbrach sich, weil ihre Tochter, bekleidet mit Flanellhemd und Spielhöschen, deren unkonventionelle Farbzusammenstellung auf ihre Mutter verwies, nicht nur den Speisewagen erforschte, sondern auch die anderen Gäste und eben dabei war, eine der Servietten eines älteren Ehepaares an sich zu nehmen.
»Lissi, nicht!«
Unbeeindruckt setzte das Mädchen die Untersuchung fort, nahm die Serviette vom Tisch, faltete sie auseinander und stand im Begriff, eine Ecke auf ihren Geschmack hin zu testen.
»Elisabeth Katharina Lilienthal!«
Der Tonfall brachte Lissi dazu innezuhalten. Was es bedeutete, wenn ihre Mutter sie beim vollen Namen rief, wusste sie.
Diana nahm ihr die Servietten weg, schimpfte mit ihr und entschuldigte sich bei dem Ehepaar.
Lissi riss sich von ihrer Mutter los, kämpfte mit den Tränen und suchte Schutz bei Hendrik, der seine Arme um sie legte, begütigend auf sie einredete und ihr schließlich seine Taschenuhr gab, mit der sie, wie er wusste, allzu gern spielte. Im Sommer wurde sie zwei Jahre alt; unglaublich, wie die Zeit verging! Lissi war für ihn wie eine eigene Tochter, Ersatz für die Kinder, die er wohl nie haben würde. Zumindest wenn er weiter mit Josephine zusammenbleiben wollte, die nun mal keine Kinder bekommen konnte. Aber wollte er das überhaupt? Das war die Frage, nicht wahr? War sie wirklich die Richtige?
Sie konnte warmherzig sein. Der alten Frau im Nebenhaus las sie an einsamen Abenden manchmal die Tageszeitung vor. Für die Kinder auf ihrer Straße hatte sie stets ein offenes Ohr. Die Knirpse nannten sie Tante Kamille, weil sie denen, die erkältet waren, immer Kamillenbonbons anbot. Sie wäre zweifellos eine gute Mutter geworden. Was er besonders an ihr schätzte, war ihre unkonventionelle Seite. Zwar würde sie immer darauf bestehen, alkoholische Getränke nur in den richtigen Gläsern zu servieren, auf der anderen Seite konnte sie einen Handwerker, der seine Arbeit nicht ordentlich verrichtete, in Grund und Boden fluchen. Und wenn sie sich über Frau Diepold ärgerte, Hendriks Nachbarin aus dem zweiten Stock, eine unverbesserliche Monarchistin, sang sie schon mal im Treppenhaus die Internationale. Nicht zuletzt mochte er ihren Humor. Neulich hatte er sich fast verschluckt vor Lachen, als sie die Comedian Harmonists imitierte, erst jeden einzelnen der sechs Sänger und dann alle zugleich.
Doch zu anderen Zeiten gab sie sich distanziert oder vergaß Verabredungen mit ihm. Bei solchen Gelegenheiten fragte er sich, ob sie ihn nur erwählt hatte, um gegen ihren Vater aufzubegehren. Ein Professor für Philosophie, ein Anhänger der Republik, ein Pazifist gar – das brachte den Major regelmäßig auf die Palme. Die beiden Male, die sie sich begegnet waren, hatten unerfreulich geendet. Und Josephine liebte es, ihren Vater zu schockieren.
Einfach war das Leben mit ihr jedenfalls nicht. Die Philosophie half ihm in dieser Sache leider auch nicht weiter. Sokrates, zum Beispiel, hatte auf die Frage, ob man heiraten solle oder nicht, nur zu antworten gewusst: Was du auch tust, du wirst es bereuen.
Zur Zeit war Josephine verreist. Zu einer Freundin, nach Schweden. Sie brauche Abstand, hatte sie gesagt. Um sich über ihr Leben klar zu werden. Damit meinte sie zum einen, dass sie in naher Zukunft gezwungen sein würde, sich eine feste Anstellung zu suchen, weil die wirtschaftlichen Probleme auch an ihr nicht spurlos vorübergingen. Wie so viele Menschen hatte sie Geld verloren, als ihre Bank Bankrott anmelden musste. Zum anderen wollte sie über eine gemeinsame Zukunft mit ihm nachdenken. Die starken Gefühle, die sie für ihn empfand, machten ihr Angst, sagte sie oft. Hendrik fand es schwierig, damit umzugehen.
Diana riss ihn aus seinen Gedanken. »Wir sind gleich da«, sagte sie. »Komm, Lissi, Mäntelchen anziehen.«
Auf Lissis Gesicht erblühte ein Lächeln. »Papa!«, sagte sie.
»Ja, Papa holt uns ab.«
Folgsam ließ sich das Mädchen von ihrer Mutter in den Kindermantel helfen, nachdem sie Hendrik die Taschenuhr zurückgegeben hatte. Sie hing an ihrem Vater und konnte es kaum erwarten, ihn wiederzusehen.
Kurze Zeit später fuhr der Zug in den Bahnhof Zoo ein. Diana stieg mit Lissi aus, Hendrik und der Schaffner hoben Michael mitsamt Rollstuhl nach draußen.
Lissi sah sich suchend nach ihrem Vater um.
Edgar Ahrens, Gregors Assistent, kam auf sie zu. »Guten Abend«, begrüßte er sie. »Gregor konnte leider nicht kommen, weil er zu einem Mord gerufen wurde. Er hat mich gebeten, Sie abzuholen und nach Hause zu bringen.«
»Einen Mord?« Diana bekam immer glänzende Augen, wenn es um einen von Gregors Fällen ging.
Lissi zupfte am Ärmel ihrer Mutter. »Papa?«, fragte sie.
»Er ist nicht da, Schatz. Du wirst dich noch einen Augenblick gedulden müssen.«
Lissi verzog das Gesicht und schmollte.
Diana wandte sich an Edgar. »Sie müssen doch sicher auch zum Tatort.«
»Gleich nachdem ich Sie abgesetzt habe.«
»Wenn wir mit Ihnen zu meinem Mann fahren und später mit ihm nach Hause, sparen Sie Zeit.« Diana drehte sich zu Hendrik und ihrem Bruder um. »Ihr habt doch nichts dagegen?«
Hendrik kannte diesen Ausdruck in ihrem Gesicht. Diana hatte wieder mal Blut geleckt. Er zuckte die Achseln.
Michael äußerte sich nicht.
»Ich weiß nicht«, sagte Edgar.
»Lissi vermisst ihren Vater.« Diana schob ihre Tochter nach vorn. »Sie hat ihn den ganzen Tag nicht gesehen.«
»Na ja … Meinetwegen.«
Zu fünft fuhren sie also zum Tatort. Natürlich sah es die Polizeiführung nicht gern, wenn sich Zivilisten in eine Morduntersuchung einmischten. Andererseits hatten Hendrik und Diana im Laufe der Jahre bewiesen, dass sie Gregor eine tatkräftige Unterstützung waren, daher wurde schon mal ein Auge zugedrückt.
Unterwegs klärte Edgar sie auf: »Es handelt sich bei dem Toten um einen gewissen Balthasar Kruse. Wurde offenbar bei der Gartenarbeit erstochen. Eine Frau Quidde hat die Leiche gefunden und uns unterrichtet.«
Er steuerte das Auto Richtung Waidmannslust und hielt schließlich vor einem Zweifamilienhaus mit Garten. Der Bereich war großräumig abgesperrt, mehrere Beamte sicherten das Grundstück. Trotz des Nieselwetters standen Grüppchen von Menschen auf der Straße und tuschelten.
Die Neuankömmlinge stiegen aus. Hendrik schob Michaels Rollstuhl, Diana trug Lissi, die während der Fahrt eingeschlafen war, auf dem Arm und hielt einen Hut über sie, um sie vor den Regentropfen zu schützen. Von den Augen der Neugierigen verfolgt gingen sie an der Absperrung vorbei durch die Gartentür und umrundeten das Haus.
Das Erste, was sie sahen, war eine auf dem Boden ausgebreitete weiße Plane, die offenbar die Leiche bedeckte. Zwei Stiefelspitzen lugten am unteren Ende hervor.
Hendrik versuchte, den Tatort in sich aufzunehmen, wie er es oft bei seinem Bruder beobachtet hatte: Haus, Schuppen, Garten. Das zweistöckige Haus mit seinen großen Fenstern zum Garten hin machte einen soliden Eindruck, nicht gerade ärmlich, aber auch nicht protzig. Der Anstrich müsste mal erneuert werden. Die beiden Wohneinheiten besaßen je eine Tür zur Straße und eine nach hinten heraus. Der Schuppen, dessen Tür offen stand, beherbergte Gartenutensilien. Man konnte eine Schubkarre sehen, Holzkisten, eine Harke. Der Garten maß vielleicht dreißig Schritt in der Breite und fünfzig in der Länge. Ein großer Teil davon war verwildert: Ginsterbüsche, Gestrüpp, Unkraut, dazwischen zwei Apfelbäume. Der Tote lag neben einem Spaten und hatte wohl das Beet zu seinen Füßen bearbeitet. Offenbar war er mit seiner Arbeit so gut wie fertig gewesen, als ihn der Tod ereilte. Seine Jacke hing über einem Korb, in dem er eine angebissene Stulle und eine halb volle Flasche Milch verstaut hatte.
Worum es bei dem Mord wohl gegangen war? Um Raub? Einen Streit? Rache? Nach Liebeshändel sah die Situation nicht aus, aber wer konnte das schon mit Sicherheit sagen?
Simon Weinstein, ein Beamter der Spurensicherung, war damit beschäftigt, Erdproben in kleinen Tüten zu verstauen. Er winkte, als er sie entdeckte. Edgar ging zu ihm hinüber und ließ sich auf den neuesten Stand bringen. Wenn die beiden nebeneinander standen, der untersetzte Simon und der baumlange Edgar, erinnerten sie Hendrik immer an das Komikerduo Pat und Patachon.
Gregor kam aus einem Gebüsch, das er vermutlich nach Spuren abgesucht hatte. Mit seinem pedantischen Vorgehen wirkte er nicht wie ein Kriminalkommissar, sondern eher wie ein Postbeamter, der jeden Morgen seine Briefmarken zählte, sortierte und mit einem Stammbaum versah. Harmlos. Aber Hendrik wusste, dass der Eindruck täuschte. Sein Bruder war ein harter Hund, den nichts von einer Fährte abbrachte. Nicht umsonst hatte er eine beeindruckende Erfolgsquote bei der Aufklärung von Verbrechen vorzuweisen.
Gregor runzelte die Stirn, als er sie sah.
»Sie haben darauf bestanden mitzukommen«, entschuldigte sich Edgar.
»Lissi wollte dich sehen«, meinte Diana.
Gregor hatte eine klare Vorstellung, wer die treibende Kraft dahinter war, verzichtete jedoch auf einen Kommentar. Kurz strich er seiner Tochter durchs Haar, ohne sie zu wecken, und nickte dem Rest seiner Familie zu. »Haltet euch zurück«, sagte er.
Dann wandte er sich an Edgar. »Der Tote ist von hinten angegriffen worden. Mehrere Messerstiche, die ihn vermutlich unerwartet trafen, anschließend wurde ihm die Kehle durchgeschnitten. Simon meint, er liege bereits seit heute Morgen hier. Oliver soll uns schleunigst Genaueres sagen, sobald er die Obduktion vorgenommen hat. Sorg bitte dafür, dass die Leiche abgeholt wird.«
Edgar nickte und verschwand.
Seit heute Morgen? Hendrik sah sich noch einmal um. Der Garten war von einer berankten Mauer umgeben, drei oder vier Meter hoch. Kein Fenster der umliegenden Häuser ragte darüber hinaus, es hatte also niemand die Tat beobachten können. Kein Wunder, dass der Mord so spät entdeckt wurde. Zeugen dürfte es daher wohl nicht geben. Trotzdem schickte Gregor einige Beamte los, um die Nachbarn zu befragen.
Simon nahm mit Handschuhen die Milchflasche aus dem Korb, holte das Taschenetui mit den Utensilien zur Sicherung von Fingerabdrücken hervor, das die Beamten des Erkennungsdienstes stets mit sich führten, und entnahm ihm Haarpinsel und Streubüchsen, Folien, Lupe und Bandmaß.
»Etwas entdeckt?«, wollte Gregor wissen.
»Der Milchmann war’s«, erwiderte Simon, ohne sich in seiner Arbeit stören zu lassen. »Weil der Ermordete seine Milch nicht getrunken hat.« Der Chemiker pflegte einen schrägen Humor, das war allgemein bekannt.
Gregor ging nicht darauf ein. »Gib mir Bescheid, wenn du etwas von Interesse findest. Ich rede mit der Frau, die die Leiche entdeckt hat.« Er hielt inne, schien über etwas nachzudenken. Dann sah er Diana an. »Die Frau steht unter Schock. Da du nun schon mal hier bist, wäre es vielleicht nicht verkehrt, wenn du mitkommst.«
Diana strahlte. Das war nach ihrem Geschmack.
»Ich nehme Lissi so lange«, bot Hendrik an.
»Danke.« Diana übergab ihm ihre schlafende Tochter und verschwand mit Gregor im Haus.
Hendrik ging zu Michael hinüber, der apathisch im Rollstuhl saß. Er hatte die ganze Zeit über weder gesprochen noch Interesse an den Vorgängen gezeigt. Es tat Hendrik in der Seele weh, ihn so zu sehen. Was hatte Dianas Bruder nicht alles durchmachen müssen! Die Verkrüppelung, die Kriegsgefangenschaft, Spott und Abscheu der Leute auf der Straße … Kein Wunder, dass er deprimiert war. Wie können wir dir nur deinen Lebensmut wiedergeben? Wie macht man jemandem Hoffnung, der nicht den geringsten Anlass dazu hat?
2
Wer je beobachtet hatte, wie ein angebissener Apfel allmählich braun wurde und verschrumpelte, sobald er der Welt ausgesetzt war, erhielt eine ungefähre Vorstellung von Gudrun Quidde. Früher einmal mochte sie voller Kraft und Enthusiasmus gewesen sein, doch das Leben hatte seine Spuren an ihr hinterlassen. Jetzt wirkte sie, als ob sie schon aus Prinzip unpässlich sei. Die Entdeckung der Leiche hatte es nicht besser gemacht. Frau Quidde saß in einem Sessel am Wohnzimmertisch, das Gesicht in den Händen vergraben, und nahm ihre Umwelt nicht zur Kenntnis.
Philipp Beck, einer von Gregors Assistenten, war bei ihr, stand unentschlossen neben dem Tisch und wirkte sichtlich erleichtert, als Gregor und Diana hereinkamen. »Sie hatten recht«, sagte er zu seinem Chef, »der Raub war nur vorgetäuscht.« Er deutete auf eine Vitrine, in der sich ein antiker Kompass, eine Weltkarte auf Pergament, eine chinesische Münze, zwei keltische Fibeln und ein Schachbrett mit Figuren aus Elfenbein befanden. »Wenn es wirklich ein Raub gewesen wäre, hätten die Diebe das hier nicht liegenlassen. Scheint wertvoll zu sein.«
»Sie wären auch nicht ausgerechnet am hellichten Tag eingebrochen, mit dem Eigentümer im Garten«, murmelte Gregor, während er die Vitrine öffnete und den Kompass in die Hand nahm. »Ein durchsichtiges Ablenkungsmanöver. Amateurhaft.«
Tatsächlich waren zwar Bücher aus den Regalen geworfen, ein Glas auf dem Tisch umgestoßen und Schubladen aufgerissen und ihr Inhalt wahllos verstreut worden, aber es wirkte irgendwie gewollt. Es sollte wohl aussehen, als hätte der Verursacher etwas Bestimmtes gesucht.
Diana trat an den Bücherschrank und sah sich die Bücher an, die noch in den Regalen standen. Es handelte sich zumeist um Sachbücher über Religion, Astronomie, Mythologie und Rassenkunde. Arthur de Gobineaus Versuch über die Ungleichheit der Menschenrassen fand sich dort, Helena Petrowna Blavatskys Geheimlehre und eine Wagner-Biografie von Houston Stewart Chamberlain.
Weil Gregor mit einem Nicken des Kopfes auf die Frau im Sessel deutete, setzte sich Diana zu Gudrun Quidde. »Wie geht es Ihnen?«, erkundigte sie sich.
Frau Quidde stöhnte nur.
»Mein Name ist Diana Lilienthal. Kann ich Ihnen helfen? Möchten Sie vielleicht ein Glas Wasser?«
Die Frau schüttelte den Kopf.
Diana stand trotzdem auf, ging in die Küche und füllte ein Glas mit Leitungswasser, das sie ihr brachte. »Trinken Sie. Das wird Ihnen guttun.«
Jetzt nahm Frau Quidde die Hände vom Gesicht. »Das ist alles so entsetzlich«, hauchte sie.
»Trinken Sie einen Schluck.«
Gehorsam nahm sie das Glas und nippte am Wasser.
Diana deutete auf Gregor. »Das ist mein Mann, Kommissar Lilienthal. Er möchte Ihnen ein paar Fragen stellen.«
Frau Quidde nickte geistesabwesend.
Gregor setzte sich auf die Couch gegenüber. »Ich verstehe, dass Sie das alles am liebsten vergessen würden, aber ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir schildern könnten, wie Sie den Toten gefunden haben.«
»Ich … Ich habe geklingelt, und als niemand öffnete, bin ich ums Haus. Wir waren doch verabredet.«
»Ja?«
»Wegen der Unterlagen.«
»Welcher Unterlagen?«
»Vom Verein meines Mannes. Abrechnungen und Protokolle. Balthasar war Protokollführer und Kassenwart. Mein Mann wollte den Abschlussbericht fürs letzte Jahr fertig machen, ehe sich der Verein wieder trifft. Das gehört sich doch so.«
»Was ist das für ein Verein?«
»Wir … Wir kommen zusammen, um zu reden.«
»Worüber?«
»Über alles Mögliche. Gott, die Welt, das Universum … Wir entwickeln ein neues Weltbild. Das alte hat abgedankt.« Weil Gregor sie fragend ansah, führte sie aus: »Es geht uns um Welterkenntnis. Das Werden der Menschheit. Um … Um kulturelle Weiterentwicklung.«
Wie Diana ihren Mann kannte, würde er sich noch eingehend über diesen Verein informieren. Es war typisch für ihn, die Bemerkung eines Befragten unkommentiert zu lassen und später durch die Aussagen anderer einer genaueren Untersuchung zu unterziehen.
Wirklich nickte Gregor bloß, als hörte er so etwas jeden Tag, und ermunterte Frau Quidde: »Sie gingen also ums Haus.«
»Ja. Und da lag er, mitten auf der Erde. Überall war Blut um seinen Kopf. Überall!« Sie schlug wieder die Hände vors Gesicht, nicht um ihre Gefühle zu verbergen, eher in dem instinktiven Versuch, ihre Augen vor dem zu schützen, was sich längst in ihre Seele gebrannt hatte.
»Und dann?«
Frau Quidde stöhnte wieder. »Das ist alles so schrecklich! Nun bin ich zum zweiten Mal mit dem Tod konfrontiert.«
»So?«
»Na ja, zuerst unsere Katze. Fräulein Garbo, hieß sie. Sie wissen schon, nach der –«
»Schauspielerin, schon klar.«
»Wir haben sie nach ihr benannt, weil sie denselben Gesichtsausdruck hatte, so einen entrückten Blick. Und dann, eines Tages –«
Gregor war offenkundig nicht in der Stimmung für Haustiergeschichten, denn er unterbrach Frau Quidde: »Haben Sie den Toten angefasst?«
»Ich … hab’ mich nicht getraut. Dass er nicht mehr lebte, war ja offensichtlich. Ich … Ich wollte weglaufen, aber die Verandatür stand offen, und da dachte ich an sein Telefon und dass ich die Polizei rufen muss. Das gehört sich doch so.«
»Hatten Sie keine Angst, dass der Mörder noch hier sein würde?«
Frau Quidde sah ihn mit aufgerissenen Augen an. Es war klar, dass sie gar nicht auf den Gedanken gekommen war. »Sie … Sie meinen …?«
»Nun, es ist ja nichts passiert«, beschwichtigte Gregor. »Der Tote lag also so da wie jetzt, ja? Und in der Wohnung? Haben Sie da etwas angefasst?«
»Nur das Telefon. Und … Ich weiß nicht, ich glaube, die Kommode. Weil meine Beine plötzlich zitterten und ich mich abstützen musste.«
»Verständlich. Ist Ihnen irgendetwas aufgefallen, das uns weiterhilft?«
Sie schüttelte den Kopf. »Was mache ich denn jetzt mit den Briefmarken?«
»Welchen Briefmarken?«
»Die ich für Balthasar aufgehoben habe. Er sammelte doch Briefmarken.«
Gregor überging die Bemerkung. »Wenn ich mich hier so umsehe, macht es den Anschein, als hätte er allein gelebt. Ist das richtig?«
Frau Quidde nickte.
»Er war nicht verheiratet?«
»Balthasar war eingefleischter Junggeselle.«
»Also keine Kinder?«
»Nein.«
»Frauenbekanntschaften?«
Frau Quidde zögerte, verneinte dann jedoch. Verschwieg sie etwas? Es juckte Diana in den Fingern nachzuhaken, aber das würde Gregor nicht zu schätzen wissen. Er würde auf seine Weise im Laufe der Untersuchung darauf zurückkommen.
»Haben Sie einen Verdacht, wer es getan haben könnte? Oder warum er ermordet wurde?«
Frau Quidde versuchte, gleichzeitig den Kopf zu schütteln und die Achseln zu zucken.
»Was war Herr Kruse für ein Mensch?«
»Ruhig. Gewissenhaft. Deswegen hat er ja die Protokolle geführt. Er war doch Kanzleiassistent.«
»Hat er mit jemandem Streit gehabt?«
»Nicht, dass ich wüsste.«
»Allem Anschein nach wurde er bereits heute Morgen ermordet. Nehmen Sie es nicht persönlich, Frau Quidde, aber ich muss Sie fragen, wo Sie sich den Vormittag über aufgehalten haben.«
»Aufgehalten? Ach so. Ich war mit Ingeborg zusammen. Ingeborg Wessel.«
»Der Schwester von Horst Wessel?«
Frau Quidde nickte. »Ich kenne sie von früher. Die ersten Wochen nach der Ermordung ihres Bruders wollte ich sie in Ruhe lassen, weil ich dachte, sie hat sicher genug um die Ohren, aber gestern habe ich sie angerufen, weil ich annahm, dass sie jemanden brauchen könnte, bei dem sie sich aussprechen kann. Das gehört sich doch so. Ich meine, die arme Frau! Erst stirbt ihr Bruder Werner bei einer Skiwanderung im Riesengebirge und dann ihr anderer Bruder auf eine solch schreckliche Weise. Was ist das für eine Welt, in der Kommunisten anständige Deutsche ermorden, nur weil ihnen ihre Nase nicht gefällt!«
»Hieß es nicht, es sei um Rivalität unter Zuhältern gegangen?«, mischte sich Diana ein.
»Das behaupten die Kommunisten. Aber warum hätte der Mörder dann warten sollen, bis sich Horst Wessels Vermieterin um Hilfe an ihn wandte?«
Diana musste zugeben, dass sie wenig über die Sache wusste. Sie versuchte, sich zu erinnern, was Gregor ihr im Februar, nach dem Tod des Nationalsozialisten, darüber erzählt hatte. Anscheinend hatte es Ärger gegeben, weil Wessel seine Geliebte, eine Prostituierte, bei sich wohnen ließ. Die Vermieterin hatte wohl einen Mietaufschlag verlangt, der nicht bezahlt wurde, oder so ähnlich. Jedenfalls war das Zusammenleben der Beteiligten problematisch geworden. Deshalb bat die Vermieterin Freunde ihres verstorbenen Mannes um Hilfe, Arbeiter aus dem kommunistischen Umfeld. Die waren ohnehin nicht gut auf Wessel zu sprechen, weil der einen als Schlägertrupp bekannten Friedrichshainer SA-Verband anführte und oft genug gegen sie einsetzte. »Arbeitermörder«, nannten sie ihn.
Und dann, was war dann geschehen? Die Männer waren in das Zimmer eingedrungen, das Wessel bewohnte, und ein – wie hieß er noch? – Albrecht oder Ali Höhler hatte auf ihn geschossen. Ein paar Wochen später war der schwer verletzte Wessel gestorben. An einer Blutvergiftung, wenn Diana sich nicht irrte. Seither versuchte Joseph Goebbels, ihn zum Märtyrer der Nationalsozialisten aufzubauen.
»Waren Sie bei der Beerdigung?«, erkundigte sich Gregor.
»Natürlich. Das gehört sich doch so. Doktor Goebbels war da und Hauptmann Göring.«
Klar, die Gelegenheit, aus der Beerdigung eine Propagandaveranstaltung zu machen, konnte sich Goebbels nicht entgehen lassen, dachte Diana.
»Auch Prinz August Wilhelm von Preußen erwies dem Toten die letzte Ehre. Es war eine zu Herzen gehende Veranstaltung. Sie haben dort das Lied gesungen, das Horst Wessel geschrieben hat. Da ist mir ein Schauer den Rücken hinuntergelaufen.« Sie fing leise an zu summen: Die Fahne hoch, die Reihen fest geschlossen … Dann unterbrach sie sich. »Die Kommunisten haben versucht zu stören. Es hat Prügeleien gegeben.«
Die sich Goebbels sicher erhofft hatte.
»Und die Polizei hatte nichts Besseres zu tun, als uns zu schikanieren. Nicht mal das Demonstrationsverbot haben sie aufgehoben und uns dadurch das Ehrengeleit verwehrt. Für die Beerdigung von Kommunisten machen sie eine Ausnahme, aber einen aufrechten Mann wie Horst Wessel demütigen sie noch über den Tod hinaus.«
»Zurück zu Ihrem Besuch heute Morgen. Sie waren also mit Ingeborg Wessel zusammen?«
»Ja.«
»Den ganzen Vormittag?«
Frau Quidde zögerte.
»Also?«
»Vielleicht nicht den ganzen. Ich habe nicht auf die Uhr gesehen.«
Gregor nickte. »Wir werden Frau Wessel danach fragen. Erst einmal lasse ich Sie von meinem Kollegen zum Revier fahren, wo Sie dann bitte Ihre Aussage zu Protokoll geben.« Er gab Philipp Beck einen Wink.
Diana rieb sich gedankenverloren die Nase. Auch Gregor war sicher aufgefallen, wie vage sich Gudrun Quidde über den Verein ihres Mannes geäußert hatte. Da dürfte es noch manches herauszufinden geben!
3
Allmählich wollte Hendrik nach Hause. Dianas Begeisterung für kriminalistische Untersuchungen in Ehren, aber er war müde und hatte schon wieder Hunger. Und Lissi wurde ihm allmählich zu schwer. Wenigstens hatte der Nieselregen aufgehört. Zum Glück verließen Gregor und Diana eben die Wohnung des Ermordeten. Offenbar war die Vernehmung dieser Frau Quidde beendet. Diana nahm ihm Lissi ab, die immer noch schlief.
Bevor Hendrik jedoch dazu kam, seine Wünsche zu äußern, tauchte Edgar mit einem unbekannten Mann auf und steuerte auf Gregor zu. »Dieser Herr behauptet, hier zu wohnen«, sagte er.
»Das behaupte ich nicht nur, es ist so.«
Alles an dem Mann war professionell: die Art, wie er seinen Hut trug, das selbstbewusste Auftreten, das den erfahrenen Geschäftsmann verriet, sogar das flüchtige Begrüßungslächeln, mit dem er sie bedachte, wirkte, als hätte er es in zahllosen Versuchen optimiert. Als würde er nichts dem Zufall überlassen. Oder einer spontanen Regung.
»Sind Sie ein Kostgänger von Herrn Kruse?«, erkundigte sich Gregor.
Der Mann schnaubte. »Mir gehört die eine Hälfte des Hauses. Und des Grundstücks.«
»Dann habe ich einige Fragen an Sie.«
Unsicher sah der Mann auf die Plane. »Ist das …? Ist er …?«
»Herr Kruse ist tot, ja.«
»Ihr Kollege sagte …«
»Er wurde ermordet.«
»Mein Gott!« Der Mann fuhr sich durchs Haar.
»Dürfte ich zunächst Ihren Namen erfahren?«
»Benecke, Frederik Benecke.«
»Was machen Sie beruflich, Herr Benecke?«
»Ich betreibe die Einhorn-Apotheke am S-Bahnhof.«
»Sie sind also Apotheker.«
Der Mann nickte.
»Sie sagen, Ihnen gehört eine Hälfte des Hauses?«
»Die andere habe ich letztes Jahr an Herrn Kruse verkauft.«
»Warum das?«
»Nun, ich … Ich brauchte das Geld.«
»Ich dachte immer, Apotheker sei ein krisensicherer Beruf. Zumal Ihre Apotheke verkehrsgünstig liegt. Sicher können Sie sich über mangelnde Kundschaft nicht beklagen«
»Stimmt schon, aber … Nun, es gab Probleme.«
Gregor sah ihn auffordernd an.
»Mein Kompagnon –«
»Sie meinen, in der Apotheke?«
»Ja. Wir haben sie damals zusammen eröffnet. Offenbar war ich zu vertrauensselig, denn er hat Geld unterschlagen. Viel Geld. Ich habe es zunächst nicht bemerkt, weil er die Bücher geführt hat. Anfang letzten Jahres sollten wir dann eine Steuerprüfung bekommen, da ist er abgehauen. Mit der Kasse. Hat mich mit einem Haufen Schulden sitzen lassen. Ich war gezwungen, die Hälfte meines Hauses zu verkaufen, um wieder flüssig zu werden.«
»Ich erinnere mich«, mischte sich Edgar ein. »Die Einhorn-Apotheke, richtig! Sebastian Hoegner, nicht wahr?«
»So heißt mein Kompagnon, ja.«
»Hat sich vermutlich ins Ausland abgesetzt, sagen die Kollegen.«
»So wurde es mir mitgeteilt.« Herr Benecke wandte sich wieder an Gregor. »Vielleicht können Sie sich mal erkundigen, ob die Sache überhaupt noch verfolgt wird, da wäre ich Ihnen dankbar.«
»Ich will sehen, was sich machen lässt. Woher kannten Sie Herrn Kruse?«
»Gar nicht. Er kam über eine Annonce, die ich wegen des Verkaufs aufgegeben hatte.«
»Und nach dem Verkauf? Kamen Sie als Nachbarn miteinander klar?«
»Aber ja. Er war ein ruhiger Mensch. Fiel kaum auf. Immer höflich. Korrekt, darauf achte ich seit der Erfahrung mit meinem Kompagnon, wie Sie sich sicher vorstellen können. Habe mich bei seinem Arbeitgeber erkundigt, ehe ich damals mit ihm handelseinig wurde. Ein durch und durch vertrauenswürdiger Mann. Die Abrechnung wegen der Nebenkosten verlief entsprechend reibungslos. Privat hatten wir allerdings nicht viel miteinander zu tun. Wenn wir uns im Garten begegnet sind, haben wir uns manchmal unterhalten, und zwei-, dreimal haben wir uns verabredet, um Dinge zu besprechen, die das Haus betrafen, aber im Prinzip ging jeder seiner Wege.«
Hendrik bemerkte, dass Herr Benecke Gregor auf eine eigentümliche Weise ansah, die er nicht zu deuten wusste. Als ob … Ja, als ob er jeden Zentimeter des Gesichts seines Bruders mit den Augen vermessen würde.
»Er war ein ruhiger Mensch, sagen Sie. Und sonst? Können Sie uns irgendetwas verraten, was uns weiterhilft? Hobbys, Kontakte, Eigenarten, irgendwas?«
»Ich weiß eigentlich nichts über ihn. Außer dass er Matjeshering verabscheut.«
»Matjeshering.«
»Ja. Wir haben den Wohnungskauf damals bei einem gemeinsamen Mittagessen besiegelt, und da äußerte er sich entsprechend.«
»Dann können Sie uns nichts über seine privaten Verhältnisse erzählen?«
»Nicht viel jedenfalls. Er hat eine Schwester, die im Wedding wohnt. Ist mit einem Arbeiter verheiratet. Ich glaube, mit denen gab es Streit wegen Geld. Das habe ich aus einigen Bemerkungen von Herr Kruse geschlossen.«
»Näheres wissen Sie nicht?«
»Bedauere.«
»Herr Kruse war nicht verheiratet?«
»Nein.«