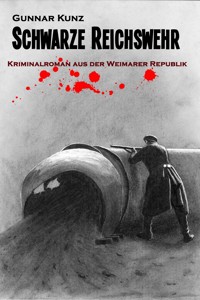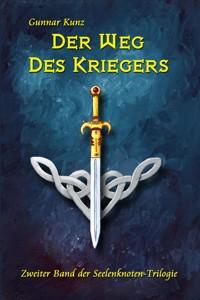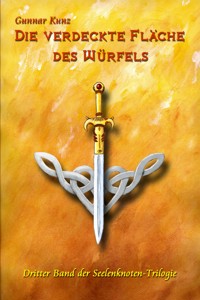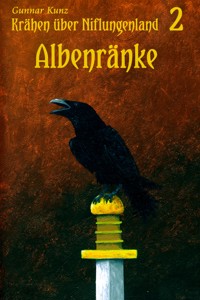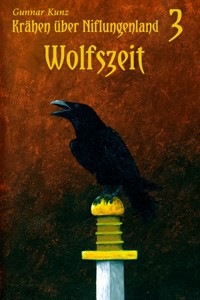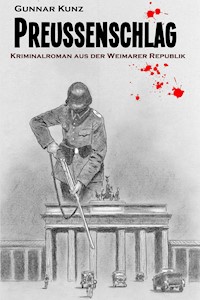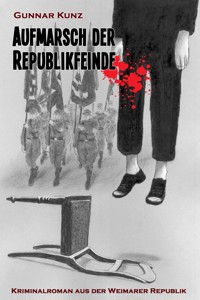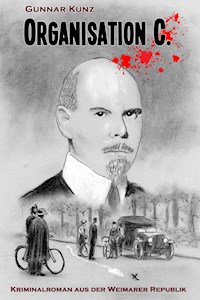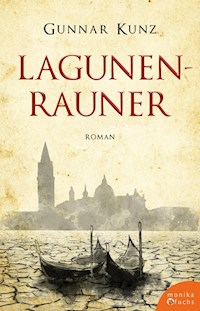7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kriminalroman aus der Weimarer Republik
- Sprache: Deutsch
Berlin, 1926. Enthüllungen über Putschpläne und Fememorde erschüttern die Republik, der Streit über die Enteignung der Fürsten spaltet das Land. Im Deutschen Theater wird eine Schauspielerin ermordet. Doch galt der Anschlag wirklich ihr oder ihrer Kollegin? Deren Noch-Ehemann käme ein Tod seiner Frau nur allzu gelegen. Und was ist mit ihrer Konkurrentin und ihrem abgewiesenen Verehrer? Während der Proben zu Shakespeares Sommernachtstraum untersuchen Hendrik Lilienthal, seine Schwägerin Diana und sein Bruder Gregor, den Fall. Derweil wird ein zweiter Anschlag verübt, und die Ermittler begreifen: Sie müssen sich beeilen, wenn sie nicht noch einen Mord beklagen wollen. (ursprünglich unter dem Titel Ausgeleuchtet erschienen) Gunnar Kunz, der selbst vierzehn Jahre am Theater gearbeitet hat, schildert das Theatermilieu mit seinen Höhen und Tiefen und lässt zugleich die spannende Zeit der 20er Jahre wiederaufleben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 331
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Gunnar Kunz
Tückisches Spiel
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Tückisches Spiel
Prolog
1
2
3
Nachwort
Empfehlenswerte Literatur zum Thema:
Weitere Bücher aus der Serie:
Impressum neobooks
Tückisches Spiel
Kriminalroman aus der Weimarer Republik
von Gunnar Kunz
Impressum:
Copyright 2022 by Gunnar Kunz, Berlin
Tel. 030 695 095 76
E-Mail über www.gunnarkunz.de
Alle Rechte vorbehalten
Einbandgestaltung: Rannug
Dieses E-Book, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne Zustimmung des Autors nicht vervielfältigt, wieder verkauft oder weitergegeben werden. Danke, dass Sie die Arbeit des Autors respektieren!
William Shakespeare
Ein Sommernachtstraum
übersetzt von August Wilhelm von Schlegel
Regie: Magnus Terboven
Dramaturgie: Knut Teusch
Hilfsregie: Jobst Lüders
Theseus / Oberon ....... Rudolf Siemsen
Hippolyta / Titania ....... Tilla Herzog
Puck ....... Thekla Giese
Egeus ....... Gerhard Uhlig
Hermia ....... Nora Dernburg
Lysander ....... Peer Fischer
Helena ....... Emily Sydow Lätitia Auer
Demetrius ....... Bernward Dahrendorf
Zettel ....... Barnabas Jandrey
Squenz ....... Henning Voss
Inspizient: Roland Kube
Souffleuse: Edna Ott
Obergarderobier: Sören Preuß
Oberbeleuchter: Xaver Stöhr
Bühnentechniker: Pit Gerber
Deutsches Theater, Berlin
Direktor: Edgar Licho
Premiere: 4. Juni 1926
Spieldauer: ca. 3 Stunden
Pause nach dem 4. Aufzug
Prolog
Letzte Worte sind selten tiefgründig oder poetisch. Es sei denn, sie stammen von Shakespeare.
Emily Sydow dachte an nichts weniger als ans Sterben, als sie sich einen Schritt nach links spielte, damit das Scheinwerferlicht sie erfasste, im Gegenteil: Ihre Gedanken kreisten um ein gemeinsames Leben mit ihrer großen Liebe, um ein Kind von ihm und vor allem um eine Karriere auf den Bühnen der Welt.
In ihrer Garderobe hatte sie den Zeitungsausschnitt aus dem Neuen Görlitzer Anzeiger aufgehängt, in dem sie zum ersten und bislang einzigen Mal von der Presse erwähnt wurde, für ihre Darstellung im Faust im Stadttheater Görlitz: Als Lieschen am Brunnen fiel Emmily Sydow durch ihre erfrischende Natürlichkeit auf. Keine spektakuläre Rolle, gewiss, aber bemerkt hatte man sie, auch wenn ihr Name falsch geschrieben worden war.
Fräulein Giese und die Garderobiere machten sich über die Kritik lustig, aber sie würde es ihnen schon zeigen. Wenn sie hart an sich arbeitete, würde sie genauso ein Star werden wie die Herzog. Dann würde man sie nicht länger verspotten, sondern endlich als Schauspielerin ernst nehmen. Kerr und Ihering würden um Superlative wetteifern, die ihr Spiel angemessen beschrieben. Wundervoll ist ihre Kraft im Dramatischen, würden sie schreiben, wie Alfred Kerr einst über Tilla Durieux geschrieben hatte. Oder: Welch eine Penthesilea, welch eine Lady Macbeth entfaltet sich hier!, wie Herbert Ihering über Agnes Straub. Und Peer würde einsehen, was für ein Talent sie war, und sie nicht länger wie ein Dummchen behandeln.
Hoppla, beinahe hätte sie ihren Einsatz verpasst. Emily, lass dich nicht ablenken! Gleich ist es so weit. Gleich wirst du ihnen beweisen, was du kannst. Gleich.
Ihr Gesicht glühte vor Aufregung, ihre Augen huschten abwechselnd zu Peer und Bernward, die um sie in ihrer Rolle als Helena buhlten. Wie im richtigen Leben, dachte sie und konnte eben noch ein Kichern unterdrücken. Hastig legte sie einen betroffenen Ausdruck an den Tag. Sie wollte nicht, dass Magnus die Probe wieder ihretwegen unterbrach. »Sei ein bisschen betroffener«, hatte er neulich mit genervter Stimme zu ihr gesagt. »Du vermutest, dass die beiden dich verspotten, du glaubst nicht, dass ihre Liebesschwüre ernst gemeint sind.« O doch, sie glaubte es. Und ob sie es glaubte!
Der Waldteppich mit dem eingeflochtenen künstlichen Gras und den Blumen zu ihren Füßen half ihr, sich in Gedanken in einen Elfenwald zu versetzen. Vorn gab es ein Gerüst mit Blattwerk und Ranken, auch ein paar Büsche waren über den Boden verteilt, den Rest musste sie sich denken. Markierungen zeigten an, wo später Bäume stehen sollten, und für den Hintergrund war sogar ein See vorgesehen, hatte man ihr gesagt.
Achtung, die Auseinandersetzung zwischen Helena und Hermia! Emily konzentrierte sich. Sie war dankbar für die Chance, eine große Rolle in einem der ersten Häuser der Welt spielen zu dürfen, und fest entschlossen, sie zu nutzen. Auf dieser Bühne hatte Max Reinhardt inszeniert, hier hatten Elisabeth Bergner und Tilla Durieux, Werner Krauss und Paul Wegener gestanden und stürmische Erfolge gefeiert. Das konnte ihr auch gelingen; Emily wusste, sie hatte das Zeug dazu. Sie war in der Lage, der ganzen Tiefe der Seelenqualen ihrer Figur Ausdruck zu verleihen, sie fühlte es deutlich in sich. Und das würde sie beweisen. Gleich. Gleich.
»Und nun, wo Ihr mich ruhig gehen lasst«, deklamierte sie, »so trag ich meine Torheit heim zur Stadt / und folg Euch ferner nicht. O lasst mich gehn! / Ihr seht, wie kindisch und wie blöd ich bin.« Die letzten Worte auszusprechen, fiel ihr schwer, weil sie immer daran denken musste, wie die Herzog bei ihrer ersten Probe zugeschaut und so laut gesagt hatte, dass alle es hören konnten: »Typbesetzt.«
Emily presste die Lippen aufeinander. Sie würde es ihr und allen anderen zeigen. Gleich. Gleich.
Nora Dernburg als ihre Nebenbuhlerin Hermia trat einen Schritt auf sie zu. »Gut! Zieht nur hin! Wer hindert Euch daran?«
Jetzt kam die Stelle, der sie seit ihrem Auftritt entgegengefiebert hatte. Jetzt. Jetzt.
Emily holte tief Luft, stürmte zwischen den Markierungen hindurch und bemerkte aus den Augenwinkeln die Irritation auf den Gesichtern ihrer Kollegen. »Ein töricht Herz, das ich zurück hier lasse«, rief sie aus, gab einem im Weg stehenden Busch einen Tritt, zerrte an einem als Ranke getarnten Seil und legte dabei alle Verzweiflung hinein, zu der sie fähig war.
Sie hatte Widerstand erwartet, aber das Seil gab nach. Emily ahnte mehr, als dass sie hörte, wie oben etwas aus seiner Verankerung ruckte. Aus zwölf Metern Höhe lösten sich zwei Scheinwerfer, die seit anderthalb Stunden glühten, rissen ihr das Seil aus der Hand und stürzten auf sie nieder.
Genau genommen stammte ihr letztes Wort nicht von Shakespeare. Es war auch weder tiefgründig noch poetisch. »Aber …«, brachte sie noch hervor, ehe die Scheinwerfer ihren Schädel zertrümmerten, ihre Haut verschmorten und ihre Hoffnungen unter sich begruben.
1
Montag, 24. – Mittwoch, 26. Mai 1926
Die Welt des Scheines, die man sich durch die furchtbare Wirklichkeit dieser Tage ursprünglich aus allen Angeln gehoben dachte, ist völlig unversehrt geblieben, sie ist eine Zuflucht geworden für die Daheimgebliebenen, aber ebenso für viele, die von draußen kommen und auch für ihre Seele Heilstätten suchten. Es hat sich gezeigt, dass sie nicht nur ein Luxusmittel für die Reichen und Saturierten, sondern ein Lebensmittel für die Bedürftigen ist.
Max Reinhardt, 1917
1
Würden kommende Generationen diese Zeit als die stabilen Jahre der Republik bezeichnen? Als Beginn einer Epoche des Friedens und relativen Wohlstands, weil die Hyperinflation gestoppt wurde und der durchschnittliche Verdienst eines Arbeiters wieder den Stand von vor dem Großen Krieg erreichte? Weil die französischen Besatzungstruppen mittlerweile auch die erste Rheinlandzone geräumt hatten, der Locarno-Pakt die Grundlage für eine Versöhnung mit den Westmächten schuf und die Aufnahme Deutschlands in den Völkerbund bevorstand?
Ein interessanter Gedanke. Ein Thema für das Philosophieseminar, das Hendrik jeden Donnerstag an der Universität abhielt: Grundprobleme der Erkenntnistheorie. Er versuchte, seine Umgebung mit den Augen eines Fremden zu betrachten, eines Zeitreisenden wie aus H. G. Wells‘ Roman.
Die Jahrmarktsstimmung im Volkspark Neukölln schien die These zu stützen. Trotz der Kälte nutzten viele Menschen den Pfingstmontag für einen Ausflug mit Familie. Buden boten Eis, Süßigkeiten oder heiße Würstchen an, Kinder mit Luftballons rannten über die Wiese, eine Musikkapelle der Kommunisten drehte fahnenschwenkend eine Runde und spielte dabei die Internationale, zum vierten Mal, wenn Hendrik richtig mitgezählt hatte. Da und dort versammelten sich übrig gebliebene Abordnungen vom zweiten Reichstreffen des Roten Frontkämpferbundes.
Gestern waren Hunderttausende hierher marschiert, um an den Kundgebungen teilzunehmen und Thälmann reden zu hören; heruntergerissene Fahnen und Abfallberge zeugten noch von dem gewaltigen Aufmarsch. Die Hugenberg-Presse hatte Mord und Totschlag vorausgesagt und den großen Pfingstschlag der Kommunisten prophezeit, der nicht ohne Blutvergießen ablaufen werde. Die Rechtsradikalen träumten offenbar immer noch von einem Aufstand der Arbeiter, den sie zum Vorwand nehmen konnten, um »für Ruhe und Ordnung zu sorgen« und sich selbst an die Macht zu putschen. In Wahrheit war der Aufmarsch friedlich verlaufen, die Schupos zu Pferd hatten nichts zu tun gehabt. Auch jetzt amüsierten sich die Leute, lachten und schwatzten, während ihre Kinder Fangen spielten oder nach einem Eis verlangten.
Würden die Menschen in hundert Jahren diese Zeit also als einen vielversprechenden Neuanfang sehen? Vielleicht gar von einer goldenen Ära sprechen, weil Kunst und Kultur eine nie da gewesene Qualität erreichten?
Lächerlich! Wer würde eine Zeit preisen, in der man jeden Tag damit rechnen musste, auf dem Weg zur Arbeit in eine handfeste Auseinandersetzung politischer Extremisten zu geraten? In der es rund zweieinhalb Millionen Arbeitslose gab, während die Industrie weiter rationalisierte? In der Attentate, Fememorde, Putschversuche zum Alltag gehörten? In der Unsicherheit und Zukunftsangst herrschten und man beim Einschlafen nicht sicher sein konnte, ob man am nächsten Morgen in derselben Republik erwachte?
Es sagte doch alles über dieses Land aus, wenn sich seine Bürger wenige Jahre nach dem Großen Krieg, dem schrecklichsten, der je geführt worden war, wieder von den gleichen Leuten wie damals am Halfterband führen ließen, indem sie Generalfeldmarschall Hindenburg, einen überzeugten Monarchisten und Miturheber der Dolchstoßlegende, als eine Art Ersatzkaiser zum Reichspräsidenten wählten. Den Gott all derer, die sich ins Philistertum zurücksehnen, wie ihn Harry Graf Kessler nannte. Oder, in den Worten von Bertold Brecht, in Anspielung auf Hindenburgs Ausspruch, die Bibel und das Exerzierreglement seien die einzige Lektüre seines Lebens gewesen: Am Endes des ersten Viertels im zwanzigsten Jahrhundert der Christenheit holten sie einen Mann in die Stadt und erwiesen ihm höchste Ehren, weil er noch nie ein Buch gelesen hatte.
Der überraschende Tod von Friedrich Ebert, Hindenburgs Vorgänger, kam einer Katastrophe gleich. Hendrik war gewiss kein Freund des Sozialdemokraten, er hatte nicht vergessen, wie Ebert immer wieder die Feinde der Republik gegen die Revolutionäre zu Hilfe rief, doch was man auch von ihm halten mochte, man musste ihm zugestehen, dass er sein Amt mit selbstlosem Einsatz und ehrlichem Bemühen um den Erhalt des Staates ausgeübt hatte. Sein Tod kam Hendrik wie ein Symbol vor, nicht nur, was den Niedergang der Republik betraf. Auch die Umstände schienen ihm symptomatisch zu sein, die zu lange hinausgezögerte Operation einer Blinddarm- und Bauchfellentzündung, weil Ebert sich gegen die Verleumdungen eines deutschvölkischen Zeitungsredakteurs wehren musste, der ihm im Zuge einer fortgesetzten Verunglimpfungskampagne Landesverrat vorwarf.
Auch sonst gab es nicht viel Anlass, von einem goldenen Zeitalter zu sprechen. Die Politische Polizei hatte Ende letzten Jahres einen Attentatsplan gegen Außenminister Stresemann aufgedeckt, betrieben von zwei Arbeitern nach dem Vorbild der Rathenau-Mörder. Das Schwein muss gekillt werden, hieß es in einem Brief, der den beiden zum Verhängnis wurde, unterzeichnet mit Heil und Sieg. War eine solche Einstellung wirklich überraschend, wenn etwa ein nationalsozialistischer Abgeordneter im bayerischen Landtag erklären konnte, er würde es begreifen, wenn ein Elsass-Lothringer Stresemann über den Haufen schießen würde?
Und das war nur die Spitze des Eisbergs. Jeden Monat gab es neue Enthüllungen über Fememorde aus dem Umfeld der Freikorps, Morde, die aufzuklären die Gerichte wenig Eifer bekundeten, weil sich dabei immer deutlicher die Umrisse einer Schwarzen Reichswehr abzeichneten, die illegal und im Geheimen, aber mit Unterstützung der eigentlichen Reichswehr als eine Art Reservearmee operierte. Weil die Gerichte bei der Aufklärung versagten, sollten jetzt Untersuchungsausschüsse Licht ins Dunkel bringen. Was dabei zutage trat, war dazu angetan, einen an diesem Land verzweifeln zu lassen. Die Schwarze Reichswehr wurde nicht nur finanziell von Industriellen unterstützt, es waren auch völkische Abgeordnete in die Machenschaften verwickelt, anscheinend sogar in die Fememorde.
Zudem hatte die Berliner Polizei Putschpläne reaktionärer Kreise aufgedeckt, die eine Diktatur anstrebten, in der der Pressezar Alfred Hugenberg das Amt des Finanzdirektors erhalten sollte. Manchmal fühlte sich Hendrik wie Diogenes von Sinope, der am helllichten Tag mit einer Laterne über den Marktplatz von Athen ging und ausrief: »Ich suche einen Menschen.«
Im Rest der Welt sah es leider nicht besser aus: In Italien behauptete sich Mussolinis Faschismus mit Massenverhaftungen und Geheimpolizei, in Portugal drohte ein Militärputsch, in Griechenland hatte General Pangalos die Regierungsgewalt an sich gerissen, in der Sowjetunion schien es auf einen Machtkampf zwischen Stalin und Trotzki hinauszulaufen, in Washington D.C. waren letztes Jahr über fünfzigtausend Männer und Frauen des Ku-Klux-Klan auf die Straße gegangen, um in aller Offenheit eine Parade abzuhalten.
»Woran denkst du?«, wollte Diana wissen, während sie sich bei Hendrik einhakte.
Die befremdeten Blicke der Passanten galten ihr, besser gesagt: ihrer Kleidung. Auch wenn er selbst mal wieder ein zerknittertes Hemd trug und seine Haare nach allen Richtungen abstanden, gegen ihre Aufmachung kam er nicht an. Sie trug einen kniefreien Rock, eine taschenbesetzte Jacke und einen Hut aus Samtband mit Federgesteck. Den Vogel schossen allerdings ihre Silberbrokatschuhe ab, die Schnallen mit bunten Steinen besaßen und mit Straußenfedern verziert waren.
Hendrik konzentrierte sich auf ihre Frage und erzählte ihr, was ihm durch den Kopf ging.
»Oh«, sagte sie nur.
Früher wäre sie auf dieses Thema sofort angesprungen. Früher hätte sie ihm einen Vortrag über Kapitalismus, den Kampf des Proletariats und internationale Solidarität gehalten. In letzter Zeit entlockte ihr die Aussicht auf ein politisches Wortgefecht nicht mal mehr ein müdes Lächeln.
»Was ist los?«, wollte er wissen.
»Nichts, ich bin nur müde.«
Es war nicht das erste Mal, dass sie ihm auswich. Hendrik fragte nicht nach. Er respektierte ihr Schweigen, obwohl es ihn traurig stimmte. Früher hätte sie ihm erzählt, was sie bedrückte. Als sie beide sich noch eine Wohnung teilten, hatten sie über alles miteinander gesprochen, in seltener Freimütigkeit. Aber er konnte natürlich nicht verlangen, dass sich durch ihre Heirat mit seinem Bruder nichts änderte.
Er musterte sie aus den Augenwinkeln. Sie hatte abgenommen, obwohl es bei ihr nicht viel zum Abnehmen gab. Ihre Fehlgeburt lag erst wenige Wochen zurück, und sie kämpfte immer noch mit Anflügen von Depression. Gregor ging es vermutlich nicht besser; Hendrik wusste, wie sehr sein Bruder sich Kinder wünschte. Als Diana endlich schwanger wurde, waren die beiden überglücklich gewesen. Der Verlust hatte sie hart getroffen.
Aber das war es nicht allein. Hendrik hatte seine eigene Theorie, warum Gregor und Diana in letzter Zeit so niedergeschlagen wirkten. Auf Dauer konnte es einfach nicht gut gehen, zu dritt in der kleinen Wohnung. Dianas Bruder war nicht gerade der umgänglichste Zeitgenosse. Michael Escher haderte mit seiner Verkrüppelung durch den Großen Krieg und neigte zu unkontrollierten Wutausbrüchen. Vor allem die fehlende Privatsphäre dürfte das Leben von Gregor und Diana belasten. Zwar beschwerten sie sich nie, aber sie mieden das Thema, und das verriet Hendrik genug.
»Wollen wir Gregor einen Besuch abstatten?«, schlug Diana vor.
»Arbeitet er etwa heute?«
»Er hilft, die Polizeiausstellung vorzubereiten. Das ganze Präsidium rotiert. Vielleicht macht er eine Pause, wenn wir kommen, und geht mit uns in ein Café.«
»Gute Idee.«
Feiertag hin oder her, auf den Straßen herrschte wie immer lebhafter Betrieb. Die Städte wurden dem gesteigerten Verkehrsaufkommen kaum Herr, überall gab es Staus, Unfälle nahmen zu. Die Zeitungen sprachen vom mörderischen Auto.
Hendrik und Diana entschieden sich, auf die Hochbahn zu verzichten und sich stattdessen eine Pferdedroschke zu leisten, solange es die noch gab. Sie drängten sich durch Gruppen von Arbeitern und Musikkapellen, deren Klänge von den Häuserwänden widerhallten, und winkten einem Kutscher.
Als sie eine halbe Stunde später am Polizeipräsidium am Alexanderplatz ausstiegen, kam ihnen Edgar Ahrens, Gregors Assistent, entgegen. »Wollen Sie zu Gregor?«, rief er ihnen zu. »Den haben Sie gerade verpasst. Er musste weg, im Deutschen Theater hat es eine Tote gegeben.«
Diana bekam leuchtende Augen. »Im Theater?«
»Ich muss auch dorthin. Soll ich Sie mitnehmen?«
»Unbedingt.«
Hendrik erhob keine Einwände. Alles, was mit der Welt des Theaters zusammenhing, faszinierte ihn. Daran war Josephine schuld, die ihn mit ihrer Begeisterung angesteckt hatte. Aber er wollte jetzt nicht an Josephine denken. Angeblich hatte sie einen neuen Verehrer. Einen Offizier, wenn man den Gerüchten Glauben schenken durfte. Nun, das ging ihn nichts mehr an. Vorbei war vorbei.
Sie stiegen in den Polizeiwagen. Diana setzte sich auf den Beifahrersitz, weil sie Edgar beim Fahren zusehen wollte. »Morgen habe ich einen Termin beim zuständigen Kreisarzt«, platzte sie heraus, »und sobald er mich für tauglich erklärt, nehme ich Fahrunterricht. Die Tochter von Hugo Stinnes plant eine Weltrundfahrt mit dem Auto, wussten Sie das? Das würde mich auch reizen.«
Während sie zur Schumannstraße fuhren, löcherte sie Edgar mit Fragen über die Tote im Theater, aber er wusste auch nicht mehr, als dass das Opfer eine Schauspielerin war, ein Fräulein Sydow, und man noch nicht sagen könne, ob es sich um einen Unfall oder einen Mord handelte.
Das Deutsche Theater lag in einem Hinterhof. Die drei betraten das Gebäude durch den Bühneneingang. An der Pforte erwartete Hendrik eine Überraschung.
»Shakespeare!«, rief er aus.
Der Mann in der Pförtnerloge zuckte zusammen. »Nennen Sie mich nicht so«, bat er, »die lachen mich sonst aus.«
»Verzeihung, ist mir so rausgerutscht. Diana, das ist Otto Drewitz. Herr Drewitz: Diana Lilienthal. Sie sind also wieder am Theater.«
»Ich sagte schon zu Ihrem Bruder, dass er mir Glück gebracht hat. Als ich mir damals die Schuhe vom Revier holte, traf ich auf dem Rückweg einen Kollegen, der hat mir die Stelle als Pförtner vermittelt.«
»Leider nicht als Schauspieler.«
»In diesen Zeiten muss man froh sein, überhaupt Arbeit zu haben. Und es ist ja nur übergangsweise. Vielleicht bekomme ich doch noch eine Rolle, immerhin sitze ich hier an der Quelle.«
Diana trat von einem Fuß auf den anderen und sah zur Tür; sie konnte es offenbar nicht abwarten, zum Tatort zu gelangen.
»Na, dann … Schön, Sie zu sehen«, verabschiedete sich Hendrik.
»Ihr Bruder ist in Ordnung«, rief Herr Drewitz ihm nach. »Er ist damals anständig mit mir umgegangen. Das kann man nicht von jedem Polizeibeamten behaupten.«
Hendrik und Diana wandten sich nach links und gingen aufs Geratewohl den Gang entlang, den Edgar vor ihnen genommen hatte.
»Wer war das?«, wollte Diana wissen.
»Erinnerst du dich noch an den Fall Ulf Weber? Damals, während der Inflation? Herr Drewitz war der Obdachlose, der sich die Schuhe des Toten genommen hatte.«
»Ach ja, du hast mir davon erzählt.«
An der ersten Abzweigung blieben sie stehen und rätselten, wohin Edgar verschwunden war. Menschen mit verstörten Gesichtern eilten an ihnen vorbei; Diana hielt einen Bühnentechniker im schwarzen Overall an und fragte nach den Herren von der Polizei. Der Mann schickte sie nach links ins Foyer. Die Saaltüren standen offen. Hendrik und Diana betraten den Zuschauerraum.
In den Sitzreihen hielten sich vereinzelt Personen auf, vermutlich Schauspieler und andere Beschäftigte des Theaters. Ein Mann hatte den Kopf in seinen Händen vergraben und schluchzte, ein Kollege kümmerte sich um ihn.
Auf der Bühne in einem unfertigen Bühnenbild, das wohl einmal ein Wald werden sollte, drängten sich die Experten der Polizei. Die Tote war noch nicht entfernt worden; ein Fotograf machte Aufnahmen von ihr, weitere Beamte untersuchten jeden Quadratzentimeter des Bühnenbodens.
Gregor stand vor der Bühne und gab seinem Assistenten Anweisungen. Wie immer wirkte er so förmlich, als befände er sich auf einer Jahresversammlung von Bestattungsunternehmern. Als er Hendrik und Diana entdeckte, runzelte er die Stirn. »Leichen ziehen euch an wie Motten das Licht, was?«, sagte er. Eine normale Begrüßung würde man von ihm auch in hundert Jahren nicht erwarten können.
»Guten Morgen, Gregor«, erwiderte Hendrik.
»Wir wollten dich im Büro besuchen«, fügte Diana hinzu und reckte sich in dem Versuch, einen Blick auf die tote Schauspielerin zu erhaschen.
»Soso.«
Hendrik beobachtete seinen Bruder und seine Schwägerin, um herauszufinden, ob bei ihnen der Haussegen schief hing. Dass sich Gregor in der Öffentlichkeit steif verhielt und den Eindruck erweckte, als kenne er Diana nur flüchtig, hatte nichts zu besagen. Es war weniger dem Umstand geschuldet, dass er sich als Polizeibeamter nüchtern geben musste, als vielmehr Ausdruck seines Charakters. Gleiches galt für die Tatsache, dass Diana mehr zu dem Mordfall hingezogen schien als zu ihrem Mann; es war ihrer Ruhelosigkeit geschuldet. Trotzdem meinte Hendrik, eine gewisse Spannung zwischen den beiden zu spüren.
Gregor wurde einer Erwiderung auf Dianas Bemerkung enthoben, weil ein Mann hereinpolterte, sich suchend umsah und auf ihn zustürmte. »Es war nicht meine Schuld«, rief er, »ich schwöre, ich habe alle Schrauben festgezogen.«
»Wer sind Sie?«
»Der Oberbeleuchter. Die Scheinwerfer waren korrekt verschraubt, das müssen Sie mir glauben, doppelt und dreifach gesichert. Alle gucken mich an, als hätte ich Fräulein Sydow auf dem Gewissen, aber ich schwöre …« Er bemühte sich, nicht zur Leiche hinüberzusehen, und doch wurde sein Blick immer wieder von der zusammengekrümmten Gestalt angezogen.
»Beruhigen Sie sich erst mal. Wir werden Sie später befragen, dann haben Sie Gelegenheit, sich ausführlich zu äußern. Bis dahin warten Sie bitte draußen.«
Ein Kollege zog ihn mit sich. »Komm schon«, sagte er, »jeder weiß doch, wie gründlich du bist.«
»Sie werden es mir anhängen«, widersprach der Beleuchter, »dann haben sie wenigstens einen Grund für den Rauswurf.« Mit einem letzten Blick auf die Tote schlich er davon.
Gregor drehte sich um, bemerkte den gestiegenen Lärmpegel im Zuschauerraum, die debattierenden Gruppen, den schluchzenden Mann. »Hatte ich nicht angeordnet, dass die Leute zu entfernen sind?«, rügte er seine Beamten. »Schafft alle raus, die hier nichts zu suchen haben.« Er sah Hendrik und Diana dabei an, als wollte er sagen: Auch die beiden da. Aber er sprach es nicht aus.
Die Polizisten machten sich an die Arbeit.
Diana war näher an die Bühne herangetreten, um die Leiche zu betrachten, und Hendrik, der eigentlich nichts dergleichen vorgehabt hatte, fühlte einen Zwang, ebenfalls hinzusehen.
Vermutlich hatte Fräulein Sydow den Kopf gehoben, als die Scheinwerfer herabstürzten, denn ihr Gesicht war übel zugerichtet und bis zur Unkenntlichkeit verbrannt, das Schädeldach zertrümmert. Man konnte nur hoffen, dass sie auf der Stelle tot gewesen war.
Ein weiterer Herr betrat den Zuschauerraum und steuerte auf Gregor zu. Er stellte sich als Edgar Licho vor, Direktor des Theaters. »Eine scheußliche Sache«, sagte er. »Schrecklich, dieser Unfall. Tragisch.«
»Ob es wirklich ein Unfall war, muss sich erst noch herausstellen.«
»Sicher war es einer, was soll es sonst gewesen sein? Ich meine, Sie können doch nicht andeuten wollen …« Er unterbrach sich und nahm Hendrik und Diana in Augenschein. »Sind Sie nicht das Pärchen, das den Mord im Zeppelin aufgeklärt hat?«
»Technisch gesehen, ja«, erwiderte Hendrik, »aber wir sind nicht –« Verheiratet, hatte er sagen wollen, doch Herr Licho ließ ihn nicht ausreden.
»Erfreut, sehr erfreut, Ihre Bekanntschaft zu machen.« Er schüttelte ihre Hände. »Das war eine außergewöhnliche Leistung, ganz außergewöhnlich. Ich habe die Zeitungsberichte geradezu verschlungen.«
Hendrik ließ ihn reden. Es hatte keinen Zweck, die Freundschaft zwischen Diana und ihm erklären zu wollen, das hatte er im Laufe der Zeit gelernt.
Edgar sprang von der Rampe und kam auf Gregor zu. »Die Ranke, also das Seil, an dem das Opfer gezogen hat, ist mit Karabinerhaken an beiden Scheinwerfern befestigt«, sagte er. »Es führt um den Handlauf der Beleuchterbrücke. Die betreffende Stelle wurde eingefettet, damit das Seil besser gleitet.«
»Also kein Unfall.«
»Sicher nicht.«
»Das ist doch nicht möglich«, rief Herr Licho aus. »Ein Mord, in meinem Theater?«
»Wir werden jeden, der hier arbeitet, befragen müssen«, sagte Gregor. »Bühne und Zuschauerraum sind derweil gesperrt. Das gilt für alle, ohne Ausnahme. Bitte unterrichten Sie Ihre Mitarbeiter.«
»Um Himmels willen, für wie lange denn?«
»Bis die Spurensicherung beendet ist.«
»Und die Vorstellung heute Abend?«
»Ich fürchte, die müssen Sie absagen. Wir sehen zu, dass Sie morgen im Verlauf des Tages Ihren Spielbetrieb wieder aufnehmen können.«
»Herrje! Herrje!« Direktor Licho raufte sich die Haare. Dann kam ihm ein Gedanke, und er wandte sich an Hendrik und Diana. »Werden Sie die Arbeit der Polizei unterstützen?«
Hendrik schüttelte den Kopf. »Ich unterrichte an der Universität. Und meine Schwägerin arbeitet für Max Planck.«
»Sicher können Sie sich ein paar Tage freinehmen.«
»Ich wollte damit sagen: Wir sind keine Kriminalbeamten.«
»Aber Sie haben einen guten Riecher. Ich wäre beruhigter, wenn Sie Ihre Fähigkeiten in den Dienst der Aufklärung stellen würden.«
»Mit Freuden«, fiel Diana ein. »Ich habe im Augenblick ohnehin bloß Fahnenkorrekturen zu lesen und Artikel zu übersetzen. Wenn Sie es wünschen, werden wir uns gern der Sache annehmen.« Sie vermied es, Gregor dabei anzusehen.
»Und ob ich das wünsche!«
Auch Hendrik musste zugeben, dass er diesmal weniger Abneigung verspürte als sonst, in einen Fall seines Bruders involviert zu sein. Reizte es nicht jeden, einmal hinter die Kulissen des Theaters zu blicken? »Nun ja, meine Vorlesungen finden nachmittags statt, insofern wäre ich zumindest vormittags und den einen oder anderen Abend frei.«
»Dann ist es abgemacht«, sagte Herr Licho. »Ihre Arbeit in Ehren, Herr Kommissar, ich möchte keinesfalls Ihre Fähigkeiten anzweifeln, aber sicher sind auch Sie über jede Hilfe dankbar, nicht wahr?«
Hendrik machte sich auf eine harsche Erwiderung seines Bruders gefasst. Gregors erster Impuls war Ablehnung, das war ihm deutlich anzumerken. Dann jedoch schien er sich anders zu besinnen. »Das ist eine hervorragende Idee«, erwiderte er mit sanfter Stimme. »Ich schlage vor, die beiden nehmen an den Proben zu Ihrem aktuellen Stück teil. Da sind sie hautnah am Geschehen und können herausfinden, was mir bei der Befragung möglicherweise verschwiegen wird.«
»Großartig!«, befand Herr Licho.
Hendrik unterdrückte ein Grinsen. Geschickt, Gregor, wirklich geschickt. Hautnah am Geschehen, was? Du glaubst, uns auf diese Weise aus dem Weg zu haben. An einem Ort, an dem wir keinen Schaden anrichten. An dem es ohnehin nichts zu entdecken gibt. Wir werden sehen, Gregor. Wir werden sehen.
2
»Da kommt ja unser Unglücksrabe«, murmelte Herr Licho.
Diana reckte den Kopf, um zu sehen, wen er meinte.
Der Beleuchter stand wieder in der Tür und starrte auf die Bühne.
Gregor winkte ihn zu sich. »Jetzt können wir uns unterhalten«, sagte er und deutete auf die erste Zuschauerreihe.
Willenlos sank der Mann auf einen Sitz. Er machte den Eindruck eines Menschen, der sich in jeder Schlange mit der Erwartung anstellt, dass alles schon vergeben ist, sobald er an die Reihe kommt.
»Wie heißen Sie?«
»Xaver Stöhr.«
»Sie haben die Scheinwerfer angebracht?«
Der Beleuchter nickte.
»Gab es dabei Probleme?«
»Nein.«
»Wann haben Sie die Schrauben und Sicherungsseile das letzte Mal überprüft?«
»Na, beim Einrichten, heute früh. Die waren alle in Ordnung, das schwöre ich.«
»Wenn ich herausfinde, dass Sie Mist gebaut haben …«, mischte sich Herr Licho ein.
»Was dann? Wollen Sie mich doppelt rauswerfen?«
Gregor hob die Hand, um eine Auseinandersetzung zu verhindern. »Heute erst haben Sie die Scheinwerfer angebracht?«, hakte er nach.
»Ja, auf Anweisung des Regisseurs. Er wollte ein paar Lichteffekte, Mondlicht durchs Geäst und so.«
»Wann hat er mit Ihnen darüber gesprochen?«
»Samstag. Er hat ziemlichen Druck gemacht, weil er sich die Wirkung heute während der Probe anschauen wollte.«
»Aha.« Gregor rieb sich das Kinn. »Was war das eben für eine Anspielung? Das mit dem Rauswurf, meine ich. Sie haben vorhin schon eine ähnliche Bemerkung gemacht.«
»Ich werde entlassen, zum Ende der Spielzeit. Acht Jahre habe ich mich für das Theater krumm geackert, und jetzt kriege ich einen Tritt.«
»Sie sind nicht der Einzige«, fuhr Herr Licho ihn an. »Sie kennen doch unsere Probleme.«
Gregor sah ihn fragend an.
»Die unsinnige Lustbarkeitssteuer ist schuld«, meinte der Direktor. »Anfang des Jahres haben wir einen Antrag gestellt auf Ermäßigung der Steuer für Theater, die mit Unterbilanzen arbeiten, vielleicht haben Sie in der Zeitung darüber gelesen. Der Magistrat hat abgelehnt. Also blieb uns nichts anderes übrig, als Kündigungen auszusprechen.«
»Auf dem Gebiet bin ich nicht bewandert, vielleicht können Sie mich aufklären. Lustbarkeitssteuer?«
»Fünfzehn Prozent auf alle Bruttoeinnahmen zuzüglich zwei Prozent Umsatzsteuer. Nur die staatlichen und städtischen Theater sind davon ausgenommen. Damit werden Privattheater steuerlich mit Bars und Nachtklubs in einen Topf geworfen. Absurd! Das Deutsche Theater wäre schon während der Inflation pleite gewesen, wenn Max Reinhardt nicht mit seinen Inszenierungen auf Auslandstournee gegangen wäre. Die harten Devisen haben es quasi subventioniert.«
»Kann man denn nichts dagegen unternehmen?«
»Edmund Reinhardt – der Bruder von Max und zugleich sein Verwaltungschef – versucht, den Theaterkonzern in eine gemeinnützige GmbH umzuwandeln und damit eine Befreiung von der Lustbarkeitssteuer zu erwirken. Der Magistrat mauert, aber wir haben die Unterstützung des preußischen Staates. Die Entscheidung steht kurz bevor.«
»Und wie immer wird alles auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen«, murrte Herr Stöhr.
»Sie haben doch keine Ahnung von unseren Problemen!«, raunzte Herr Licho ihn an, um anschließend mit seiner Erklärung gegenüber Gregor fortzufahren: »Die vergangene Spielzeit endete mit einem Defizit von dreißigtausend Mark, und das, obwohl Max Reinhardt keine Bezüge erhielt und die Heilige Johanna von Shaw ein großer Erfolg war. Die Forderung von Regiegagen und der Pachtzins fürs Deutsche Theater und die Kammerspiele beliefen sich auf über hunderttausend Mark, dazu kamen Steuerschulden von über siebzigtausend Mark, die im letzten Jahr mit fünfzehntausend Freikarten für Erwerbslose und Rentner abgegolten werden mussten. Wenn unsere Umstrukturierung nicht genehmigt wird, droht der Zusammenbruch.«
»Das ändert nichts an den Tatsachen«, grollte Herr Stöhr. »Die Leitung übernimmt sich, und die Kleinen zahlen die Zeche. So eine Gelegenheit wie diese«, er machte eine Kopfbewegung Richtung Bühne, »kommt Ihnen doch gerade recht, um mich mit Schmutz zu bewerfen.«
Der Mann ist verbittert, dachte Diana. Wäre es denkbar, dass er einen Zwischenfall provozieren wollte, um das Theater in Misskredit zu bringen? Nein, das ist wohl zu weit hergeholt. Sicher würde er keinen Unfall mit tödlichem Ausgang riskieren, nur um dem Theater eins auszuwischen. Außerdem würde es als schlampige Arbeit gelten und auf ihn zurückfallen. Und damit nachträglich die Entscheidung der Leitung rechtfertigen. Andererseits … Er könnte sich in einer Stimmung befunden haben, in der ihm alles egal war. Und man weiß nie, wozu ein Mensch fähig ist, der in die Enge getrieben wurde.
3
Gregors Blicke auszuhalten, war nie einfach, erst recht nicht, wenn man sich schuldig fühlte. Diana hätte sich Hendrik anschließen können, der Herrn Licho folgte, um mit dem Ensemble bekannt gemacht zu werden, dann müsste sie sich jetzt nicht den stummen Vorwürfen ihres Mannes aussetzen. Doch sie wollte unbedingt an der Befragung der Zeugen teilnehmen.
»Ich weiß, du bist verärgert«, sagte sie, als sie das Schweigen nicht länger aushielt, »aber ich bin dankbar, wenn sich mein Verstand zur Abwechslung mit etwas anderem beschäftigen kann, als mit … mit …« Sie biss sich auf die Lippen. »Ich brauche die Ablenkung, verstehst du das nicht?«
In Gregors Gesicht arbeitete es. Dann schlug er die Augen nieder. »Hol mir den Regisseur her«, sagte er mit rauer Stimme. »Wir werden die Befragung im Zuschauerraum vornehmen. Auf den hinteren Sitzen sind wir einigermaßen ungestört.«
Diana beeilte sich, seiner Aufforderung nachzukommen. Sie fühlte sich mies. Wie konnte sie nur das Schrecklichste, das ihnen beiden widerfahren war, als Ausrede benutzen? Wie konnte sie nur an seinen Schmerz rühren, aus keinem anderen Grund als dem, dass er sich wie ein Schuft vorkommen musste, würde er ihr die Teilnahme an der Untersuchung verweigern? Erst auf dem Weg zu den Saaltüren merkte sie, dass es gar keine Ausrede war. Sie brauchte die Ablenkung. Verzweifelt.
Es wäre ein Mädchen geworden, hatte der Arzt gesagt. Sie sollte Marianne heißen, nach ihrer Schwester. Wäre es ein Junge geworden, hätten sie ihn Michael genannt. Als Diana im fünften Monat zu bluten anfing, mitten auf der Straße, als sie die Blutlache unter sich sah und wusste, dass ihr Kind tot war, ihr Kind, für das sie bereits Kleider und Spielzeug gekauft, dem sie Lieder vorgesungen hatte, ihr Kind, das längst Teil ihres Lebens gewesen war und nun auf einen Schlag fortgerissen wurde, als all das im Bruchteil eines Atemzuges geschah, war eine Leere in ihr zurückgeblieben, die sich durch nichts füllen ließ.
Niemand hat dich je gesehen, dachte Diana. Niemand hat je deine Stimme gehört. Welche Augenfarbe hättest du gehabt? Wie hätte dein Lächeln ausgesehen? Es ist nicht gerecht! Du hast nie die Chance gehabt, die Sonne auf deiner Haut zu spüren oder den Wind. Ich hätte dir so gern erklärt, woher der Regen kommt und warum der Himmel blau ist. Ich hätte dich so gern in meinen Armen gewiegt. Für andere warst du nicht wirklich, aber ich, ich habe dich in mir gespürt, ich weiß, dass es dich gab, dass du geboren werden wolltest. Warum bist du von mir gegangen, bevor ich dich kennenlernen durfte?
Diana grub die Fingernägel in ihre Handballen, um Schmerz mit Schmerz zu bekämpfen, öffnete die Saaltür und betrat das Foyer.
Ein Mann und eine Frau standen am Fenster und sprachen erregt miteinander. So vertieft waren sie in ihr Gespräch, dass sie Diana zunächst nicht kommen hörten. Die Frau trug eine Wasserwellenfrisur und sah aus wie jemand, der nie satt wird, sondern mit jedem Bissen hungriger. Der Mann hingegen erweckte den Eindruck, als würde er aus jeder Rolle Siegfried, den Drachentöter, machen, selbst aus Cyrano de Bergerac.
»Glaubst du im Ernst, ich würde dir so etwas antun?«, fragte er gerade.
»Es käme dir gelegen, nicht wahr?«, erwiderte die Frau.
Sobald sie Diana wahrnahmen, verstummten sie. Diana nickte ihnen zu und ging weiter, als hätte sie nichts gehört, doch in Gedanken versuchte sie, die Sätze einzuordnen. Glaubst du im Ernst, ich würde dir so etwas antun? Irgendwie hatte es geklungen, als beziehe er sich dabei auf die Tote. Wie kam sie darauf? Es musste an der Stimme liegen, an der Art der Betonung. Oder interpretierte sie etwas hinein? Es war die Kopfbewegung, begriff sie. Der Mann hatte seinen Kopf Richtung Bühne gedreht, als er »so etwas« sagte.
Wer waren die beiden? Gehörten sie zum Ensemble? Als eifrige Theaterbesucherin kannte Diana die meisten Schauspieler, aber dieses Paar war ihr unbekannt. Sie musste unbedingt Gregor von dem, was sie da aufgeschnappt hatte, berichten.
Auf dem Weg zur Pforte fragte sie jeden, der ihr begegnete, nach dem Regisseur, und fand ihn schließlich nahe der Pförtnerloge, wo er auf einen anderen Mann einredete.
»Schaffen Sie mir die Auer ran, die muss einspringen. Treiben Sie sie auf, egal wie, aber bringen Sie sie her, zack zack!«
Der Angesprochene machte den Eindruck, als würde er selbst bei einer Revolution eine Teilnehmerliste führen und unterwegs für Erfrischungen sorgen. Vermutlich der Hilfsregisseur. Nickend eilte er davon.
»Sind Sie der Regisseur?«, erkundigte sich Diana. »Der Kommissar möchte sie sprechen. Im Zuschauerraum.«
Der Mann hob die Hände und ließ sie wieder fallen, um seinen Unmut auszudrücken, folgte ihr aber anstandslos. Er kam ihr vor wie jemand, der gelesen hat, dass Genies oft Widerlinge seien, und sich seither wie ein Widerling verhält in der Annahme, dadurch automatisch zum Genie zu werden.
Gregor hatte den Vorhang schließen lassen, sodass die Tote und die Spurensicherer nicht zu sehen waren, und sich in die letzte Reihe gesetzt. Mit einer Kopfbewegung bat er Diana und ihren Begleiter, Platz zu nehmen. »Gregor Lilienthal, Kriminalpolizei«, stellte er sich vor.
»Magnus Terboven.«
»Sie sind der Regisseur des Stückes, das heute geprobt wurde?«
Herr Terboven nickte.
»Am besten, Sie erzählen mir zunächst mal, was genau Sie hier tun und was die Aufgabe der Toten dabei war.«
»Wir proben den Sommernachtstraum von Shakespeare. Premiere ist in anderthalb Wochen, verdammt! Wie soll ich das bloß schaffen? Das Kostüm muss geändert werden, die Maske. Und die Auer wird wieder anfangen, über Striche zu diskutieren …«
»Sie sind verärgert über die verlorene Zeit?«
»Was denn sonst?« Dann schien Herr Terboven zu begreifen, dass Gregors Frage noch etwas anderes implizierte. »Natürlich tut es mir leid wegen Emily. Aber das macht sie auch nicht wieder lebendig.«
»Sie war Schauspielerin?«
»Sie spielte die Rolle der Helena, das ist – kennen Sie den Sommernachtstraum?«
Gregor verneinte.
»Das Stück spielt auf drei Ebenen. Es gibt die Elfenwelt, es gibt Handwerker, die ein Stück zur Hochzeit ihres Herrschers aufführen wollen, und schließlich gibt es noch zwei in Liebeswirren miteinander verstrickte Paare. Eigentlich ein Paar und zwei unglücklich Verliebte, aber egal. Emily –«
»Sydow, sagte man mir, ja? Emily Sydow.«
»Ganz recht. Sie spielte eine der Frauen der Liebeshandlung.«
»Erzählen Sie mir, was Sie beobachtet haben, als das Unglück geschah.«
»Es war eine normale Probe, und plötzlich stürmte Emily nach vorn und riss an der Ranke, das dumme Ding. Was hat sie sich bloß dabei gedacht?«
»Es gehörte nicht zu ihrer Rolle?«
»Natürlich nicht. Es war eine Eigenmächtigkeit, die überhaupt nicht passte. Aufgesetzt. Furchtbar. Helena ist eine Naive, die still vor sich hin leidet, und kein Racheengel. Ich hätte ihr diese unsinnige Reaktion ausgeredet. Das Rütteln gehört zu Frau Dernburgs Spiel, ein paar Zeilen später. Frau Dernburg spielt die Hermia, die glaubt, sie wird verspottet, und vor Wut an den Ranken reißt, die ihr den Weg versperren, so haben wir es geprobt.« Er runzelte die Stirn. »Wenn es sich wirklich um einen Mordanschlag handeln sollte, wie überall erzählt wird, galt er unzweifelhaft ihr. O mein Gott, dann ist das Ganze womöglich noch nicht ausgestanden!«
Diana begriff. »Frau Dernburg – ist das die mit der Wasserwellenfrisur?«
»Ja, Nora Dernburg.«
»Und wer ist der blonde Schönling, mit dem ich sie vorhin gesehen habe?«
»Ich nehme an, Sie sprechen von Peer Fischer, der den Lysander spielt. Außerdem ist er …« Er stockte. »… ihr Ehemann«, vollendete er langsam.
Diana hätte darauf gewettet, dass er ebenfalls Gedanken darüber anstellte, dass es dem Schauspieler »gelegen käme«, wäre seine Frau an Emilys Stelle erschlagen worden. Gregor warf ihr einen fragenden Blick zu. Sie musste ihm erzählen, was sie mitangehört hatte. Aber nicht vor fremden Ohren.
»Arme Emily«, sinnierte Herr Terboven. »Ausgerechnet sie muss es treffen, die nun wirklich keiner Fliege etwas zuleide tun konnte. Dazu wäre sie gar nicht in der Lage gewesen.«
»Wie meinen Sie das?«
»Na ja, sie war … schlicht. Deshalb habe ich sie ja für die Rolle ausgewählt. Helena ist von eher schlichtem Gemüt, weil sie – ach, das sind künstlerische Fragen.« Er machte eine wegwerfende Handbewegung, die so viel bedeutete wie: Das begreifen Sie ohnehin nicht.
»Also, noch mal, damit ich das richtig verstehe«, sagte Gregor. »Frau Dernburg war diejenige, die laut Inszenierung an der Ranke zerren sollte. Und Fräulein Sydow kam ihr heute eigenmächtig und zum ersten Mal zuvor?«
Der Regisseur nickte.
»Hat sie so etwas öfter gemacht? Sie sagen, es passte überhaupt nicht zu ihrer Rolle …«
»Sie war keine begnadete Schauspielerin, um ehrlich zu sein. Und das wusste sie auch, deshalb hat sie ständig nach Äußerlichkeiten gesucht, nach theatralischen Ausbrüchen, wildem Gestikulieren, Geschrei. Ich hab’ sie immer machen lassen und es ihr anschließend weggenommen und durch ein dezenteres Spiel ersetzt. Das funktionierte. Wenn man ihr klare Anweisungen gab, kam durchaus etwas Brauchbares dabei heraus.«
»Wäre es nicht besser gewesen, von vornherein jemand anderen zu besetzen?«
»Wie ich schon sagte: Sie war der ideale Typ für die Rolle. Wenn sie mit den Anlagen gearbeitet hätte, die sie besaß, statt ständig etwas anderes zu wollen …« Er unterbrach sich, weil der junge Mann, mit dem er vorhin auf dem Gang gesprochen hatte, den Zuschauerraum betrat, sich suchend umsah und auf ihn zukam. »Und?«, rief Herr Terboven.
»Zu Hause ist sie nicht.«
»Dann suchen Sie weiter, verdammt noch mal.«
»Natürlich. Ich wollte nur fragen, ob ich den Elfen Bescheid geben soll, dass die Probe ausfällt. Wir könnten die morgen ansetzen, anstelle der Liebespaare.«
»Sind Sie verrückt? Die Umbesetzungsproben haben Vorrang. Streichen Sie alles andere, setzen Sie nur die Liebespaare auf den Probenplan. Muss ich denn alles selber machen?«
»Ich dachte, wir sollten Herrn Dahrendorf schonen, wenigstens einen oder zwei Tage.«
»Das Denken überlassen Sie gefälligst mir. Die Produktion muss weitergehen. Schaffen Sie mir die Auer ran, aber ein bisschen plötzlich!«
Eingeschüchtert trabte der junge Mann davon.
»Wer war das?«, wollte Gregor wissen.
»Jobst Lüders, mein Hilfsregisseur. Eher Last als Hilfe.«
»Und wer ist Herr Dahrendorf?«
»Bernward Dahrendorf, Emilys Verlobter. Er spielt den Demetrius.«
Gregor machte sich Notizen. »Noch einmal zu den Scheinwerfern. Sie haben die Einrichtung kurzfristig angeordnet, ist das richtig?«
»Ich wollte ein paar Lichteffekte ausprobieren.«
»Wussten die Schauspieler davon?«
»Keine Ahnung.«
»Sie haben es Ihnen nicht gesagt?«
»Wozu? Man darf Schauspieler nicht mit Dingen behelligen, die nichts mit ihrer Rolle zu tun haben.«
»Und die Ranke?«
»Die ist normalerweise an der Brüstung der Beleuchterbrücke befestigt, nicht an irgendwelchen Scheinwerfern.«
»Hm.« Gregor blätterte in seinen Notizen. Es wirkte zerstreut, aber Diana wusste, dass er alles andere als das war. »Entschuldigen Sie, wenn ich insistiere, aber ich möchte diesen Punkt vollkommen klar haben: Keiner von den Schauspielern wusste von den Scheinwerfern?«
Herr Terboven zuckte die Achseln. »Vielleicht hat jemand mitbekommen, wie ich mit dem Oberbeleuchter darüber sprach. Es war ja kein Geheimnis.«