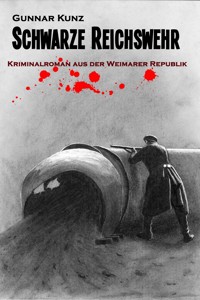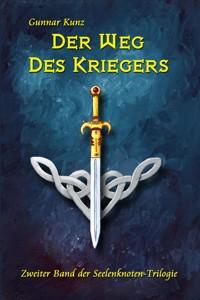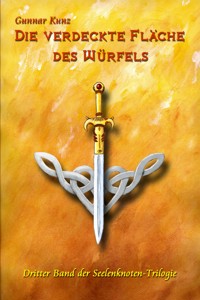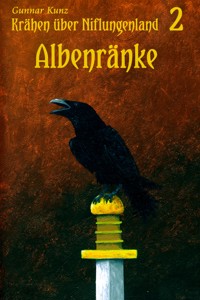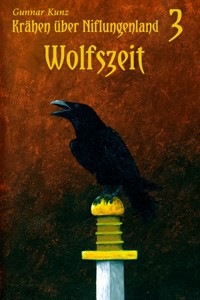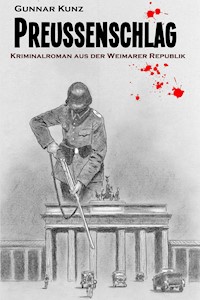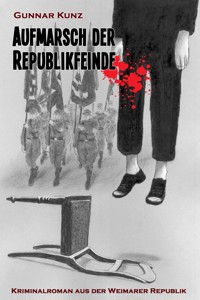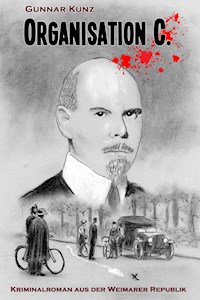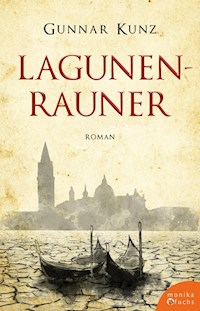8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kriminalroman aus der Weimarer Republik
- Sprache: Deutsch
Berlin, 1933. Hitler ist an der Macht, der Reichstag brennt, jüdische Geschäfte werden boykottiert. Kommissar Gregor Lilienthal, unterstützt von seiner Frau Diana und seinem Bruder Hendrik, ist mit der Aufklärung mehrerer Morde beschäftigt. Seine Ermittlungen sind den neuen Machthabern allerdings ein Dorn im Auge, weil sie in eine Richtung führen, die ihnen nicht gefällt. Gregors Arbeit wird denn auch nach Kräften behindert, zudem muss er ertragen, dass ihm ein alter Widersacher vor die Nase gesetzt wird. Schon bald wird offenbar, dass mit dem Aufbau einer Geheimen Staatspolizei und der Errichtung von Konzentrationslagern niemand mehr vor staatlicher Willkür sicher ist. Und als Hendrik die Wahrheit über den Reichstagsbrand herausfindet, eskaliert die Situation.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 368
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Gunnar Kunz
Gleichschaltung
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Gleichschaltung
Prolog: Samstag, 18. Februar 1933
1
2
3
Epilog
Nachwort
Empfehlenswerte Literatur zum Thema
Weitere Bücher aus der Serie:
Impressum neobooks
Gleichschaltung
Kriminalroman aus der Weimarer Republik
von Gunnar Kunz
Impressum:
Copyright 2025 by Gunnar Kunz, Berlin
Tel. 030 695 095 76
E-Mail über www.gunnarkunz.de
Alle Rechte vorbehalten
Einbandgestaltung: Rannug
Dieses E-Book, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne Zustimmung des Autors nicht vervielfältigt, wieder verkauft oder weitergegeben werden. Danke, dass Sie die Arbeit des Autors respektieren!
Prolog: Samstag, 18. Februar 1933
Wenn Wilbert Schiele etwas hasste, dann Schlamperei. Nicht umsonst war er stolz darauf, in den siebzehn Jahren seiner Tätigkeit als Dienstmann bei der Gepäckabfertigung im Bahnhof Stettin – Hauptbahnhof Stettin, wie er zu betonen pflegte – stets für eine korrekte Übergabe aufgegebener Gepäckstücke gesorgt und nie Anlass zur Beanstandung gegeben zu haben. Andere hingegen nahmen es offenbar mit ihrer Arbeitseinstellung nicht so genau.
Seit fast drei Wochen ärgerte er sich über den Reisekorb, der nicht abgeholt wurde und überall im Weg stand, mehr noch über den Kollegen in Berlin, der die Begleitpapiere schludrig ausgefüllt hatte. Der Korb war mit dem letzten Zug hierher aufgegeben worden, vermutlich hatte es der Kollege eilig gehabt, in den Feierabend zu kommen. Typisch! In der Großstadt glaubten sie immer, sich Nachlässigkeiten erlauben zu können. Sollten sich doch die Provinzbeamten mit dem Ergebnis herumschlagen!
Vor Wut kaute Wilbert auf dem Mundstück seiner kalten Pfeife herum. Arrogantes Pack! Versah er etwa seinen Dienst schlampig? Nein. Pflichtbewusst kam er zur Arbeit, obwohl er seit einer Woche mit einem veritablen Schnupfen herumlief, bei der Kälte und seinem zugigen Quartier kein Wunder. Stets füllte er jeden Abschnitt der Gepäckscheine penibel aus, auch wenn es die Reisenden eilig hatten. Ihr Problem, wenn sie erst in letzter Minute anrauschten! Er kontrollierte sogar den Zustand der Koffer und Reisetaschen, damit es nicht etwa hinterher Beschwerden gab, wenn ein Gepäckstück bei der Rückgabe auseinanderfiel. Und was hatte er nicht schon alles verschickt! Eine Drehorgel, ein komplettes Porzellanservice, Ersatzteile für einen Zeppelin, einmal sogar eine Ringelnatter. Solange der Fahrgast eine gültige Fahrkarte vorweisen konnte und die Fracht ordnungsgemäß bezahlte oder die Begleitpapiere von ankommendem Gepäck vollständig und korrekt ausgefüllt waren, kümmerte ihn der Inhalt nicht. Aber nun dies!
Zum wiederholten Mal überprüfte er die Packmeisterkarte, als hätte sich in der Zwischenzeit irgendetwas daran geändert. Zugnummer, Datum, Versand- und Empfangsstation waren nur mühsam zu entziffern, die Frachtkosten mehrfach durchgestrichen und korrigiert, das Gewicht – fünfundsechzig Kilo – an einer falschen Stelle hingeschmiert worden, der Beförderungsweg fehlte zur Gänze. Großstadtpfuscher!
Wieder biss Wilbert auf das Mundstück seiner Pfeife, nieste und warf dem Reisekorb einen bösen Blick zu. Was dachten sich eigentlich Fahrgäste, ihr Gepäck wochenlang nicht abzuholen? Das hier war eine Gepäckstation, kein Gerümpellager! Er ging neben dem Korb in die Hocke und betrachtete den Beklebezettel, der genauso schlampig ausgefüllt war wie die Packmeisterkarte. Den Namen des Besitzers musste man erraten. Der würde schön blechen müssen, denn inzwischen war ein ordentliches Sümmchen an Lagergeld zusammengekommen. Aber Wilbert bezweifelte, dass der Besitzer überhaupt noch auftauchte.
Gepäck, das vierzehn Tage lang nicht abgeholt wurde, galt als unanbringlich; Wilbert hatte also das Recht, es zu öffnen und den Inhalt festzustellen. So etwas tat er nicht gern, hatte es in seinem Berufsleben auch erst wenige Male machen müssen. Es kam ihm nicht korrekt vor. Andererseits drang ein unangenehmer Geruch aus dem Korb, den er selbst durch seine verstopfte Nase wahrnahm; möglicherweise handelte es sich um verderbliche Ware. Und er hatte keine Lust, sich tagelang dem Gestank von ranzigem Käse oder vergammelter Wurst auszusetzen.
Unschlüssig drehte Wilbert das Vorhängeschloss, mit dem der Korb gesichert war, in seiner Hand. Dann erhob er sich fluchend, ging zum Werkzeugschrank und entnahm ihm ein Stemmeisen, auf Großstädter im Allgemeinen und den Fahrgast im Besonderen schimpfend. Er brauchte mehrere Anläufe, bis das Schloss seinen Anstrengungen nachgab. Wilbert legte das Werkzeug beiseite und öffnete den Korb. Der unangenehme Geruch wurde stärker. Ein graues Sacktuch verbarg den Inhalt. Wilbert schlug es auf.
Mit einem Würgelaut wich er zurück und versuchte vergeblich, seinen Mageninhalt bei sich zu behalten.
Im Reisekorb befand sich eine Leiche ohne Kopf.
1
Sonntag, 19. Februar – Donnerstag, 23. März 1933
Die Ereignisse von 1933 bis 1945 hätten spätestens 1928 bekämpft werden müssen. Später war es zu spät. Man darf nicht warten, bis der Freiheitskampf Landesverrat genannt wird.
Erich Kästner
1
Wenn man die Berliner bei ihrem sonntäglichen Wintervergnügen beobachtete, mochte man meinen, nichts hätte sich durch die Ernennung Hitlers zum Reichskanzler geändert. Kinder sausten jauchzend auf ihren Schlitten die Rodelbahn am Kreuzberg hinunter, ihre Eltern standen am Rand, sahen dem Treiben belustigt zu und unterhielten sich, Würstchenverkäufer boten ihre Ware feil, als sei alles wie immer. Für ihr Privatleben traf das wohl auch zu. Außer vielleicht für die Schüler, die damit rechnen mussten, künftig wieder der Prügelstrafe zu unterliegen, nachdem der Reichskommissar für das preußische Unterrichtsministerium einen Erlass herausgegeben hatte, der darauf hinauslief, einen Lehrer, der »sich in seinen erzieherischen Maßnahmen vergriffen hat«, gegen ein Einschreiten seiner Aufsichtsbehörde zu schützen. Es war bereits abzusehen, dass die Nationalsozialisten vorhatten, das gesamte Bildungssystem ihren Vorstellungen gemäß umzubauen. Dann würde Nietzsches Befund umso mehr zutreffen: Erziehung: wesentlich das Mittel, die Ausnahme zu ruinieren zugunsten der Regel.
Hendrik bemühte sich, seine düsteren Gedanken zu verscheuchen, als er sich abstieß, um mit seiner Nichte die Bahn hinunterzurodeln. Lissi quietschte vor Begeisterung und schrie den anderen Kindern Worte zu, die im Wind verwehten. Die Fahrt beanspruchte Hendriks volle Konzentration, weil er oft gegensteuern musste, um niemandem ins Gehege zu kommen.
Unten angelangt sprang Lissi vom Schlitten und hüpfte auf und nieder. »Hast du gesehen, wie schnell wir waren?«, schrie sie. »Hast du gesehen?« Ihre Wangen waren gerötet, ihre Augen glänzten.
Hendrik musste lächeln. Die Begeisterung seiner Nichte ließ ihn für den Moment seine Sorgen vergessen. Er nahm die Leine des Schlittens auf, um ihr Gefährt den Berg hinaufzuziehen.
Lissi ergriff seine Hand und hopste neben ihm her. »Noch ganz viele Montage und Dienstage, dann komm’ ich in die Schule«, erklärte sie ihm.
»Freust du dich darauf?«
Lissi nickte. »Da lern’ ich lesen. Dann kann ich alle Bücher selbst lesen, die Mama mir vorliest.«
Ein bisschen würde es schon noch dauern, schließlich wurde seine Nichte im Juli erst fünf. Aber Hendrik wollte ihr die Vorfreude nicht nehmen, deshalb erwiderte er nichts.
Oben nahm ihm Lissi die Leine aus der Hand. »Jetzt fahr’ ich alleine«, sagte sie.
»Sicher?«
Sie nickte. »Ich bin schon groß.«
»Das stimmt.« Hendrik sah zu, wie sie sich auf den Schlitten setzte und mit einem Schrei davonschoss, und gesellte sich zu seinen Freunden.
Sie hatten sich auf dem Kreuzberg getroffen, weil er zentral gelegen war: Hendrik mit seiner Frau Josephine, sein Bruder Gregor und Diana, die ihrer Tochter nachsahen, Simon Weinstein, der Polizeichemiker, der Schauspieler Henning Voss, mit dem Hendrik eine Freundschaft verband, und Bettina Koenig, eine ehemalige Literaturstudentin, die Diana während ihrer Studienzeit im Bus kennengelernt hatte, mit ihren beiden Jungen, die sich mit ihren sechs und sieben Jahren zu alt dünkten, um gemeinsam mit Lissi zu rodeln. Der Ältere der beiden spielte ohnehin lieber mit seinem Jo-Jo, dem letztjährigen Schlager der Spielwarenindustrie. Beide trugen Mäntel mit Knöpfen auf den Ärmeln, damit sie sich nicht daran die Nasen putzten. Gerade traf auch Edgar Ahrens, Gregors Assistent im Polizeipräsidium, ein und begrüßte die anderen.
»Wo sind deine Frau und dein Sohn?«, wollte Gregor wissen.
»Zu Hause. Denen ist es zu kalt.«
Sie sprachen zunächst über die Grippewelle, die Berlin heimsuchte, und das Revolverattentat auf US-Präsident Roosevelt, ehe sich das Gespräch unweigerlich den aktuellen politischen Ereignissen in Deutschland zuwandte.
»Wie, denkt ihr, werden die Neuwahlen ausgehen?«, wollte Edgar wissen.
»An der Zusammensetzung des Kabinetts wird sich nicht viel ändern«, vermutete Josephine.
»Glaube ich nicht«, warf Gregor ein. »Hitler hat jetzt die Autorität Hindenburgs im Rücken. Das wird ihm zusätzliche Stimmen einbringen.«
»Aber nicht genug«, sagte Simon. »Jedenfalls nicht genug, um ihm die absolute Mehrheit zu verschaffen und vom Parlament unabhängig zu machen. Darum geht es ihm doch. Der vorgeschobene Grund, eine konstruktive Arbeit sei nicht möglich gewesen, ist lächerlich. Das Zentrum wäre prinzipiell bereit gewesen, die Regierung zu unterstützen. Nur ein bedingungsloses Ermächtigungsgesetz wollen sie sich nicht abringen lassen.«
»Immer wieder dieselben Methoden«, entfuhr es Hendrik. »Das Parlament nach Hause schicken und Neuwahlen ansetzen. Der alte Reichstag ist doch gerade mal eine Handvoll Wochen im Amt, der hatte doch gar keine Gelegenheit, Anlass zu seiner Auflösung zu geben. Wie viele Wahlen haben wir in den paar Jahren seit dem Ende des Kaiserreichs gehabt? Zwanzig? Einundzwanzig? Die ständige Wählerei zermürbt das Volk wie der Stellungskrieg in den Schützengräben die Soldaten zermürbt hat. Wenn der Regierung die Entscheidung der Wähler nicht passt, muss eben neu gewählt werden, so lange, bis das Ergebnis den Herrschaften genehm ist.«
»Als Hitlers Vorgänger Neuwahlen angesetzt hatten, haben die Nazis das vehement kritisiert. Jetzt, wo sie an der Macht sind, treiben sie dasselbe Spiel«, stimmte Diana ihm zu.
»Das ist nichts gegen den Verfassungsbruch, den sie in Preußen begehen«, sagte Gregor.
Hendrik musste ihm recht geben. Der Antrag der Nationalsozialisten, auch den preußischen Landtag neu zu wählen, war eigentlich abgeschmettert worden. Das verantwortliche preußische Dreimännerkollegium aus NS-Landtagspräsident Kerrl, SPD-Ministerpräsident Braun und Staatspräsident Adenauer vom Zentrum hatte mit zwei zu eins dagegen gestimmt. Woraufhin Hindenburg kurzerhand alle Befugnisse des Landes auf Papen als Reichskommissar Preußens übertragen und somit Otto Braun ausgeschaltet hatte, mit dem erwünschten Ergebnis. Trotz des Urteils des Staatsgerichtshofs im vergangen Jahr, das die Kompetenzen zwischen Reich und Land eindeutig regelte. Damit hatte sich das Regime endgültig von jedem Anschein von Recht und Gesetz verabschiedet. Wenn es möglich war, das Urteil des Staatsgerichtshofs für ungültig anzusehen, gab es in Deutschland keinerlei Rechtssicherheit mehr. Das Vorgehen war nichts weiter als ein neuerlicher Staatsstreich.
»Ich würde nicht gleich so schwarz sehen«, warf Bettina Koenig ein. »Gebt Hitler doch etwas Zeit. Er ist ja kaum drei Wochen an der Macht. Bis jetzt hat er ziemlich moderat regiert. Nichts von dem, was zu erwarten war, ist eingetreten: Die KPD ist nicht verboten, die Juden werden in Ruhe gelassen … Seine Rundfunkansprache fand ich gar nicht schlecht. Er will die Einheit des Volkes wiederherstellen, hat er gesagt. Das klingt nicht nach einem Krieg gegen seine Gegner, oder? Lasst uns doch erst mal abwarten, was der Mann kann.«
»Gesetze brechen«, erwiderte Diana hitzig. »Hast du es nicht gehört? ›Diese Wahlen werden die letzten sein‹, hat Hitler gesagt.«
»Das sind doch bloß Gerüchte.«
»Sind es nicht. Auch Frick hat deutlich gemacht, dass die Nazis nicht gewillt sind, ›das Feld freiwillig zu räumen‹.«
»Was die Nazis wollen, ist das eine«, sagte Simon Weinstein. »Was sie bekommen, steht auf einem anderen Blatt. Genau genommen war Hitlers Ernennung zum Reichskanzler der schlaueste Schachzug Papens, um ihn kaltzustellen. Mit drei jämmerlichen Ministerposten ist Hitler der Gefangene seines Kabinetts. Seine Bundesgenossen werden ihn zähmen.«
Hendrik schnürte es die Kehle zu. Genau so hatte Legationsrat Diehl damals im Zeppelin in Bezug auf den Attentäter argumentiert, der verhindern sollte, dass der LZ 126 seinen Bestimmungsort erreichte: Dass man manchmal eben jemanden fürs Grobe brauche, dessen man sich bedienen und dessen Kampfgeist man in die richtige Richtung lenken müsse. Es hatte schon damals nicht funktioniert. Man kann Menschen, die sich an keine Verhaltensnormen gebunden fühlen, nicht zähmen!
»Außerdem ist da immer noch Hindenburg«, sagte Bettina Koenig, »der wird das Schlimmste verhindern. An ihm beißt sich Hitler die Zähne aus.«
»Womöglich ist es gar nicht nötig, Hitler zu zähmen«, fiel Henning Voss ein. »Glaubt ihr im Ernst, der wird all das, was er so großsprecherisch von sich gegeben hat, auch umsetzen? Das war doch bloß Wahlpropaganda. Besonders die ganze Judenhetze. Die können es sich gar nicht leisten, sich Tausende von guten Deutschen zu Feinden zu machen. Das Land würde ohne Leute wie Einstein, Max Reinhardt oder Elisabeth Bergner kaum auskommen.«
»Selbst wenn«, meinte Edgar, »je radikaler die Revolution, umso kürzer ihre Dauer. Ich gebe der Regierung sechs Wochen. Acht maximal.«
»Ich glaube, ihr macht euch zu viele Gedanken«, sagte Josephine. »Ihr sagt es doch selbst: Ständig gibt es Neuwahlen, allein zwei im letzten Jahr. Genau so wird es wieder kommen. Hitler murkst herum wie seine Vorgänger, sein Nimbus, den er der Tatsache verdankt, dass er bislang immer nur aus der Opposition heraus kritisiert hat und nie Verantwortung übernehmen musste, schwindet, und bei der nächsten Wahl bekommt er die Quittung und ist weg vom Fenster. Vermutlich für immer.«
»An Hitlers Regierungserklärung im Rundfunk gibt es nichts auszusetzen, finde ich«, wandte Bettina Koenig ein. »Er will die Probleme anpacken, Arbeitslosigkeit und alles, und bittet lediglich um vier Jahre Zeit dafür.«
»Vierjahrespläne«, höhnte Diana. »Ausgerechnet er, der gegen die Kommunisten hetzt wie kein zweiter, macht Anleihen bei Moskau.«
»Ich fand seine Regierungserklärung dürftig«, gab Henning Voss zu. »Viel Rhetorik, nichts dahinter. Statt Arbeit und Brot gibt’s Paraden, Fackelzüge und Vorschusslorbeeren. Das beweist nur, dass von ihm nichts zu befürchten ist. Schlimmer als die Papen-Regierung kann es ohnehin nicht werden.«
»Was meinst du, Gregor?«, wollte Hendrik wissen.
»Dass ihr am Kern vorbei diskutiert. Zähmung, die Abwahl Hitlers, dass es schon nicht so schlimm kommen wird – das sind alles fromme Wünsche. Seht euch einfach die Realität an. Demonstrations- und Umzugsverbote für die KPD. Die SPD-Kundgebung im Lustgarten untersagt. Wahlveranstaltungen der politischen Gegner nach Kräften behindert. Nicht nur behindert, es werden tätliche Angriffe auf Abgeordnete verübt und Kundgebungen gesprengt. Seit Hitlers Ernennung kennt der Terror der SA kein Maß mehr. Darüber hinaus schränkt die neue Notverordnung Versammlungs- und Pressefreiheit schlimmer ein, als es die Vorgängerregierungen je getan haben. Allein die schwammigen Verbotsgründe für eine Pressezensur, ›wenn offensichtlich unrichtige Nachrichten enthalten sind, deren Verbreitung geeignet ist, lebenswichtige Interessen des Staates zu gefährden‹. Als hätte die Regierung ein Monopol darauf zu bestimmen, was wahr und falsch ist!«
Bedrücktes Schweigen stellte sich ein. Auch die Kinder, die mit ihren Schlitten nach oben kamen und für Trubel sorgten, änderten nichts daran, dass die Stimmung hinüber war. Zudem fing es wieder an zu schneien, deshalb verabschiedeten sie sich eine halbe Stunde später voneinander und machten sich auf den Weg nach Hause. Josephine wollte eine Freundin besuchen, Hendrik begleitete Gregor, Diana und Lissi, die darauf bestand, ihm noch zwei Bilder zu zeigen, die sie gestern gemalt hatte.
Trotz der Kälte war auf den Straßen einiges los. Heiße Getränke wurden verkauft, ein Straßenhändler röstete Maiskörner, die er anschließend mit Himbeersaft übergoss. Kohlenträger trugen Kohlen aus, die Ein-Zentner-Kästen halbvoll auf dem Rücken schleppend, und brachten sie den Kunden in die Wohnung oder in den Keller. Privatpersonen, die sich die zehn Pfennige Treppengeld pro Etage nicht leisten konnten, holten sich die Kohlen selbst, Presskohlen zumeist, und trugen sie eimerweise oder in Einkaufstaschen heim. Mit mürrischen Gesichtern, vermutlich, weil sie sich darüber ärgerten, im Sommer, als die Kohlen billiger waren, nicht genug gekauft zu haben, sodass sie jetzt teuren Nachschub besorgen mussten.
Noch während Gregor die Wohnungstür aufschloss, läutete das Telefon. Mit ein paar Schritten war er am Beistelltisch und nahm den Hörer ab. »Lilienthal«, meldete er sich.
Diana trug eine übermüdete Lissi ins Kinderzimmer. Hendrik hatte den Schlitten in den Keller gebracht, schloss nun die Tür und machte es sich auf einem Stuhl bequem, während er herauszufinden versuchte, wer da anrief. Was nicht einfach war, weil sein Bruder kein Wort sagte, sondern nur zuhörte. Also vermutlich das Präsidium, zumal Gregor seine offizielle Miene aufgesetzt hatte: ernst, undurchdringlich, distanziert. Hendriks Vermutung bestätigte sich, als sein Bruder »Ist denn niemand sonst verfügbar?« sagte.
Diana war aus dem Kinderzimmer zurück und hatte die letzten Worte mitbekommen. »Du musst fort?«, fragte sie, sobald Gregor aufgelegt hatte.
»Leider. Das war Edgar. Sie haben eine kopflose Leiche gefunden. Oliver obduziert bereits.«
2
Die Einschränkung der Pressefreiheit hatte dafür gesorgt, dass die Chefredaktion der Vossischen Zeitung Hendriks Kolumnen, mit denen er auf philosophischer Grundlage zu aktuellen politischen Geschehnissen Stellung nahm, »vorerst« auf Eis legte. Stattdessen hatte man ihm vorgeschlagen, eine unpolitische Artikelserie über die Arbeit der Kriminalpolizei zu verfassen, aufgrund seiner persönlichen Beziehungen sei er doch ideal dafür geeignet. Deshalb begleitete Hendrik nun seinen Bruder zur Gerichtsmedizin.
Unpolitisch, dachte Hendrik. Wie soll ich unpolitisch über die Arbeit der Kripo schreiben? Der kommissarische Preußische Innenminister Hermann Göring hatte eine Säuberungswelle innerhalb der Polizei in Gang gesetzt. Etliche Regierungs- und Polizeipräsidenten Preußens waren beurlaubt und durch solche Männer ersetzt worden, die den neuen Machthabern genehm waren: in Köln, in Aachen, in Halle, in Kassel, in Hannover und so weiter. In Berlin war Konteradmiral von Levetzow zum neuen Polizeipräsidenten ernannt worden. Zeitweilig war sogar Graf Helldorf für diesen Posten im Gespräch gewesen, ausgerechnet der Mann, der als Oberführer der Berliner SA für die Hetzjagd auf Juden am Ku’damm vor zwei Jahren verantwortlich gewesen war. An solchen Überlegungen ließ sich ablesen, welcher Geist jetzt Einzug hielt.
Der SS-Mann Kurt Daluege, ein alter Kampfgenosse Hitlers, ehemaliger Abteilungsleiter der Berliner Müllabfuhr, war zum Kommissar zur besonderen Verwendung im Innenministerium berufen und mit der Umstrukturierung der preußischen Polizei beauftragt worden. Er galt nicht gerade als Geistesleuchte, was er notfalls durch Brutalität wettzumachen verstand. Laut Gregor glaubte er, das Berufsverbrechertum durch rücksichtsloses Vorgehen »vernichten« zu können.
In erster Linie wurde die Politische Polizei auf Linie gebracht. Diejenigen, die sich mit der Beobachtung der Kommunisten beschäftigten, waren naturgemäß wenig gefährdet, während diejenigen, die bislang den Nationalsozialisten auf den Zahn gefühlt hatten, damit rechnen mussten, ausgewechselt zu werden. Wobei viele demokratisch gesinnte Beamte bereits im Zuge des Preußenschlags entfernt und durch Vertrauensleute der Nationalsozialisten und Sympathisanten des Papenregimes ersetzt worden waren. Rudolf Diels, der damals der Preußischen Regierung in den Rücken gefallen war, durfte jetzt die politische Abteilung leiten. Göring hatte bereits deren Herauslösung aus dem Polizeiapparat angekündigt, dieser Machtfaktor sollte ihm künftig direkt unterstellt sein. Das besondere Augenmerk der neuen Landesherren galt zudem der Schutzpolizei, die Göring ebenfalls in seine Hand zu bekommen trachtete. Die Kriminalpolizei kam vergleichsweise glimpflich davon, nicht zuletzt aufgrund des notorischen Personalmangels. Sicher auch, weil viele Beamte den neuen Geist begrüßten und endlich »befreit von den Fesseln des Rechtsstaates« gegen Berlins Unterwelt vorgehen durften. Ein Satz Nietzsches ging Hendrik durch den Kopf: Das Schlechte gewinnt durch die Nachahmung an Ansehen, das Gute verliert dabei.
Gregor hatte eine ausführliche Befragung durch Daluege über sich ergehen lassen müssen, durchsetzt mit unverhohlenen Drohungen. Vorläufig durfte er auf seinem Platz bleiben, aber er machte sich keine Illusionen: Von Entlassung über Degradierung bis zur Versetzung in die Provinz konnte ihm alles blühen. Dennoch wollte er nicht den Dienst quittieren. Er hatte darüber nachgedacht, sich jedoch dagegen entschieden, weil das bedeuten würde, den Feinden der Demokratie kampflos das Feld zu überlassen.
Vielleicht bereute er seinen Entschluss inzwischen, denn Göring hatte nicht nur die Polizeibeamten mit einem Schießbefehl zum rücksichtslosen Gebrauch von Schusswaffen »gegen kommunistische Terrorakte« aufgefordert und im Falle der Weigerung – »in falscher Rücksichtsnahme« – mit dienststrafrechtlichen Folgen gedroht, sondern es ging das Gerücht, dass er plante, SA, SS und Stahlhelm, ausgerüstet mit dem neuesten Modell einer automatischen Pistole, zu »Hilfspolizisten« zu machen und in bestimmten Fällen den regulären Beamten an die Seite zu stellen.
Den neuen Geist im Land konnte Hendrik auch durch eigene Erfahrung bestätigen. Der Prozess gegen die SA-Studenten, die ihn im Dezember zusammengeschlagen hatten, endete kürzlich mit einem Freispruch. Die Studenten seien durch sein Verhalten und seine hetzerischen Zeitungskolumnen provoziert worden. Er könne froh sein, so glimpflich davonzukommen, denn seine Veröffentlichungen seien geeignet gewesen, lebenswichtige Interessen des Staates zu gefährden. Den Jiu-Jitsu-Unterricht zur Selbstverteidigung hatte Hendrik wieder aufgegeben. Er sah keinen Sinn darin. Die Schläger traten immer in Rudeln auf, was konnte ein Kampftraining dagegen schon ausrichten!
Oliver Pauly erwartete sie bereits im Sektionssaal. Er hatte wieder sein früheres Körpergewicht erreicht, das ihn zusammen mit seinem Backenbart wie ein Walross aussehen ließ, und rieb sich vergnügt die Hände, was darauf hindeutete, dass er mit dem Ergebnis seiner Arbeit zufrieden war.
Hendrik hielt sich im Hintergrund. Auch wenn sämtliche Leichen auf den Tischen abgedeckt waren, allein der Geruch drehte ihm den Magen um.
Gregor verzichtete darauf, sich den Toten ohne Kopf näher anzusehen und hielt sich nicht lange mit Vorreden auf. »Was hast du für mich?«, fragte er den Gerichtsmediziner.
»Eine männliche Leiche, Mitte oder Ende zwanzig. Zwölf Messerstiche: Brust, Bauch. Von unten nach oben. Einmal wurde die Tatwaffe beim Herausziehen gedreht. Innere Organe sind verletzt. Die Halsschlagader wurde aufgerissen, das hat dem Mann den Rest gegeben. Wobei er auch ansonsten nicht überlebt hätte. Kein Fluchtversuch, keine Abwehrbewegung; das Opfer ist von der Tat überrascht worden.«
Hendrik wunderte sich über die knappe Antwort. Gewöhnlich liebte es Oliver, sich lang und breit über seine Erkenntnisse auszulassen, und ein Sinn für Theatralik war ihm auch nicht abzusprechen.
»Und die Enthauptung?«, erkundigte sich Gregor.
»Geschah nach dem Tod des Opfers. Mit einer Axt, vermute ich. Der Täter hat wild zugeschlagen, um den Kopf vom Rumpf zu trennen, da war nichts Feinsinniges dabei.«
»Wie meinst du das?«
»Na ja, ein Arzt hätte gewusst, wie er es am geschicktesten anzustellen hätte. Und er hätte vielleicht ein Skalpell benutzt. Hier jedoch nichts dergleichen, nur rohe Gewalt.« Oliver sah aus, als hätte ihn die Vorgehensweise des Mörders persönlich beleidigt.
Gregor rieb sich die Schläfen. »Edgar sucht sich bereits durch unsere Zehnfingerabdrucksammlung, aber ich rechne mit keinem Ergebnis. Wenn das Opfer nicht gerade ein vorbestrafter Verbrecher ist, haben wir keine Chance, die Identität des Mannes herauszufinden.«
»Er hat eine kleine Narbe am Ballen der linken Hand; solltest du je einen Verwandten oder Bekannten des Opfers auftreiben, kann der ihn daran identifizieren.«
»Schwache Hoffnung. Ohne einen Anhaltspunkt weiß ich nicht einmal, in welche Richtung ich ermitteln soll.«
»Ich schon.«
»So?«
Oliver Pauly grinste ihn an. »Er war Schneider.«
»Was?«
»Er war Schneider.«
»Du hast also noch etwas für mich?«
»Frag einen Experten.«
Hendrik konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. Deshalb also war Oliver über die Ergebnisse seiner Obduktion hinweggehuscht: weil er sich seinen Hang zu weitschweifigen Ausführungen für diesen Augenblick aufgehoben hatte.
In der Tat setzte der Gerichtsmediziner seinen Zeigefinger wie ein Ausrufezeichen in die Luft, eine Marotte, die in der Regel eine längere Abhandlung ankündigte. »Jeder Beruf verlangt typische Bewegungsabläufe, und wenn man diese tagein, tagaus wiederholt, prägen sie sich wie ein Stempel in den Körper ein. Blau verfärbte Hände deuten auf einen Färber hin, rot oder grün verfärbte Hände auf einen Maler oder Anstreicher, weiß verfärbte Hände auf einen Müller, einen Bäcker oder einen Kalk-, Zinn-, Bleiweißarbeiter, schwarz verfärbte Hände auf einen Kohlenarbeiter, vielleicht auch einen Kesselheizer, einen Schmied, einen Schlosser, braun oder gelb verfärbte Hände auf einen Gerber oder Schreiner. Sind hingegen nur die Fingerspitzen und Nägel gelb, handelt es sich lediglich um einen Raucher, der Zigaretten ohne Mundstück benutzt.«
»Prinzip verstanden«, begann Gregor in der Hoffnung, den Redeschwall abzukürzen, doch Oliver Pauly hob wieder den Zeigefinger und unterbrach ihn.
»Ungleich hohe Schultern lassen es wahrscheinlich sein, dass wir einen Schreiner vor uns haben oder jemanden, der Schreibarbeiten verrichtet. Schwielen an den rechten Fingern: ein Bürstenbinder, Steinklopfer, Schuhmacher. Schwielen an den linken Fingern: ein Graveur, ein Schlosser, ein Korbmacher, ein Musiker, der ein Saiteninstrument spielt.«
»Gilt das auch für Linkshänder?«, warf Gregor ein .
Oliver ließ sich nicht beirren. »Schwielen an beiden Händen: ein Weber, Hutmacher, Seiler, Packer. Hände mit glatten Innenflächen: eine Wäscherin. Schmutzig grüner Zahnbelag: ein Metallarbeiter.«
»Zu dumm, dass wir keine Zähne zur Begutachtung haben.«
»Schneidezähne mit grobschartigen Kanten oder rinnenförmig ausgeschliffenen Zähnen: ein Schuhmacher oder Tapezierer, der sich kleine Nägel in den Mund steckt und sie einzeln mit der Zungenspitze durch die Zähne schiebt, um sie dort zu fassen.«
Die Begründungen kamen Hendrik willkürlich vor. Die Arbeitsspuren, die auf einen Schuhmacher und Tapezierer deuteten, leuchteten ihm ein, die Hinweise auf Färber, Musiker, Metallarbeiter, na schön, die waren vielleicht möglich. Aber der Rest?
Auch Gregor machte ein zweifelndes Gesicht, dennoch fragte er: »Und warum ein Schneider?«
»Die zerstochene Haut des linken Zeigefingers. Wegen der Nadeln, verstehst du? Hätten wir seinen Kopf, gehe ich jede Wette ein, dass sich schlitzförmige Einschnitte in seinen Schneidezähnen zeigen würden, wo er regelmäßig einen Faden abgebissen hat.«
»Hm«, machte Gregor. »Ich bin nicht völlig überzeugt, aber ich werde deinen Hinweis berücksichtigen.«
»Nicht überzeugt? Das verletzt mich«, sagte Oliver und sah dabei kein bisschen verletzt aus.
3
Einige tausend Menschen wurden jährlich in Deutschland vermisst. Darunter befanden sich jugendliche Ausreißer, die aus Abenteuerlust, Ärger über Bevormundung, Angst vor elterlichen Strafen aufgrund schlechter Zeugnisse oder wegen eines strengen Meisters in der Lehre das Weite suchten und in der Regel entweder auf Rummelplätzen aufgegriffen wurden oder spätestens beim ersten Platzregen nach Hause zurückkehren. Außerdem gab es Ehepartner, die nach einem häuslichen Streit für immer das Heim verließen, und Gestrauchelte, die ihr Heil in der Fremdenlegion suchten, um einer Strafe zu entgehen. Dann waren da noch die Unglücklichen, die keinen Sinn mehr in ihrem Leben sahen und diesem ein Ende setzten. Übrig blieb ein nicht gerade geringer Prozentsatz an Verschwundenen, bei denen zu befürchten stand, dass sie das Opfer eines Verbrechens wurden.
Gregor war am Abend beauftragt worden, in einem Mietshaus im Regierungsviertel die näheren Umstände einer Vermisstenanzeige zu untersuchen – er vermutete wohl nicht zu Unrecht, dass er als »unzuverlässiger Geselle« von wichtigeren Fällen ferngehalten werden sollte –, und die Befragung der Mieter hatte sich länger hingezogen, als erwartet. Hendrik, der seinen Bruder begleitete, fror, was kein Wunder war, angesichts der sternenklaren Nacht mit Temperaturen deutlich unter null, eines scharfen Ostwinds und vereister Bürgersteige. Ein heißer Punsch käme jetzt gerade recht! Den kann man demnächst auch wieder in den USA bekommen, ging ihm durch den Kopf. Die Prohibition war dabei zu fallen, das Repräsentantenhaus kippte gerade das Alkoholverbot.
Wegen der Schneewehen, die das Parken vielfach unmöglich machte, hatte Gregor sein Auto in der Nähe des Reichstags abgestellt. Auf dem Weg dorthin entdeckte Hendrik ein Wahlplakat, das Hitler und Hindenburg zeigte, wie sie sich die Hände reichten. Sicher Goebbels’ Werk! Der Gefreite und der Offizier vereint, das würde vielen ehemaligen Soldaten aus der Seele sprechen! Dass die Führungsriege der Nazis auf ihren Wahlkundgebungen in aller Offenheit davon sprachen, die Macht nicht mehr aus der Hand zu geben, einerlei, wie die Wahl ausgehe, würde dagegen in den Hintergrund geraten.
Im Auto war es ebenso kalt wie draußen. Gregor fiel in den Sitz und saß mit geschlossenen Augen da, ohne Anstalten zu machen loszufahren. Vermutlich hadert er damit, aufs Abstellgleis geschoben zu werden, dachte Hendrik und überlegte, wie er seinen Bruder aufmuntern konnte.
»Es gibt ein Gerücht«, sagte Gregor unvermittelt.
»Was für ein Gerücht?«
»Sie planen, ein Attentat auf Hitler vorzutäuschen, um anschließend den Ausnahmezustand verhängen und gegen ihre politischen Gegner vorgehen zu können.«
»Glaubst du, da ist etwas dran?«
»Goebbels soll sich das ausgedacht haben. Es trägt seine Handschrift.«
»Wenn das geschieht …«
»Wenn das geschieht, gibt es ein Blutbad. Die haben bereits entsprechende Verordnungen und Listen missliebiger Personen in der Schublade liegen.«
Hendrik wusste nicht, was er sagen sollte.
Eine Weile herrschte Schweigen im Auto.
Schließlich raffte sich Gregor auf und startete den Wagen. »Wir können ohnehin nichts daran ändern«, sagte er. »Alles, was wir tun können, ist, so gut wie möglich unsere Arbeit zu verrichten, etwas anderes bleibt uns nicht.«
»Seneca«, murmelte Hendrik.
»Was?«
»Du hast gerade Seneca zitiert: Bleibe auf deinem Posten und hilf durch deinen Zuruf. Und wenn man dir die Kehle zudrückt, bleibe auf deinem Posten und hilf durch dein Schweigen.«
Gregors Züge wurden weich. Dann lächelte er. »Ach, Hendrik! Du bist unverwüstlich.«
Jetzt lächelte auch Hendrik. »Wenn du meinst.« Um seinen Bruder auf andere Gedanken zu bringen, erkundigte er sich: »Gibt es etwas Neues über die enthauptete Leiche?«
Gregor schüttelte den Kopf. »Wir haben acht Tage lang praktisch jeden Schneider der Stadt befragt – Fehlanzeige. Niemand vermisst den Toten. Edgar ist nach Stettin gefahren, um mit dem Dienstmann zu sprechen, der die Leiche gefunden hat: ohne Ergebnis.«
»Hat der Mann denn nicht früher etwas gerochen? Der Korb stand immerhin drei Wochen in der Gepäckabfertigung, wenn ich das richtig verstanden habe.«
»Die Kälte. Der Torso war halb gefroren. Außerdem hatte der Mann Schnupfen.«
»Zu dumm.«
»Ich habe mir in der Zwischenzeit den Beamten vorgeknöpft, der den Reisekorb hier in Berlin entgegengenommen hat. Der Mann erinnert sich an nichts. Auch nicht an die Fahrkarte, die ihm vorgezeigt worden sein muss, damit er sie mit dem Gepäckstempel versehen konnte.«
»Also hast du nichts in der Hand.«
»Nur einen Trostpreis. Simon hat den Schmutz in der Kleidung des Toten untersucht. Unter anderem fand er Kohlespuren und hat durch einige Versuche, um die Dichte zu bestimmen, herausgefunden, dass es sich um Anthrazit handelt. Sägemehl aus Kiefernholz und eine bestimmte Sorte Staub konnte er ebenfalls isolieren. Als Höhepunkt gibt es zwei menschliche Haare, die nicht vom Toten stammen. Sofern wir also einen Verdächtigen und einen mutmaßlichen Tatort finden, sind wir möglicherweise in der Lage, den Täter zu überführen. Aber dazu müssen wir ihn erst einmal haben.«
Gregor fuhr aus der Parklücke. Vorsichtig, wegen der vereisten Straßen. »Ich setze dich zu Hause ab«, sagte er.
Hendrik nickte. Es war bereits kurz nach neun, Josephine würde sich fragen, wo er blieb.
Sein Bruder steuerte die Straßenmitte an, um nicht gegen einen Bordstein zu stoßen. Das Auto schlitterte über das Eis.
Am Platz der Republik trat Gregor plötzlich so hart auf die Bremse, dass der Wagen ins Rutschen geriet und erst nach zwei Metern kurz vor dem Bordstein zum Stehen kam.
»Was ist los?«, wollte Hendrik wissen.
Doch sein Bruder hatte schon die Tür aufgerissen und rannte über den menschenleeren Platz auf das Hauptportal des Reichstags zu. Hendrik blieb nichts anderes übrig, als ihm zu folgen. Als er ihn erreichte, war Gregor rechts neben dem Portal stehen geblieben, hatte seine Dienstwaffe gezogen und sah nach oben. Hendrik folgte seinem Blick, konnte jedoch in der Dunkelheit nicht ausmachen, was seinen Bruder so in Aufregung versetzte.
In diesem Augenblick kamen zwei Männer angelaufen. Gregor erkannte offenbar einen von ihnen. »Oberwachtmeister Buwert«, sagte er.
»Wer …? Oh, Kommissar Lilienthal. Jemand soll durch ein Fenster in den Reichstag eingestiegen sein, sagt der Herr hier, haben Sie –«
»Da war ein Mann auf dem Mauervorsprung«, unterbrach ihn Gregor. »Auf dem Sims zu einem der Balkone.«
»Sims? Balkone?« Der Wachtmeister war sichtlich überfordert.
»Ich glaube, die Scheiben der Balkontür sind gesplittert, sehen Sie?«
Herr Buwert schüttelte den Kopf.
Hendrik kniff die Augen zusammen, und, ja, jetzt meinte er auch, ein Loch im Glas zu erkennen. Und glomm es dahinter nicht rötlich?
»Tatsächlich«, sagte der Wachtmeister, »mir scheint …«
»Es brennt!«, rief der junge Mann, der ihn begleitete.
»Ein Vorhang muss Feuer gefangen haben«, stotterte Buwert.
Hendrik bildete sich ein, Rauch riechen zu können. Waren Menschen in Gefahr? An normalen Werktagen arbeiteten über tausend Personen im Reichstag: Abgeordnete, Angestellte, Stenografen, dazu die Presse, das Restaurantpersonal, Bibliothekare. Um diese Uhrzeit, noch dazu bei der derzeitigen Witterungslage würde das Gebäude hoffentlich weitgehend leer sein.
»Lauf zur Wache am Brandenburger Tor«, befahl sein Bruder. »Sag ihnen –«
Aus der Dunkelheit kam eine Gestalt auf sie zugestürmt und stieß mit ihnen zusammen. Hendrik taumelte, Gregor fluchte. Der Mann konnte gerade noch verhindern, dass er zu Boden ging. Der Uniform nach handelte es sich um einen Soldaten. Er sah aus, wie Hendrik sich einen Klabautermann vorstellte: Kantiges, wettergegerbtes Gesicht, das den Mann älter erscheinen ließ, als er zweifellos war, große Nase, eisblaue Augen.
Der Soldat fand sein Gleichgewicht wieder, schien zuerst verärgert, wurde jedoch plötzlich ruhig, strich seine Uniform glatt und nickte ihnen zu. »Ich bitte vielmals um Entschuldigung«, sagte er.
Gregor befahl jetzt ihm, die Wache am Brandenburger Tor zu verständigen, jemand sei in den Reichstag eingedrungen, möglicherweise brenne es.
Der Soldat salutierte und ging zügig, jedoch ohne zu laufen davon. Begriff er den Ernst der Lage nicht?
Hendrik wurde abgelenkt, weil mittlerweile auch hinter einem Fenster im Parterre etwas aufleuchtete. Hatte jemand das Licht eingeschaltet? Der Schein schien sich zu bewegen. Eine Fackel?
»Das sind Brandstifter!«, rief der junge Mann an der Seite des Wachtmeisters. »Schießen Sie!«
Reflexartig riss Buwert seine Dienstwaffe heraus und feuerte auf die Fackel, die augenblicklich im Inneren des Gebäudes verschwand.
»Sind Sie verrückt?«, herrschte Gregor ihn an. »Sie wissen doch gar nicht, was los ist!«
»B… B… Brandstifter«, stotterte Buwert.
»Nehmen Sie die Waffe runter!«
Zitternd gehorchte der Wachtmeister.
Hendrik war wie gelähmt. Brandstifter im Reichstag?
Auch sein Bruder, sonst die Geistesgegenwart in Person, schien zu zögern. »Das Attentat«, hauchte er.
»Was?«
»Das ist das Attentat.«
Glaubte Gregor etwa …?
Von der Feuerwache in der Linienstraße raste ein Löschzug heran. So schnell? Wer hatte die Helfer informiert?
»Sie bleiben hier!«, rief Gregor dem Wachtmeister zu. »Ich sehe zu, dass ich irgendwo reinkomme.« Ohne eine Antwort abzuwarten, rannte er um das Gebäude.
Die Feuerwehrmänner sprangen aus dem Wagen. Wachtmeister Buwert fand seine Geistesgegenwart wieder und eilte ihnen entgegen. »Es brennt«, rief er. »Das Restaurant vermutlich.« Die Männer waren schon dabei, Leitern herauszuholen und an die Mauer zu lehnen. Andere rollten Schläuche ab. Der Brandmeister kletterte eine Leiter hinauf, schlug mit der Axt ein Restaurantfenster ein und kletterte durch die entstandene Öffnung.
Vom Brandenburger Tor raste ein Polizeiwagen auf den Platz. Mehrere Wachtmeister sprangen heraus. Hendrik hörte einen von ihnen rufen: »Feuer im Reichstag. Verstärkung erforderlich.« Der Wagen raste zurück, während die Wachtmeister um das Gebäude herumliefen. Gleichzeitig kam ein weiterer Löschzug herangebraust.
Das Geschehen entwickelte sich in einem solchen Tempo, dass Hendrik kaum zur Besinnung kam. Er beobachtete, wie Wachtmeister Buwert die neu hinzugekommenen Feuerwehrmänner informierte, während der junge Mann, der ihn begleitet hatte, davonging. Dann sah er, dass die Kuppel des Reichstags hell erleuchtet war. Ein zweites Feuer, ein weitaus größeres! Das musste der Plenarsaal sein, der da brannte!
Auch die Feuerwehrmänner bemerkten es und entschieden sich, nicht ihren Kollegen zu folgen, sondern ein offenes Portal zu suchen.
Hendrik stand immer noch wie gelähmt an seinem Platz und verlor allmählich den Überblick. Weitere Löschzüge. Überall brüllende, laufende, fluchende Männer. Immer mehr Leitern an der Mauer. Rote Schlauchleitungen, die sich über den Platz wanden. Ein Feuerschein, der die Umgebung erhellte. Polizeiwagen von allen Seiten. Polizeibeamte sprangen heraus und fingen an, den Platz abzuriegeln. Erste Schaulustige näherten sich aus den Seitenstraßen. Der Wahnsinn ist ausgebrochen, dachte Hendrik.
Gregor rannte auf der Suche nach einem offenen Portal um das Gebäude herum, rüttelte an den Türen und rief nach dem Portier, der doch irgendwo stecken musste, verdammt noch mal! Plötzlich polterten Schritte hinter ihm her, drei Polizeibeamte, die offenbar wie er einen offenen Eingang ins Innere des Gebäudes suchten. »Kommissar Lilienthal«, keuchte er. »Portal II, III und IV sind verschlossen.«
»Polizeileutnant Lateit.«
Sie nickten sich flüchtig zu und rannten weiter zur Nordseite des Reichstags. Am Portal V erwartete sie ein nervöser Mann, der ihnen mit Schlüsseln winkte. »Scranowitz«, rief er, »ich bin der Hausinspektor. Hier rein!«
Über den roten Veloursläufer auf der Treppe rannten sie, gefolgt vom Hausinspektor, zur Wandelhalle des ersten Stocks hinauf, zum Hauptgeschoss. Brandgeruch schlug ihnen entgegen. Vorhänge standen in Flammen, ein Wandschrank, ein auf dem Boden liegender Mantel. Aus der Tür zum Plenarsaal drang eine Hitze, die ihnen den Atem raubte. Sie sahen hinein: Die Tische des Reichstagspräsidenten und der Stenografen brannten, die Sitze der Abgeordneten, das Rednerpult. Flammen loderten meterhoch, eine Feuersäule wand sich brüllend empor. Hier war nichts mehr zu retten, erkannte Gregor.
»Brandstiftung, Pistolen raus!«, befahl Lateit. »Wir müssen die Schweine finden.«
Während der Hausinspektor und ein junger Wachtmeister oben mit der Suche begannen, rannte Lateit mit seinem anderen Kollegen wieder die Treppe hinab. Gregor begleitete sie. Feuerwehrmänner kamen ihnen entgegen, Schläuche hinter sich herziehend.
»Brandstiftung!«, rief Lateit. »Es brennt an allen Ecken und Kanten.« Unten blieb er stehen. »Ihr sucht weiter«, befahl er seinem Kollegen. »Ich muss zum Brandenburger Tor, wir brauchen mehr Leute.« Damit verschwand er.
Gregor und der Beamte fingen an, das Erdgeschoss mit seinen Küchenräumen und Büros zu durchsuchen, und wollten sich anschließend den Keller vornehmen. Auf halbem Wege überlegte es sich Gregor anders und stürmte wieder nach oben, seinem Instinkt gehorchend. War es nicht wahrscheinlicher, die Brandstifter in der Nähe ihrer Tat zu finden? Immerhin waren nur Minuten vergangen, seit er den Einstieg eines Unbekannten ins Reichstagsgebäude beobachtet hatte. Im Vorbeilaufen warf er einen Blick in den Plenarsaal, vor dessen Tür einer der Brandmeister einen Löschschlauch entlangzerrte.
In diesem Augenblick gab es eine Explosion, die gläserne Decke zerbarst in mehreren Detonationen, die wie Maschinengewehrfeuer klangen. Splitter regneten herab. Ein plötzlicher Luftzug ließ die Flammen jäh emporfauchen und über Tische und Bänke rasen. So stark war der Luftzug, dass sich sowohl Gregor als auch der Brandmeister an der Tür festklammern mussten, um nicht in die Brandhölle gesogen zu werden. Erst nach endlos scheinenden Sekunden ließ der Sog nach. Gregors Knie knickten ein, er sank zu Boden, kämpfte sich jedoch sofort wieder hustend auf die Beine und wankte weiter, nachdem er sich davon überzeugt hatte, dass der Brandmeister wohlauf war.
Im südlichen Korridor, in der Nähe des Bismarcksaals, kamen ihm der Hausinspektor und der Wachtmeister, der ihn begleitet hatte, entgegen. Sie hielten einen bleichen jungen Mann mit nacktem Oberkörper fest, der gekrümmt ging, als sei er geschlagen worden. »Das ist der Scheißkerl«, rief Herr Scranowitz.
»Ein Brandstifter?«
»Van der Lubbe heißt er«, sagte der Wachtmeister.
»Und seine Komplizen?«
»Er war allein.«
Gregor war nicht überzeugt. Ein Mann allein sollte dieses Inferno ausgelöst haben? Er wandte sich von dem Trio ab und eilte weiter. Zehn, fünfzehn Minuten lang durchsuchte er Raum für Raum, Ecke für Ecke. Schweiß lief ihm über das Gesicht, die Hitze machte ihm das Atmen schwer.
Überall rannten Feuerwehrmänner umher und setzten ihre Schläuche ein. Wasser lief über die Veloursteppiche und tropfte die Treppen hinunter. Der Mittelbau des Reichstags war ein einziges Flammenmeer, das vom Boden des Plenarsaals bis zur geborstenen Kuppel reichte. Die Wandelgänge ringsherum konnte man noch begehen, aber es war wohl nur eine Frage der Zeit, bis auch sie Feuer fingen, wenn es den Feuerwehrmännern nicht gelang, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Hier drinnen schwebte man ständig in Lebensgefahr. Wie lange mochte die Eisenkonstruktion der Kuppel noch halten, ehe sie anfing, sich zu verbiegen?
Mit wachsender Sorge verfolgte Hendrik, wie sich das Feuer ausbreitete. Komm raus da, Gregor!, dachte er.
Immer mehr Autos verstopften den Platz der Republik: Krankenwagen, Rüstwagen, Schlauchfahrzeuge; in den anliegenden Straßen stauten sich Schlangen von Privatfahrzeugen und Autodroschken. Scheinwerfer auf Spezialwagen erhellten die Rettungsmaßnahmen. Kompanien von berittenen Schupos umkreisten die Straßen des Tiergartens, durch deren Bäume der flackernde Schein des Feuers irrlichterte. Kameramänner und Fotografen waren erschienen, um die Katastrophe zu dokumentieren. Trotz der Kälte drängten sich die Schaulustigen an der Polizeikette, auch Abgeordnete und Vertreter des Magistrats befanden sich darunter. Hendrik war bislang nicht des Platzes verwiesen, nicht einmal nach seinem Ausweis gefragt worden, vermutlich weil er mit Wachtmeister Buwert gesprochen hatte, als die Absperrung begann, und die Polizisten annahmen, er sei ein Mitarbeiter.
Vorhin war er einmal um den Reichstag herumgegangen und hatte beobachtet, wie Feuerwehrmänner mit Äxten an allen vier Fronten des Gebäudes Türen und Fenster einschlugen und Schläuche ins Innere zogen. Die goldene Kuppel des Reichstags hatte sich auf der Spree gespiegelt, wo Feuerlöschboote Wassermassen herauspumpten. Bei seinem Rundgang war er Zeuge geworden, wie Polizisten jemanden abführten; sicher einen der Brandstifter. Nun stand er wieder an seinem Ausgangspunkt und betete, dass sein Bruder heil aus dem Inferno herauskam. Das Reichstagsgebäude brannte mittlerweile wie eine riesige Fackel. Flammen schlugen aus der Kuppel, immer wieder knallte es, wenn Glas platzte.
Zu seiner Erleichterung sah er Gregor aus dem Nordportal stürzen, unverletzt. Ohne nach links und rechts zu sehen, ohne ihm ein Zeichen oder eine Erklärung zu geben, stürmte sein Bruder davon, vermutlich zur Wache am Brandenburger Tor. Unschlüssig sah Hendrik ihm nach. Sollte er ihm folgen? Besser nicht. Weder Gregor noch die Wachen würden es zu schätzen wissen, wenn er sich einmischte. Also blieb er auf dem Platz der Republik.
In der Nähe des Haupteingangs entdeckte er Hermann Göring und Rudolf Diels. Wann waren die beiden eingetroffen? Er hatte sie nicht kommen sehen. Was bei Diels kein Wunder war, der Mann schlich immer wie auf Katzenpfoten umher. Soeben trafen zwei schwarze Mercedeslimousinen ein, denen Hitler und Goebbels entstiegen. Göring eilte mit flatterndem Mantel auf die beiden zu, um Hitler über die Katastrophe zu unterrichten. Die Gruppe stand zu weit weg, als dass Hendrik etwas verstehen konnte, nur einmal hörte er Göring poltern, die Brandlegung sei zweifellos das Werk der Kommunisten. Hitler antwortete mit einem langen Monolog, aus dem Hendrik die Worte »kein Erbarmen« vernahm.
Das ist das Attentat, hatte sein Bruder gesagt. Der Vorwand, den die Nazis brauchten, um ein Blutbad anzurichten.
Von der Wache am Brandenburger Tor erfuhr Gregor, dass sich van der Lubbe nicht länger dort in Gewahrsam befand, sondern zur Vernehmung ins Polizeipräsidium gebracht worden war. Er musste ihnen nach! Aber war das ratsam? Eine Sekunde lang war Gregor unschlüssig. Doch, auf jeden Fall. Nach gerade mal vier Wochen Kanzlerschaft Hitlers saßen die Nationalsozialisten keineswegs fest im Sattel, noch gab es pflichtbewusste Beamte, die bestrebt waren, ihre Arbeit korrekt zu verrichten, selbst bei der Politischen Polizei. Wenn er recht behielt und der Brand ein abgekartetes Spiel war, würden die ahnungslosen Verhörspezialisten nicht die richtigen Fragen stellen. Wenn er dagegen ein paar vorsichtige Hinweise gab – immerhin war er Augenzeuge des Brands gewesen –, konnte er vielleicht zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen, ohne sich allzu sehr zu exponieren. Es käme darauf an, wer das Verhör durchführte: jemand von den Scharfmachern oder einer der Anständigen. Höchste Zeit, es herauszufinden.
Er rannte zum Platz der Republik zurück, zu seinem Auto, hielt im Laufen Ausschau nach seinem Bruder, konnte ihn jedoch nirgends entdecken. Keine Zeit, nach ihm zu suchen, jetzt kam es auf jede Sekunde an! Hendrik war alt genug, er würde schon allein nach Hause kommen.
Gregors Wagen war von den Autos Schaulustiger eingekeilt. Er musste seine ganze Autorität aufbieten und mehrfach seine Dienstmarke hochhalten, ehe er den Fuhrpark so organisiert bekam, dass eine Lücke entstand, durch die er mit Hin- und Herrangieren hinausfahren konnte. Weitere kostbare Minuten gingen dadurch verloren, dass er in Schrittgeschwindigkeit und slalomartig dem Strom entgegenkommender oder mitten auf der Straße abgestellter Wagen ausweichen musste.
Endlich konnte er Gas geben. So schnell er es bei den vereisten Fahrbahnen vertreten konnte, jagte er zum Alex. Dort sprang er aus dem Wagen und sprintete die Treppen hinauf zum zweiten Stock, wo sich die Abteilung I, die Politische Polizei, befand.
Überall standen Beamte herum in der Hoffnung, etwas vom Verhör mitzubekommen. Auch Kurt Daluege befand sich unter ihnen und redete gerade auf jemanden ein. Als er Gregor kommen sah, stellte er sich ihm in den Weg. »Wohin, Lilienthal?«
»Zu van der Lubbe.«
»Das ist nicht Ihr Fall.«
»Ich war beim Reichstagsgebäude, als … Ich habe den Beginn des Brandes miterlebt, ich kann wertvolle Beobachtungen beisteuern und dafür sorgen, dass …« das Verhör keinen falschen Verlauf nimmt »… sich der Täter nicht herausredet.«
»Das überlassen Sie den Spezialisten von der Politischen. Wir übernehmen den Fall. Das ist Chefsache. Sie halten sich gefälligst von dem Mann fern. Habe ich mich klar ausgedrückt?«
»Ich –«
Daluege nahm eine drohende Körperhaltung ein. »Was hatten Sie überhaupt dort zu suchen?«
Gregor hielt seinem Blick stand. »Sie haben mich ins Regierungsviertel geschickt.«
Daluege antwortete nicht sofort. Drei, vier Sekunden starrte er ihn an. Dann schnauzte er: »Sie halten sich von der Sache fern, kapiert? Das ist ein Befehl.«
4
Die neuen Machthaber verloren keine Zeit. Noch in der Nacht holten sie über hundert missliebige Personen aus den Betten und verhafteten sie, darunter nicht nur Kommunistenführer, sondern auch Leute wie Carl von Ossietzky. Die Morgenausgabe des SPD-Blattes Vorwärts wurde beschlagnahmt, die Zeitung verboten, ein Polizeikommando hielt die Redaktionsräume besetzt. Bereits am Donnerstag – also Tage vor dem Reichstagsbrand – hatten Schupos und Politische Polizei das Karl-Liebknecht-Haus der KPD wegen Flugblättern mit angeblich hochverräterischen Äußerungen besetzt und geschlossen. Wer befürchten musste, auf einer Schwarzen Liste zu stehen, tauchte unter, vor allem, wenn er den Kommunisten nahestand. Beispielsweise Pit Gerber, den Hendrik während der Morduntersuchung im Deutschen Theater kennengelernt hatte. Laut Auskunft von Henning Voss war der Bühnentechniker heute früh um fünf nicht zum Bühnenumbau erschienen und offenbar verschwunden.
Im Polizeipräsidium herrschte höchste Alarmbereitschaft. Sonderwagen durchstreiften die Stadt, öffentliche Gebäude wurden bewacht. Göring hatte die »Hilfspolizei« einberufen, daher machten jetzt SA- und SS-Männer mit polizeilicher Machtbefugnis die Straßen noch unsicherer, als sie ohnehin schon waren. Kommissar Erich Liebermann von Sonnenberg, seit Langem Anhänger der Nationalsozialisten, war zum stellvertretenden Leiter der Berliner Kriminalpolizei ernannt worden.
Vor allem aber hatte Innenminister Wilhelm Frick dem Kabinett am frühen Morgen eine neue Notverordnung »zum Schutz von Volk und Staat« präsentiert, die Reichspräsident Hindenburg noch heute zur Unterzeichnung vorgelegt werden würde.