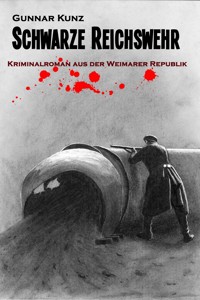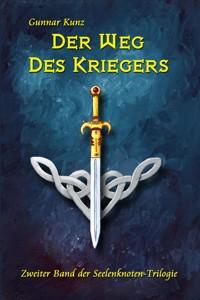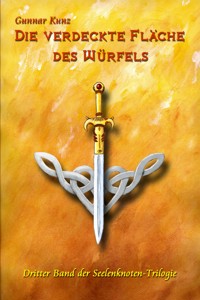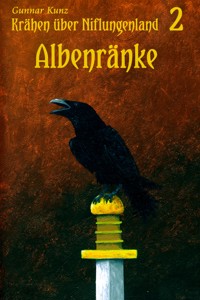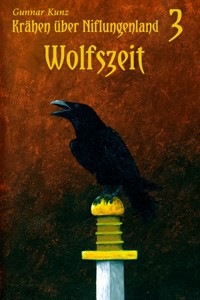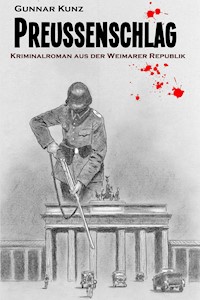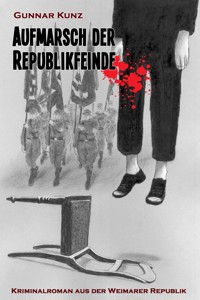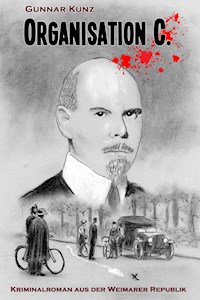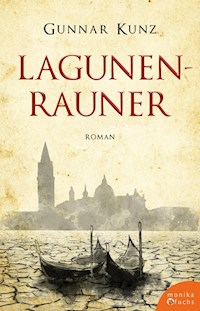7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kriminalroman aus der Weimarer Republik
- Sprache: Deutsch
Berlin, 1932/33. Reichspräsident Hindenburg plant verfassungswidrige Experimente, Reichskanzler Papen regiert gegen das Volk, in einem Streik kämpfen Kommunisten und Nationalsozialisten Seite an Seite. Ein Bürgerkrieg scheint nicht ausgeschlossen. In dieser explosiven Situation fällt der Sohn eines ostelbischen Junkers einem Nitroglyzerinanschlag zum Opfer. Kommissar Gregor Lilienthal, sein Bruder Hendrik und seine Frau Diana untersuchen den Fall und finden heraus, dass die Junkerfamilie berüchtigt war für ihren brutalen Umgang mit Untergebenen. Außerdem scheint sich ein verbissener Kampf der Kinder um das Erbe herauszukristallisieren. Während ein kaltblütiger Mörder mit gnadenloser Präzision ein Familienmitglied nach dem anderen ermordet, ebnen Geheimgespräche Hitler den Weg zur Macht, und in den dramatischen Wochen des Januar 1933 entscheidet sich das Schicksal Deutschlands.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 283
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Gunnar Kunz
Machtübernahme
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Machtübernahme
Prolog
1
2
3
Nachwort
Empfehlenswerte Literatur zum Thema
Weitere Bücher aus der Serie:
Impressum neobooks
Machtübernahme
Kriminalroman aus der Weimarer Republik
von Gunnar Kunz
Impressum:
Copyright 2024 by Gunnar Kunz, Berlin
Tel. 030 695 095 76
E-Mail über www.gunnarkunz.de
Alle Rechte vorbehalten
Einbandgestaltung: Rannug
Dieses E-Book, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne Zustimmung des Autors nicht vervielfältigt, wieder verkauft oder weitergegeben werden. Danke, dass Sie die Arbeit des Autors respektieren!
Prolog
Es gibt viele Arten, eines gewaltsamen Todes zu sterben, und keine ist besonders angenehm. Immer wird ein solcher Moment begleitet von Schmerz und, sofern dem Opfer noch ein paar Sekunden Zeit bleibt, vom Gefühl einer Kränkung: Warum ich? Warum so? Warum jetzt schon? Stets kommt der Tod zu früh und in der Regel unerwartet.
Bodo von Hochstein jedenfalls wäre nie auf den Gedanken gekommen, dass er heute »den Löffel abgeben würde«, wie er es ausgedrückt hätte. Seine Sorgen waren anderer Natur. Deswegen hatte er auch die Nacht nicht schlafen können und fühlte sich am frühen Morgen wie gerädert.
Von Unruhe getrieben sah er sicher zum hundertsten Mal auf seine Taschenuhr, ein Erbstück seines Großvaters. Gleich sechs. Noch zwei lange Stunden, bis er endlich die Verantwortlichen vom Reichslandbund traf. Dieses Gespräch würde über seine Zukunft entscheiden. Wenn es ihm nicht gelang, mehr Fördergelder über das Osthilfegesetz herauszuholen, war er erledigt. Dann war es aus mit weiteren Erwerbungen für seine Waffensammlung und feuchtfröhlichen Abenden im Wirtshaus. Er stand ohnehin schon bei etlichen Geschäftsleuten in der Kreide.
Die Misere ist nicht meine Schuld, dachte er. Was kann ich dafür, dass die Landwirtschaft immer weniger abwirft? Das liegt alles nur an den Landarbeitern mit ihren maßlosen Forderungen. An den Knechten und Mägden, die mir den schuldigen Respekt verweigern. Dem Gesindel, das mir davonläuft, bloß weil ich ihm ein-, zweimal mit der Faust klargemacht habe, wer der Herr ist. Ein bisschen Prügel hat noch keinem geschadet.
Bodo von Hochstein sah wieder auf seine Uhr. Wenn er kein weiteres Geld aus der Osthilfe quetschen konnte … Verdammt! Estelle würde ihm die Hölle heiß machen. Sie war es gewohnt, ausgeführt zu werden und nach Lust und Laune Kleider zu kaufen. Nie würde sie von ihren Ansprüchen abgehen. Blöde Kuh, die. Konrad würde ihm wieder Vorträge halten und behaupten, er könne nicht wirtschaften. Faselte immer von modernen Arbeitsmethoden, von Kosten-Nutzen-Analyse und sah auf ihn herab, der Drecksack! Und Irene erst und ihr Mann, die ihn verklagt hatten, die Schweine, weil sie es nicht verwinden konnten, dass das Gut jetzt ihm gehörte!
Zwei Stunden noch.
Bodo fing an, ruhelos auf- und abzugehen. Wenn er doch schon wieder zu Hause wäre! Nur auf dem Land fühlte er sich richtig wohl. Das Berliner Domizil der Familie hatte er nie gemocht. Estelle hatte es zu ihrem Hauptwohnsitz erkoren. Weil ihr das Landgut und das Haus in Pommern »zu schmutzig« waren. Verwöhnte Zicke! All das nutzlose Zeug, das sie hier angeschafft hatte, Nippes und Bücher, als würde sie je lesen! Selbst auf einem Klavier hatte sie bestanden, dabei war sie so musikalisch wie ein quietschender Lackschuh.
Bodo leckte sich über die Lippen. Am liebsten hätte er jetzt etwas Alkoholisches, aber das konnte er sich nicht leisten. Er brauchte einen klaren Kopf, wenn er sich mit den Männern vom Landbund traf. Also besser ein Glas Apfelmost.
Bodo verließ das Wohnzimmer und stieg die Treppe in den Keller hinunter. Hier war es noch kälter als oben, aber das hielt die Lebensmittel frisch, den Käse und die Butter, die Würste und den Wein. Bodo trat ans Regal, in dem die braunen Flaschen mit Apfelmost standen, und griff sich die vorderste. Wie gewöhnlich schüttelte er sie, um die Trübung zu verteilen.
Die darauf folgende Explosion riss ihm den Arm ab, zerfetzte sein Gesicht, seinen Körper, das Regal, die Schränke, jagte Splitter durch den Raum und tötete ihn auf der Stelle. Ihm blieb nicht mal die Zeit, darüber gekränkt zu sein, dass jemand seinen Tod wünschte.
1
Freitag, 4. November – Sonntag, 25. Dezember 1932
Man muss dem Volk nur den Stiefelabsatz durch die Schnauze ziehen, dann pariert es schon.
Franz von Papen
1
Er würde zu spät kommen, so viel stand fest. Hendrik verfiel in einen leichten Trab, gab aber zwei Querstraßen weiter wieder auf, weil ihm sein linkes Bein Beschwerden bereitete, sein Andenken aus dem Krieg. Wie ärgerlich!
Bürgersteige und Fahrdämme waren schwarz vor Menschen auf dem Weg zur Arbeit, wandernde Armeen von Fußgängern mit Regenschirmen, dazwischen Radfahrer, selbst Pferdedroschken waren im Einsatz, um die fehlenden Busse, Straßenbahnen und U-Bahnen zu ersetzen. Niemand hatte erwartet, dass die Arbeiter der Berliner Verkehrsbetriebe wirklich streiken würden. Gewiss, es wurde hart um den Lohn gestritten, aber man ging doch davon aus, dass sich die Parteien im letzten Moment einigen würden. Dass die Stadt an diesem Morgen praktisch lahmgelegt war, traf die Einwohner Berlins deshalb unvorbereitet.
Und das bei diesem Schmuddelwetter! Hendrik zog den Kopf zwischen die Schultern und schlug den Kragen hoch, aber natürlich machte das keinen Unterschied. Der Nieselregen hatte bereits Hut und Mantel durchweicht. Es wäre nicht verwunderlich, wenn er sich eine Erkältung zuziehen würde.
Zu dumm, dass er sein Fahrrad nicht benutzen konnte, dann hätte er vielleicht noch eine Chance gehabt, pünktlich zu sein. Aber die Kette war ihm neulich gerissen, und er hatte bisher versäumt, sie zu reparieren, weil er mit dem Gedanken liebäugelte, sich ein Ballon-Fahrrad mit Freilauf-Rücktrittbremse zu kaufen. Achtundvierzig Mark, drei Jahre Garantie.
Die S-Bahnen fuhren noch, soviel er wusste, weil sie der Reichsbahn gehörten. Aber bis er den nächsten S-Bahnhof erreicht hätte, konnte er schon halb in Charlottenburg sein. Außerdem war der Andrang bei den Bahnen sicher so groß, dass man mit Verspätungen rechnen musste. Also verzichtete er darauf und hielt stattdessen Ausschau nach einem Taxi. Sofern sich überhaupt eines blicken ließ, war es jedoch stets besetzt.
Vielleicht sollte er einen Artikel darüber schreiben. Über den Streik und dessen Hintergründe, über die Stadt im Chaos. Er könnte das Geld gebrauchen. Seit er bei der Universität gekündigt hatte und nicht länger ein Professorengehalt bekam, schlug er sich mit Zeitungsbeiträgen durch. In der Vossischen hatte er eine eigene Kolumne, in der er das Zeitgeschehen auf philosophische Art kommentierte. Viel brachte das allerdings nicht ein. Noch konnte er von seinem Ersparten zehren, aber das würde nicht ewig reichen.
Hendrik spürte, wie sich seine Strümpfe mit Wasser vollsogen, und fluchte. Seine Kleidung klebte ihm am Körper. Und der graue Himmel bot keinen Anlass, darauf zu hoffen, dass sich die Wolken in absehbarer Zeit verziehen würden. Glücklich, wer ein Auto besaß oder Fahrgemeinschaften bilden konnte!
Ein Mann mit Aktentasche hastete an ihm vorbei und übersprang eine Pfütze. Unter einer Markise standen zwei Frauen und diskutierten den Streik. Blätter fielen von den Bäumen auf die nassen Straßen. Automotoren und Signalhörner dominierten die Sinfonie der Großstadt und ersetzten das gewohnte Quietschen der Straßenbahnen.
Hier und da hatten nächtliche Sabotagetrupps Schalthebel an den Masten der Oberleitung abgebrochen, um die Verkehrsbetriebe daran zu hindern, den Streik zu unterlaufen. Hendrik entdeckte einen umgekippten Bus mit eingeworfenen Scheiben. Etwas weiter vorn waren Schienen aufgerissen worden. Die tarifliche Auseinandersetzung nahm offenbar gewaltsame Formen an.
Plötzlich betätigte jemand in seiner Nähe ein Horn, und dann hielt ein ramponierter Benz-Gaggenau mit offener Ladefläche, auf der sich ein gutes Dutzend Männer, vorwiegend Arbeiter, drängte, neben ihm an Straßenrand. »Hallo, Herr Lilienthal!«, rief eine Stimme aus dem überfüllten Führerhaus.
»Herr Broscheck! Seit wann besitzen Sie denn einen Lastwagen?«
»Geliehen. Ich nutze die Gelegenheit, um ein bisschen was zu verdienen. Wo wollen Sie hin?«
»Nach Charlottenburg.«
»Bis zum Savignyplatz kann ich Sie mitnehmen. Springen Sie rauf!«
Das ließ sich Hendrik nicht zweimal sagen. Hände griffen zu und halfen ihm auf die Ladefläche, wo er sich dankbar zwischen die anderen Männer quetschte. Ihm gegenüber entdeckte er einen ehemaligen Kollegen, der an der Universität Geschichte lehrte. »Professor Helbig!«, sagte er überrascht.
Verhaltenes Nicken war die Antwort. Helbig gehörte zu denjenigen, die ihm früher das Leben schwer gemacht hatten, weil sie seine politische Haltung missbilligten. Vermutlich hätte der Mann es vorgezogen, ihm nicht zu begegnen.
Herr Helbig setzte ein leutseliges Lächeln auf und erkundigte sich: »Wohin sind Sie unterwegs?«
»Nach Charlottenburg. Zu meiner Frau.« Josephine hatte gestern eine Freundin besucht und bei ihr übernachtet, um heute früh zwei Straßen weiter dem Pfarrer ihrer ehemaligen Kirchengemeinde bei der Notspeisung der Armen zu helfen. Hendrik hatte versprochen, sie abzuholen und mit ihr ein Geschenk für seinen Bruder auszusuchen, dessen Geburtstag in zwei Wochen anstand.
»Verdammter Streik, was?«
Hendrik zuckte die Achseln. Er hatte keine Lust, sich auf eine politische Diskussion mit seinem ehemaligen Kollegen einzulassen.
Doch Herr Helbig redete sich in Rage. »Die Arbeiter haben kein Recht dazu«, fuhr er fort, »nicht mal nach den Satzungen der Gewerkschaften. Die vorgeschriebene Dreiviertelmehrheit für den Streik wurde bei der Urabstimmung nicht erreicht.«
»Von den Anwesenden waren 78 Prozent dafür.«
»Das spielt keine Rolle, der Arbeitskampf ist ungesetzlich. Die Gewerkschaften selbst haben erklärt, dass eine Streikmehrheit nicht gegeben ist.«
»Schon recht. Dennoch kann ich den Streikenden keinen Vorwurf daraus machen, dass sie die ständigen Lohnkürzungen nicht länger hinnehmen.«
»Was wollen Sie, die verdienen doch mehr als die übrigen kommunalen Arbeiter. Und die Direktion der BVG hat eingelenkt. Das ganze Chaos wegen zwei Pfennigen Lohnkürzung. Wegen zwei Pfennigen!«
»Pro Stunde«, mischte sich einer der Arbeiter auf der Ladefläche des Lastwagens ein. »Das ist bereits die siebte Lohnsenkung seit Ausbruch der Wirtschaftskrise. Die Kollegen verdienen im Durchschnitt nur noch hundertsechzig Reichsmark, ganz abgesehen von den unbezahlten Feierschichten. Und der Tarif soll bloß einen Monat gelten, danach gibt’s womöglich einen weiteren Lohnabbau. Dass die Kameraden die Schnauze voll haben, ist kein Wunder.«
Zustimmendes Nicken.
Herr Helbig schwieg und murmelte etwas in sich hinein.
Der Lastwagen fuhr kreuz und quer durch die Straßen. Von Zeit zu Zeit hielt Herr Broscheck, um einen Mitfahrer an seinem Arbeitsplatz abzusetzen. Je länger sie unterwegs waren, desto deutlicher wurde die Erbitterung, mit der der Arbeitskampf geführt wurde. Offenbar hatte die BVG-Direktion versucht, einen Notverkehr auf die Beine zu stellen, um die Streikenden zu entmutigen. Zwar blieben überall die Gittertore der Untergrundbahnhöfe geschlossen, aber einige Busse und vor allem Straßenbahnlinien waren in Betrieb genommen, jedoch gleich wieder zum Erliegen gebracht worden. Streikende, unter ihnen viele Frauen, errichteten Barrikaden auf den Schienen oder verstopften diese mit Sand und Steinen. Einzelne Straßenbahnwagen waren umgekippt oder deren Leinen zur Stromstange durchschnitten worden.
Hendrik wurde Zeuge, wie BVG-Arbeiter eine Straßenbahn enterten. Die aufgebrachten Männer und Frauen warfen Steine; Scheiben gingen zu Bruch, Splitter regneten über die erschrockenen Fahrgäste, die sich schreiend duckten. Der Fahrer versuchte durchzubrechen, doch eine Barriere aus Geröll und Tonnen hinderte ihn daran. Die Bahn kam zum Stehen. Arbeiter stemmten die Türen auf und zwangen die Insassen zum Aussteigen. Fluchtartig verließen die Fahrgäste den Wagen; ein alter Mann mit Glassplittern im Haar stürzte dabei, einer Frau lief ein Blutfaden die Wange hinunter, ein kleiner Junge weinte. Die Streikenden schlugen auf den Fahrer ein und nahmen ihm die Kurbel weg.
»Die BVG hat die Bullen zu Hilfe gerufen«, sagte der Arbeiter, der sich vorhin eingemischt hatte. »Die haben schon etliche Menschen abgeknallt.«
»Unsinn«, fuhr ihn Herr Helbig an.
»Kein Unsinn. Vorm Straßenbahndepot Belzigerstraße haben sie in die Menge geschossen und sogar noch auf die Fliehenden gezielt. Die haben den Befehl, rücksichtslos von der Schusswaffe Gebrauch zu machen.«
»Hab’ ich auch gehört«, sagte ein anderer.
»Aber nicht alle machen mit«, meinte ein dritter. »Manche tun nur so, ich hab’s gesehen.«
Erregt stritten die Männer darüber, wie das Verhalten der Polizei einzuschätzen war. Hendrik beteiligte sich nicht daran. Er würde bei Gelegenheit seinen Bruder befragen. Gregor konnte ihm aus erster Hand berichten, was an den Gerüchten dran war. Viel mehr beschäftigte ihn die Tastsache, dass man inzwischen überall SA-Männer in Uniform unter den Streikenden sah, die offenbar Hand in Hand mit Kommunisten Weichen mit Brecheisen unbrauchbar machten oder Bäume fällten und auf die Leitungen stürzen ließen. Eigentlich sollte ihn die Zusammenarbeit nicht überraschen. Die Fluktuation an den Rändern des Parteienspektrums hatte es immer schon gegeben. Was die Extremisten beider Seiten vereinte, war ihr Hass auf die Republik, auf Demokratie und Meinungsfreiheit. Dennoch: Joseph Goebbels und Walter Ulbricht, die gemeinsame Sache machten, das war eine besorgniserregende Entwicklung!
Vermutlich wollten sich die Nazis kurz vor der Reichstagswahl am Sonntag noch als Arbeiterfreunde darstellen. Bei der letzten Wahl vor drei Monaten hatten sie über 37 Prozent der Stimmen geholt und damit die Zahl ihrer Mandate mehr als verdoppelt. Hindenburg empfing Hitler inzwischen zu Gesprächen über eine Regierungsbeteiligung, und wenn der Reichspräsident auch einem Führungsanspruch Hitlers eine deutliche Absage erteilte, so gab es doch keinen Zweifel, dass er einer Einbeziehung der Nationalsozialisten in die Regierung wohlwollend gegenüberstand. Vermutlich hoffte er, die Nazis als Juniorpartner unter Reichskanzler Papen unter Kontrolle zu bekommen. Zweifellos gefiel ihm auch der Gedanke einer Konzentration aller national gesinnten Kräfte, also einer Koalition vom Zentrum bis zur NSDAP; die Einigkeit des Volkes unter einer nationalkonservativen Regierung war von jeher seine politische Vision gewesen.
Vor allem aber wollte Hindenburg langfristig den Reichstag ausschalten, weil er im Parlamentarismus die Wurzel allen Übels sah. Deshalb hatte er auch Papen mit einer Blankovollmacht ausgestattet, mit der der Kanzler jederzeit den Reichstag auflösen konnte. Und sich, wenn man dem Geraune aus regierungsnahen Kreisen Glauben schenken durfte, sogar bereit erklärt, auf verfassungswidrige Weise die anschließend zwingend notwendigen Neuwahlen auszusetzen, weil Hindenburg nur zu gut wusste, dass diese den mangelnden Rückhalt der Regierung Papen noch klarer zutage treten lassen würden. In der Tat hatte ein Misstrauensantrag neulich gezeigt, wie isoliert Papens »Kabinett der Barone« dastand.
Hitler hingegen hatte sich brüskiert gefühlt, als der Reichspräsident es ablehnte, ihn, den Führer der stärksten politischen Partei, zum Kanzler zu machen und mit demselben präsidialen Machtmittel zu versehen, das er Brüning und Papen in die Hände gelegt hatte, dem Recht zum Erlass von Notverordnungen. Kampf gegen die Regierung Papen war daher die Reaktion der Nazis.
Die Abfuhr Hindenburgs dürfte nicht die einzige Sorge sein, mit der sich Hitler herumplagen musste. Seine Schergen hatten im Zuge des blutigen Wahlkampfs im Juli zahllose politische Gegner ermordet, woraufhin sich die Regierung nach endlosem Zaudern gezwungen sah, eine Notverordnung zu verabschieden, die für politische Morde die Todesstrafe vorsah. Nur Stunden später hatten SA-Männer einen kommunistischen Arbeiter in dessen Wohnung vor den Augen seiner Mutter erschlagen und waren daher zum Tode verurteilt worden, was Hitler veranlasste, sich vor seine Männer zu stellen. Die NS-Presse fuhr eine beispiellose Kampagne gegen das Urteil. Mit dem Ergebnis, dass Papen Hindenburg zur Umwandlung in eine lebenslange Freiheitsstrafe überreden konnte. So etwas hatte es noch nicht gegeben, dass sich eine politische Partei offiziell für rechtsgültig verurteilte Mörder einsetzte!
Privat ging es bei Hitler anscheinend nicht weniger gewalttätig zu. Durch Gregor und die Politische Polizei wusste Hendrik, dass es im Leben des Führers der Nationalsozialisten seit Kurzem eine geheim gehaltene Geliebte namens Eva Braun gab, die vor drei Tagen versucht hatte, sich das Leben zu nehmen, weil sie sich vernachlässigt fühlte.
Hendrik wurde aus seinen Gedanken gerissen, weil sich Herr Helbig süffisant erkundigte: »Was macht Ihre neue Tätigkeit?«
»Man schlägt sich so durch. Es ist nicht einfach, mit Artikeln seine Brötchen zu verdienen.«
»Daran sind Sie selbst schuld. Wenn Sie sich ein bisschen angepasst hätten, hätten Sie es nicht nötig, auf diese würdelose Weise Ihren Lebensunterhalt zu bestreiten.«
Unwillkürlich musste Hendrik lachen.
»Was ist daran so amüsant?«
»Sie erinnern mich an Platon. Der traf einst Diogenes Laertios dabei an, wie er Kohl spülte, und hielt ihm vor: Hättest du dich dem Dionysos fügsam erwiesen, so brauchtest du keinen Kohl zu waschen. Woraufhin Diogenes erwiderte: Und hättest du dich zum Kohlabspülen herabgelassen, so hättest du dich nicht dem Dionysos dienstbar gemacht.«
»Idiot!«, murmelte Herr Helbig, was Hendrik erneut zum Lachen brachte.
Am Savignyplatz sprang er von der Ladefläche und bedankte sich bei Curt Broscheck, der sich weigerte, Geld von ihm anzunehmen. Dann legte er den Rest des Weges zu Fuß zurück, wobei er mehrmals einer Auseinandersetzung zwischen Streikenden und Schupos ausweichen musste.
Zu seiner Erleichterung war Josephine noch nicht fort. Er entdeckte sie, wie sie mit zwei Mädchen in den Quadraten von Himmel und Hölle hin und her hopste, und musste grinsen. Typisch Josephine! Sie bemerkte ihn und spitzte ihren Mund, um ihm über die Entfernung einen Kuss zuzuwerfen.
Hendrik trat näher. »Ich muss euch meine Frau leider entführen«, sagte er zu den Mädchen.
»Schade. Es war gerade so schön«, antworteten die beiden.
»Es ist ja nicht das letzte Mal«, meinte Josephine und verabschiedete sich.
»Ich hatte schon befürchtet, dass du nicht mehr da bist«, sagte Hendrik.
»Ich wusste doch, dass du kommst. Verkehrsstreik hin oder her, wenn’s drauf ankommt, hält dich nichts auf.« Sie küsste ihn und hakte sich bei ihm ein. »Hast du dir schon überlegt, was wir deinem Bruder schenken?«
»Für Gregor etwas Passendes zu finden, ist nicht einfach. Ich dachte, ich lasse mich von den Auslagen in den Geschäften inspirieren. Und ich hoffe auf deine Unterstützung. Es sollte jedenfalls etwas Originelleres als eine Krawatte sein.«
»Ich hätte vielleicht eine Idee.«
»So?«
»Was hältst du von Eintrittskarten für den Wintergarten? Thea Alba tritt wieder auf.«
»Großartig!«, rief Hendrik aus. »Das ist ein wunderbarer Vorschlag. Und für uns kaufen wir gleich zwei Karten mit.« Er war selbst neugierig auf die »Frau mit den zehn Gehirnen«, die mit aufgesteckten Kreiden an ihren Fingern simultan zehn Ziffern gleichzeitig schreiben oder verschiedene Worte mit Händen, Füßen und Mund parallel auf eine Tafel malen konnte.
Sie besorgten die Eintrittskarten und noch ein paar Dinge mehr und machten sich am frühen Nachmittag auf den Rückweg. Der Regen hatte inzwischen aufgehört, deshalb beschlossen sie, zu Fuß nach Hause zu gehen, statt zu versuchen, eine Mitfahrgelegenheit zu ergattern. Die BVG hatte es offenbar aufgegeben, einen Notverkehr durchzusetzen. Die Streikenden, die am Morgen noch vor den Depots und in den Bahnhöfen versucht hatten, die Ausfahrt von Bussen, Straßenbahnen und U-Bahnen zu verhindern, blockierten jetzt vor allem Kreuzungen und Hauptverkehrsstraßen.
Am Olivaer Platz waren Hunderte von Männern und Frauen versammelt. Gerade kam eine Straßenbahn um die Ecke gefahren. Von allen Seiten stürzten die Arbeitskämpfer darauf zu und bewarfen sie mit Steinen. Auf dem Vorder- und Hinterperron befand sich jedoch eine Schupoeskorte, die sofort die Pistolen zog und in die Menge schoss. »Herunter mit den Bluthunden«, brüllte jemand, doch die meisten Menschen flohen oder warfen sich flach auf den Boden. Einer der Männer wälzte sich getroffen auf der Straße und schrie wie am Spieß. Zwei Kollegen zerrten ihn in einen Hauseingang.
Hendrik und Josephine hatten sich hinter eine Litfaßsäule geflüchtet. Eine Kugel schlug nicht weit von ihnen in eine Hausmauer ein.
»Komm, weg hier!«, schrie Josephine.
Sie fassten sich bei den Händen und rannten um ihr Leben. Erst drei Straßen weiter hielten sie außer Atem an.
»Das war knapp«, keuchte Hendrik.
Josephine hielt sich die schmerzende Seite. »Wir hätten sterben können! Sind die denn verrückt geworden?«
»Lass uns machen, dass wir nach Hause kommen.«
In Schöneberg erwartete sie jedoch ein weiteres Anzeichen dafür, dass der Streik außer Kontrolle geraten war: Mitten auf der Fahrbahn, inmitten einer Blutlache, lag eine Leiche. Der Uniform nach handelte es sich um einen SA-Mann. Autos machten einen Bogen um den Toten, wagten jedoch nicht anzuhalten. Passanten auf dem gegenüberliegenden Bürgersteig huschten vorüber und bemühten sich dabei, nicht hinzusehen. Eine Gruppe Männer in braunen Hemden umstanden den leblosen Körper und tauchten ihre Sturmfahne wieder und wieder in das Blut des Toten, das übliche Ritual, um sie zur »Blutfahne« zu weihen.
Hendrik und Josephine beeilten sich, außer Sicht zu gelangen, und atmeten erst auf, als sie ihr Zuhause erreichten. Dort erwartete sie eine Überraschung in Gestalt eines jungen Mannes, der auf den Treppenstufen zu ihrer Wohnung saß.
»Herr von Salburg-Oertzen!«, sagte Hendrik entgeistert. »Was machen Sie denn hier?«
»Ich muss mit Ihnen reden«, erwiderte der Mann und erhob sich, um Josephine zu begrüßen.
Hendrik stellte die beiden einander vor: »Meine Frau – Ferdinand von Salburg-Oertzen. Ihn habe ich damals im Zeppelin kennengelernt.«
»Und vor einer großen Dummheit bewahrt.«
»Das haben Sie selbst getan.«
»Unterschätzen Sie Ihren Einfluss nicht. Dürfte ich Sie wohl einen Augenblick sprechen? Es ist dringend.«
»Selbstverständlich. Kommen Sie herein.« Hendrik schloss die Tür auf.
Die drei begaben sich in die Wohnung. Josephine bot an, einen Tee zuzubereiten. Hendrik und Ferdinand nahmen im Wohnzimmer Platz.
»Es geht um Odile von Lehndorff-Alvensleben«, begann der junge Mann ohne Umschweife.
»Aber Sie sagten doch damals –«
»Nein, nein, Sie missverstehen mich, ich habe sie nicht geheiratet. Aber wir sind uns freundschaftlich verbunden geblieben. Sie hat mich um Hilfe gebeten, weil … Nun, eigentlich geht es nicht um sie, sondern um ihre Base, Margot von Hochstein, die wiederum …« Ferdinand brach ab. »Verwandtschaftsbeziehungen können kompliziert sein, was?«
»Am besten, Sie fangen noch mal von vorn an.«
»Es hat einen Mord gegeben, soviel ich weiß. Bodo von Hochstein heißt das Opfer. Seine Frau hat ihn gefunden, jedenfalls das, was noch von ihm übrig ist, und ihren Schwager angerufen, weil sie nicht wusste, was sie tun sollte. Dessen Frau, eben Margot von Hochstein, hat Odile kontaktiert, weil sie sich an den Mord an meinem Vater und Ihren Beitrag bei der Aufklärung erinnerte, und Odile hat dann mich … Kurz und gut, ich bitte Sie, sich der Sache anzunehmen.«
»Ich?«
»Sie haben damals zusammen mit Ihrer Schwägerin im Handumdrehen herausgefunden, wer meinen Vater auf dem Gewissen hatte.«
»Genau genommen –«
»Wir haben Vertrauen in Sie. Bitte sagen Sie nicht nein. Estelle … Estelle von Hochstein, die Frau des Ermordeten … Sie hat explizit nach Ihrem Bruder verlangt, als sie die Polizei verständigte, in der Hoffnung, dass Sie und er und Ihre Schwägerin gemeinsam …«
Unschlüssig kratzte sich Hendrik am Kopf. Es war nicht seine Aufgabe, einen Mordfall zu lösen; die Angelegenheit war bei seinem Bruder in guten Händen. Außerdem war es zur Zeit gefährlich draußen. Andererseits war er nicht unempfänglich für die Bitten des jungen Mannes, der ihm immer sympathisch gewesen war. Sein Ringen um den richtigen Lebensweg hatte ihm damals imponiert.
»Bitte«, flehte Ferdinand von Salburg-Oertzen.
Verdammt, dachte Hendrik, worauf lasse ich mich jetzt schon wieder ein?
2
Wie erwartet war Gregor nicht gerade erbaut davon, dass Hendrik am Tatort auftauchte. »Ich habe schon gehört, dass man dich ›angefordert‹ hat«, sagte er. »Als wärst du ein Privatdetektiv.«
»Es ist mir selbst peinlich«, erwiderte Hendrik. »Lässt du mich trotzdem dabei sein? Ich stehe auch nicht im Weg.«
Gregor sah ihn an. Lange. »Dass dir das bloß nicht zu Kopf steigt«, sagte er schließlich und wandte sich wieder einem Schriftstück zu, in dem er zuvor gelesen hatte.
»Was ist geschehen?«, wagte Hendrik zu fragen.
»Eine Explosion. Im Keller.«
Davon war hier oben nichts zu bemerken.
Wie aufs Stichwort kam ein Mann die Kellertreppe herauf und steuerte auf Gregor zu. Hendrik kannte ihn; es handelte sich um Björn Jaeger, den Sprengstoffexperten der Kriminalpolizei, von dem er immer dachte, er sähe aus, als hätte eine gute Fee einen Nussknacker zum Leben erweckt. Mit seinem kantigen Gesicht signalisierte er, dass mit ihm im Konfliktfall nicht gut Kirschen essen war, aber auch, dass man sich vertrauensvoll an ihn wenden konnte, wenn es ein Problem zu knacken galt, dessen Lösung Biss verlangte.
Herr Jaeger stutzte, als er Hendrik entdeckte, nickte kurz und meinte dann zu Gregor: »Wir werden den ganzen Tag brauchen, um uns durch das Chaos zu wühlen.«
»Kannst du mir schon irgendwas sagen?«
»Ich tippe auf Nitroglyzerin, aber das ist nur eine Arbeitshypothese. Morgen weiß ich mehr.«
Während sich die beiden unterhielten, sah Hendrik sich um. Das Haus der von Hochsteins war ein widersprüchliches Konglomerat aus Niveau und Kitsch. Einerseits waren überall hochwertige Materialien verwendet worden: eichengetäfelte Wände, zweiflüglige Zimmertüren aus Mahagoni, ein samtbezogenes Sofa, Sitzgruppen, über die Seidentücher drapiert waren, ein wuchtiger Tisch aus Nussbaumholz, Damasttischdecken. Der Boden bestand aus Steinfliesen in warmen Tönen, über die Läufer gelegt worden waren. Verglaste Türen führten zur Terrasse und zum Garten. Einen Kamin gab es auch. Davor lag allerdings ein schmutziges Bärenfell, dem ein Ohr fehlte. Hinter einem halb zurückgezogenen Vorhang befand sich ein billiges Hängeregal mit einem halben Dutzend achtlos daraufgeworfenen Büchern und eine Ablage mit der Kreuz-Zeitung, der Gartenlaube und einigen Modejournalen. Geschmacklose Plastiken aus der Massenproduktion standen wahllos verstreut auf kleinen Tischchen und dem Sockel für die zwei Meter große Palme. Skizzenhaft ausgeführte Modezeichnungen, koloriert mit Pastell- oder Wasserfarben, hingen neben Ölgemälden röhrender Hirsche. Durch eine offene Tür konnte Hendrik ins Arbeitszimmer sehen, dort befand sich ein arg mitgenommener Billardtisch. Außerdem gab es einen puristisch ausgestatteten Gymnastikraum. Wenn er raten müsste, würde er vermuten, dass sich die Interessen von Hausherr und Hausdame bissen. Einen zweifelhaften Geschmack besaßen beide.
Da Herr Jaeger seinen vorläufigen Bericht beendet hatte und sich wieder in den Keller begab, nutzte Hendrik die Gelegenheit und erkundigte sich bei seinem Bruder: »Hast du die Ehefrau schon verhört?«
»Das habe ich jetzt vor.«
»Darf ich …?«
Gregor verzog das Gesicht, forderte ihn aber mit einem Kopfnicken auf, ihn zu begleiten, und stieg die Treppe zum ersten Stock hinauf. Von oben schlug ihnen Stimmengewirr entgegen. »Nachbarinnen«, erklärte Gregor.
Sie betraten einen weiteren Salon, in dem sich vier Frauen aufhielten.
Auf den ersten Blick erweckte Estelle von Hochstein den Eindruck, eine Perle unter Kieselsteinen zu sein, weil sie sich sowohl durch ihre ebenmäßigen Gesichtszüge und die reine Haut als auch durch Kleiderwahl, Haltung und Make-up von den anderen Damen absetzte. Doch schon auf den zweiten Blick wurde deutlich, dass sie eher ein Kieselstein unter lauter Perlen war, denn während sich ihre Nachbarinnen rührend um sie sorgten, wirkte sie mehr wie eine Darstellerin ihres eigenen Schicksals. »Der Verlust meines Mannes zerreißt mich innerlich!«, stieß sie mit Tremolo in der Stimme hervor. »Aber ich muss stark sein. Für die Familie. Für die Polizei.« Bedeutsam nickte sie Gregor zu.
»Wie tapfer Sie Ihren Schicksalsschlag ertragen!«, sagte eine der Nachbarinnen.
»Würden Sie uns bitte allein lassen?«, bat Gregor die Damen. »Ich möchte mit Frau von Hochstein sprechen.«
Gehorsam erhoben sich die Frauen und verließen den Raum, nicht ohne die junge Witwe noch einmal ihres Mitgefühls zu versichern.
»Sind Sie in der Lage, uns ein paar Fragen zu beantworten?«, wollte Gregor wissen.
»Fragen Sie nur, ich beiße die Zähne zusammen«, erwiderte Estelle von Hochstein.
»Zunächst einmal wüsste ich gern, wie Sie Ihren Mann gefunden haben.«
»Es war furchtbar, ganz furchtbar! Ein Albtraum! Ich kam nach Hause und habe nach ihm gerufen. Bodo hat nicht geantwortet, aber die Kellertür stand offen. Da bin ich nach unten gegangen und da … da …« Eine Träne rann ihr die Wange hinab.
Hendrik kam der Gefühlsausbruch nicht echt vor. Vermutlich war Estelle von Hochstein eine jener Frauen, die auf Knopfdruck Tränen produzieren konnten.
Gregor reagierte nicht darauf, sondern wartete einfach ab, deshalb schniefte die junge Witwe nur noch einmal und fuhr dann fort: »Ich weiß nicht, wie ich es ausgehalten habe. Es war der Schock meines Lebens.«
Hendrik, der normalerweise für die Schwächen anderer viel Verständnis aufbrachte, fing an, Estelle von Hochstein herzlich unsympathisch zu finden. Sie machte selbst aus dem Tod ihres Mannes noch eine Bühne für ihre Selbstdarstellung, als sei sie die Hauptfigur in diesem Drama. Aber vielleicht tat er ihr Unrecht. Vielleicht war es einfach ihre Art, mit einem Schicksalsschlag umzugehen.
»Warum waren Sie sofort überzeugt, dass es sich um einen Mord handelte?«
»Wie meinen Sie das?«
»Nun, es hätte schließlich auch ein Unfall sein können, eine Gasexplosion infolge eines Lecks. Es wäre nicht die erste.«
»Wir haben kein Gas im Haus. Und Bodo hatte Feinde.«
»So?«
»Auf jeden Fall. Seiner Schwester, zum Beispiel, traue ich alles zu. Irene hat nie damit hinterm Berg gehalten, dass sie mich verachtet, die blöde Kuh. Auf Bodo hat sie auch herabgesehen. Und ihr Mann genauso. Eiskalte Arschlöcher, die beiden.«
»Das ist kein Motiv.«
»Sie haben Bodo verklagt, wegen des Erbes. Seitdem ist jedes Zusammentreffen mit ihnen die Hölle. Die ganze Familie ist bescheuert, abgesehen von Konrad.«
»Das ist der Mann, den Sie zuerst verständigt haben, ja?«
»Bodos Bruder. Der Einzige in der Familie, der was taugt. Die anderen … Wie gesagt: Seine Schwester und ihr Mann sind Arschlöcher. Konrads Frau ist die langweiligste Person auf der Welt und gluckt ständig um ihre nervtötenden Kinder herum. Bodos Mutter, die olle Scharteke, ist eine Giftspritze. Und das einzig Gute, das ich über seinen Vater sagen kann, ist, dass er tot ist.«
»Kürzlich gestorben?«
»Vor zwei Monaten. War lange krank. Hatte seit Jahren Magenprobleme.«
»Gab es sonst noch jemanden, der etwas gegen Ihren Mann haben könnte?«
»Auf jeden Fall. Die Arbeiter, zum Beispiel. Bodo war nicht immer sonderlich feinfühlig im Umgang mit seinen Untergebenen, den Landarbeitern und dem Gesinde.«
»Landarbeiter?«
»Bodos Familie stammt aus Pommern. Bodo hat das Landgut seiner Eltern geerbt.«
Ostelbische Junker, das hatte sich Hendrik nach dem Gespräch mit Ferdinand von Salburg-Oertzen schon gedacht.
»So ein Gut verlangt viel Aufmerksamkeit«, sagte Gregor. »Ich vermute, dass es Ihrem Mann nicht oft möglich war, nach Berlin zu kommen?«
»Selten. Und jetzt wird es hier noch einsamer für mich werden.«
»Wie meinen Sie das, noch einsamer? Lebten Sie beide denn nicht zusammen?«
»Schon, aber mein Beruf erfordert es, dass ich überwiegend in Berlin und oft auch auf Reisen sein muss. Ich bin Mannequin.«
Das erklärte die teuren Kleider, die sie trug.
»Nebenbei studiere ich an der Berliner Modeschule am Warschauer Platz.«
»So?«
»Na ja, als Mannequin kann man nicht ewig arbeiten, mit dreißig gilt man schon als zu alt fürs Geschäft. Wer klug ist, baut vor.«
»Was lernt man denn in so einer Modeschule?«
»Die Grundlagen. Alles, was man für die Mode braucht, theoretisch wie praktisch: Materiallehre, Farbchemie, Volkswirtschaft, Anatomie, aber auch die Putzmacherei, das Schneidern und Modezeichnen.«
»Dann stammen die Bilder an den Wänden von Ihnen?«
»Auf jeden Fall. Vielleicht arbeite ich später als Modezeichnerin. Oder entwerfe selbst Kleider. Ich habe ehrgeizige Pläne. Irgendwann will ich eine leitende Stellung in einem Modehaus bekleiden.« Sie kicherte, als sie ihr unbeabsichtigtes Wortspiel bemerkte.
»Was bedeutet ›nicht sonderlich feinfühlig‹? Wie ist Ihr Mann mit seinen Untergebenen umgegangen?«
»Na ja, er hat eben Wert auf Respekt gelegt. Wenn ihm jemand dumm kam, konnte er schon mal die Faust erheben.«
»Aha.« Gregor ließ nicht durchblicken, was er dachte. »Haben Sie sich mit Ihrem Mann verstanden?«
»Auf jeden Fall! Mein Bodo und ich, wir waren ein Herz und eine Seele. Wie kommen Sie darauf, dass es anders sein könnte?«
»Sie beide lebten offenbar einen nicht unwesentlichen Teil des Jahres getrennt voneinander, und Ihre Berufe scheinen mir auch nicht gerade gut miteinander vereinbar zu sein.«
»Liebe überwindet alle Schwierigkeiten«, sagte sie theatralisch. »Bodos Tod trifft mich bis ins Mark.«
»Ihr Mann besitzt also ein Landgut in Pommern. Aus welchem Grund war er dann in Berlin?«
»Er wollte den Reichslandbund aufsuchen. Aber dazu ist es nicht mehr gekommen. Armer, armer Bodo! Ich weiß nicht, wie ich diesen Schmerz aushalten soll.« Sie hielt sich die Hand vor die Stirn.
»Wann ist er in Berlin eingetroffen?«
»Gestern Abend.«
»Also haben Sie ihn noch gesprochen, bevor er getötet wurde?«
Sie nickte.
»Hat er irgendetwas gesagt, was darauf schließen lässt, dass er so etwas«, Gregor machte eine Handbewegung zum Keller hin, »befürchtete?«
»Nein, absolut nicht.«
»Und wo waren Sie, als Ihr Mann ermordet wurde?«
»Ich, äh, habe einen Waldlauf gemacht. Als Mannequin muss man in Form bleiben.«
»Lange?«
»Ein paar Stunden. Ich bin gern im Wald.«
»Hat Sie jemand dabei gesehen?«
»Nicht, dass ich wüsste.«
Gregor nickte. »Nun gut.« Er erhob sich. »Ach, eine Sache noch: Warum haben Sie als Erstes Ihren Schwager angerufen?«
»Ich war außer mir. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Konrad ist so vernünftig. Pragmatisch. Er schafft es immer, einen auf den Boden zurückzuholen.«
»Was hat er gesagt?«
»Dass ich die Polizei rufen und nichts anfassen soll. Das habe ich gemacht.«
Gregor beendete die Befragung und entließ Estelle von Hochstein.
Hendrik war nicht sicher, was er von ihr halten sollte. Sie wirkte billig, was vor allem an ihrer Art zu reden lag, aber wenn sie intelligent genug war, das natürliche Ende ihres Mannequinberufs vorauszusehen und ein ehrgeiziges Studium an der Modeschule absolvierte, sollte man besser nicht den Fehler begehen, sie zu unterschätzen.
3
Der Mensch ist zu erstaunlichen Dingen fähig. Er kann seinen Umgang mit der Welt dosieren und seine Umgebung je nach Bedürfnis wahrnehmen oder ausblenden, er kann seinen Verstand so konditionieren, dass dieser sich auf Gegebenheiten einlässt oder sich ihnen verweigert. Um in schweren Zeiten nicht zu verzweifeln, zieht sich manch einer ins Private zurück, andere erfüllen die Anforderungen des Alltags mechanisch, ohne innere Beteiligung, wieder andere verstehen sich darauf, sich auf eine begrenzte Aufgabe zu konzentrieren und den Rest auszublenden. Gregor hingegen war nicht der Typ, der Veränderungen zum Schlechten einfach hinnahm, deshalb machte sich Diana Sorgen um ihren Mann.
Nach dem Preußenschlag, der rechtswidrigen Absetzung der Preußischen Regierung durch Papen und Hindenburg, waren etliche leitende Beamte entlassen und durch konservativere ausgetauscht worden. Zwar blieben die unteren Hierarchieebenen weitgehend unangetastet, fähige Kriminalisten wurden unter jeder Regierung gebraucht, doch die politische Schlagseite war nicht zu übersehen. Beispielsweise galten nun alle vier Inspektionsleiter des Außendienstes der Politischen Polizei als Nazisympathisanten. Nicht wenige Kriminalbeamte bekannten sich mehr oder minder offen zum Nationalsozialismus: Arthur Nebe, zum Beispiel, der Fälschungsspezialist Liebermann von Sonnenberg oder der Einbruchexperte Otto Trettin. Rudolf Diels, der eine unrühmliche Rolle beim Preußenschlag gespielt hatte, war zum Oberregierungsrat befördert worden und stand angeblich in ständigem Kontakt mit Hermann Göring.
Das Reichsgericht hatte mittlerweile sein Urteil gesprochen und das Vorgehen der Reichsregierung sanktioniert. Der kommissarisch als Kommandeur der Berliner Schutzpolizei eingesetzte Oberst Poten war offiziell in dieser Funktion bestätigt worden. Der frühere Kommandeur, Oberst Heimannsberg, hatte sein Abschiedsgesuch eingereicht. Gegen ihn und den ehemaligen Polizei-Vizepräsidenten Weiß war zudem Anklage wegen »Widerstands gegen die Staatsgewalt« erhoben worden. Die Feinde der Republik leisteten wirklich ganze Arbeit.
Deshalb tauchte Diana öfter als sonst im Polizeipräsidium auf. Sie wollte es rechtzeitig mitbekommen, wenn ihrem Mann Ungemach drohte, Ärger mit den Vorgesetzten oder gar Entlassung. Abgesehen davon fühlte sie sich berufen, bei der Aufklärung des Mordes an Bodo von Hochstein eine aktive Rolle zu spielen. Schließlich hatte Ferdinand von Salburg-Oertzen auch sie um Hilfe gebeten, nicht wahr?
Gregor war allerdings wenig begeistert, als sie sein Büro betrat. »Was machst du hier?«, fragte er. »Es ist immer noch gefährlich draußen.«