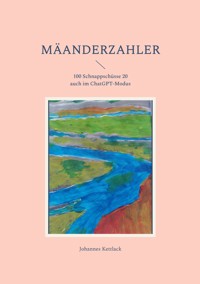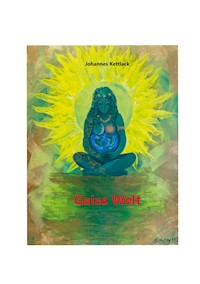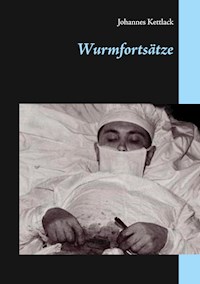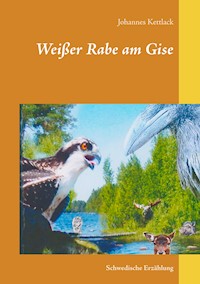Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Es ist ja nur ein Mädchen", sagte Jann, als ihm Dora endlich das erste Kind gebar. Zu seinem Glück, wie er dachte, folgten vier Söhne, und er begann, von seinem großen Bauernhof zu träumen. Das 20. Jahrhundert war jedoch für langfristige Pläne und festen Zukunftsglauben auch für die Kleinen Leute am Niederrhein völlig ungeeignet. Sie arbeiteten hart, litten geduldig und gehörten dennoch zu den Verlierern. Solschenizyn sagte von solchen Menschen, sie leben unter uns und wir merken nicht, dass ohne sie kein Dorf, keine Stadt, ja die Welt nicht existieren könnte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 405
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vorbemerkung
Nach der Lektüre von Paul Celans Todesfuge und den neuen Erkenntnissen zu ihrem biographischen Hintergrund und noch bevor er die Geschichte vom „Zauberlehrling“ Geert Wilders im Original weiterlas, entschied er sich zu schreiben, was und wer ihm immer wieder in den Sinn kam und wie ein ungezogenes Kind an seinem Ärmel zog.
Zunächst trug er sich mit dem Gedanken, unter einem Pseudonym zu schreiben, um den selbsternannten oder gut bezahlten Kritikern in Berlin und Frankfurt aus dem Weg zu gehen. Da er aber Celans Dichte zu erreichen gar nicht vorgab, ein Buch zu schreiben wie das über den niederländischen Politiker sich jedoch sehr wohl zutraute, gab er den Plan schnell wieder auf.
Dass er das Buch wie viele Bewohner des Niederrheins im Original fast ohne Wörterbuch lesen konnte, verdankte er vor allem den Großeltern. Von ihnen lernte er auch den Unterschied zwischen mein und dein; den zwischen mir und mich nicht.
Erste GenerationHenricus & Anna
Zweite GenerationCatherina, Johann, Conrad, Stephan, Maria, Eduard, Theodor,Heinrich, Wilhelmina, Friedrica, KarlTheodor & Gerharda
Dritte GenerationHenn, Hanne, Jann, Wellem, Konrad, GerdJann & Dora
Vierte GenerationGerlinde, Theo, Battje, Hermann, AlfredGerlinde & Bernhard
Fünfte GenerationJann-Bernd, Alfred, Hermann
Inhaltsverzeichnis
Vorbemerkung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Nachwort
Alles ist ewig im Innern verwandt.Clemens Brentano
1
Doras und Janns Muttersprache war eine abgewandelte Form des Holländischen. Ob sie des Hochdeutschen wirklich mächtig waren, war schwer in Erfahrung zu bringen. Beide unterhielten sich mit den Kindern, Enkeln, mit der Verwandtschaft und den Nachbarn ausschließlich in ihrer erdverbundenen, anschaulichen aber emotionsverhüllenden Muttersprache. Sie war in ihnen tief verwurzelt.
Andererseits mussten sie eine passive Grundkompetenz der Hochsprache haben. Schließlich hatten sie beide die Volksschule besucht, den Katechismus auswendiggelernt und die Bibel gelesen. Auch das Bürger-Blatt, die Zeitung für ihren Kreis, lasen beide regelmäßig. Sie hatten sich daran gewöhnt, nicht alles, was in offizieller Sprache ausgedrückt wurde, zu verstehen. So fragten sie beispielsweise nicht nach, wenn der Hausarzt, der häufig gerufen werden musste, unvermittelt ins Hochdeutsche wechselte oder gar medizinische Fachausdrücke benutzte, und bis auf die Predigt verstanden sie ja sonntags in der lateinischen Messe auch nicht viel.
Wenn Dora das „Vaterunser“ und „Gegrüßet seist du, Maria“ sprach, auf Hochdeutsch, wie sie sicher annahm, verschlang sie viele Silben, und die Intonation ähnelte dem repetitiven Mahlgeräusch der Kaffemühle, die sie mindestens zweimal am Tag zwischen den Knien hielt.
Einmal spielte ihr einer der Enkel eine Tonaufnahme des „Vaterunsers“ vor. „Hör dir das mal an, Oma!“, sagte er.
Wie enttäuscht war er, als er statt der erhofften Heiterkeit Unverständnis erntete. Dora hatte sich gar nicht wiedererkannt und empfand es als gotteslästerlich, Gebete in dieser Weise zu missbrauchen.“Wie kannst du das nur tun, Junge?“, fragte sie verärgert, natürlich auf „niederrheinländisch“.
Janns niederländische Vorfahren waren spätestens im 17. Jahrhundert aus den Niederlanden in das Land der Cherusker, genauer in das der Hattuarier gekommen, denen das Dorf seinen Namen „Hetter“ verdankte. Wahrscheinlich kannten seine Bewohner die Sage von Siegfried aus Xanten; ob sie wussten, dass sich dahinter vielleicht der „große Deutsche“ Hermann der Cherusker, verbirgt, ist unwahrscheinlich.
Im Dorf gab es viele Familien mit holländischen Familiennamen. Sie hießen Awater, Blusward, Drost, Mulder, Peerenboom, te Beek, van Haaren, Rademaker oder te Wild und die Vornamen klangen noch holländischer: Rütger, Hermes, Derrick, Joes, Kuntje, Lijsken oder Elsgen.
Janns Großvater Henricus hatte 1848 aus dem niederländischen Nachbardorf einwandern dürfen, aber erst nachdem ein einheimischer Bürger ihm ein Stück Land zur Verfügung gestellt hatte. Eigentlich müsste es heißen: wieder einwandern, denn sein Vater war auf dem Stammsitz der Familie in Hetter geboren. Die Staatsgrenze, die sich im Laufe der Jahrhunderte mehrmals verschoben hatte, war weder eine Sprachbarriere, noch konnte sie verhindern, dass alte Familienbande weiter existierten und neue geknüpft wurden.
Dieser fruchtbare Teil Europas mit seinem eigenmächtigen Fluss, den zahlreichen stillen Wassern und seinem kraftvollen Westwind hatte seit dem Mittelalter viele Herrscher gesehen: die Herzöge von Cleve, die Spanier, die Franzosen, die Niederländer, die Preußen. Es gab am Niederrhein Orte, die mehrfach ihre Staatszugehörigkeit geändert hatten und mit ihnen die Bewohner. Sofern es überhaupt zu einem Wechsel der individuellen Staatsangehörigkeit kam – am Niederrhein lebten selbst im Zweiten Weltkrieg viele Holländer und Deutsche auf der „verkehrten“ Seite der Grenze – mit einem Kulturschock war diese Form der Einwanderung nicht verbunden. Die Diskussion darüber, ob der im Herzogtum Cleve geborene Peter Minuit, der Gründer New Yorks, Deutscher oder Niederländer war, drang nie bis zu den Dörfern beiderseits der Grenze vor. Integrationsprobleme gab es nicht.
Der Gemeinderat stimmte also der „Immigration“ nur unter dieser Maßgabe zu. Das Recht auf Steuerung der Einwanderung hatte der preußische König den Gemeinden eingeräumt, um zu verhindern, dass die Zahl der Bewohner, die der gesetzlich vorgeschriebenen Armenfürsorge unterlagen, nicht zu sehr anstieg. Der Rat, in dem fast ausschließlich grundbesitzende Bauern mit hoher Abgabeverpflichtung saßen, war sich völlig einig, dass „Einwanderung in das Sozialsystem“, wie es 150 Jahre später hieß, vermieden werden musste.
Henricus war Ackerer und hätte sich von diesen zwei Morgen Weideland nicht ernähren können. Er war gerufen worden, um seinen Onkel Derk einmal zu beerben, dessen Söhne vorzeitig verstorben waren. Einmal in Preußen, heiratete er Anna, eine recht vermögende Bauerntochter. Sie brachte zusätzliches Land und eine beträchtliche Summe Bargeld mit in die Ehe. Somit war der kleine Hof wirtschaftlich gesund und hätte Basis für die großen Pläne sein können, die sein Enkel nach dem Ersten Weltkrieg verwirklichen wollte.
Das Dorf, das in Wirklichkeit aus zwei Dorfschaften mit unterschiedlichen Namen, einem Ritter- und einem Landgut bestand, war nach Westen durch zwei Altrheinarme und den Deich vom Hauptstrom getrennt. Nur bei etwas höherem Wasserstand konnten die Bewohner die Lastkähne sehen. Bei richtigem Hochwasser begriffen sie, warum ihre Kirche nun schon seit Jahrhunderten nicht mehr in der Nähe des ursprünglichen Flusslaufes stand. Die Berichte und Erzählungen über Dammbrüche, über in den Fluten versunkene Familien, über Menschen, die auf der Flucht vor dem Wasser auf den Bäumen erfroren waren, vor allem die Tatsache, dass ihr Dorf zweimal vollständig von den Fluten mitgerissen worden war, ließen sie es als gottgegeben hinnehmen, dass man nach Westen den sonst üblichen Weitblick nur auf der Deichkrone hatte. Dieser war umso grandioser, aber auch Ehrfurcht erregender, je höher das Wasser stand: Es hätte die Nordsee sein können, wären da nicht die beiden auf Warften gelegenen Höfe und, vereinzelt, alten Weiden und Pappeln gewesen.
Parallel zum Deich verliefen die Provinzialstraße, später auch die Straßenbahnschienen und die Reichsbahn. In einem großen Bogen, gut fünfhundert Meter von dieser Straße entfernt, verlief die unbefestigte Wiesenstraße, die die Ortsteile untereinander und Hetter mit dem Nachbardorf Verveld verband. Eins der wenigen Häuser gehörte Doras Eltern. Es trug die Hausnummer 1 und gehörte zum Nachbardorf mit eigener Kirche und Schule. Jann und Dora hatten sich daher auch erst nach der Schulzeit kennengelernt.
Jann, der wie seine Frau bei der Heirat zweiundzwanzig Jahre alt war, zog nach der Hochzeit 1914 hier ein. Die sechs Kilometer zu seinem Arbeitsplatz bei der Eisenbahn in der Stadt legte er in den ersten Jahren zu Fuß zurück. Dora hatte es bis zur Molkerei nicht so weit, musste aber dafür morgens und abends, also zweimal am Tag, zu ihrer Arbeit laufen. Diese bestand unter anderem darin, „Gouda- und Edamerkäse in Brotform“ herzustellen. Ansonsten kümmerte sie sich um Feld und Garten, den Haushalt und den kranken Vater.
Wenn sie aus dem Küchenfenster schauten, hatten sie einen unverstellten Blick bis weit nach Holland hinein. In dieser Gegend gab es nur Wiesen und Felder. Berge und Wald kannten die Kinder der Dörfer hier nur aus den Märchen. Sie hielten sie daher für ebenso wunderlich wie Hexen oder Feen.
Der Blick nach Osten hätte ebenso weit reichen können, wären da nicht die mächtigen Gebäude der beiden Großbauern gewesen. Für einen von ihnen leistete Jann Spanndienste. Als Gegenleistung durfte er Pferd und Pflug ausleihen, um seinen eigenen kleinen Acker zu bestellen. Er hätte sonst sein eigenes Stück Land mit dem Spaten umgraben müssen! So hatte er das das Gefühl, selbst ein kleiner Bauer zu sein.
Die Arbeit bei der Bahn betrachtete er sowieso lediglich als Existenzsicherung; sein Traum war, selbstständiger Oeconom zu werden, wie die großen Bauern sich damals nannten. „Voor en Telder Papp över de Ächterdör van den Buur springen“, also für einen Teller Milchsuppe über das Scheunentor des Großbauern springen, wollte Jann nicht.
Veränderungen im Haus seines Vaters ließen die Hoffnung zu, dass dieser Traum Wirklichkeit werden könnte. Das war jedoch zehn Jahre später. Jetzt stand nach dem Militärdienst in der Garnisonsstadt der Einsatz in Frankreich bevor.
Hätten die Enkel fünfzig Jahre später Janns und Doras zahlreichen Briefe, deren Marken sie für ihre Sammlung brauchten, nicht einfach weggeworfen, wäre über ihre Liebe zueinander sicher mehr zu sagen, als dass sie bis zu ihrem Tod hielt. Vielleicht wären aber auch nur mehr Einzelheiten über das Leben in der Kaserne und an der Front herausgekommen oder über das beschwerliche Leben zu Hause, die alle vier Wochen abzuarbeitenden Wäscheberge, das tägliche Ausmisten des Schweinestalles, über die hektischen Schlachttage, die Arbeit auf dem Feld bei Wind und Wetter, über die Belastung durch die Arbeit in der Käserei, über das Leiden des todkranken Vaters.
Man hätte wohl auch genauer gewusst, ob Jann wirklich bei den Ulanen war, wie wiederholt kolportiert wurde. Seine stattliche Figur, sein kräftiger Schnauzbart und – Jahre später – seine Rolle als Oberst zu Pferde in der Schützenbruderschaft waren für Gutmeinende Beweis genug. Dennoch ist es mehr als zweifelhaft. Selbst hat er dies nie erwähnt. Aber auch nicht, dass er wahrscheinlich nur Grenadier war.
Dora liebte trotz des beschwerlichen Daseins ihr Zuhause sehr. Nachdem sie schon Jahrzehnte nicht mehr dort wohnte, fuhr sie mit dem Fahrrad regelmäßig „noor Huis“, wie sie zu sagen pflegte. In der Rückschau war offenbar das Leben dort trotz allem erfreulicher und leichter gewesen als „opp den Bölt“ – auf dem Buckel – wie man das Anwesen ihres Schwiegervaters nannte, wo sie die anderen Zweidrittel ihres Lebens zubrachte. Jann pflegte ihren Wunsch mit einer Mischung aus Verärgerung und Nachsicht zu kommentieren:“Noor Huis, noor huis! Wat willt gej door?“
Ihre immer wieder mal geäußerten Bemerkungen zum Tod ihres Vaters waren von Mitleid geprägt, keineswegs von Erleichterung darüber, dass eine schwierige Pflege zu Ende gegangen war. „Seine Zehen und Hände waren von den ständigen Schmerzen und Krämpfen, die sein Blasenleiden mit sich gebracht hatte, ungewöhnlich verkrümmt, sein Gesicht unnatürlich verzerrt. Er muss fürchterlich gelitten haben.“
2
Warum Jann auf sein erstes Kind zwei Jahre warten musste, lässt keine eindeutige Antwort zu. Während er von seinen Kameraden im Turnverein Germania zu hören bekam, er sei wohl ein „Börg“, man habe ihm anscheinend die Manneskraft genommen, mag Dora instinktiv den Krieg als ungünstige Voraussetzung für neues Leben angesehen haben. Jedenfalls spricht vieles dagegen, dass es eine in jeder Hinsicht bewusste Entscheidung war. Schließlich dauerte der Krieg noch weitere zwei Jahre.
Als ihm die Nachbarn zu seiner Erstgeborenen schließlich gratulieren konnten, erwiderte Jann: “Danke, danke, aber es ist ja nur ein Mädchen.“ Dreißig Jahre später erwies sich diese Bemerkung als die größte Fehleinschätzung seines Lebens.
Janns Onkel, der aus den USA zurückgekehrt war, um den Sieg gegen Frankreich nicht zu verpassen, und ihr Schwager Gerd waren schon gefallen. Sie machte sich große Sorgen, dass auch Jann sie und ihre Tochter allein lassen könnte. Mehrmals am Tag betete Dora inbrünstig zum lieben Gott, er möge Jann verschonen. Als sich dann endlich die Nachricht vom Waffenstillstand herumsprach, schaute sie hundert Mal aus dem Fenster an der Ritterburg vorbei bis zur Provinzialstraße, bevor sie Jann, die Tochter auf dem Arm, entgegenlaufen und in die Arme schließen konnte.
Im folgenden Jahr wurde der eigentlich schon früher erwartete Sohn geboren. Sie tauften ihn nach dem Großvater väterlicherseits auf den Namen Theodorus, riefen ihn aber von Anfang an nur Theo. Auch den zweiten Sohn, Albert genannt Battje, brachte Dora noch im Bettkasten des elterlichen Hauses zur Welt. Die Hebamme glaubte schon kurz nach der Geburt, bei diesem Kind eine besondere Keckheit feststellen zu können. Beispiele dafür konnte Dora Jahre später, wenn sie von ihrem allzu früh verstorbenen Jungen erzählte, in der Tat anführen.
Janns Elternhaus, das unweit des Deiches fast unmittelbar an der Provinzialstraße lag, nannten die Dörfler liebevoll auch Rosenkate. Ob es dafür handfeste Gründe gab, ob also auf dem Anwesen mehr Rosen als anderswo blühten, ist zweifelhaft. Fotos aus dieser Zeit geben jedenfalls keinerlei diesbezügliche Hinweise. Das Schicksal der Bewohner rechtfertigt diese Bezeichnung nicht.
Das Haus, das wie bereits angedeutet, wegen des Rheinhochwassers auf einem Hügel gebaut worden war, bestand aus einem Vorderhaus mit Essküche, einem kleinen Wohnzimmerchen, drei Schlafzimmern und Waschküche sowie dem Hinterhaus mit Deel – Tenne auf Hochdeutsch – ,Schweineställen und Kuhstall. Ein weiteres Schlafzimmer, die sogenannte Obkamer, war nur über eine sechsstufige hochklappbare Holztreppe zu erreichen, die zugleich als Abschluss des kleinen und sehr niedrigen Kellers diente.
Das Anwesen, zu dem auch eine mittelgroße Scheune gehörte, war auf drei Seiten von Wiesen bzw. dem großen Garten umgeben. Wollte ein Fremder das Wohnhaus durch die Vordertür betreten – Bekannte wählten den Weg über die Deel – musste er, um den breiten Schaugraben zu überqueren, zunächst über eine Holzbrücke gehen, das Eisentor öffnen und dann die letzten dreißig Meter zum Haus hinaufsteigen. Die Kinder benutzten die Brücke nur im Frühjahr, wenn das Rheinhochwasser die Gräben auf dieser Seite des Deiches überquellen ließ. Dann löste sich die Brücke aus der losen Verankerung und wurde für Jungen zum leicht handbaren Floß.
Hier hatten zunächst der Einwanderer aus Holland, Henricus, mit seiner deutschen Frau Anna und ihre elf Kinder gelebt. Sieben waren in die Vereinigten Staaten ausgewandert, drei lebten in der Nähe oder in Holland. Theodorus mit seiner Frau Gerharda waren zu Hause geblieben, bewirtschafteten den kleinen Hof und hatten sich testamentarisch verpflichtet, die Sorge für die Eltern zu übernehmen. Er konnte über insgesamt acht verschiedene Flurstücke mit etwa dreißig Morgen verfügen, hatte aber laut Erbvertrag den Geschwistern je vierhundert Mark ausgezahlt und musste weitere zweitausendvierhundert Mark zu einem späteren Auszahlungstermin bereithalten. Zur Befriedigung dieser Erbansprüche, die dem Werte nach dem eines neuen Hauses entsprachen, hatte er ein großes Stück Land verkauft. Darüber hinaus hatte er sich Geld geliehen, eine Last, die auch die nächste Generation in ihrem Expansionsdrang noch einschränkte.
Theodor konnte trotz des selbstverständlichen Einsatzes seiner unverheirateten Geschwister und, später, seiner eigenen Kinder von der Bewirtschaftung seines kleinen Hofes und von der Arbeit für den Gutsbesitzer allenfalls überleben; die Schulden zu seinen Lebzeiten abzuzahlen war ihm nicht möglich.
Er hatte trotz des ihm Respekt verleihenden kaiserlichen Backenbartes, seiner körperlichen Größe und seines gebieterischen Auftretens eine Schwäche, die ihm jedoch erst Jahre später den üblichen Ansehensverlust einbrachte. Er brauchte für seinen Eigenbedarf Bargeld, wenig, wenn man es in absoluten Zahlen angeben wollte, zu viel, gemessen an den sehr geringen Erträgen aus dem Verkauf von Eiern oder Milch.
Theodor trank. Er brauchte regelmäßig sein Borreltje, und das nahm er nicht nur zu Hause zu sich. Beim Kartenspiel in der Schenke trank er so viel, dass ihm der Heimweg immer mal wieder zu schmal wurde, und er im Graben landete. Zumindest einmal konnte er dieses Missgeschick Frau und Kindern nicht verheimlichen. Der teure handgeschneiderte braune Sonntagsanzug – der einzige, den er hatte – roch am Morgen danach so eindringlich nach Jauche, dass Gerharda ihn einer ärgerlichen Befragung unterzog:
„Theodor, wo warst du? Was hast du gemacht? Warum stinkt dein Anzug nach Kuhstall? Den müssen wir waschen und dann zum Aufbügeln zum Schneider bringen. Weißt du, was das kostet? Theodor, bist du wieder „satt“ gewesen? Du wolltest doch nicht mehr so viel trinken!“ Worauf Theodor antwortete, Jannetje, der Nachbar, habe ihn in den Graben gestoßen, in den ja bekanntermaßen der Gutsbesitzer van de Waal seine Jauche ableite. Gerharda widersprach nicht. Thedor war ein stimmgewaltiger Mann und pflegte ihm nicht gefällige Meinungen niederzubrüllen. Sie vertraute auf andere, subtilere Mittel, um mit seinem Laster fertig zu werden.
Theodorus hatte eine Tochter, Hanne, und fünf Söhne: Heinrich genannt Henn, Johann genannt Jann, Wilhelm genannt Wellem, Gerd und Konrad. Das waren zwar nur noch halb so viele wie sein Vater zu versorgen gehabt hatte, stellte aber angesichts der Wirtschaftskrisen mit ihren Folgen für ihn eine große Last dar.
Unglücklicherweise mussten er und Gerharda sich auch noch um einen seiner Brüder kümmern, der krank aus Ohio zurückgekommen war und sein ihm zustehendes Heimrecht wahrnahm. Er war daher froh, als Hanne heiratete und ins Nachbardorf zog, Henn als Bahnwärter eine Anstellung fand und sich mit seiner jungen Frau eine Wohnung suchte, und Wellem als Kopfschlächter ebenfalls auf eigenen Füßen stand. Jann war ja schon elf Jahre zuvor ausgezogen.
Da Gerd, der jüngste, auf dem Feld der Ehre sein Leben gelassen hatte, blieb ihm nur noch Konrad. Er sollte den Hof übernehmen und seine Eltern bis zu deren Lebensende „in allen Lebensbedürfnissen, insbesondere auch in der erforderlichen Pflege in Arzt und Arzneien angemessen und standesgemäß unterhalten, ihnen auch nach ihrem Tode ein standesgemäßes Begräbnis bereiten“.
Konrad nahm den Erbvertrag gern an, entband er ihn doch von der Verpflichtung, sich als Tagelöhner zu verdingen oder sich eine Beschäftigung außer Haus zu suchen. Er war noch jung und seine Eltern noch sehr rüstig. Sich ihnen unterzuordnen fiel ihm nicht schwer. Andere Loyalitäten kannte er nicht, und konnte er sich nicht vorstellen. Um sich herum sah er Gleichaltrige, die arbeitslos waren, für Unterkunft und Verpflegung bei einem der Gutsbesitzer schufteten oder ins Ruhrgebiet verzogen, um eine ihnen völlig fremde und harte Arbeit anzunehmen, wie es zwei von Doras Brüder getan hatten. Letztere konnten selbst Jahre danach, auch als es ihnen gut ging, ihren Ansehensverlust bei ihren Verwandten im Dorf nicht wieder wettmachen.
Wäre Konrad Junggeselle geblieben, alles hätte noch Jahre so weitergehen können. Er half Theodor beim Melken der zwei Kühe, brachte die Milchkanne zur Molkerei, mähte das Gras für die Schweine, mistete den Schweinestall aus, fütterte die Hühner, lief hinter Pflug und Egge, säte und erntete, sägte und hackte Holz für Kamin und Herd und leistete gehorsam die geforderten Spanndienste beim Oeconomen.
Theodor war bemüht, ihn an der kurzen Leine zu halten. Aber er konnte nicht verhindern, dass Konrad wie alle jungen Leute zum Schützenfest ging und bei dieser Gelegenheit Aloysia, eine Näherin aus der Stadt, kennenlernte.
Die Hochzeit kam schneller, als den beiden und seinen Eltern recht war. Obgleich sie keineswegs aus begüterten Verhältnissen kam und zu arbeiten sowohl zu Hause als auch beim Kleidermacher gewohnt war, fiel ihr die plötzliche Umstellung auf die Rollen als Ehefrau, Mutter, Schwiegertochter und Magd sehr schwer. Als letztere fühlte sie sich nicht zuletzt wegen der, wie sie meinte, herablassenden Art ihrer Schwiegermutter, mit der diese ihr zeigte, wie man das Feuer im Herd anmachte oder einen Speckpfannkuchen backte.
“Stell dich nicht so dumm an, Deern. Du wirst es schon noch lernen!“ meinte sie.
Was das Wesen ihrer Schwiegermutter anging, irrte sich Aloysia. Gerharda war eine kluge, sanfte und auf Ausgleich bedachte Frau, die schon deshalb nicht zum Hochmut neigte, weil sie selbst in den ersten Jahren „opp den Bölt“ vieles hatte lernen müssen, was in ihrem Elternhaus Dienstmägde erledigt hatten.
Schlimmer als die vermeintliche Hochmütigkeit Gerhardas war der herrische Ton, den der Schwiegervater immer dann anschlug, wenn sie sich weigerte, zum Oeconomen zu gehen, um dort an Theodors oder Konrads Stelle bei der Ernte oder beim Schlachten auszuhelfen.
„Was ich kann oder meine Frau, ist dir wohl nicht gut genug. Was bildest du dir ein? Du gehst dort hin und sonst gar nichts!“ schalt sie Theodor.
Aloysia verließ dann schluchzend das Haus und suchte ihren Mann, um bei ihm Trost und Rat zu finden. Konrad aber konnte nicht helfen. Er verstand sie nicht. Seine ältere Schwester Hanne hatte doch dieselben Arbeiten verrichtet, ja sogar gern zur Abwechslung einmal beim Großbauern gearbeitet. Ihm war vor der Heirat gar nicht in den Sinn gekommen, ihr von diesen Verpflichtungen und Abhängigkeiten zu erzählen. Sie dagegen fragte sich, warum können sich diese stolzen Leute kein eigenes Pferd leisten? Warum pachteten sie Land an, wenn sie kein Geld für den Pachtzins haben? Dafür sollte sie jetzt schuften? Auch von den Schulden, die jedes Jahr bedient werden mussten, erfuhr sie mehr durch Zufall! Sie begriff und erkannte immer deutlicher, ihr Leben in der Stadt wäre einfacher und leichter gewesen, aber Konrad durfte sie das nicht sagen.
Es war ein anstrengender Tag gewesen. Arbeit und Sonne hatten ihnen den Schweiß aus allen Poren gelockt. Theodor, Konrad und Bruder Jann hatten das ganze Roggenfeld gemäht, Gerharda, Schwiegertochter Dora und eine Nachbarin hatten das Getreide gebunden und zum Trocknen aufgerichtet. Am folgenden Tag sollte es aufgeladen und in die Scheune gebracht werden, bevor es dann später im Jahr gedroschen würde. Das war der Lauf der Dinge. So machte man es.
Sie hätten zufrieden einschlafen können, Theodor und Gerharda. Obwohl Juli, war es in ihrem Schlafzimmer stockfinster. Es hatte kein Fenster nach draußen, wohl aber eine kleine Luke, die jedoch nicht zum Lüften gedacht war, sondern einzig und allein dazu diente zu überprüfen, ob in den Ställen alles in Ordnung war. Insbesondere wenn eine Kuh zum Kalben anstand, schliefen beide unruhig, schoben abwechselnd immer mal wieder die rotkarierte Gardine zur Seite und schauten nach.
Heute Abend war es ruhig, aber sie konnten beide nicht einschlafen. Nebenan, in „de achterste Kamer“, so genannt, weil dieses Schlafzimmer von der Küche aus am weitesten entfernt lag, atmete der kranke Bruder schwer, aber regelmäßig. Die jungen Leute in der Obkamer waren zu weit weg, als dass sie Gespräche im elterlichen Schlafplatz hören konnten.
„Theodor, kannst du auch nicht schlafen?“
„Nein, ich mache mir große Sorgen. Aloysias Verhalten passt mir ganz und gar nicht. Hätte sie heute nicht mit uns aufs Feld kommen können? Du hättest nicht vergessen, uns Kaffee und Butterbrote zu bringen, und unseren Schnaps hätten wir auch bekommen.“
„Sicher, ich finde es jedoch viel schlimmer, dass sie so wenig interessiert ist. Mir hat sie entschuldigend gesagt, sie sei Schneiderin und nicht Bauerntochter. Ich glaube, sie hat sich alles ganz anders, vor allem leichter, vorgestellt. Ich habe darüber mit Konrad schon mal gesprochen, aber er ist mir ausgewichen.“
„Ja, unser Konrad. Er ist ein Schlappschwanz. Kann sich nicht durchsetzen. Sollte mal mit der Faust auf den Tisch hauen!“
„Aber Thedor, das kann Konrad doch gar nicht. Du weißt doch, Männer, die heiraten müssen, weil sie zu früh ein Kind angesetzt haben, werden von ihren Frauen ihr Leben lang kurz gehalten. Da ändert sich nichts mehr.“
„Hast du gesehen, wie leicht und schwungvoll Jann mit der Sense umgegangen ist? Und Dora, wie gut und schnell sie die Garben gebunden hat? Und dabei hatte sie schon zwei Stunden auf der Molkerei gearbeitet!“
„Was willst du mir sagen?“
„Was ich dir sagen will? Jann und Dora passen besser zu uns auf den Hof. Das will ich dir sagen.“
Gerharda mochte seine Überlegungen nicht zu Ende denken. Was sollte dann aus Konrad werden, der doch nichts gelernt hatte? Und das in diesen schweren Zeiten, wo die am besten dran waren, die über Land oder Vieh verfügten und sich weitgehend selbst versorgen konnten!
3
An einem Sonntag im August besuchte Jann nach dem Hochamt seinen Vater wie immer, wenn er in seinem Heimatdorf in die Kirche ging. Die Mutter hatte dann eine Tasse Hühnersuppe für ihn und Theodor, obwohl dieser lieber einen Schnaps gehabt hätte, was auch Adelheid, die Witwe des reichen Oeconomen vom Offenberg wusste. Sie kam, für Gerharda zu oft, direkt über die Deel herein und ließ sich ohne Aufforderung am Tisch in der großen Wohnküche nieder, wo Theodor die Flasche schon bereit hielt. Ihren modischen Hut, der einer dreischichtigen Torte glich, und ihren dicken grauen Mantel mit großen Revers und langen Ärmelaufschlägen behielt sie dabei an. Der Unterschied zwischen der bescheidenen, einfachen Gerharda und dieser mondänen, anspruchsvollen Frau schuf eine Disharmonie, die Jann körperlich zu fühlen glaubte. Als sie Jann kommen sah, stand sie, wie ein kleiner Junge, der beim Naschen erwischt worden war, auf und ging. Das passte Theodor überhaupt nicht.
Wie immer wenn Jann zu Besuch kam, gingen sie zunächst auf die Deel, bestaunten die jungen Ferkel oder das Kalb, das sich seit dem letzten Besuch so außerordentlich gut entwickelt hatte, und dann gingen sie am Hühnerstall vorbei auf die am Haus gelegene Wiese, schauten den Kühen beim Grasen zu und diskutierten Fettgehalt und Butterpreise. Jann fühlte sich hier immer noch zu Hause und seit einiger Zeit auch ernst genommen.
An diesem Sonntag kam ihm der Vater verändert vor, bedrückt, zögerlich, nicht so selbstsicher wie er sich sonst zu geben pflegte.
„Jann, wir machen uns Sorgen“, sagte er völlig unvermittelt. “Mit Konrad und Aloysia, das klappt einfach nicht.“
Jann schaute seinen Vater verwundert an. Sollte ihm völlig entgangen sein, dass sein Bruder sich mit seiner Frau nicht verstand? Und das nach so kurzer Zeit? Der Vater gab ihm keine Gelegenheit zu fragen, sondern fuhr lapidar fort: „Du musst wieder nach Hause kommen; du hast eine tüchtige Frau. Aloysia ist für die Landwirtschaft völlig ungeeignet.“ Jann war über dieses Angebot, das eher wie eine Aufforderung oder gar Anordnung geklungen hatte, überrascht und verwirrt zugleich, aber er war auch stolz, dass sein Vater ihm die Bewirtschaftung des Hofes zutraute. Seinen Ehrgeiz, selbst einmal ein anerkannter Bauer zu werden mit hinreichend Ländereien, einem größeren Viehbestand, mit eigenen Pferden hatte er angesichts der beschränkten Möglichkeiten auf dem Anwesen seiner Schwiegereltern immer wieder unterdrückt. Dieser Ehrgeiz war aber, wie er jetzt merkte, immer noch lebendig und keineswegs abgestorben.
Am liebsten hätte er sofort gesagt: „Ja, wir kommen gerne!“ Aber ihm gingen tausend Fragen durch den Kopf. Wie hatte Vater sich den Wechsel vorgestellt? Was sollte mit Konrad und Aloysia geschehen? Wovon sollten sie leben? Welche Bedeutung hatte der Erbvertrag, den sie mit Theodor geschlossen hatten? Könnte er die ungeliebte Arbeit bei der Bahn schon bald aufgeben? Ja, und das fiel ihm erst jetzt ein, was hielt Dora von der ganzen Sache?
„Na, was hältst du davon?“ hörte er den Vater sagen. Jann zögerte, bevor er antwortete: „Vater, darüber muss ich erst einmal eine Nacht schlafen.“
Drei Tage später entschied er sich. Er war auf dem Heimweg von der Arbeit und hatte den Wind im Rücken. Er hatte Frühschicht gehabt, die immer besonders anstrengend war. Neben den zahlreichen Personen- und Güterzügen, die zwischen Amsterdam und dem Ruhrgebiet verkehrten, hatten die Rangierloks einen Güterwagen nach dem anderen zu und von den Ölwerken gezogen. Für Jann und seine Kollegen Schrankenwärter hieß das, alle sieben oder acht Minuten die langen schweren Holzbarrieren von Hand auf- und zudrehen, und das acht Stunden lang. Wollte er, weil der nächste Zug schon in sieben Minuten den Übergang passieren würde, die Schranken einfach geschlossen halten, schimpften die wartenden Fußgänger oder Bauern auf ihren Sturzkarren und riefen „Aufmachen, aufmachen!“
Er war nicht dazu gekommen, seinen Henkelmann mit dem von ihm so geschätzten Wurzelgemüse mit durchwachsenem Speck leer zu essen. Dora machte ihm den Rest nochmals warm und setzte sich zu ihm. Da alle anderen schon wieder im Garten arbeiteten, waren die beiden allein im Haus.
„Dora, ich würde am liebsten wieder zur Rosenkate zurückkehren.“
Dora traute ihren Ohren nicht und wunderte sich, dass er sein ehemaliges Zuhause nicht wie üblich „den Bölt“ nannte.
„Theodor hat uns angeboten, das Anwesen zu übernehmen. Sie kommen mit Aloysia nicht zurecht.“
Dora schossen die Tränen in die Augen. Eine solch grundlegende Veränderung ging weit über ihr Vorstellungsvermögen hinaus. Sie wohnten nun schon zehn Jahre in ihrem Elternhaus, hatten ihr Leben wohl geordnet, drei Kinder waren hier geboren, im Grunde ging es ihnen gut, ja das Leben war nach dem langen Siechtum des Vaters sogar leichter geworden. Zur Mutter hatte sie ein inniges Verhältnis. Auch mit den Veldkamps, ihren nächsten Nachbarn, verstand sie sich gut. Sie war jetzt zweiunddreißig Jahre alt und hatte ihre Heimat noch nie verlassen.
„Nü bleert toch niet, Dora!“
Wenn sie weinte, wusste Jann sich nicht anders zu helfen, als laut zu werden.
„‘Opp den Bölt‘ machen wir alles neu. Die alten Bettkästen schmeißen wir raus. Du bekommst richtige Betten für dich und die Kinder. Wir haben mehr Platz, ein zusätzliches Schlafzimmer, eine große Wohnküche, eine davon getrennte Waschküche, größere Ställe, eine Scheune…“
Dora verstand plötzlich: Jann hatte sich längst entschieden. Sie würde ihm folgen müssen. Sie nickte und Jann nahm sie in den Arm und drückte sie fest an sich.
“Wir schaffen das“, sagte er, zog die Bahnuniform aus, schlüpfte in die frisch gewaschene Arbeitskleidung, setzte sich den alten Hut auf und ging aufs Feld, um Rüben zu hacken.
Als Dora zu ihrer Mutter in den Garten kam, konnte sie nicht verbergen, dass sie geweint hatte. „Grootmänniken“, wie die Kinder ihre Oma liebevoll nannten, sah ihre Tochter fragend an, und nun sprudelte es aus Dora heraus. Nicht nur, was Jann vorhatte, auch, was sie bedrückte: Würde sie mit der Schwiegermutter zurechtkommen? Würde sie Janns kranken Onkel pflegen müssen? Müsste sie sich auch Theodor unterordnen? Wie würde Schwager Konrad den Vertrauensentzug aufnehmen?
„Und was wird aus dir, Mutter?“ fragte sie.
Grootmänniken war erstaunlich ruhig geblieben und antwortete zu Doras großer Erleichterung: „Mach dir keine Sorgen um mich. Du weißt doch, deine Schwester Anna hat nie ganz verwunden, dass sie als jüngste nicht zu Hause bleiben durfte. Sie fühlt sich mit ihren beiden Kindern in der Stadtwohnung gar nicht wohl. Ich brauche ihr nur zu sagen, dass sie zurückkommen kann, und sie kommt.“
Schon am selben Abend, als sie alle am Tisch saßen und die mit getrockneten Birnen angereicherte Sauermilchsuppe löffelten, hatte Jann Antworten auf die meisten Fragen. Der kranke Onkel sollte zu seiner Schwester nach Holland gehen. Jann würde dafür sorgen, dass er selbst in der Landwirtschaft und Dora im Haus das „Regiment“ übernähmen, und was Konrad anging, so würde er sich persönlich dafür einsetzen, dass er bei der Bahn anfangen könnte. Die Bahn suche ja bekanntlich Gleisbauarbeiter. Vielleicht könnte er mit seiner Frau und dem Kind sogar die Stadtwohnung von Anna übernehmen. Jann hatte jetzt freie Hand und suchte die passende Gelegenheit, um mit Theodor zu sprechen. Bevor der Erbvertrag nicht umgeschrieben war, würde er mit seiner Familie nicht einziehen.
Als er am folgenden Sonntag nach dem Hochamt zu seinem Vater kam, saß dieser mit der „Dame aus gutem Hause“, wie Jann Adelheid ironisch nannte, hinter der Flasche und war bereits leicht angetrunken. Das ärgerte Jann sehr, aber dieses Mal schwieg er noch. Er würde wiederkommen.
Die wichtigen existentiellen Fragen der Großen hatten Theo und Battje kaum berührt, wohl aber die zehnjährige Gerlinde. Sie begriff schnell, wie sehr die anstehenden Veränderungen ihr Leben betreffen würden. Es war weniger der Umzug ins Haus der anderen Großeltern. Dort kannte sie sich ja schon ein wenig aus. Aber schon bei der Frage, ob die andere Großmutter genauso lieb sein würde, kamen ihr Zweifel. Mit Grootmänniken hatte sie sich immer sehr gut verstanden. So manches Mal hatte sie bei ihr Trost gefunden, wenn der Vater sie laut angefahren oder gerügt hatte. Außerdem hatte sie ihr versprochen, dafür zu sorgen, dass sie bald zur Höheren Schule gehen dürfe wie ihre Freundin Lijske vom Hof gegenüber. Ihr Lehrer hatte schon einige Male ihre Aufsätze gelobt, und gut rechnen konnte sie auch. Gerlinde war ehrgeizig, ebenso ehrgeizig wie ihr Vater, aber Bäuerin werden wollte sie nicht! Umgekehrt hatte sie noch keinen klaren Berufswunsch. Wie sehr sich ihr Leben von dem ihrer Freundin unterschied, das hatte sie jedoch verstanden.
Lijske, die in der Schule neben ihr saß, bekam öfter ein neues Kleid, das zudem von einer Schneiderin nach Maß angefertigt wurde, aus neuen und bunten Stoffen, die die Großbäuerin meterweise beim „Jödd“, wie sie den jüdischen Handelsreisenden aus der Stadt nannte, kaufte. Ihr eigenes Kleidchen hatte die Mutter aus einer alten blaugestreiften Schürze genäht und zwar so groß, dass es ihr auch nach zwei Jahren noch passte. Lijske kam in feinen Lederschuhen zur Schule, sie in Holzschuhen, wie die meisten in ihrer Klasse. Sie musste sich nach der Schule „alte Sachen“ anziehen, Lijske behielt ihr feines Kleid an; sie machte sich im Garten oder auf dem Feld schmutzig, Lijske durfte Klavier spielen. Für Garten- und Feldarbeit hatte ihr Vater Knechte und Mägde.
Und Lijske sprach anders als sie, vornehmer, gebrauchte manchmal Wörter, die sie noch nie gehört hatte, und sie hatte keinerlei Probleme damit, den Lehrer mit „Sie“ oder „Ihnen“ anzureden.
Gerlinde beeindruckte auch ihre herrschaftliche Wohnung. Lijske verfügte über ein eigenes Schlafzimmer mit einem richtigen Bett, und sogar die Schneiderin hatte ihr eigenes Nähzimmer. Neben der Küche gab es ein Esszimmer, ein geheiztes Wohnzimmer und ein Wohnzimmer mit besonders edlen Möbeln, das nur bei Familienfesten und Visiten benutzt wurde. Lijskes Mutter hatte grobes Porzellan und einfaches Besteck für den täglichen Gebrauch und das feine mit Goldrand samt Silberbesteck, das sonntags und feiertags hervorgeholt wurde.
Das einzige, was Gerlinde befremdlich vorkam, war, dass die Knechte und Mägde in der großen Küche aßen, während Lijske mit ihren Eltern und Geschwistern ihre Mahlzeiten im Esszimmer einnahm.
So würde Gerlinde auch gern leben und hatte nun Angst, dass sie mit ihren Wünschen kein Gehör mehr finden würde. Die Großmutter ihrerseits war mit sich und ihren Sorgen mehr beschäftigt als üblich und gab ihr wenig Gelegenheit, zu ihr auf den Schoß zu kriechen und zu schmusen.
Die Gelegenheit, mit ihr zu sprechen, ergab sich erst wieder, als Jann und Dora beide auf dem Feld waren und Grootmänniken am Spülstein stand und das Geschirr abwusch. Gerlinde hielt schon das Geschirrtuch in der Hand, um abzutrocknen: „Eigentlich möchte ich ja bei dir bleiben, Grootmänniken, und nicht umziehen. Aber das geht ja wohl nicht. Hoffentlich klappt das mit der Höheren Schule.“
Ihre Großmutter schaute sie erstaunt an, bevor sie wusste, wovon ihre Enkelin sprach. Dass sie das nicht vergessen hat!, dachte sie bei sich und amüsierte sich über das gute Gedächtnis und die Zielstrebigkeit ihrer Enkelin. Sie wollte schon lächelnd über die Frage hinweggehen, da fragte Gerlinde: „Das hast du doch nicht vergessen, Grootmännniken? Du hast mir versprochen, dass ich mit Lijske zusammen zu den Nonnen auf die Schule darf.“
Die Großmutter wurde sich bewusst, dies war Gerlinde ein ernstes Anliegen, dem diese viel mehr Gewicht beimaß, als sie es in dem Gespräch getan hatte, das nun schon Monate zurücklag. Sie hatte darin nicht mehr als einen der vielen Wünsche gesehen, die alle Kinder äußerten, wenn sie von anderen etwas Ungewöhnliches oder Neues gehört hatten, das mit Stolz oder Begeisterung vorgetragen wurde. Sie hatte damals gleich gewusst, den Floh hat ihr Lijske ins Ohr gesetzt. Gerlinde wartete besorgt auf eine Antwort.
„Weißt du, Gerlinde, das wird jetzt schwierig sein, aber ich werde mit deinem Vater darüber sprechen.“
Gerlinde sah sie mit traurigen Augen an, hängte das Geschirrtuch sorgfältig über die Trockenstange, die seitlich am Herd befestigt war, und ging hinaus. Grootmänniken war nicht minder traurig. Sie wusste, Jann würde dem niemals zustimmen. Eher könnte man im Flachland Berge versetzen! Trotzdem suchte sie nach einer Gelegenheit, um mit Dora und Jann darüber zu sprechen.
4
Die Tage am Niederrhein wurden kürzer und abends legte sich neblige Feuchtigkeit auf Wiesen und Felder. Jann hatte, da der Großbauer Pferde und Wagen selbst gebrauchte, die Rüben auf der Schubkarre nach Hause gefahren. Mehr als einmal war er mit der schweren Last im lehmigen Boden steckengeblieben und hatte kräftig in sich hinein geflucht. Die Bauern hatten mit ihren Karren die Wiesenstraße noch modderiger gemacht als sonst, so dass die Holzschuhe jetzt jeden Abend abgeschrubbt werden mussten. Diese Arbeit übernahm regelmäßig Dora, nicht ohne mit den Kindern geschimpft zu haben, weil ihnen der Modder in die Holzschuhe hineingelaufen war und so auch noch die Strümpfe verschmutzt waren.
Von der nassen Kälte waren ihre Hände bläulich geworden. Sie war froh, als sie in die Küche gehen konnte, um sich aufzuwärmen. Schon an der Tür schlug ihr der Qualm und der Bratengeruch entgegen. Sie hörte das Zischen in der Pfanne. Ihre Mutter backte Speckpfannkuchen und war gerade dabei, ihn mit Schwung und Geschick von der Pfanne auf den Pfannendeckel zu wenden und von diesem zurück in die Pfanne. Die Mutter backte die Pfannkuchen eigentlich etwas zu dick, aber sie schmeckten allen ausgezeichnet. Neben der Bratpfanne stand der Topf mit „Papp“ aus angedickter Buttermilch mit Pflaumen. Grootmänniken hatte früh bemerkt, dass Jann gern noch einen Nachtisch aß.
Dieser saß bereits auf seinem angestammten Platz am oberen Ende des klobigen und vom häufigen Scheuern abgenutzten Küchentisches. Zwar hatte er die schmutzige Arbeitsjacke ausgezogen, die ebenfalls lehmige Hose aber zum Leidwesen der Frauen anbehalten. Vorher hatte er noch einen kleinen Stapel Holz neben den Herd gelegt und war nun dabei, lange dünne Holzspäne von einem noch nicht ganz trocknen Holzscheid abzuschälen, mit denen er sich vom Herd Feuer für die Petroleumlampen, aber auch für seine uralte Krummpfeife zu holen pflegte. Die Kinder warteten geduldig darauf, dass Grootmänniken ihre Schürze ablegte und sich zu ihnen an den Tisch setzte.
Gerlinde sagte das neue Tischgebet auf, das sie in der Schule gelernt hatte. Dann durften sie endlich anfangen. Kurz darauf war der scheppernde und etwas zu lang nachklingende Ton der alten Pendeluhr über dem Spülstein zu hören. Sieben Uhr. Jann bestand darauf, dass auch zu Hause alles nach Fahrplan verlief. Er war sehr zufrieden.
Nach dem Essen brachte Dora die drei Kinder in ihre Bettkästen, während Grootmänniken das Geschirr geschwind unter die Pumpe hielt und abtrocknete. Obwohl sie zu sechst waren, verwendeten sie wenig Geschirr. Auch bei mehreren Gängen benutzten sie immer nur je einen Teller, dazu Gabel und den Löffel. Lediglich Jann erhielt auch ein Messer, da er den Pfannkuchen mit großen Speckscheiben bekam und ihn klein schneiden wollte; alle anderen bevorzugten kleine Speckwürfelchen möglichst auf den ganzen Pfannkuchen verteilt. Jann legte nochmals Holz nach und sorgte so für wohlige Wärme. Dann stopfte er sich ein Pfeifchen und werkelte weiter an seinen Holzspänen. Dora setzte sich wieder zu ihm an den Tisch und begann die Strümpfe der Kinder zu stopfen. Grootmänniken brauchte besonders viel Wärme und kroch mit ihrem Strickstrumpf nahe ans Feuer, aber so, dass sie Jann in die Augen sehen konnte.
„Sagt mal, wie nehmen es eigentlich die „Blagen“ auf, dass sie von der Wiesenstraße weg sollen?“, begann sie das Gespräch so unverfänglich wie möglich.
„Gut“, antwortete Jann, ohne von seinem Messer aufzublicken.
Dora zögerte einen Moment, bevor sie sagte: „Die Kleinen haben, glaub ich, noch nicht begriffen, worum es geht. Aber Gerlinde fragt dauernd, warum wir auf den „Bölt“ ziehen wollen, wo wir es hier doch so gut haben.“
„Die kriegen es dort genauso gut“, grummelte Jann und dachte, das Gespräch damit zu beenden.
„Musst du doch verstehen, Jann“, warf Grootmänniken ein. „Hier hat sie Lijske und ihre Schulkameraden. Und der Lehrer ist auch sehr zufrieden mit ihr. Er hat bereits mehrmals erwähnt, wie gut ihre Aufsätze sind und dass sie gut rechnen kann. Vielleicht hat sie nur Angst, die neue Lehrerin könnte es nicht so gut mit ihr meinen. Außerdem will sie gerne zu den Nonnen.“
„Was sagst du da? Sie will ins Kloster?“ fragte Dora nach, halb überrascht, halb erfreut.
„Nein, Nonne werden will sie nicht. Sie möchte was lernen und die Höhere Schule bei den Nonnen besuchen“, stellte Grootmänniken richtig und merkte, wie Jann plötzlich mit dem Kopf hochfuhr und sie streng anschaute:
„Was sagst du da? Gerlinde will auf die Höhere Schule, zu den Nonnen? Da, wo Lijskes Schwestern sind?“
Er glaubte nicht, was er gehört hatte. Wenn Gerlinde gesagt hätte, sie wolle Prinzessin werden, es hätte ihn weniger überrascht. In seiner näheren Umgebung kannte er nur drei Menschen, die mehr als die Volksschule besucht hatten: den Pastor, den Doktor und den Lehrer. Nicht einmal sein Bahnhofsvorsteher hatte wahrscheinlich mehr gelernt. Und nun wollte ausgerechnet die Tochter eines Kötters die Höhere Schule besuchen? Dass neuerdings die Töchter einiger „Heerburen“, wie er die reichen Bauern nannte, solche Schulen besuchten, mochte ja angehen. Für Angehörige seines Standes kam das einfach nicht in Frage. Auch wenn Gerlinde mit Lijske spielte und beim Großbauern aus- und einging, bedeutete das keineswegs, dass sie als ebenbürtig angesehen wurde. Oft hatte er selbst erlebt, wie herrisch und herablassend der Bauer war, wenn er sich Pferd und Wagen bei ihm leihen wollte. Viel besser als die Knechte fühlte er sich dann nicht behandelt. Für Gerlinde kam, wenn überhaupt, Aufstieg nur durch Heirat in Frage. Und dafür brauchte sie keine Höhere Bildung. Sie sollte das können, was Dora auch gelernt hatte. Im Übrigen brauchte er jede Arbeitskraft für seine eigenen Pläne.
„Kommt nicht in Frage!“ erwiderte er kurz und knapp. Die Frauen schwiegen.
Dora fand sich mit den Entscheidungen Janns ab, war aber nicht beruhigt. Im Gegenteil. Ihre Sorgen und Ängste beschäftigen sie Tag und Nacht. Dabei dachte sie nicht allein an ihre eigene Zukunft mit den vielen Ungewissheiten; sie bedauerte auch Aloysia, deren Rolle sie übernehmen sollte, deren Schicksal vielleicht auch ihr Schicksal werden könnte. Und ihr fiel ein, was sie in der Bibel über Sarah und Hagar gelesen hatte. Sie hatte diese Frauen immer bedauert, waren sie doch völlig unverschuldet in ihre missliche Lage geraten, verstoßen, ohne dass sie sich schuldig gemacht hätten. Gottes Wege waren unbegreiflich! Ihr Mitleid mit der Schwägerin war groß. Sie würde für sich und Aloysia beten.
Schon am Abend, bevor sie einschlief, gingen ihr Text und Melodie ihres Lieblingsliedes durch den Kopf: „Sei gegrüßt o Königin, Mutter der Barmherzigkeit…zu dir seufzen wir trauernd in diesem Tal der Tränen…“. Die erste größere Gelegenheit zum Gebet war die Rosenkranzandacht, die immer im Oktober stattfand und zu der der Pastor am Sonntag alle Gläubigen nachdrücklich eingeladen hatte. Dora betete ihr Leben lang besonders gern zur Mutter des Herrn, war ihr doch so unmenschliches Leid zugefügt worden. Sie hatte großes Verständnis für die Unterdrückten dieser Erden.
Die Gläubigen, die sich zum Rosenkranzgebet versammelt hatten, brachten, von den Kindern einmal abgesehen, Zeit, Geduld und großen Leidensdruck mit. Die Zeiten nach dem verlorenen Krieg und der Hyperinflation waren nicht gut. Jeder hatte sein Kreuz zu tragen. Von den verschiedenen Gebeten, die traditionsgemäß gesprochen wurden – „Im Namen des Vaters und des Sohnes..; Ich glaube an Gott, den allmächtigen Vater…Vater unser im Himmel… und Gegrüßet seist du, Maria“ – traf letzteres in Verbindung mit den „schmerzhaften Geheimnissen“ am besten Doras Befindlichkeit: „Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat…Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat…“ Nach der Andacht fühlte sie sich erleichtert und machte sich, nicht ganz ohne Freude, wieder an die Arbeit.
Gerharda „opp den Bölt“ war nicht minder besorgt. Sie befürchtete Streit und großen Unfrieden in der Familie. Konrad würde das Vorhaben seines Vaters als Rauswurf samt Enterbung auffassen. Sein Stolz würde es nicht zulassen, dass er von heute auf morgen wie ein Hund vom elterlichen Hof, der ihm doch versprochen worden war, gejagt würde. Würde er nicht Vater und Mutter, ja den eignen Bruder zu hassen beginnen? Vielleicht würden sich sogar die anderen Geschwister auf seine Seite schlagen und die Feindschaft in die nächste Generation tragen? Gerhardas Befürchtungen, die sich als weitsichtig erweisen sollten, beruhten nicht auf Erfahrungen mit ihrer Verwandtschaft oder Nachbarschaft. Sie entsprachen dem, was sie in der Heiligen Schrift gelesen und gelernt hatte.
Die Geschichte von Kain und Abel kannte sie in- und auswendig; sie hatte in ihr aber mit zunehmendem Alter neben den üblichen Gewissheiten auch Zweifel aufkommen lassen, die sie zwar für sich behielt, die jedoch ihre Einstellung, wenn auch nur selten ihr Handeln, veränderten. Die Feindschaft zwischen den Brüdern, die sie zunächst im herkömmlichen Sinne des Wortes als gottgegeben hingenommen hatte, interpretierte sie später mehr als von Gott zu verantwortende. Was hatte Kain falsch gemacht, um so endgültig vom Herrn fallen gelassen zu werden? Sie nahm am Abend nochmals die Bibel in die Hand und las: „Der Herr schaute auf Abel und sein Opfer, aber auf Kain und sein Opfer schaute er nicht.“ Kain tat ihr leid!
Auch die Berichte über Esau und Jakob weckten in ihr böse Vorahnungen hinsichtlich ihrer eigenen Familie. So wie Rebekka würde sie niemals handeln. Sie liebte alle ihre Kinder ohne Unterschied. Wenn die Brüder Esau und Jakob sich nicht mehr verstanden, war daran ihre Mutter mehr schuld als die Jungen selbst. Wie konnte sie zulassen, dass aus den Brüdern Fremde wurden?
„Liebe deinen Nächsten“ – das nahm sie sehr ernst, aber sie war sich der Unmöglichkeit bewusst, auch die Söhne darauf zu verpflichten. Jann war viel zu sehr mit dem Diesseits, dem Vorankommen, dem Aufstieg beschäftigt. Konrad fehlte die erforderliche Selbstsicherheit und, was Gerharda besonders beklagte, das nötige Gottvertrauen.
Die Gespräche mit dem kranken Schwager und der Schwägerin in Holland waren zu ihrer Erleichterung sehr einvernehmlich verlaufen. Theodors Schwester sah es als selbstverständlich an, dass auch sie für einige Zeit die Pflege ihres Bruders übernahm. Er war bei seiner Schwester herzlich willkommen und konnte von heut auf morgen umziehen.
Jann und Dora hatten von Theodor erfahren, dass Konrad vorhatte, am Sonntag mit Aloysia zur Geburtstagsfeier ihres Vaters in die Stadt zu fahren. Sie würden erst nach dem Melken zurück sein. Für Gerharda war das die Gelegenheit, Jann und Schwiegertochter zum Essen einzuladen, um anschließend alles zu besprechen, was Jann wissen wollte und was auch im eigenen Interesse geklärt werden musste.
Als Jann und Dora sich zu Fuß auf den Weg nach Hetter machten, regnete es in Strömen. Trotz Parapluie, wie sie den dunklen Regenschirm nannten, durchnässten ihre guten Schuhe völlig, und auch das schicke Kleid und Janns schwarze Hose wurden lehmig und feucht. Sie hatten mit Wind und Schirm zu kämpfen und kamen prompt zu spät zur Kirche, wo das Hochamt schon begonnen hatte. Sie hatten nicht einkalkuliert, dass der Pastor wegen der Aussetzung des Allerheiligsten die Messe mehr als pünktlich beginnen würde.
Schon bevor sie den Gottesraum betraten, hörten sie das „Tantum ergo…“ und als sie eintraten, kam der Priester, in das goldfarbene Velum gehüllt, mit dem er auch die Monstranz, die er feierlich vor sich hertrug, festhielt, ihnen im Mittelgang entgegen. Die Kirche war brechend voll. Jann blieb in der Nähe der Tür stehen. Dora fand noch einen Platz im Seitenschiff. Spontan stimmte sie in den feierlichen Gesang ein: „et antiquum documentum novo cedat ritui…“ Wie oft hatte sie diesen Hymnus nicht schon gesungen. Sie kannte den Text auswendig, ohne ihn zu verstehen. Die Melodie erweckte in ihr ein Glücksgefühl. Wie eine Fontäne schraubte sie sich in die Höhe, tanzte einige Male auf und ab und vereinigte sich beim letzten Vers jeder Strophe wieder mit dem ruhigen Wasser des Brunnens, aus dem sie gekommen war.
Jann ging es ähnlich, aber er sang nicht mit. Er gehöre nicht zu den Menschen, die sangen oder laut lachten. Außerdem war er nicht bei der Sache. Er dachte schon an den neuen Vertrag, den er mit seinem Vater abschließen wollte. Hätte er sich auf den Gesang konzentriert und hätte er Latein verstanden, ihm wäre auch dann sein Anliegen in den Sinn gekommen: „Dieser Bund wird ewig wären, und der alte hat ein End…“.
Jann war froh, als das Hochamt zu Ende war. Die Luft war von den feuchten Kleidern stickig, und er hatte in den nassen Schuhen kalte Füße bekommen. Er freute sich auf die heiße Suppe, die ja zum Sonntagsritual dazu gehörte wie der Mittagsschlaf, auf den er heute allerdings verzichten musste.
Ihr Kirchweg verlief quer durch die Gärten der Nachbarn und war seiner Familie aufgrund des Gewohnheitsrechtes für alle Zeiten sicher.
Den Schnaps, den Theodor ihn als erstes anbot, lehnte Jann ab. Er wartete, bis Gerharda die Suppe auftischte, die ihm heute besonders guttat. Gerharda wollte wissen, ob Wellem und seine Frau Lis auch in der Kirche waren, was Dora verneinte. Sie hatte sich wie immer die Kommunizierenden genau angesehen und keinen von beiden entdeckt. „Vielleicht sind sie ja auch zum Geburtstag eingeladen“, mutmaßte Theodor. Gern hätte er gewusst, ob sie Adelheid gesehen hätten, aber er verkniff sich die Frage.
Da auch hier alle Gänge vom selben Teller gegessen wurden, waren diese noch heiß, als Gerharda ein großes Stück Fleisch vom in der Woche zuvor erst geschlachteten Schwein, Kartoffeln und Spitzkohl aus ihrem Garten und die herzhaft angemachte braune Sauce auf den Tisch brachte. Als Nachtisch gab es Reispudding mit Himbeersaft, Janns Lieblingsspeise. Jann lächelte und Dora sagte: „Dass du das nicht vergessen hast, Mutter!“