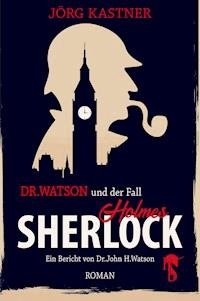
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Sherlock Holmes und Dr. Watson - das bekannteste Ermittler-Duo der Welt aus der Baker Street. Als Jörg Kastner im Juli 1984 eine Woche in London verbringt, entdeckt er auf einem Flohmarkt eine Holztruhe – bis zum Rand gefüllt mit vergilbten Papieren. Er beginnt zu lesen und schon bald stockt ihm der Atem: Ein gewisser Dr. Watson erzählt darin von seinen Erlebnissen mit einem gewissen Sherlock Holmes. Jörg Kastner sieht sich die Papiere genauer an und stellt fest, dass es sich um handgeschriebene Manuskripte von Dr. Watson handelt. Mit dem vorliegenden Bericht wählt er davon eines der umfangreichsten zur Veröffentlichung aus: Sherlock Holmes wird seinem Freund und Biografen Dr. Watson mit jedem Tag fremder, sein Verhalten gibt ihm Rätsel auf. Holmes lässt Beweismaterial von einem Tatort verschwinden – und das, ohne ihn, seinen engsten Freund, einzuweihen. Dr. Watson beschattet Holmes, als dieser im Londoner East End eine merkwürdige Gestalt aufsucht und erfährt dabei Dinge, die ihn erschaudern lassen. Schnell wird dieser Fall für die beiden Freunde zu einem ihrer spannendsten und gefährlichsten. Eine Detektivgeschichte, die ihresgleichen sucht ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 246
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Jörg Kastner (Hrsg.)
Dr. Watson und der Fall Sherlock Holmes
Ein Bericht von Dr. John H. Watson
Kriminalroman
Sir Arthur Conan Doyle gewidmet,dessen literarische Kinderden Lesern in aller Weltbereits seit Generationenunendliches Vergnügen bereiten.Zur Erinnerung anThorsten C. Dickel,dem es leiderviel zu kurze Zeitvergönnt war,Watsons Spuren zu folgen.
„… die Anzahl der Aufzeichnungen,die er (Sherlock Holmes) hinterlassen hat,oder die der Erinnerungenim Kopf seines Biographenist unbegrenzt.“Sir Arthur Conan Doyle
Vorwort des Herausgebers
Eins ist mir klar: Wer der Welt einen „neuen“ Fall des berühmtesten aller Detektive präsentieren will, wird zunächst auf eine Mauer des Unglaubens stoßen. Zu viele „bisher unveröffentlichte Manuskripte“, die angeblich Dr. Watsons Feder entstammen, sind in den vergangenen Jahren auf verstaubten Dachböden oder in Bankschließfächern gefunden worden oder auf sonst eine mehr oder weniger geheimnisvolle Weise in die Hände des jeweiligen „Herausgebers“ gelangt. Einige davon sind offensichtlich Fälschungen, bei anderen muss das jeder Leser selbst entscheiden. Zu dem folgenden Bericht so viel: Wäre ich von der Echtheit nicht überzeugt, so unglaublich einige von Watsons Schilderungen auch erscheinen mögen, hätte ich mir nicht die Mühe gemacht, ihn zu übersetzen und einen Verleger zu finden. Dass ich auf nicht minder mysteriöse Weise in seinen Besitz gelangt bin, wie so viele Leute vor mir, gebe ich offen zu.
Als ich im Juli 1984 eine Woche in London verbrachte, entdeckte ich auf einem Flohmarkt nahe der Carnaby Street eine Holztruhe – nein, kein Blechbehälter! –, die bis zum Rand mit vergilbten Papieren gefüllt war. Da mich alles Geschriebene interessiert, begann ich zu lesen, und bald stockte mir der Atem: Ein gewisser Dr. Watson erzählte von seinen Erlebnissen mit einem gewissen Sherlock Holmes! Hastig klappte ich den Deckel zu und fragte den Verkäufer, was er für diese Truhe samt Inhalt verlange. Der Mann war so alt, dass ich die Jahre nicht im Entferntesten abzuschätzen vermochte. Schlohweißes Haar und ein schlohweißer Bart umrahmten ein zerfurchtes, aber dennoch scharf geschnittenes Gesicht, aus dem mich wache graue Augen musterten. Der Alte musste einst sehr groß gewesen sein, doch die Last der Jahrzehnte hatte seine Gestalt gebeugt. Schließlich, nachdem er mich eine Weile stumm betrachtet hatte, sagte er mit klarer, markanter Stimme, dass ich die Papiere umsonst bekommen könne, und der Preis, den er für die Truhe verlangte, war, gemessen an ihrem Inhalt, bedeutungslos. In meinem East Croydoner Quartier sah ich mir die Papiere genauer an und stellte fest, dass es sich tatsächlich um mehrere handgeschriebene Manuskripte Dr. Watsons handelte.
Am nächsten Tag hatte ich meinen klaren Verstand zurückgewonnen und brach erneut zu dem Flohmarkt auf, um den Alten über die Herkunft der Truhe auszufragen. Er hatte ihren Inhalt sicher nicht gekannt, und ich kam mir wegen des geringen Preises beinahe ein bisschen schäbig vor. Der Mann und sein Stand fehlten an diesem Tag. Niemand der anderen Standinhaber kannte ihn oder hatte ihn jemals zuvor gesehen. So blieb die Herkunft der Truhe bis zum heutigen Tag ungeklärt.
Ich wählte eines der umfangreichsten Manuskripte zuerst zur Veröffentlichung aus. Der vorliegende Bericht dürfte für diejenigen von besonderem Interesse sein, die mehr über Mr. Sherlock Holmes selbst erfahren möchten. Zugleich enthält er eines der erregendsten Abenteuer, in das die beiden Freunde aus der Baker Street verwickelt gewesen sind. Aber ich will Dr. Watson nicht vorgreifen.
Irgendwann einmal müssen die Papiere mit Wasser in Berührung gekommen sein, denn einige Passagen sind unlesbar geworden, sodass ich sie rekonstruieren musste, um den Lesefluss nicht zu stören. Irgendwelche Unstimmigkeiten sind deshalb nicht Dr. Watson anzulasten, sondern meiner Person. Wer jedoch an diesem für Sherlock Holmes selbst wichtigsten Fall seiner langen Karriere Gefallen findet, der möge sich bei Dr. Watson bedanken. Ansonsten ließ ich alles unverändert und versah den Text lediglich mit Anmerkungen, wo ich es um des besseren Verständnisses willen für notwendig oder aus bestimmten Gründen für zweckmäßig hielt.
Nun, liebe Leser, entscheiden Sie selbst, ob Sie es mit Wahrheit oder Dichtung zu tun haben. Ich gebe das Wort ab an den getreuen Watson.
Jörg Kastner
Erster Teil: Die rätselhaften Todesfälle
Wenn ich die Seiten durchblättere, sehe ich meine Aufzeichnungen über … den schrecklichen Tod des Bankiers Crosby.Dr. Watson in „Das goldene Pincenez“Ein dritter erwähnenswerter Fall ist der von Isadora Persano, dem bekannten Journalisten und Duellanten, den man mit einem vor Wahnsinn völlig verstörten Blick auffand, vor sich eine Zündholzschachtel mit einem bemerkenswerten Wurm, welcher der Wissenschaft bislang unbekannt war.Dr. Watson in „Die Thor-Brücke“
1. Kapitel – Allein in der Baker Street
Einen Anfang zu finden, gehört für jemanden, der schreibt, zu den schwierigsten Dingen überhaupt. Ganz besonders schwierig ist es in diesem Fall, geht es doch nicht um eines der üblichen Geheimnisse, von denen Mr. Sherlock Holmes im Laufe seiner langen, ruhmreichen Karriere so viele bravourös entschleiert hat, sondern um das Geheimnis seines ganzen Lebens. Gleichwohl mangelt es den Vorkommnissen, die zu schildern ich so umständlich ansetze, nicht an nervenaufreibenden, dunklen und höchst erstaunlichen Aspekten. Sie sind diesbezüglich in einem Atemzug zu nennen mit den mysteriösen Vorgängen auf und um Baskerville Hall[1] sowie mit den finsteren, bedrohlichen Machenschaften des verschlagenen Barons Maupertuis.[2] Am einfachsten wird es sein, wenn ich, wie schon so oft, die Geschichte aus meiner eigenen Perspektive erzähle und mit jenem Herbstabend des Jahres 1897 beginne, an dem ich zum ersten Mal den kalten Hauch jener Ereignisse verspürte, die längst ihre Schatten über meinen Freund Sherlock Holmes und mich geworfen hatten.
Der große Detektiv hatte jüngst die Attentate auf Reverend Jones beendet und die unheimlichen Vorfälle im Britischen Museum aufgeklärt, bei denen die Goldmaske der Kleopatra eine nicht unbedeutende Rolle gespielt hatte,[3] und war zur Zeit bar jeden Auftrags. Zwar lockten sein berühmter Name und die damit verbundenen Erfolge jeden Tag neue Klienten an, die per Brief, telegrafisch oder persönlich seinen Rat oder Beistand erbaten, aber mein Hausgenosse übte seinen Beruf nicht um des Geldes willen aus, sondern er betrachtete sich selbst als Künstler, den nur solche Fälle interessierten, die für seinen außergewöhnlichen Verstand eine Herausforderung darstellten. Zeiten wie diese, in denen Holmes keinen rätselhaften Spuren nachging und keinem vermeintlich gewieften Gauner eine Falle stellte, hatten mir vor zehn Jahren große Sorgen bereitet, betäubte der Detektiv die von Untätigkeit gequälte Unrast seines Intellekts doch allzu gern mit Morphium oder Kokain, in Maßen angewandt für die Medizin nützlich, aber bei übertriebenem Genuss gefährlich für die Klarheit des Geistes. Ich dankte dem Himmel dafür, dass mein Freund von diesen zwiespältigen Drogen Abstand genommen und seinem Verstand andere Betätigungsfelder erschlossen hatte, denen er sich bei beruflicher Flaute zuwandte. Dazu gehörte das Verfassen von Abhandlungen, wie jene sehr bekannt gewordene Über die Unterscheidung verschiedener Tabaksorten nach ihrer Asche, die für die Wissenschaft der Kriminalistik eine nicht zu unterschätzende Hilfe darstellten, denn Holmes war in seinen Methoden und Erkenntnissen der offiziellen Polizei weit voraus.
Seine freie Zeit nutzte er für die Arbeit an einer erweiterten Neuauflage des oben zitierten Titels, die nun zweihundert anstatt der ursprünglichen einhundertvierzig Tabaksorten auflisten sollte, da in den achtzehn Jahren seit der Erstveröffentlichung viele neue Sorten, vorzugsweise aus den Kolonien, den englischen Markt erobert hatten. Holmes’ Experimente dauerten erst seit Kurzem an, doch schon sehnte ich einen geheimnisvollen Klienten mit einem nicht minder geheimnisvollen Problem herbei, denn der Gestank sechzig verschiedener Tabaksorten und ihrer Asche sowie verschiedener Chemikalien hatte sich in unserer gemeinsamen Wohnung zu einem undurchdringlichen Nebel verbunden, der seinem berühmt-berüchtigten Londoner Vetter den Rang abzulaufen drohte. Ich entfloh der stickigen Hölle ins Carlton Theater, wo das Erstlingswerk eines noch unbekannten Dramatikers an diesem Abend seine Premiere erleben sollte, und ließ Holmes, andächtig über Reagenzgläser und sein Notizbuch gebeugt, allein zurück. Er hatte keine schlechte Wahl getroffen, denn das im Carlton aufgeführte Stück war derart ermüdend, dass sein Autor bestimmt unbekannt sterben würde.
Als ich unguter Laune in die Baker Street zurückkehrte, fand ich unsere Wohnung zu meiner Überraschung verlassen vor. Die komplizierte Apparatur, die Holmes für seine Versuche ersonnen und konstruiert hatte, erweckte den Eindruck, dass sie bis vor Kurzem in Betrieb gewesen sei. Davor lagen das aufgeschlagene Notizbuch und ein Kohlestift auf dem Tisch. Alles sah so aus, als sei Holmes, der mir gegenüber nicht erwähnt hatte, das Haus noch verlassen zu wollen, mitten in seinen Forschungen unterbrochen worden. Mein Eindruck wurde durch einen Blick in das Notizbuch bestätigt, dessen letzte Eintragung mitten im Satz abbrach. Der Gestank verpestete noch immer die Luft, weshalb ich ein Fenster aufriss, wobei leider die vom brennenden Kaminfeuer ausgehende Wärme verloren ging. Ich legte Hut und Mantel ab und bemerkte dabei das Fehlen von Holmes’ Sachen. Meine Augen durchstreiften das Wohnzimmer auf der Suche nach einer Nachricht, die er vielleicht für mich hinterlassen hatte, aber sie fanden nichts Derartiges.
Ich erinnerte mich, beim Betreten des Hauses Licht in der Wohnung unserer Vermieterin gesehen zu haben. Möglicherweise wusste sie etwas über Holmes’ Verbleib. Ich ging hinunter und sah erneut den Lichtschimmer, der aus Mrs. Hudsons kleinem, behaglich eingerichtetem Wohnzimmer kam. Sie saß bei einer Tasse Tee in einem bequemen Sessel, eine Lesebrille fast auf der Nasenspitze, und war in Wilkie Collins’ Roman Die weiße Frau vertieft. Ich nahm den angebotenen Tee an, nahm auf einem gepolsterten Stuhl Platz und erkundigte mich nach ihrem anderen Mieter.
Mrs. Hudson legte ein handgearbeitetes Lesezeichen zwischen die Buchseiten, bevor sie antwortete. „Mr. Holmes hat das Haus vor einer knappen Stunde verlassen, Dr. Watson. Ich saß hier und las, als sich ein Bote an der Tür meldete, der ein Schreiben für Mr. Holmes überbrachte. Kurz nachdem ich ihm das Schreiben gegeben hatte, hörte ich ihn eilig weggehen.“
„Holmes hat nicht gesagt, worum es sich handelte?“
„Leider nein.“
„Oder der Bote?“
„Auch nicht.“
„Von wem kam er?“
„Das hat er auch nicht gesagt. Er war überhaupt sehr schweigsam und machte sich sofort davon, nachdem er den Brief abgegeben hatte. Vielleicht ein neuer Fall für Mr. Holmes?“
„Vermutlich“, sagte ich und wunderte mich darüber, wie rasch mein Wunsch nach einem neuen Klienten in Erfüllung gegangen war. „Was stand auf dem Umschlag?“
„Nur ‚Sherlock Holmes‘, weiter nichts. Es tut mir leid, dass ich Ihnen nicht helfen kann, Dr. Watson.“
„Das ist nicht so tragisch“, tröstete ich die gute Frau. „Ich kann Holmes ja nachher selbst fragen, in welcher Angelegenheit er unterwegs gewesen ist. Ich habe mich nur gewundert, weil er vorher nichts gesagt hat, aber da wusste er es wohl auch nicht.“
Ich trank meinen Tee aus, wünschte der Hauswirtin eine gute Nacht und erstieg die siebzehn Stufen zu unserer Wohnung, wo ich als erstes das Fenster schloss. Die kalte Nachtluft des Herbstes hatte den Gestank weitgehend vertrieben. Mich fröstelte, als ich auf die von Laternen beleuchtete Straße hinunterschaute. Eine vierrädrige Droschke ratterte in gemäßigtem Tempo unter mir entlang und verschwand aus meinem Blickfeld, als sie um die Ecke bog.
London bei Nacht. Nur wenige Menschen wussten so gut wie Sherlock Holmes und ich, welche Gefahren in der riesigen, von sieben Millionen Seelen bevölkerten Stadt auf ihre unvorbereiteten Opfer lauerten. Die Metropole des britischen Weltreiches war zugleich ein Zentrum des Verbrechens. Fälscher und Betrüger, Diebe und Straßenräuber, Mörder und anderes finsteres Gesindel sorgten dafür, dass Gregson, Lestrade, Jones, Hopkins, MacDonald und die übrigen Inspektoren von Scotland Yard samt der restlichen Polizei niemals arbeitslos wurden.
Mittendrin in dem undurchschaubaren, oft bedrohlichen Treiben, das die dunkle Seite Londons beherrschte, stand Sherlock Holmes, der Welt erster Detektivberater, ein Streiter für die Gerechtigkeit, wie ich keinen zweiten kannte. Durch ein Netz von Informanten wurde er über alle wichtigen Vorgänge in der Unterwelt unterrichtet, und seine einmalige Kombinationsgabe wurde in Verbrecherkreisen ebenso gefürchtet, wie sie von der Polizei geschätzt wurde, wenn diese mit ihren üblichen Methoden wieder einmal nicht weiterkam. Mehr als einmal hatte Holmes seinem Vaterland unschätzbare Dienste erwiesen, und es blieb mir ein Rätsel, weshalb er Auszeichnungen und Ehrungen immer wieder ausschlug. Erst kürzlich hatte er die Aufnahme als ordentliches Mitglied der Royal Society, die ihm aufgrund seiner Verdienste um die Kriminalwissenschaft angetragen wurde, abgelehnt und sogar mir seine Gründe verschwiegen. Welchem Mysterium mochte der in manchen Dingen selber rätselhafte Mann jetzt gerade auf der Spur sein?
Kälte und Müdigkeit veranlassten mich, mein Bett aufzusuchen. Mein letzter Gedanke vor dem Einschlafen, an den ich mich erinnere, galt Holmes, der mir am kommenden Morgen beim Frühstück wahrscheinlich Interessantes zu berichten haben würde.
Umso erstaunter war ich, als Holmes am nächsten Morgen noch nicht zurück war. Große Sorgen machte ich mir aber nicht, da die Abwesenheit des Detektivs nichts Außergewöhnliches war. Vielleicht zwangen ihn seine Ermittlungen dazu, Londons Straßen in irgendeiner Verkleidung zu durchstreifen. Er unterhielt in der Stadt mehrere Quartiere, die ihm unter anderem zum Anlegen seiner Masken dienten.
Holmes blieb auch den folgenden Tag verschwunden, weshalb Mrs. Hudson und ich mehrere Besucher, die seine Dienste in Anspruch nehmen wollten, auf unbestimmte Zeit vertrösten mussten. Auch Inspektor MacDonald, der den aufsehenerregenden Diebstahl der Pidgerry-Juwelen aufzuklären hatte, kam vergeblich in die Baker Street. Kälte, Regen und Nebel bestimmten das Wetter; so blieb ich die meiste Zeit zu Hause und brachte anhand meiner Notizen ein paar von Holmes’ jüngsten Fällen zu Papier.
Am achten Tag nach Holmes’' Verschwinden – ich hatte soeben das Frühstück beendet und war mit der Niederschrift unserer Erlebnisse mit dem unglücklichen Reverend Milton B. Jones beschäftigt – wurde ohne vorheriges Anklopfen die Wohnzimmertür geöffnet. Erschrocken ließ ich die Feder fallen und sah von meiner Arbeit auf. Ich blickte in ein Paar durchdringende graue Augen, unter denen eine scharfe, gebogene Nase saß, die dem langen asketischen Gesicht etwas Raubvogelhaftes verlieh. Die Gestalt des Mannes war groß und schlank, aber nicht so dünn, um schwächlich zu erscheinen. Seine Kleidung war ein wenig nass und sah reichlich mitgenommen aus.
„Guten Morgen, Watson“, grüßte Sherlock Holmes freundlich und entledigte sich gleichzeitig seiner Überkleider. „Ich hoffe, das Frühstück hat Ihnen geschmeckt, auch wenn Mrs. Hudsons Eier heute etwas zu dünn geraten sind.“
„Woher wissen Sie das?“, waren die ersten Worte, die ich nach seiner langen Abwesenheit hervorbrachte. Obgleich unsere Freundschaft jetzt seit über eineinhalb Jahrzehnten bestand, brachte Holmes es immer wieder fertig, mich zu verblüffen.
Er nahm seine lange Kirschholzpfeife aus der Halterung neben dem Kamin, stopfte sie mit einer der sechzig Tabaksorten, die ihm momentan zur Verfügung standen, setzte sie mit einem Stück glühender Kohle in Gang, das er mit einer Zange dem Kamin entnahm, und ließ sich in seinem Armsessel nieder.
„Elementar, mein Lieber. Der Eigelbfleck auf Ihrer Brust hätte auch Sie zu keinem anderen Schluss kommen lassen.“
Ich hatte den kleinen gelben Fleck bislang nicht bemerkt.
„Stimmt, Holmes, das ist wahrhaftig einfach. Doch erzählen Sie mir endlich, wo Sie die ganze Zeit gesteckt haben!“
Er lehnte sich bedächtig zurück, legte ein Bein über das andere und stieß ein paar Rauchwölkchen aus. Er machte auf mich einen abgekämpften Eindruck, als sei die vergangene Woche für ihn recht strapaziös gewesen. Seine Haut schien mir eine Spur blasser als sonst zu sein, sein Gesicht noch etwas schmaler.
„Ich habe am Abend Ihres Theaterbesuches überraschend einen Fall übertragen bekommen, mit dem ich bis heute beschäftigt war und in den einige hochstehende, der Öffentlichkeit wohlvertraute Personen verwickelt waren. Um diese Personen nicht in Misskredit zu bringen, habe ich versprechen müssen, die Ereignisse nicht publik werden zu lassen. Seien Sie mir also nicht böse, Watson, wenn ich Sie bitte, nicht weiter in mich zu dringen.“
„Man könnte die Namen und ein paar Fakten ändern, wie ich es früher schon getan habe.“
„Ich weiß Ihre Fähigkeiten auf diesem Gebiet zu schätzen, aber in diesem Fall wäre das unmöglich. Sie würden mir zustimmen, erzählte ich Ihnen Näheres darüber. Aber ich befürchte, dann könnten Sie der Versuchung nicht widerstehen, die Geschichte niederzuschreiben.“
Ich war mit Holmes’ Launen und Eigenheiten so gut vertraut wie niemand sonst auf der Welt und wusste, dass er sich nichts aus der Nase ziehen ließ, wenn er nicht wollte. Deshalb ritt ich nicht länger auf dem Thema herum, insgeheim von der Hoffnung beseelt, ihn zu einem späteren Zeitpunkt umstimmen zu können.
Ich fragte, ob er sich krank fühle. „Sie sehen ziemlich erschöpft aus, Holmes.“
„Die letzten Tage waren in der Tat über die Maßen anstrengend, jedoch kann ich nicht behaupten, mich krank zu fühlen. Ich verspüre lediglich ein gewisses Knurren in der Magengegend, da ich heute noch nichts gegessen habe. Seien Sie so nett, Mrs. Hudson um ein Frühstück für mich zu bitten, während ich mich frisch mache.“
Er erhob sich und ging in sein Schlafzimmer.
2. Kapitel – Colonel Morans Flucht
Die stets fürsorgliche Mrs. Hudson bereitete ein schmackhaftes Frühstück für Holmes zu, das dieser mit Genuss verspeiste. Er hatte kaum den Kaffee ausgetrunken, als jemand energisch an die Tür klopfte und eintrat, ohne eine Antwort abzuwarten. Der kleine, frettchenhafte Mann mit dem Gesicht einer Ratte war ein guter Bekannter, Inspektor Lestrade von Scotland Yard.
„Guten Morgen, meine Herren! Ich freue mich, Sie anzutreffen. Etwas sehr Beunruhigendes ist geschehen.“
„Legen Sie erst einmal ab, Inspektor, und setzen Sie sich“, sagte Holmes. „Sie sind ja aufgeregt wie ein Jüngling vor seinem ersten Rendezvous.“
Der Beamte setzte sich auf die Kante des Korbsessels und fuhr mit einer Hand nervös durch sein Haar.
„Ich habe auch allen Grund dazu“, erwiderte er spitz. „Heute Morgen ist ein Insasse aus unserem sichersten Zuchthaus[4] geflohen, ein gefährlicher Mann und dazu ein alter Bekannter von uns dreien: Colonel Sebastian Moran!“
Lestrades Nachricht schlug wie eine Bombe ein und rief eine Anzahl von Erinnerungen in mir wach, die zumeist unliebsamer Natur waren. Vor dreieinhalb Jahren war es uns gelungen, Colonel Moran dingfest zu machen, den Holmes als den zweitgefährlichsten Mann Londons bezeichnet hatte. Morans bedrohliches, wie aus Granit gemeißeltes Gesicht mit der zerklüfteten Stirn, den grausamen blauen Augen und der wie ein Schnabel vorspringenden Nase tauchte vor meinem geistigen Auge auf. Bei dem Gedanken, dass dieser skrupellose Mann wieder frei herumlief, rann mir ein kalter Schauer über den Rücken. Moran war die rechte Hand Professor Moriartys gewesen, jenes Napoleons des Verbrechens, wie Holmes ihn zu bezeichnen pflegte, der mit seiner mächtigen Organisation jahrelang die Unterwelt beherrscht hatte, bis es Holmes im Jahre 1891 am Reichenbach-Fall in der Schweiz endlich gelang, seinem Leben und somit auch seiner Karriere ein Ende zu setzen. Ich habe diese Begebenheit unter dem Titel Das letzte Problem veröffentlicht. Der harte Kern von Moriartys Organisation blieb nach seinem Tod bestehen und setzte unter Morans Führung sein übles Wirken fort, wenn auch nicht so erfolgreich wie zuvor. Als der vermeintlich ebenfalls tote Sherlock Holmes drei Jahre nach dem Duell am Reichenbach-Fall nach London zurückkehrte, bekam er die Rache von Moriartys Anhängern zu spüren. Der Colonel persönlich machte mit einem besonderen Luftgewehr von enormer Durchschlagskraft, das heute im Scotland-Yard-Museum zu besichtigen ist, Jagd auf den Detektiv, dem es durch eine List gelang, Moran zu überwältigen, wie ich es ausführlich in meinem Das leere Haus benannten Bericht beschrieben habe. Der Verbrecher wurde angeklagt, den jungen Ronald Adair ermordet zu haben, aber durch gewiefte Anwälte und falsche Zeugen gelang es ihm, der Todesstrafe zu entgehen. Das Gericht entschied auf eine lebenslängliche Zuchthausstrafe. Holmes hatte das damals mit einem Kopfschütteln zur Kenntnis genommen und gesagt: „Das Leben ist voller Ungerechtigkeiten, Watson. Wäre Sebastian Moran nicht von vornehmer Herkunft, Eton- und Oxford-Absolvent und ein Kriegsheld, sondern nur ein armer Schlucker, der Frau und Kinder mit Mühe satt bekommt, hätte das Urteil anders gelautet.“ Er hatte dabei mit dem Zeigefinger ein Kehledurchschneiden angedeutet.
„Berichten Sie, Inspektor!“, sagte Holmes knapp, lehnte sich zurück, drückte die Fingerspitzen beider Hände gegeneinander und schloss die Augen; eine Angewohnheit, die ihm half, sich beim Zuhören besser zu konzentrieren.
„Vor mehr als zwei Stunden machte eine Gruppe der Zuchthausinsassen, darunter Colonel Moran, ihren Spaziergang auf dem Hof, da fuhr ein Lieferwagen mit Gemüse, der schon erwartet wurde, herein. Plötzlich steuerte der Kutscher den Wagen in die Richtung der Gefangenen; Männer sprangen heraus und warfen Rauchbomben. Ein Aufseher, der einen der Angreifer überwältigen wollte, wurde niedergeschossen und starb kurz darauf. Die beiden Wachen am Tor wurden ebenfalls angeschossen, sind aber mit dem Leben davongekommen. Sekunden nach Beginn des Überfalls preschte der Wagen schon wieder hinaus. Eine Flucht der Häftlinge durch das offene Tor konnte verhindert werden, aber Moran ist verschwunden. Ein Aufseher glaubt gesehen zu haben, wie der Colonel in den Wagen gesprungen ist, was wohl den Tatsachen entsprechen dürfte. Die gesamte Aktion galt offensichtlich der Befreiung Morans. Den Gemüsewagen hat man in der Nähe des Zuchthauses entdeckt. Den richtigen Fahrer fand man im Inneren, bewusstlos, gefesselt und geknebelt. Er liegt jetzt im Hospital; anschließend werde ich dorthin fahren, um ihn zu vernehmen. Vielleicht möchten Sie mitkommen, Mr. Holmes.“
„Versuchen können wir es“, sagte mein Freund und nickte schwach, „obwohl ich nicht glaube, dass der Mann uns weiterhelfen wird. Wir haben es hier mit organisierten Verbrechern zu tun – leider. Ich wusste, dass das Herz von Professor Moriartys Organisation noch lebt, aber seit Colonel Morans Verhaftung war sie nicht mehr aktiv. Ich befürchte, das wird sich bald ändern. London steht eine schlimme Zeit bevor, wenn Moran sein altes Handwerk wieder aufnimmt. Sie, Lestrade, und Ihre Kollegen werden dann mehr Arbeit bekommen, als Ihnen lieb sein wird. Ich nehme an, die Großfahndung nach dem Entflohenen ist bereits angelaufen.“
„Natürlich, Sir“, antwortete der Inspektor mit einem Anflug von Stolz. „Es dürfte Colonel Moran schwerfallen, aus London hinauszukommen.“
„Das wage ich zu bezweifeln“, meinte der Detektiv, der die Kirschholzpfeife wieder zur Hand genommen hatte. „Davon abgesehen wird Moran nach meiner Einschätzung überhaupt nicht versuchen, London zu verlassen. Die größte Stadt der Welt ist für ihn das ideale Versteck. Wer will ihn in diesem Ameisenhaufen finden? Außerdem sitzt hier das Zentrum seiner Organisation. Wie einst Moriarty kann sein ehemaliger Adjutant wie die Spinne im Netz sitzen und die Fäden ziehen. Was mich aber am meisten beunruhigt, ist der Zeitpunkt seiner Flucht.“
„Das verstehe ich nicht“, gab Lestrade zu. „Was ist mit dem Zeitpunkt?“
„Das ist es ja. Wenn die Organisation vorhatte, Moran zu befreien, warum hat sie so lange gewartet? Sie hätte ihn schon vor Jahren herausholen können. Niemand verbringt freiwillig dreieinhalb Jahre im Zuchthaus.“
„Vielleicht musste der Colonel erst den besten Fluchtweg auskundschaften“, vermutete ich.
„Einverstanden, Watson“, sagte Holmes. „Aber dazu benötigt man möglicherweise drei Monate, jedoch niemals über drei Jahre. Es gibt einen Grund dafür, dass die Flucht gerade jetzt stattgefunden hat. Wenn wir diesen Grund herausbekommen, bringt uns das auf Morans Spur.“
„Wie wollen Sie das anstellen?“, erkundigte sich der Mann von Scotland Yard.
„Die Beantwortung dieser Frage benötigt mehr Zeit als die einer Pfeife“, antwortete der Detektiv und klopfte seine Kirschholzpfeife aus. „Hören wir uns erst mal an, was der Gemüsefahrer zu sagen hat, obgleich ich bezweifle, dass es uns weiterbringen wird.“
„Wie können Sie das behaupten, Sir?“
„Wir haben es, wie ich bereits bemerkte, mit professionellen Verbrechern zu tun, die zu gewitzt sind, jemanden am Leben zu lassen, der sie in Gefahr bringen könnte. Sie haben bei Morans Befreiung unter Beweis gestellt, dass sie vor dem Töten nicht zurückschrecken. Versuchen wir es trotzdem, zumal wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Auswahl an Spuren haben, denen zu folgen sich lohnte. Watson, ich bin sicher, Sie werden uns begleiten.“
Natürlich tat ich das. Wenig später saßen wir in einer Polizei-Kutsche, die vor unserem Haus gewartet hatte, jeder in seine Gedanken versunken. Ich war noch immer damit beschäftigt, Lestrades ebenso unerwartete wie unliebsame Nachricht zu verarbeiten. Das Kapitel Moriarty/Moran in Sherlock Holmes’ Laufbahn schien im Frühling des Jahres 1894 endgültig abgeschlossen zu sein, gottlob mit einem für meinen Freund glücklichen Ausgang. Jetzt war dieser düstere Abschnitt der Vergangenheit zu neuem Leben erwacht, auferstanden wie der Phönix aus der Asche. Für mich bestand kein Zweifel, dass ein verdorbener Charakter wie Colonel Sebastian Moran, einmal in Freiheit, sein verbrecherisches Treiben wieder aufnehmen würde. Sicherlich hatten sich seine Rachegedanken gegen Holmes während der Haft verstärkt, weshalb sich Holmes’ Leben in akuter Gefahr befand. Der Detektiv war sich darüber klar, aber auf seinem markanten Gesicht zeigte sich nicht die Andeutung irgendeiner Emotion. Wie ich ihn kannte, waren seine grauen Zellen bereits mit der Dingfestmachung des Entflohenen beschäftigt, was das einzig Vernünftige war. Wenn ein Mensch Moran aufspüren konnte, so war es Sherlock Holmes.
Als die Kutsche vor dem Hospital hielt und wir ausstiegen, schlug uns ein kalter Wind entgegen. Ich klappte rasch meinen Mantelkragen hoch. Der Herbstwind war eifrig damit beschäftigt, die Eichen und Buchen vor dem Hospital zu entlauben. Er spielte mit den bunten Blättern und wirbelte sie wie Schiffe in einem Orkan durch die Luft. Wenigstens regnete es im Moment nicht.
Die großen Türen des Gebäudes schlossen sich hinter uns und verwehrten dem Wetter den Eintritt. Stattdessen umfing uns der typische Krankenhausgeruch, an den ich seit meiner Jugend gewöhnt war. Wir wussten, welche Abteilung wir aufzusuchen hatten und fragten dort auf dem Gang eine Schwester nach dem neu Eingelieferten. Die hilfsbereite junge Frau führte uns in einen großen Saal mit dreißig Betten, von denen fast alle belegt waren.
„Dort liegt Mr. Donegan“, sagte sie und deutete auf einen in unserer Nähe liegenden Mann von mittlerer Statur, dessen Kopf verbunden war. „Ich lassen Sie jetzt allein.“
Jack Donegan, so der Name des Gemüsekutschers, starrte uns fragend an. Lestrade trat an sein Bett; Holmes und ich folgten ihm.
„Ich bin Inspektor Lestrade von Scotland Yard. Das sind Mr. Holmes und Dr. Watson. Fühlen Sie sich in der Lage, uns ein paar Fragen zu beantworten, Mr. Donegan?“
Der Mann im Bett versuchte eine Antwort, brachte aber nur ein fast tonloses Krächzen zustande. Er räusperte sich verlegen und setzte dann erneut an.
„Ja, Sir. Fragen Sie nur!“
„Erzählen Sie uns, was geschah, bevor Sie Ihr Bewusstsein verloren!“
„Jawohl, Sir.“ Er räusperte sich wieder. „Ich arbeite für Mr. Westmoreland, der das Zuchthaus mit Gemüse beliefert, jeden Montag, Mittwoch und Freitag. Meistens fahre ich die Tour, heute auch. Als ich durch die Oak Lane fuhr, wo wie immer kaum Verkehr herrschte, musste ich anhalten, weil ein Wagen quer auf der Fahrbahn stand, dem ein Rad abgegangen war. Zwei Männer bemühten sich vergebens, den Schaden zu reparieren. Sie schafften es nich’, den Wagen hoch genug anzuheben. Deshalb baten sie mich, ihnen zu helfen. Ich tat es, weil ich es eilig hatte weiterzukommen. Mr. Westmoreland hasst Unpünktlichkeit. Ich packte also am Wagen mit an, da spürte ich einen gewaltigen Schmerz am Hinterkopf. Das nächste, an das ich mich erinnere, sind die Polizisten, die mich wach gerüttelt haben.“
„Wie sahen die beiden Männer aus?“, fragte der Inspektor.
„Ganz normal, Sir. Wie Männer eben aussehen. Der eine hatte einen dunklen Schnauzbart, glaub’ ich.“
„Glauben Sie es, oder wissen Sie es?“
„Nun, so genau hab’ ich sie mir auch nich’ angesehen. Es ging ja alles so schnell.“
Holmes ergriff das Wort: „Wie sah die Kutsche der Verbrecher aus?“
„Es war ein ganz normaler Zweispänner, Sir, nichts Besonderes.“
„Mr. Donegan“, sagte Lestrade, „gibt es sonst noch etwas, was Sie uns berichten wollen?“
Ein versuchtes Kopfschütteln brachte dem Fahrer Schmerzen ein.
„Nein, Sir.“
„Haben Sie noch Fragen?“, wandte sich der Polizist an Holmes.
Dieser verneinte, und wir verließen das Krankenzimmer.
„Ich habe recht gehabt“, sagte Holmes auf dem Gang mit einem Unterton, aus dem ich eine Art von Genugtuung herauszuhören glaubte. „Den Besuch bei Donegan hätten wir uns sparen können.“
„Aber um das mit absoluter Sicherheit zu erfahren, mussten wir den Besuch erst machen“, trumpfte Lestrade auf. „Außerdem ist die Angelegenheit zu wichtig, als dass wir es uns leisten könnten, eine Spur, mag sie auch noch so unbedeutend erscheinen, außer Acht zu lassen.“
Holmes schaute unseren alten Bekannten von Scotland Yard ernst an.
„Sie haben recht, Lestrade – leider. Wir müssen Moran finden, je eher, desto besser. Wenn er Zeit genug hat, die alte Organisation wieder aufzubauen, wird das schlimme Folgen haben.“
„Was gedenken Sie zu unternehmen, Sir?“, erkundigte sich Lestrade.
„Ich werde meine Verbindungen zur Unterwelt spielen lassen und jeder Erschütterung, ob groß oder winzig klein, in dem Spinnennetz nachgehen.“
„Sie werden mich natürlich informieren, sobald Sie etwas Wichtiges herausfinden.“
Holmes nickte und sagte: „Und umgekehrt.“
Die Witterung hatte an Unfreundlichkeit zugenommen, und ich war froh, dass die Kutsche vor dem Hospital auf uns wartete.
Lestrade setzte Holmes und mich nach einer kurzen Verabschiedung in der Baker Street ab.
3. Kapitel – Der schreckliche Tod des Bankiers Crosby
An diesem Tag verlor Holmes kaum noch ein Wort über die Angelegenheit. Stattdessen hüllte er sich und seinen Lieblingssessel in dichte Rauchwolken, begleitet von dem kräftigen Geruch, den sein geliebter Shag-Tabak verbreitete. Nach dem Mittagessen verließ er die Wohnung, um Informationen einzuholen und „um das Räderwerk in Betrieb zu setzen“, wie er es nannte.
Sherlock Holmes’ Jagd auf Colonel Sebastian Moran hatte begonnen!
Am nächsten Morgen – wir waren beide früh auf den Beinen – hatten wir uns gerade an den Frühstückstisch gesetzt, als jemand, den wir schon im Treppenhaus gehört hatten, durch Klopfen um Einlass bat.
„Nanu, das wird doch nicht schon wieder unser Freund Lestrade sein“, meinte ich.
„Wohl kaum“, sagte Holmes. „So leichtfüßig, wie unser Besucher die Treppe heraufgesprungen ist, kann es sich nur um einen jungen Mann handeln. Herein!“
Der Mann in der Dienstbotenuniform war tatsächlich jung an Jahren, keinesfalls älter als Zwanzig. Die Wangen unter dem lockigen dunklen Haar glänzten in einem gesunden Rot.
„Mr. Sherlock Holmes?“
„Das bin ich.“
„Das ist für Sie, Sir.“
Der Jüngling reichte Holmes einen zusammengefalteten Zettel, auf dem Holmes’ Name und Adresse handschriftlich vermerkt waren.
„Geben Sie dem jungen Mann ein Trinkgeld, Watson“, sagte mein Freund und faltete das Papier auseinander.
Ich stand auf und holte ein paar Münzen aus der Tasche meines Mantels. Der Bote bedankte sich artig, bevor er uns verließ.
Holmes hatte die Nachricht inzwischen gelesen und gab sie mir.
„Mit Ihrer Bemerkung über Lestrade lagen Sie gar nicht so falsch, mein Lieber. Das Schreiben stammt von Gregson. Lesen Sie es, bitte, noch einmal laut vor!“





























