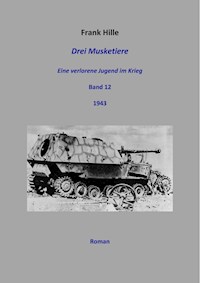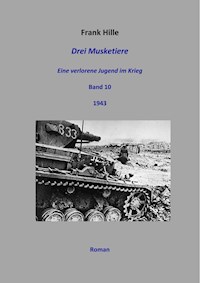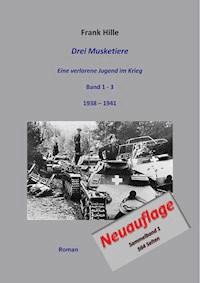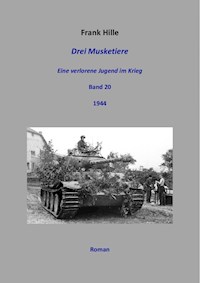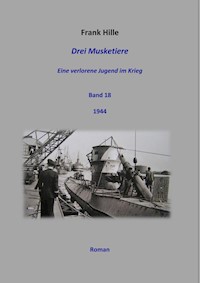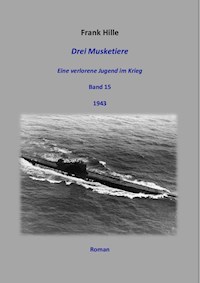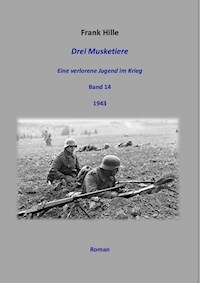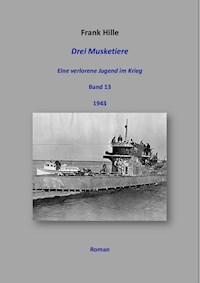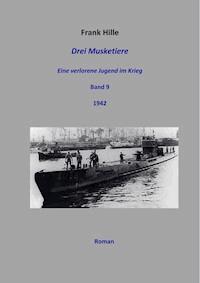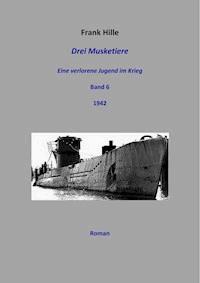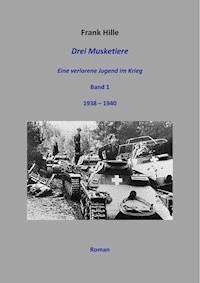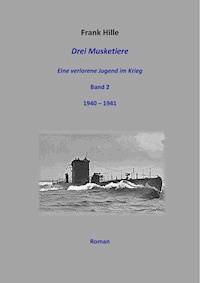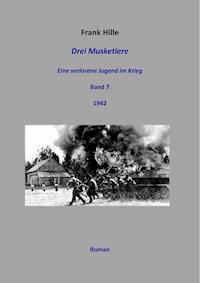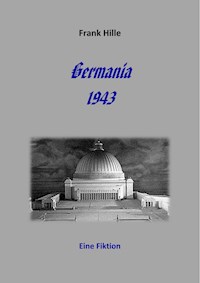Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Im Spätherbst 1944 steht das Deutsche Reich militärisch und versorgungsseitig nunmehr fast hilflos mit dem Rücken an der Wand, denn die Ölquellen in Ungarn sind die einzigen, auf die Deutschland noch zur Treibstoffversorgung Zugriff hat. Dementsprechend werden die Kämpfe in Ungarn mit großer Härte geführt. Fred Beyer ist mit seinem "Panther" ständig im Einsatz, Günther Weber mit seinen Männern im mörderischen Häuserkampf in Budapest gebunden. Martin Haberkorn lernt den Typ XXI in der Baubelehrung kennen und brennt darauf, mit so einem U-Boot in See stechen zu können.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 171
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum
Drei Musketiere
Eine verlorene Jugend im Krieg
Band 21
1944 / 1945
Copyright: © 2020 Frank Hille
Published by: epubli GmbH, Berlin
www. epubli.de
Günther Weber, 15. Dezember 1944, Ungarn
Martin Haberkorn, 15. Dezember 1944, Hamburg
Fred Beyer, 15. Dezember 1944, Generalgouvernement
Günther Weber, 25. Dezember 1944, Budapest
Martin Haberkorn, 24. Dezember 1944, Hamburg
Fred Beyer, 25. Dezember 1944, Generalgouvernement
Günther Weber, 2. Januar 1945, Budapest
Martin Haberkorn, 5. Januar 1945, Hamburg
Fred Beyer, 6. Januar 1945, Ungarn
Günther Weber, 6. Januar 1945, Budapest
Martin Haberkorn, 7. Januar 1945, Hamburg
Fred Beyer, 7. Januar 1945, Ungarn
Günther Weber, 7. Januar 1945, Budapest
Fred Beyer, 12. Januar 1945, Ungarn
Günther Weber, 14. Januar 1945, Budapest
Günther Weber, 15. Dezember 1944, Ungarn
Die Raketengeschosse der russischen Werfer hatten das Gelände umgepflügt und die Männer des Panzergrenadierbataillons in dem Moment überrascht, als sie gerade dabei gewesen waren, sich in der flachen Gegend nah bei Budapest eiligst einzugraben. Günther Weber hatte in seiner langen Zeit als Soldat viel erlebt, sich aber an diese Art der Angriffe nie gewöhnen können. Es war die furchterregende Mischung aus den kreischenden Einschlägen und der enormen und brachialen Gewalt des Beschusses. Die Teuflichkeit dieser Sprengkörper lag vor allem darin, dass sie die Splitter sehr nah über dem Boden streuten und so ein Entkommen nur in gut ausgebauten Deckungen möglich war. Außerdem war die Konzentration der Raketengeschosse viel größer als bei Artilleriefeuer. Die Sowjets hatten diesen Werfern den Namen „Katjuscha“ gegeben, die Deutschen nannten sie „Stalinorgel“. Eigentlich waren die Werfer nur eine grob gefertigte Konstruktion aus schräg angebrachten Startschienen für die Raketengeschosse, die man auf LKW montiert hatte. Bereits ausgangs der dreißiger Jahre hatten die Russen diese Raketenwerfer erprobt und das Ergebnis war überzeugend gewesen. Auf deutscher Seite war man in der Raketentechnologie sicher erheblich besser aufgestellt, aber hatte so eine Verwendung auf dem unmittelbaren Gefechtsfeld nicht in den Blick genommen. Vielmehr hatte man sich auf die V1 und das Aggregat 4, später als V 2 bezeichnet, konzentriert. Diese typische deutsche Hybris, ein noch nie dagewesenes und nicht zu bekämpfendes Fernwaffensystem zu schaffen war eine enorme technisch-technologische Leistung gewesen, die zwar die Grenzen des bislang Machbaren sprengte, aber nie kriegsentscheidend sein sollte. 1942 waren zwar mit Nebelwerfern verschiedener Kaliber mit der „Katjuscha“ vergleichbare Waffen in den Einsatz gekommen, aber nicht in relevanten Stückzahlen. Das russische Waffensystem war durch die Verlastung auf LKW sehr mobil und konnte gut zwischen Frontabschnitten bewegt werden. Nach einem Gefecht im Herbst 1943 war Webers Einheit an einer zusammengeschossenen Batterie solcher Fahrzeuge vorbei vorgerückt und er hatte sich die Zeit genommen, sich einen der LKW anzusehen. Schon lange waren amerikanische Lieferungen von Waffen und anderen Gütern an die Sowjets eine wichtige Hilfe für die Rote Armee. Die enormen Verluste an Material in den ersten Monaten des Krieges hätten dem russischen Regime fast das Genick gebrochen, aber mit nahezu übermenschlichen Anstrengungen hatten die Russen ganze Betriebe weit nach Osten des Landes verlegt und so dem Zugriff der Deutschen entzogen. Unter extremsten Arbeitsbedingungen war dann die Produktion von Rüstungsgütern wieder angelaufen, aber trotzdem gab es noch bis weit in das Jahr 1942 hinein erheblichen Mangel an Kriegstechnik. Eigentlich recht logisch hatte das Hauptgewicht der Produktion auf schweren Waffen wie Panzern und Geschützen gelegen. Mit diesem Material würde man die Deutschen am ehesten aufhalten können, und so gab es für andere hochwichtige Güter, wie zum Beispiel LKW, viel zu wenige Kapazitäten. Auf heftiges Drängen von Stalin waren die Amerikaner dann Lieferverpflichtungen gegenüber den Sowjets eingegangen, und dazu zählte auch die Bereitstellung von LKW.
Günther Weber hatte als Soldat einen recht nüchternen Blick auf den Zweck einer Waffe. Zweifelsohne musste sie unter allen möglichen Gefechtsbedingungen funktionieren, sollte technisch nicht verkompliziert sein, und keinen Anspruch an Perfektion in der Produktionsausführung erheben. Als die deutsche Rüstungsindustrie wieder heimlich belebt worden war hatte es den typischen Drang der Ingenieure gegeben, möglichst viele theoretisch machbare technische Lösung in die Waffensysteme zu integrieren. Diese technikverliebte Denkweise war den Russen und den Amerikanern allerdings ziemlich fremd. Die Rüstungsindustrien dieser beiden Nationen hatten im Gegensatz zu den deutschen Betrieben sehr zielstrebig auf die Organisation einer Massenproduktion gesetzt. Damit war auch von vornherein klar gewesen, dass das Prinzip „Funktion vor Aussehen und Ausführung“ lauten und gewisse Abstriche bei der Fertigungsqualität die Folge sein würden. Den deutschen Soldaten kamen erbeutete russische Waffen sehr grobschlächtig vor, aber sie funktionierten auch unter schlechtesten Bedingungen tadellos. Auch die amerikanischen LKW von Studebaker waren simpel ausgeführt und luschig zusammengebaut, aber ihre Zuverlässigkeit war hoch.
Als der Beschuss beendet war kam die Stille Weber unwirklich vor, aber eines der Geschosse war recht nah neben ihm eingeschlagen und hatte ihn für einen Moment fast ertauben lassen. Dann hörte er die Schreie der Verwundeten und er ahnte, dass seine Einheit erneut Soldaten verlieren würde. Das Sanitätswesen war fast vollständig zusammengebrochen, und nur eine schwache Erstversorgung auf dem Gefechtsfeld reichte nicht aus, um den Männern richtig zu helfen. Vielfach waren die Verletzungen zwar sehr schwerwiegend, doch nicht gleich tödlich. Aber wenn die rasiermesserscharfen Splitter den Grenadieren Körperteile abtrennten waren auch die Sanitäter machtlos. Wenigstens, das redete sich Weber ein, würde der Wundschock die schrecklichen Schmerzen bis zum schnellen Tod vermutlich übertünchen. Er richtete sich auf und sah zwei der Sanitäter geduckt über das Gelände laufen. Erfahrungsgemäß benötigte der Gegner jetzt etwas Zeit, um die Raketenwerfer nachzuladen. Weber ging davon aus, dass die Feuerpause nur dem Nachladen geschuldet war. So wie die Deutschen zu Beginn des Krieges den Feind durch heftigen Beschuss mit Artillerie niedergehalten, und so der Infanterie den Weg für einen relativ verlustarmen Vormarsch geebnet hatten, so setzten die Sowjets jetzt keine Soldaten mehr aufs Spiel, sondern ließen stattdessen ihre waffentechnische Überlegenheit spielen. Eine 82-Millimeter-Rakete der Werfer wog gerade einmal 8 Kilogramm, und war damit kaum schwerer als eine Panzergranate. Eingespielte Raketenwerfer-Bedienungen der Roten Armee hatten ihre Fahrzeuge nach ungefähr 5 Minuten wieder feuerbereit.
Feldwebel Igor Kossygin war kurz vor Kriegsbeginn als LKW-Fahrer eingezogen worden und hatte die verheerenden Niederlagen der Roten Armee miterlebt. Sein Fahrzeug war sehr schnell verloren gegangen, als ein deutscher Jagdflieger tief von vorn kommend auf einer deckungslosen Landstraße die Bordwaffen abgefeuert hatte. Der klapprige LKW war regelrecht zerrissen worden und Kossygin war nur davongekommen, weil er noch während der Fahrt aus der Fahrerkabine abgesprungen war. Was mit den anderen Soldaten auf der Ladefläche passieren würde war ihm in diesem Moment egal gewesen, es ging um sein Leben. Als er sich nach dem Angriff wieder aufgerappelt hatte waren von dem Fahrzeug nur noch Fragmente übriggeblieben, und es war zu vermuten, dass keiner der anderen Männer diese Attacke überlebt haben sollte. Der Treibstoff des LKW hatte sich entzündet und die hölzerne Pritsche in Brand gesetzt. Was Kossygin dann an menschlichen Überresten in den Trümmern gesehen hatte ließ ihn sofort speiend brechen aber noch viel mehr hatte ihn entsetzt, dass einer der Soldaten offenbar auch wie er von dem noch rollenden LKW abgesprungen und jetzt auch zu dem Wrack gekommen war.
„Du feiges Schwein“ hatte ihn der Mann angeschrien „bist einfach rausgesprungen! Das hab ich gesehen! Du bist der Fahrer gewesen! Aber hast dir wohl vor Angst in die Hose geschissen! Das melde ich! Du hast fast 10 Leute auf dem Gewissen!“
Kossygin hatte in den mörderischen und extrem verlustreichen Kämpfen gegen die Deutschen des Öfteren gesehen, wie Politkommissare scheinbare Deserteure oder als Spione verdächtigte Männer kurzerhand erschossen hatten. Manchmal hatten fehlende oder verlorene Papiere für ein Todesurteil ausgereicht. In seinem Fall würde Aussage gegen Aussage stehen, aber so wie er es einschätzte, hätte er wohl die schlechteren Karten.
„Brüderchen“ hatte er gesagt „was hätte ich denn tun sollen? Der Flieger hätte uns doch so oder so zur Minna gemacht. Hier gibt es keinerlei Deckung. Jetzt sag mir mal, was ich hätte tun sollen!“
„Gas geben, ausweichen“ war die gebrüllte Antwort des anderen Soldaten gewesen „dann hätten wir es schaffen können. Aber solch ein Abschaum wie du hast nur deinen eigenen Arsch retten wollen. Ich verhafte dich jetzt wegen Feigheit vor dem Feind! Nimm die Hände hoch. Und vorher schnallst du dein Koppel ab.“
Kossygin war unbewaffnet, sein Karabiner lag irgendwo zwischen den Trümmern des LKW, und vermutlich war er auch unbrauchbar geworden. Er überlegte fieberhaft, wie er aus dieser Situation entkommen könnte. Dass er das Koppel abschnallen sollte bedeutete, dass der andere ihm die Hände fesseln wollte. Wenn er das zulassen würde wäre er verloren. Also musste er in diesem Moment etwas tun, ansonsten würde man ihn erschießen. Er versuchte es noch einmal.
„Was hast du davon, wenn ich auch erschossen werde“ hatte er den anderen Mann weinerlich gefragt „ich werde meine Schuld mit meinem Blut im Kampf abwaschen, das verspreche ich dir. Wem nützt es denn, wenn ich auch tot bin?“
„Spar dir dein Gejammer“ hatte er hören müssen „das hättest du dir früher überlegen sollen. Mach das Koppel ab, sofort!“
Kossygin hatte den Leibriemen wie betäubt aus den Schnallen der Hose herausgezogen und ließ das Koppel nach unten hängen. So, als wollte er es dem anderen übergeben, bewegte er seine rechte Hand nach vorn. Der andere Mann hatte seinen Karabiner auf Kossygins Brust gerichtet.
„Lass es fallen“ hatte er geschrien „und geh´ drei Meter zurück.“
In diesem Augenblick war es Kossygin klar geworden, dass er eine Chance verpasst hatte, denn er war noch nah an dem anderen Mann dran gewesen. Seine letzte Möglichkeit würde dann kommen, wenn der andere ihn fesseln wollte, denn dann würde dieser sein Gewehr ablegen müssen.
„So“ hatte der andere Soldat dann zu ihm gesagt „jetzt bleib dort stehen, dreh dich um und nimm die Hände hinter dem Rücken zusammen.“
Wie ein in die Enge getriebenes Tier hatte Kossygin das Näherkommen des anderen Mannes gespürt, aber folgsam seine Hände nach hinten gehalten. Als er den anderen atmen hörte hatte er sich zu Boden fallen lassen, sich gedreht und dem anderen Mann im Liegen gegen die Beine getreten. Dieser war auf den Rücken gestürzt und Kossygin war hochgeschnellt und hatte mit einem Satz das Gewehr des anderen Soldaten erreicht und es genommen. Das typische lange russische Seitengewehr war aufgepflanzt gewesen, und er hatte die Waffe dann auf den anderen, der auch schon wieder auf den Beinen war, gerichtet.
„Was jetzt“ hatte Kossygin den anderen Mann nach Luft schnappend und keuchend gefragt „sei doch vernünftig! Niemand außer uns hat etwas gesehen. Wir gehen zur nächsten Kommandostelle und melden uns dort. Die können sich ja das Wrack und die Toten ansehen. Wir haben eben Glück gehabt. Ich bin bei der Explosion aus dem Fahrerhaus geschleudert worden und du von der Ladefläche. Wer will etwas anderes beweisen?“
Als er dem ihm gegenüberstehenden Mann in die Augen geschaut hatte war Kossygin aber endgültig klar geworden, dass der andere ihn trotzdem verraten würde. Das bedeutete aber auch, dass er den Mann jetzt töten musste. Ob der Karabiner geladen war oder überhaupt funktionierte wusste er nicht aber er würde ohnehin nicht schießen, es wäre im Falle einer Untersuchung zu offensichtlich, was passiert wäre. Aber Kossygin war mittlerweile so panisch gewesen, dass er nicht mehr klar hatte denken können. Er war auf den anderen zugestürmt und hatte das Seitengewehr auf dessen Bauch gerichtet. Der andere Soldat war davon vollkommen überrascht worden und hatte sich nicht bewegt. Das scharfe Bajonett hatte den Leib des Mannes vollständig durchdrungen und dessen Spitze war am Rücken ausgetreten. Dem Mann war sofort ein Blutbach aus dem vor Entsetzen weit geöffneten Mund gestürzt und statt eines Schreies war nur ein Gurgeln zu hören gewesen. Kossygin war genauso schockiert gewesen, obwohl er das Ergebnis seines Handelns hätte vorausahnen müssen. Der Karabiner war seinen Händen entglitten aber steckte noch mit dem Seitengewehr seinem Gegner im Körper. Der andere Soldat war auf die Knie gefallen und dann zur Seite gerollt. Seine zuckenden Beine hatte er mit einer letzten Willensanstrengung an den Leib gezogen. Kossygin hatte auf den Rücken des Mannes geschaut und gesehen, dass die Spitze des Bajonetts daraus herausragte. Die Hände des Sterbenden hatten sich in den Boden gewühlt, aber seine Bewegungen waren schon schwächer geworden. Igor Kossygin hatte plötzlich Feuchtigkeit in seiner Unterhose gespürt, sein Schließmuskel hatte versagt. Wie gelähmt hatte er auf den anderen Mann am Boden geblickt und gehofft, dass dessen Tod schnell kommen würde. Der andere war aber ein kräftiger und zäher Mann gewesen, der noch viele Minuten um sein Leben gekämpft hatte. Als es vorbei gewesen war hatte Kossygin ein Gebet gesprochen, und um Vergebung für seine Sünden gehofft. Schon damals hatte er gewusst, dass ihn dieser Vorfall sein Leben lang in Gedanken begleiten würde. Er hatte dann die Leiche an den Beinen gepackt und den schweren Körper bis zum Wrack des LKW geschleift. Irgendwie war es ihm dann auch gelungen, den Toten auf das schwelende Stahlgerippe und die brennende Holzpritsche des zerschossenen Fahrzeugs zu ziehen, so dass der leblose Körper mit der Zeit so ausreichend verkohlen würde, um die Ursache seines Todes zu verschleiern.
Kosygin hatte dann noch eine Weile überlegt ob er sich den Deutschen ergeben oder den Weg zu den eigenen Einheiten nehmen sollte. Er war zu dem Schluss gekommen, dass es vermutlich besser wäre nicht zu desertieren, denn mit einem Blick auf den zerstörten LKW war er sich ziemlich sicher gewesen, dass alles so wie jetzt an vielen Frontabschnitten aussah, an denen die Rote Armee in dieser katastrophalen Zeit Unmengen an Soldaten und Kriegstechnik verlor. Nach einem längeren Marsch war er dann auf eine versprengte Einheit gestoßen deren Kommissar sich seine Geschichte uninteressiert und wie gehetzt anhört hatte, denn so etwas geschah gerade aller Orten und außerdem würde das Gebiet des Geschehens bald hinter den sich ungeordnet zurückziehenden sowjetischen Truppen liegen. Kossygin war dann einem Zug von Infanteristen zugeteilt worden, ohne ihm aber eine Waffe auszuhändigen. Diese sollte er dann später einem Gefallenen abnehmen. Das war ihm in diesen Augenblicken vollkommen egal gewesen, denn er würde sein scheinbares Tun vor niemandem mehr erklären müssen und die Erinnerung daran mit ins Grab nehmen. Die Einheit bestand aus knapp 150 Soldaten und war am nächsten Vormittag von vorstoßenden deutschen Panzern eingekesselt und fast vollständig aufgerieben worden. Kossygin konnte mit ein paar Überlebenden in einen nahegelegenen Wald flüchten und hatte nun keine Not mehr, eine Geschichte erfinden zu müssen. Er war dann wieder einer anderen Einheit zugeteilt worden und wie es in dieser Zeit eben gewesen war, mussten die mörderischen Verluste auch an Unteroffiziersdienstgraden ersetzt werden. Da er sich in der folgenden Zeit mutig und entschlossen gezeigt hatte war er befördert worden und nach und nach verblasste auch seine Erinnerung an die von ihm verübte schmähliche Tat. Vielmehr war sein Hass auf die Deutschen, die ja durch die Entfesselung des Krieges die eigentliche Ursache für sein Handeln gewesen waren, enorm angestiegen. Er kletterte die Beförderungsleiter weiter hoch und war schließlich Zugführer von drei Raketenwerfern geworden.
Günther Weber war ebenfalls geduckt über das Gelände gegangen und musste verbittert feststellen, dass vier seiner Männer durch den Beschuss getötet und fünf weitere zum Teil schwer verletzt worden waren. Einem hatten die Splitter den rechten Arm nah der Schulter abrasiert und der Notverband des Sanis war sofort durchblutet gewesen. Es hatte auch keine Möglichkeit gegeben die großen, Blut pumpenden Gefäße irgendwie abzubinden und Weber wusste, dass der Mann eigentlich verloren war. So wie es üblich war hatte man dem Mann Morphium gespritzt, um ihm die Qualen des Sterbens möglichst etwas zu lindern. Das Gesicht des jungen Soldaten war schon fahl geworden, und er lag mit rollenden Augen auf dem Boden. Weber hatte ihn vor gerade einmal drei Monaten als Ersatz in seiner Einheit aufgenommen, und das Leben des achtzehnjährigen ging jetzt schon zu Ende. Das Bataillon war personell enorm geschwächt worden aber was Weber noch mehr beunruhigte war dessen strukturelle Zusammensetzung. In den vergangenen schweren Kämpfen waren viele der erfahrenen Kämpfer gefallen oder verwundet ausgeschieden. Jetzt bestanden mehr als zwei Drittel der Mannschaft aus sehr jungen und noch nicht sehr versierten Männern. In solchen Augenblicken gingen Weber auch Gedanken durch den Kopf, wie denn Deutschland nach dem Ende des Krieges aussehen würde. Eine ganze Generation würde fehlen, um einen Wiederaufbau beginnen zu können. Dass der Krieg verloren war sah er sehr klar, aber ein Aufgeben kam für ihn nicht in Frage. Er hatte sich dem schwarzen Orden aus tiefster Überzeugung verpflichtet, und selbst wenn alles in Scherben fallen sollte, würde er diese Entscheidung nicht bereuen. Er selbst hatte seine Jugendzeit hingegeben und er würde die weiteren Dinge auf sich zukommen lassen. Nicht passiv und voller Angst, sondern so wie er eben war, in seiner nüchternen Art.
Martin Haberkorn, 15. Dezember 1944, Hamburg
Die Tage in der Werft waren lang und anstrengend. Martin Haberkorn war nicht in der Marineschule in Mürwik stationiert worden, denn diese lag viel zu weit weg von Hamburg. Vielmehr hatte man eine Art Außenstelle für die neuen U-Boot-Besatzungen am Stadtrand geschaffen, die nichts weiter als ein umzäuntes und bewachtes Barackenlager war, in welchem sich im Schnitt so um die 150 Männer aufhielten. Die Bedingungen dort waren durchaus erträglich, denn es gab eine bestens funktionierende Küche, und fußläufig entfernt befanden sich ein paar Kneipen. Haberkorn, zwei Obermaschinisten, vier Maschinisten sowie vier Matrosen der Zentralemannschaft und die Nummer Eins wurden jeden Morgen mit einem LKW zur Werft gefahren. Als Offizier war Haberkorns Platz im Fahrerhaus, und so war er nicht den schon tiefen Temperaturen ausgesetzt. Die Fahrt dauerte nicht allzu lange, nach 20 Minuten konnten die Männer absteigen. Auf den Hellingen lagen Boote vom Typ XXI in verschiedenen Bauzuständen. Einige waren schon als äußerlich fertige Unterwasserfahrzeuge zu erkennen, bei anderen hatte man schon ein paar Schüsse miteinander verschweißt, aber es fehlten noch Sektionen. Das war es vor allem, was die Fertigung dieses neuen Typs so besonders machte. Die Idee dahinter war keineswegs revolutionär oder noch nie angewendet worden, aber für den deutschen U-Boot-Bau absolut neu. Wenn sich das System des örtlich getrennten Sektionsbaus und des abschließenden Zusammenbaus in den Werften bewähren sollte, mussten aber eine Vielzahl von anderen Bedingungen geschaffen werden und reibungslos ineinandergreifen. Man musste hier natürlich auch noch zusätzlich in Betracht ziehen, dass ein U-Boot eine sehr komplexe Kriegsmaschine ist, deren Kompliziertheitsgrad durch die neue Konstruktion nochmals erhöht worden war. Den veränderten, und nunmehr vom Gegner diktierten Bedingungen des Seekrieges geschuldet, waren die Boote schon längere Zeit durch die feindlichen Kriegsschiffe und Flugzeuge zunehmend unter Wasser gedrückt worden, und die anfangs so wirksamen Überwasserangriffe nicht mehr möglich gewesen. Zwangsläufig musste die Unterwassergeschwindigkeit der Boote erheblich erhöht werden, um überhaupt noch eine Chance zum Angriff zu haben. Gerade dieser Forderung hatten die Ingenieure vom Projektierungsbüro „Glückauf“ im Harz insbesondere in der Konstruktion entsprochen. Die riesige Batterieanlage würde die Boote noch mehr von der Außenluft unabhängig machen und durch die deutlich höhere Unterwassergeschwindigkeit ein Entkommen nach einem Angriff besser ermöglichen. Neben dieser enorm wichtigen Neuerung hatte es eine Vielzahl von weiteren Verbesserungen in diesem Bootstyp gegeben, die von einer weiteren Mechanisierung des Torpedonachladens, sehr viel leistungsstärkeren Ortungsmitteln bis hin zu deutlich komfortableren Lebensbedingungen der Mannschaft reichten. Das traditionelle Tauchboot war damit erstmalig zu einem echten Unterseeboot geworden.