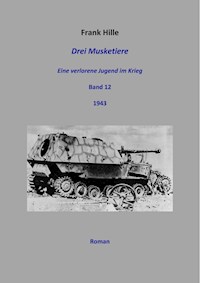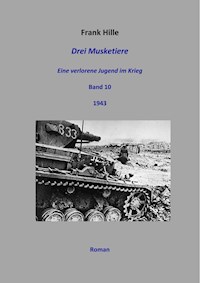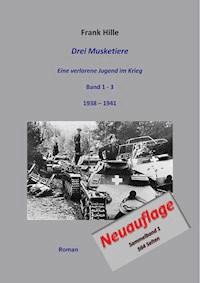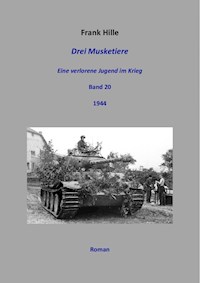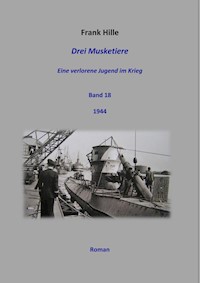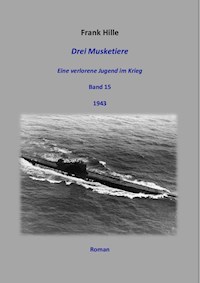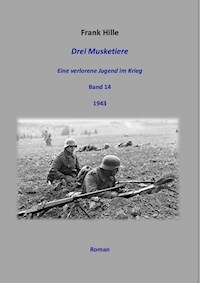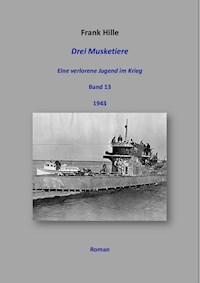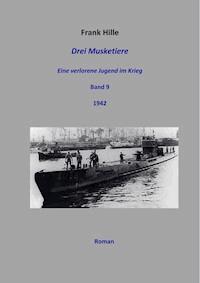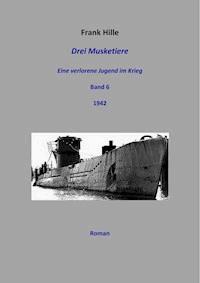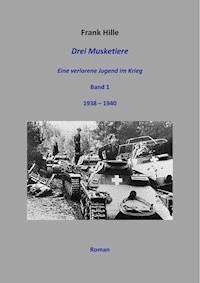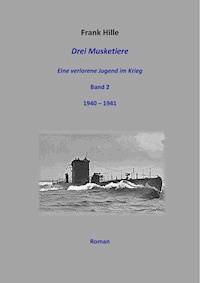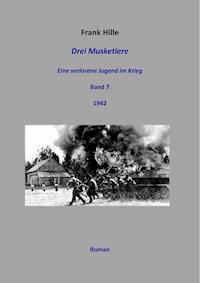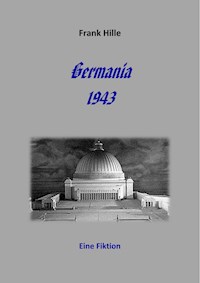Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Im Mai 1945 geht der Krieg für Deutschland mit einer katastrophalen Niederlage zu Ende. Fred Beyer, Martin Haberkorn und Günther Weber geraten in den letzten Kriegstagen in den Strudel sich überschlagender chaotischer militärischer Handlungen durch die klar wird, dass die deutsche Führung nun endgültig jeglichen Überblick über die Lage verloren hat. Zufälligerweise kämpfen die drei Schulfreunde gleichzeitig im Kessel Halbe südlich von Berlin die letzten aussichtslosen Gefechte. Die jungen Männer stehen nach sechs Jahren Krieg vor einer ungewissen und trostlosen Zukunft und erst nach und nach erkennen sie, dass ihnen die Jugend gestohlen wurde. Statt einer unbeschwerten Zeit haben sie Tod, Grausamkeiten und Zerstörung erlebt. Sie selbst haben vielfach getötet, und die Erlebnisse des Krieges werden wie eine unsichtbare schwere Last auf ihren Seelen liegen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 172
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum
Drei Musketiere
Eine verlorene Jugend im Krieg
Band 25
1945
Copyright: © 2023 Frank Hille
Published by: epubli GmbH, Berlin
www. epubli.de
Günther Weber, vor Berlin, 20. April 1945
Fred Beyer, 20. April 1945, in der Nähe von Storkow
Martin Haberkorn, 20. April 1945, Horten, Norwegen
Fred Beyer, 24. April 1945, Raum Storkow
Günther Weber, 24. April 1945, Müllrose
Martin Haberkorn, 24. April 1945, Horten, Norwegen
Günther Weber, 25. April 1945, Müllrose
Major Rolf Fiedler, 25. April 1945,
Me 262-Jagdgeschwader
William Shatner, 25. April 1945, Südengland
Martin Haberkorn, 25. April 1945, vor der norwegischen Küste
Günther Weber, 25. April 1945, südlich von Berlin
Karl-Friedrich Petersen, 25. April 1945, Bremerhaven
Martin Haberkorn, 25. April 1945, Norwegen
IS 2, Sergey Wolkow, 25. April 1945, bei Halbe
William Shatner, 26. April 1945, Ruhrgebiet
Teurow, 26. April 1945, 900 Meter südlich von Halbe
Morgengrauen, Halbe-Teupitz, 26. April 1945,
östlicher Teil des Kessels
Panther, Halbe, 26. April 1945,
westlicher Teil des Kessels von Halbe
Martin Haberkorn, 26. April 1945,
östlicher Teil des Kessels von Halbe
Fred Beyer, Augsburg
Günther Weber, Frankfurt am Main
Martin Haberkorn, Rostock
Nachwort
Günther Weber, vor Berlin, 20. April 1945
Günther Weber hatte sich selbst oft als ziemlich emotionslosen und manchmal gefühlskalten Menschen gesehen. Diese Eigenschaften waren nicht erst durch im Krieg entstanden, er war von Hause aus ein sehr sachlicher und rationaler Typ Mensch. Seine Erlebnisse im Krieg hatten allerdings verstärkend dazu beigetragen, dass seine schon lange vorhandene Skepsis an der grundlegenden Vernunft der Menschheit noch mehr verstärkt worden war. Jetzt war eine Phase der militärischen Auseinandersetzungen angebrochen, in der eine noch einigermaßen realitätsbewusste Führung hätte einsehen müssen, dass das Spiel verloren war. Es ging um die deutsche Reichsregierung. Weber war ein winziger Teil jenes aus politischen, ideologischen, wirtschaftlichen und militärischen Zielen zusammengefügten deutschen Systems. Wenn dieses vor gerade einmal fünf Jahren als bombensicher, unzerstörbar und unbesiegbar geltende Gebilde in den nächsten Wochen kollabieren würde, dann würde auch in Deutschland kein Stein mehr auf dem anderen bleiben, und sich sogar einiges in der Weltpolitik ändern. Das ging ihn aber schon etwas an, denn sein eigenes Schicksal hatte er vollkommen freiwillig mit dem Schicksal des Reiches verknüpft, und nur das würde für ihn in der nächsten Zeit eine Rolle spielen und sich hier auf deutschem Boden ereignen. Davor war ihm tatsächlich nicht bange, denn er war sich ganz klar darüber, dass er auch mit im Trudel der Katastrophe untergehen könnte. Er war nach seinem eigenen Empfinden ohnehin schon viel zu lange fast ungeschoren davongekommen, und auch für ihn würde es einen Schlusspunkt geben müssen. Da er aber nicht freiwillig bereit war sich dem Gegner zu unterwerfen, würde er bis zuletzt mit seinen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln weiterkämpfen.
Seine Panzerjagdabteilung hatte vom Höhenzug der Seelower Höhen aus den angreifenden Sowjets schwere Verluste beifügen können, aber war selbst ausgesprochen heftig dezimiert worden. Weber hatte noch nie zuvor so einen großen Verband geführt, aber rein aus seiner langen Erfahrung heraus hatte er geahnt, dass das Konzept der deutschen Heeresführung falsch gewesen war. Es war gut vorauszusehen gewesen, dass die Sowjets die deutschen Streitkräfte an den Seelower Höhen binden, und dort ihren Hauptstoß ansetzen würden, aber gleichzeitig mit weiteren Kräften die schwachen deutschen Flanken bedrohen und durchbrechen wollten. Letztlich war dieser Plan des Gegners auch aufgegangen, aber selbst der letzte Landser hätte dies erkennen können. Weber spürte gerade in diesen entscheidenden Tagen die immer mehr wachsende Diskrepanz zwischen der Wirklichkeit und der Wahrnehmung der Führung. Offensichtlich wurde in Berlin nur noch mit dem Prinzip der Hoffnung gearbeitet, doch das half ihm als Frontkommandeur keinen Schritt weiter.
Die momentane Situation war erschreckend. Günther Weber war oft genug allein oder mit seiner Einheit in eine Lage geraten, aus der kein Entkommen mehr möglich erschienen war. Irgendwie, durch Zufall, oder durch eine durchdachte Operationsplanung, hatte er doch noch flüchten können. Er erinnerte sich mit einem großen Unbehagen an die vielen Rückzugsgefechte der letzten Monate. Weber war mit einem gewissen Gottvertrauen und dem Glauben an die Stärke der Gemeinschaft einer verschworenen Truppe freiwillig in die SS eingetreten. Allgemein galt, dass gerade die SS verwundete Kameraden niemals zurücklassen würde. Das hatte in der Anfangszeit des Krieges erfüllt werden können. Aber seitdem die Deutschen von den Russen nur noch auf Berlin hin zugeprügelt wurden, war auch dieses Tabu gefallen. Weber hätte gern einen Panzer für ein Leben seiner Männer eingetauscht, aber er hatte diese Wahl nicht. So hatte er als Kommandeur in der letzten Zeit öfter eine Entscheidung treffen müssen, die verwundete Männer in die Hände der Russen fallen ließ. Das war aus seiner Sicht immer nur dann notwendig geworden, wenn er mehr Männer durch einen Rückzug retten konnte, als die, die wahrscheinlich schon verloren waren. Jedes Mal wurde die Last dieser Befehle auf seinen Schultern schwerer, und er ahnte, dass er daran sein Leben lang tragen würde.
Nachdem die Sowjets mit ihrer Übermacht die deutsche Verteidigung bei Seelow immer mehr zermürbt hatten, war diese am dritten Angriffstag endgültig zusammengebrochen. Wie eigentlich immer in solchen Phasen einer bevorstehenden Katastrophe, hatte die bislang noch einigermaßen funktionierende Abwehrfront schlagartig alle Kraft verloren, weil ein Dominoeffekt eingesetzt hatte. Die Deutschen hatten nur noch auf dem Papier Divisionen und Bataillone aufzuweisen, aber in Wahrheit waren die Ist-Stärken der Einheiten nur noch erschreckend. Mit ihrer materiellen und personellen Überlegenheit waren die Sowjets nun fast genauso wie die Wehrmacht im Sommer 1941 verfahren. Damals konnte man, so falsch wie der Begriff in seinem eigentlichen Sinne auch klang, von deutscher Kriegskunst reden. Ein perfekt aufeinander abgestimmtes Räderwerk bündelte je nach Lage Einheiten der Teilstreitkräfte. Waren Infanteriestellungen nur schwer einzunehmen, beschoss die Artillerie diese. Kam man so nicht weiter, wurden Stuka eingesetzt. Erbrachte alles keinen Erfolg, schoss man eben mit schweren Fernkampfwaffen so lange auf den Gegner, bis dessen Widerstand gebrochen war. Jetzt waren die Deutschen diejenigen, die gnadenlos bekämpft wurden. Günther Weber kannte die Dynamik bei Durchbrüchen des Feindes. Erst bröckelte es an einer Stelle, dann gab der nächste Widerstandspunkt nach, und dann fiel alles in Panik zusammen.
Zu seinem großen Unverständnis hatte er am 17. April den Befehl bekommen, mit seiner Einheit nach Müllrose, zirka 20 Kilometer vor Beeskow zu verlegen, und sich dem Standortkommandanten zu unterstellen. Offensichtlich war der Druck der Sowjets im Südraum so groß geworden, dass die Führung dort einen Durchbruch vermutete. Die erfahrenen Soldaten hatten ihre schweren Waffen in einem Waldgebiet äußerst geschickt in Stellung gebracht und getarnt. Weber war die Stellungen abgegangen und hatte sich mit den Männern immer wieder unterhalten. Er spürte die Erschöpfung der Soldaten und bemerkte auch, dass sie an einem guten Ausgang des Krieges zweifelten. Das war für ihn absolut verständlich, denn bis Berlin war es im Vergleich zu früheren Entfernungsmaßstäben nur noch ein Katzensprung. Allerdings ballten sich auf dem Gebiet des Restreiches noch vergleichsweise viele Einheiten, obwohl diese schon vielfach zerschlagen worden waren und keine ernstzunehmende Kampfkraft mehr aufwiesen.
Er fragte sich auch immer mehr, ob er den voraussehbaren Tod seiner überwiegend sehr jungen Soldaten noch rechtfertigen konnte. Aber dann rief er sich ins Gedächtnis, dass es wie er selbst überwiegend Freiwillige waren.
Fred Beyer, 20. April 1945, in der Nähe von Storkow
Nachdem die Nachbareinheiten am 17. April panisch aus ihren Stellungen geflüchtet waren hatte es für Fred Beyer auch keinen Grund mehr gegeben, an der Kante der Seelower Höhen mit seinen Soldaten und Waffen weiter auszuharren. Er konnte die jetzt den Hang emporkommenden feindlichen Truppen mit seinen Panzern ohnehin nicht mehr bekämpfen, und hatte den Rückzugsbefehl ausgegeben. Er war allerdings so weitsichtig gewesen, das alles vorher mit seinem Stab zu besprechen. Die übergeordnete Truppenführung war scheinbar komplett zusammengebrochen, denn Anfragen per Funk waren nicht mehr beantwortet worden. So hatte er das der Wehrmacht innewohnende Prinzip der Auftragstaktik für sich in Anspruch genommen und entschieden, die zwecklos gewordene Stellung zu räumen. Würde er das nicht getan haben, wäre sein Verband von den nunmehr offenen Flanken zusammengeschossen worden. Er hielt sein Handeln unter den gegenwärtigen Umständen für richtig, und etwaige Unterstellungen von Feigheit würde er widerlegen können. Es war schwer genug gewesen, einen halbwegs geordneten Rückzug organisieren zu können.
Fred Beyer hatte selbst oft genug im tiefsten Schlamassel gesteckt und wusste, wie schnell sich größte Unruhe und Verzweiflung breitmachen konnte. Er konnte keinem seiner Männer verdenken, dass sie den Mut verloren. Diese Soldaten hatten drei Tage unter schwerstem feindlichem Feuer gelegen, hatten ihre Kameraden sterben sehen, waren nicht einmal zum Essen gekommen, hatten ihre Notdurft neben Toten im Schützengraben erledigt und keine Minute Schlaf abbekommen. Eigentlich waren die Männer gar nicht mehr richtig kampffähig, und nur der Selbsterhaltungstrieb hielt sie noch aufrecht. Aber irgendwann würden auch die letzten körperlichen und mentalen Reserven verbraucht sein, und insbesondere aus diesem Grund hatte er das Absetzen von den Seelower Höhen befohlen. In den verlassenen Stellungen blieben die Toten und die zerstörte Waffentechnik zurück. Insgesamt 26 Panzer hatten noch aus der Falle herausgezogen werden können. Die zurückgelassenen Fahrzeuge wären unter anderen Umständen zum großen Teil noch zu reparieren gewesen, aber jetzt gab es dazu keine Möglichkeiten mehr. Jeder Panzer zählte in diesen Tagen, und den nun auf den Berliner Verteidigungsring zurückflutenden Einheiten fehlten diese kostbaren Waffen enorm. Es war auch kein Trost mehr, dass das Abschussverhältnis ähnlich wie bei "Zitadelle" bei eins zu sechs, wenn nicht gar darüber gelegen hatte, denn der Gegner führte einfach neue T 34 aus seinen Reserven nach.
Südöstlich vor Storkow, etwa in der Mitte zu Beeskow im Osten hin liegend, war eine Auffanglinie gebildet worden, die aber diese Bezeichnung nur in der Hinsicht rechtfertigte, als dass dort fliehende deutsche Soldaten entweder vor ein Standgericht gestellt, oder die Männer in sogenannten Alarmeinheiten zusammengefasst wurden. Jetzt gab es vermehrt Fälle von Fahnenflucht, und davon zeugten auch die aufgehängten Deserteure. Das war ein klares Zeichen an die Soldaten: wer floh, der starb in Schande. Für den Augenblick mochte das sehr abschreckend wirken, aber selbst diese brutalen Maßnahmen würden den Untergang der Wehrmacht nicht mehr aufhalten können. Die Reste von Beyers Panzerabteilung waren dem Standortkommandanten von Storkow unterstellt worden. Das war ein nach seinem Auftreten vollkommen überforderter Oberst, der in seinem Dienstzimmer mit sich überschlagender Stimme Befehle in das Telefon brüllte. Es klingelte fortlaufend, und Beyer war von einem Stabsoffizier zur Seite genommen worden.
"Sie sind doch der Panzermann" hatte der Major zu Beyer gesagt "Sie werden hier höchstwahrscheinlich keine sinnvollen Befehle mehr bekommen. Sie sehen ja selbst, was hier los ist. Überblick hat hier längst keiner mehr. Ich werde Ihnen an der Karte die momentane Lage zeigen, und dann legen wir beide zusammen fest, wo Sie Ihre Waffen aufstellen. Natürlich alles immer noch mit amtlichen Papieren, denn man gerät heute schnell unter den Verdacht der Drückebergerei. Und das wollen wir doch so kurz vor dem Endsieg nicht riskieren."
Beyer ging auf diese Bemerkung nicht ein. Mittlerweile misstraute jeder jedem, und ein falsches Wort konnte tödlich ein. Deswegen erwiderte er trocken:
"Das wäre hilfreich, Herr Major. Ich habe immerhin noch 26 Panzer und etliche Panzergrenadiere zur Verfügung. So einfach wird uns der Iwan nicht aus dem Weg räumen können. Wir sind schließlich keine heurigen Hasen mehr."
Die Panzer waren am östlichen Rand eines unscheinbaren Dorfes, welches aus gerade einmal acht Gehöften bestand, in der typischen märkischen Wald- und Seenlandschaft in Stellung gegangen. Beyer war mit einem Volkswagen Kübelwagen die einzelnen Fahrzeuge abgefahren um sich den Männern zu zeigen, und ihnen Mut zuzusprechen. Nach Beyers Auffassung war diese Stellung taktisch absolut unzweckmäßig gewählt worden, weil die Sowjets im Norden schon deutlich weiter westlich standen, und Beyers Verband damit schon jetzt in der Falle saß. Auch im Süden drückten die 3. und die 4. Gardepanzerarmee Richtung Berlin. Fred Beyer hatte immer noch seinen Plan im Kopf, solange es möglich war hinhaltenden Widerstand zu leisten, und sich dann nach Westen zu den Amerikanern hin abzusetzen. Alles hing aber von der Entwicklung in den kommenden Tagen ab und seine Erfahrung als Panzermann sagte ihm, dass das Gelände zwar für einige Überraschungserfolge gut sein würde, aber eben gerade nicht für Panzer geeignet war. Es würde nie gelingen die Abteilung so zu formieren, dass sie ihre geballte Feuerkraft ausspielen konnte. Stattdessen rechnete er damit, dass es russischen Panzernahbekämpfern in dem unübersichtlichen Gebiet gelingen könnte, an die Fahrzeuge heranzukommen und diese zu vernichten. Beyers infanteristische Kräfte waren schwach, und sie würden den angreifenden Wellen der Rotarmisten nur wenig entgegensetzen können.
Er erwartete wieder einen der schon im Voraus gescheiterten Abwehrkämpfe, und seine Bereitschaft, sich zum wiederholten Male darauf einzulassen, zerbröselte immer mehr.
Martin Haberkorn, 20. April 1945, Horten, Norwegen
Vor zwei Tagen war das Boot in den Stützpunkt eingelaufen und vom Flottillenchef am Kai begrüßt worden. Statt des früheren großen Tamtams waren die Zeremonien nunmehr einer eher sachlichen Art des Willkommen Heißens gewichen. Nach der Musterung hatte der Flottillenchef Haberkorn in seinem Dienstzimmer einen Kognak angeboten.
"Man muss die Feste eben feiern wie sie fallen" hatte er gesagt "es freut mich sehr, dass Sie mit dem Boot durchgekommen sind. Waren Sie bei den Tests erfolgreich?"
"Zum Teil" war Haberkorns Antwort gewesen "beim Tieftauchversuch sind uns die eigentlich druckfesten Schlauchboote explodiert, und ich musste abbrechen. Aber erfreulicherweise hat es keine strukturellen Probleme mit dem Druckkörper gegeben, da scheint alles in Ordnung zu sein. Mich juckt es schon, den Versuch zu wiederholen."
"Ich werde Sie nicht daran hindern" hatte der Flottillenchef gesagt "bloß muss ich mir das vom BdU absegnen lassen. Aber ich vermute mal, dass doch alle irgendwie darauf scharf sind zu wissen wie tief man mit dem neuen Typ gehen kann. Rechnerisch ist ja alles klar, aber grau mein Freund ist jede Theorie. Sagt zumindest Goethe. Also, ich frage mal bei der Führung an. Aber heute Abend gibt es die übliche Racke nach dem Einlaufen. Auch wenn keine Wimpel mehr am Sehrohr flattern. Es ist wichtiger, dass unsere Seemänner jetzt nicht noch sinnlos absaufen."
Martin Haberkorn war nie ein Freund dieser üblen Besäufnisse gewesen. Nach den Feindfahrten in den ersten Kriegsjahren waren es noch rauschende Feste für die enormen Versenkungszahlen gewesen. Damals hatte man die gegnerische Abwehr noch ziemlich leicht ausmanövrieren können. Bald darauf war es anders geworden, und es ging den ehemaligen Jägern aus der der Tiefe an den Kragen. Mehr und mehr machte sich Katzenjammer breit, und die gerahmten Bilder der abgesoffenen Besatzungen kleisterten die Wände der Messen zu. So langsam wurde den U-Boot-Männern klar, dass sie mit stumpfen Waffen kämpfen mussten, denn die Alliierten enteilten mit ihren technischen Neuerungen. Umso mehr hatten die Seeleute auf die neuen Boote gewartet und waren derweil noch mit den alten VII C und IX-Bootstypen auf Feindfahrt gegangen. Jetzt war eine Art Zwischenzeit erreicht worden: die Elektroboote liefen immer mehr zu, aber sie waren noch unerprobt und sollten Kampfhandlungen weitestgehend vermeiden. So richtig konnte Haberkorn diese Ansage nicht verstehen, denn eigentlich war doch nun gerade jetzt die Gelegenheit, die neue Waffe im scharfen Schuss zu erproben. Das würde nicht mehr allzu lange möglich sein, denn das Kriegsende war absehbar.
Die Einlauffeier fand in einem Saal eines Hafengebäudes statt. Einige Offiziere der Flottille waren mit anwesend und sie hatten glücklicherweise das Gespür, keine Durchhalteparolen von sich zu geben. Richtige Stimmung wollte nicht aufkommen, obwohl die Bewirtung hervorragend war. Alle der U-Boot-Männer hatten Verwandte zu Hause: Frauen, Kinder, Eltern. Und alle konnten sich auch ausrechnen, dass sie die ihnen so nahestehenden Menschen nicht so bald wiedersehen würden. Haberkorn war mit einem der Offiziere der Flottille ins Gespräch gekommen.
"Gibt es denn schon Befehle, ich sage mal so, für den Fall der Fälle?"
"Nicht offiziell" hatte der Kapitän geantwortet "es wird Empfehlungen geben, die die Kommandanten je nach Situation auslegen können. Sie werden sicher verstehen, dass sich die Führung nicht zu weit aus dem Fenster lehnen kann."
"Warum eigentlich nicht" hatte Haberkorn trotzig nachgefragt "warum soll eine Entscheidung auf eine untere Ebene verschoben werden?"
"Weil wir beide viel zu wenig wissen, was die Herrschaften da oben gerade ausklügeln" hatte der Mann erwidert "womöglich gibt es geheime Absprachen mit den Alliierten. Etwa über die Auslieferung der neuen Boote. Aber von mir haben Sie das nicht."
Haberkorn war nicht einmal über diese Aussagen enttäuscht gewesen, das hatte er erwartet. Dieses unbestimmte Hin- und Hergerede über offensichtliche Tatsachen empfand er aber zunehmend als Beleidigung seiner Intelligenz. Es war doch klar, dass der Krieg verloren war, und er nahm sich selbst gleich wieder bei diesem Gedanken zurück, denn er würde auch nicht darüber reden, dass Deutschland wieder einmal verloren hatte. Offensichtlich hatte sich das Land ein weiteres Mal viel zu wichtig genommen und seine Möglichkeiten gnadenlos überschätzt. Selbst wenn er mit dem Flottillenoffizier Klartext reden würde, würde sich im Konkreten nichts ändern. Jetzt endlich hatte er begriffen, dass sein tatsächlich ehrliches Bemühen für das Land nicht das gebracht hatte, was er sich vorgestellt hatte. Er war mit dem Wunsch zur Marine gegangen, Deutschland auf dem Meer wieder stark zu machen. Das war eine Zeitlang aufgegangen, aber heute musste er sich das Scheitern eingestehen. Die U-Boot-Waffe verfügte jetzt über die die besten Boote, die es jemals gegeben hatte, aber sie wurden von der politischen Führung des Reiches aus ihm unerklärlichen Gründen zurückgehalten.
"Weil der unteren Ebene der Gesamtüberblick fehlt" hatte der Flottillenoffizier noch ergänzt "und das ist nicht überheblich gemeint. Es gibt viel zu berücksichtigen. Was erreichen wir, wenn wir jetzt noch einmal richtig losschlagen, was verbauen wir uns damit für Möglichkeiten nach dem Krieg? Das muss alles abgewogen werden."
"Und den Männern muss man das nicht erklären" hatte Haberkorn gefragt "die müssen das doch ausbaden."
"Man muss das den Männern nicht erklären" hatte der Flottillenoffizier seine Meinung bekräftigt "die Mannschaften sind Wehrpflichtige und vielfach Freiwillige und an Befehle gebunden, die Berufssoldaten an Bord wissen, worauf sie sich eingelassen haben. Jeder müsste eigentlich wissen, wohin die Reise geht."
Dem musste Haberkorn allerdings zustimmen.
Er war das beste Beispiel dafür.
Fred Beyer, 24. April 1945, Raum Storkow
Die 1. Ukrainische Front hatte am Vortag etwas südwestlich von Berlin und ungefähr auf der Linie Teupitz-Mittenwalde eine gut 50 Kilometer lange Verteidigungsstellung zur Vorbereitung des Sturms auf Berlin aufgebaut. Niemand brauchte jetzt noch prophetische Gaben: alle von der Oderfront nach Westen auf Berlin zu zurückgedrängten deutschen Truppen würden de facto demnächst von allen Himmelsrichtungen aus von feindlichen Kräften eingeschlossen sein. Die Sowjets standen auch kurz davor, den Sack bei Potsdam endgültig zuzubinden. Fred Beyer hatte das mit seiner leidenschaftslosen Art für folgerichtig gehalten. Zumindest aus der Sicht des Gegners gesehen.
In den Anfangsphasen der deutschen "Blitzkriege" hatte die Wehrmacht hunderttausende Gefangene machen können, die je nach Herkunft, die Westeuropäer in Lager, oder die Russen zur Zwangsarbeit ins Reich oder dem Hunger und einem elendigen Verrecken preisgegeben, behandelt worden waren. Jetzt drohte den deutschen Soldaten und den all im Kesselgebiet befindlichen Zivilisten ein ähnliches Schicksal. Da sie sich aber demnächst im russischen Einflussgebiet befinden würden, war die Furcht vor Vergeltung grenzenlos. Die Soldaten würden sich erbittert wehren, aber was sollten die Zivilisten tun? Sie konnten sich nur an die mehr oder weniger planlos umherirrenden Einheiten anhängen und darauf hoffen, vielleicht noch mit in ein Schlupfloch zu den westlichen Alliierten hereingezogen zu werden. Diese standen aber noch viel zu weit westlich entfernt. Es war ein vergebliches Rennen zu einem Tor in eine eventuelle Freiheit: das gab es einfach nicht.
Fred Beyer hatte neue Waffenkameraden bekommen. Reste der schweren SS-Panzerabteilung 502 sowie der SS-Panzeraufklärungsabteilung 10 waren in dem Gebiet um Storkow erschienen. Beyer wusste aus eigener Erfahrung, dass er sich mit diesen Herren lieber nicht anlegte. Den uralten Kampf um die Vorherrschaft um die Befehlsgewalt wollte und würde er sich nicht mehr antun, da er ohnehin andere Pläne hatte. Dennoch musste er sich eingestehen, dass gerade die Soldaten der SS am erbittertsten kämpfen würden, und er würde auch mit seiner Panzerabteilung das tun, was noch möglich war. Da die Sowjets mit Sicherheit wussten, dass sich die südlich von Berlin befindlichen deutschen Truppen nach Westen absetzen wollten, würden sie die Einkesselung dieser Verbände beschleunigen. Beyer schätzte, dass der Einschließungsring in spätestens zwei Tagen dicht wäre. Beyers Panzerabteilung war durch einen Befehl des Stabes von General Busse, dem Oberbefehlshaber der 9. Armee, den SS-Einheiten zugeordnet und unterstellt worden. Busse befehligte auch die 4. Panzerarmee, die ebenfalls in diesem Gebiet operierte. Eine durchgehende Front existierte nirgendwo mehr, und daraus ergaben sich nur noch hinhaltende Gefechte.