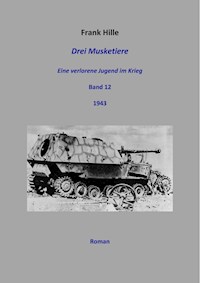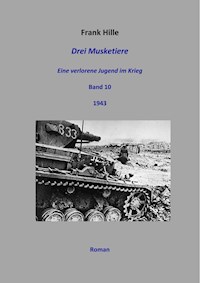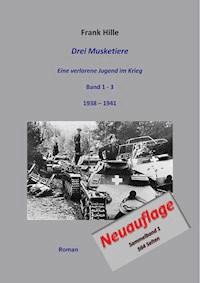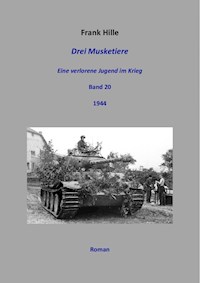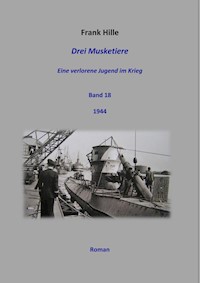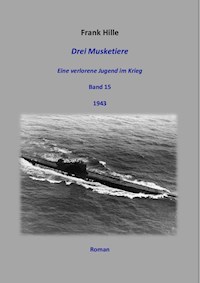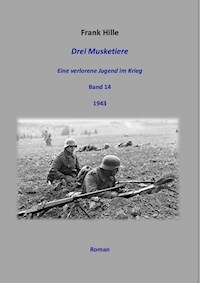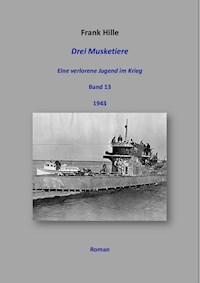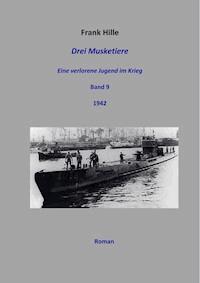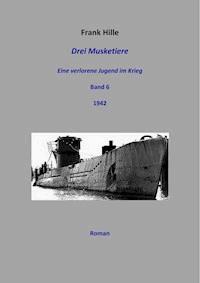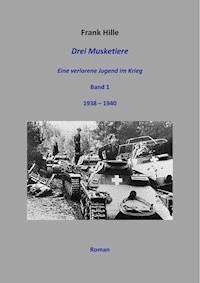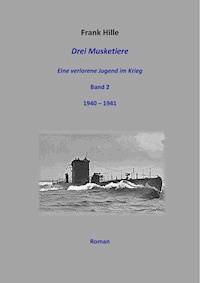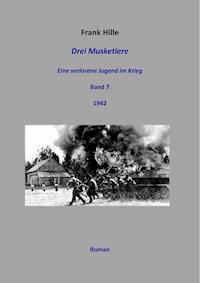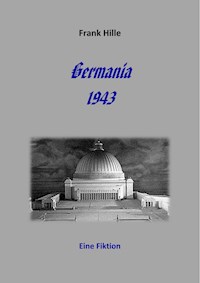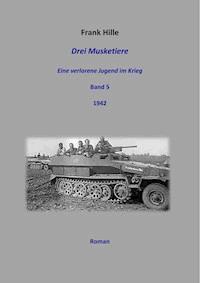
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Nach den schweren Gefechten im Bereich der Heeresgruppe Mitte vor Moskau kommt es im beginnenden Frühjahr 1942 zu Bemühungen beider Seiten, die Initiative wieder zu gewinnen. Deutsche und Russen sind aber gleichermaßen erschöpft und in Abnutzungsgefechten verlieren die Gegner weiterhin an Kraft. Insgeheim hoffen alle auf das Einsetzen der Tauperiode, um in dieser Zeit des Stillstands Verstärkungen heranführen zu können. Dennoch kommt es zu gnadenlosen Auseinandersetzungen um das Gebiet von Rshew wo die Deutschen einem vielfach überlegenen Angreifer standhalten können aber ebenfalls furchtbare Verluste davon tragen. Die Kompanie von Fred Beyer wird zur Umschulung auf den Panzer IV aus der Front herausgezogen, Günther Weber wegen einer besonderen Tapferkeitstat auf die SS-Junkerschule in Bad Tölz kommandiert. Martin Haberkorn wächst immer mehr in seine Rolle als LI hinein, aber erlebt auf seinen Reisen die ständig schwieriger werdende Lage für die deutschen U-Boote.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 159
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum
Drei Musketiere
Eine verlorene Jugend im Krieg
Band 5
1942
Copyright: © 2016 Frank Hille
Published by: epubli GmbH, Berlin
www. epubli.de
ISBN 978
Martin Haberkorn, März 1942, Provence
Günther Weber, Anfang März 1942, Russland
Fred Beyer, März 1942, Russland
Martin Haberkorn, 4. März 1942, Brest
Fred Beyer, 5.März 1942, Russland
Martin Haberkorn, 5.März 1942, Atlantik
Fred Beyer, 6. März 1942, Russland
Günther Weber, 6. März 1942, Russland
Martin Haberkorn, 6.März 1942, Atlantik
Fred Beyer, 8. März 1942, Russland
Martin Haberkorn, 8. März 1942, Atlantik
Günther Weber, 9. März 1942, Russland
Fred Beyer, 9.März 1942, Russland
Martin Haberkorn, 10. März 1942, Atlantik
Günther Weber, 10. März 1942,Russland
Martin Haberkorn, 10. und 11. März 1942, Atlantik
Günther Weber, 11. März 1942, Russland
Wiedersehen, 1. April 1942
Günther Weber, 12. April 1942, Junkerschule Bad Tölz
Fred Beyer, 13. April 1942, Truppenübungsplatz Munster
Martin Haberkorn, 14. April 1942, Brest
Fred Beyer, 14. April 1942, Truppenübungsplatz Münster
Günther Weber, 15. April 1942, Junkerschule Bad Tölz
Fred Beyer, 21. April 1942, Russland
Martin Haberkorn, März 1942, Provence
Nach seinem Empfinden war es schon eine Ewigkeit her, dass er die eine Woche in Camaret-sur-mer gewesen war. So wie er es vorgehabt hatte konnte er sich in den Tagen ein wenig in der Gegend umsehen. Natürlich war der Winter nicht die ideale Jahreszeit die Bretagne zu erkunden, aber ob die Sonne schien oder es bitter kalt war, an der ursprünglichen rauen Schönheit der Landschaft änderte das Wetter nichts. Da sein Auftrag nur der war, die Teile nach Fertigstellung zur Flottille zu bringen, war er eigentlich ohne Aufgaben und der Tag stand frei zu seiner Verfügung. Dem Fahrer hatte er erklärt, dass er für ihn nichts zu tun hätte und er sich frei bewegen könnte, aber wenn er auch nur von einer Winzigkeit von Disziplinarverstößen Wind bekommen sollte, würde die Sache für ihn ein übles Ende nehmen.
"Keine Sorge, Herr Leutnant" hatte der Mann geantwortet "ich bin Fahrzeugschlosser und da der LKW ja in ner Scheune steht kann ich mir den mal ordentlich vorknöpfen. Irgendwie kommt der nicht richtig auf Leistung. Das will ich rauskriegen."
"Und wenn Ihnen Teile fehlen sollten?"
"Gehe ich über den Hof und rede mit den Männern im Betrieb."
"Können Sie Französisch?'
"Nö, wozu? Ich werde schon klarkommen."
"Liegt so n bisschen im Blut, alles in Schuss zu halten und Geld zu sparen? Ich meine bei den Schwaben."
"Muss ja nicht schlecht sein, oder?"
Zum Frühstück um 7 Uhr saßen der Firmenbesitzer, seine Frau, die beiden Kinder, Haberkorn und der Fahrer am Tisch. Der Sohn arbeitete im Betrieb mit, Marie, die Tochter, erledigte die Buchhaltung und das andere Geschäftliche in Absprache mit ihrem Vater. Es wurde nur wenig geredet, 8 Uhr erschienen dann die Arbeiter. Haberkorn hielt sich noch ein wenig in seiner Kammer auf, dann zog er los. Der Ort lag direkt an der Küste und er schaute lange auf die anbrandende Dünung. Diese endlose Weite des Wassers bis zum Horizont beeindruckte ihn immer wieder und er erinnerte sich an den Geographieunterricht, als er erstaunt festgestellt hatte, welche riesigen Gebiete der Erde von Wasser bedeckt waren. Zu dieser Zeit hatte er alles gelesen was mit Seefahrt zu tun hatte, und der Wagemut der Leute auf den Segelschiffen vor vielen Jahrhunderten und ihr Entdeckerdrang hatte ihn zutiefst fasziniert. Für ihn war schnell klargeworden, dass ihn die Arbeit in einem Büro schnell langweilen würde, auf dem Meer hingegen galt es Herausforderungen zu bestehen. Diese romantische Sicht hatte er bei der Kriegsmarine bald abgelegt, aber der Dienst auf dem Boot erschien ihm als die richtige Wahl. Ihm war kalt geworden und er betrat ein Kaffee. Der Espresso war kräftig, dann lief er weiter durch die Straßen und schaute in die Auslagen der Geschäfte. Die Häuser sahen heruntergekommen aus, aber die bunten Schilder über den Läden verliehen dem trüben Anblick wenigstens etwas Lockerheit. Das Leben verlief in Frankreich ohnehin in einem ganz anderen Takt als in Deutschland. Während die Dinge zu Hause in knappen Sätzen geregelt wurden sprachen die Leute hier ausgiebig und freundlich miteinander. Das brauchte zwar seine Zeit, aber das Ergebnis war nicht schlechter. Dass man hier lange Zeit bei den Essen saß war ein typisches Merkmal des Landes, in Deutschland ging es vor allem um die Nahrungsaufnahme, nicht um den Genuss. Nach einem längeren Spaziergang durch die windgeschützten Gassen des Ortes landete er in einem Restaurant.
Mit etwas Bange bestellte er Miesmuscheln. Nach einiger Zeit stand ein Teller mit den Schalentieren vor ihm, einige Scheiben Baguette gehörten zum Gericht. Er fragte die Kellnerin, wie er die Muscheln denn essen sollte. Na mit den Händen, war die Antwort. Er hörte nur etwas Spott heraus, keine Arroganz oder gar Beleidigung. Haberkorn öffnete die erste Muschel. Dann aß er. Die Muscheln waren in Weißwein und Knoblauch sowie anderem Gemüse gekocht worden und so einen Geschmack hatte er noch nie am Gaumen gehabt. Es schmeckte ganz hervorragend. Absolut zufrieden bestellte er noch einen Pastis.
"Nur damit Sie es wissen, Monsieur, hier trinkt man den Aperitif vor dem Essen" sagte die Kellnerin lächelnd.
"Ich lerne noch" antwortete Haberkorn freundlich "aber alles war phantastisch. So gut habe ich lange nicht mehr gegessen."
"Das glaube ich Ihnen. Wo dienen Sie denn?"
"Auf einem U-Boot."
"Oh, mon Dieu! Nichts Frisches. Alles aus der Dose! Sie Ärmster."
Abends zu Tisch berichtete Haberkorn von seinem Tag.
"Tja Monsieur Leutnant" sagte der Firmenchef "die Deutschen und Franzosen unterscheiden sich doch schon, meinen Sie nicht auch?"
"Dem stimme ich zu. Aber wir haben auch viele Gemeinsamkeiten."
"Und die wären?"
"Eine große Geschichte mit vielen Errungenschaften. Den Stolz auf das Erreichte. Die Hoffnung auf ein gemeinsames friedliches Zusammenleben."
"Das setzt aber voraus, dass man sich auf Augenhöhe begegnet und nicht Bürger zweiter Klasse im eigenen Land ist."
"Antoine" sagte die Frau des Mannes scharf.
"Lass mich. Der Leutnant sieht nicht so aus, als würde er gleich die Gestapo informieren wollen. Wenn wir schon über bestimmte Dinge reden, dann richtig. Nun Herr Leutnant, wie würden Sie sich fühlen, wenn Frankreich Deutschland besetzt halten würde?
"Nicht gut."
"Also? Wie sieht die Lösung aus?"
Haberkorn überlegte. Der Fahrer saß zwar mit am Tisch, aber verstand kein Wort. Er konnte ehrlich antworten.
"Vielleicht ein Völkerbund in Europa, in den die Staaten gleichberechtigt entscheiden können."
"Das ist unlogisch. Warum hat Deutschland den Krieg begonnen? Um den Kontinent zu dominieren! Das ist die Wahrheit."
Haberkorn schwieg betreten. Der Mann hatte Recht. Ihm selbst war in seiner Jugendzeit stets vermittelt worden, dass das deutsche Volk zur Führung in Europa bestimmt wäre. Er hatte jetzt keine Argumente mehr und sagte hilflos:
"Glauben Sie mir bitte, nichts wäre mir lieber als ein Ende des Krieges. Ich würde gern als Ingenieur auf einem guten Schiff fahren, und nicht dazu beitragen, feindliche zu versenken. Aber wenn wir den Krieg jetzt einstellen würden, würden die Russen Europa überfluten und ihr Regime bei uns errichten. Es gibt keinen Weg zurück. Haben Sie Dank für das Essen und gute Nacht."
Er und der Fahrer verließen das Haus. Haberkorn zündete sich eine Zigarette an. Der Fahrer ging in seine Kammer. Die Tochter des Firmenchefs kam zu Haberkorn.
"Mein Vater ist ein sehr impulsiver Mann" sagte sie "er meint es nicht so."
"Doch, er meint es so, und ich verstehe ihn" antwortete Haberkorn "aber vielleicht können Sie mich auch verstehen. Es geht um mein Land."
"Ja, das kann ich. Gute Nacht."
Die folgenden Tage begegnete man sich höflich aber reserviert. Bereits nach vier Tagen war der Auftrag erledigt, so, als wollte man, dass die Deutschen schnell wieder abrücken konnten. Drei Stunden vor der Abfahrt des LKW kam Marie zu Haberkorn und bat um seine Feldpostnummer. Er kritzelte sie auf einen Zettel. Sie sah ihn noch einmal kurz an, dann ging sie in den Betrieb zurück.
"Alle Achtung" sagte der Flottilleningenieur "die haben sich ja mächtig ins Zeug gelegt. Und wieder beste Qualität. Übermorgen geht Ihr Boot ins Trockendock. Anfang März müsste alles fertig sein."
Die Werftabnahme mit Tieftauchversuch fand am 1. März statt. Alles funktionierte tadellos, dann verlegte das Boot an den Ausrüstungskai. Am folgenden Tag wurden Torpedos, Treibstoff und Proviant übernommen. Haberkorn war den ganzen Tag auf den Beinen. Als er nach dem Abendbrot geschafft in seine Kammer einrückte, hatte er drei Briefe bekommen. Seine Freunde Beyer und Weber hatten ihm geschrieben, der dritte war von Marie Hublot. Er wollte den Brief sofort öffnen aber entschied dann, ihn erst an Bord zu lesen.
Am kommenden Tag würde das Boot auslaufen.
Günther Weber, Anfang März 1942,Russland
In den vergangenen Wochen hatte es keine ernsthaften Aktionen beider Seiten gegeben. Die Deutschen waren noch weiter zurückgewichen, aber mittlerweile war eine Verteidigungslinie aufgebaut worden, die diesem Namen entsprach. Seit langer Zeit fanden die Männer auch ganz passable beheizbare Erdbunker vor. Diese waren nicht wie auf dem ständigen Rückzug als Quartiere für kurze Zeit ausgelegt, sondern diesmal mit Balken an der Decke verstärkt worden. Irgendwie war es sogar gelungen, einen Tisch und ein paar Stühle dort unterzubringen. In einer Emaile Schüssel wurde Wasser aufgetaut. Das Grabensystem war durchgängig und gut ausgebaut. Artillerie war rückwärtig in Stellung gegangen. Einige Panzer waren dicht an der Linie postiert, andere weiter hinten in Reservestellungen geparkt. Die durchschlagkräftigen Acht Acht hatte man gut gedeckt in geschützten Stellungen verteilt, Flak Vierlinge sollten Luftangriffe abwehren. Munitionslager waren ein Stück weit weg angelegt worden.
Gestern hatten die Russen wieder wie üblich gegen Abend einen Artillerieüberfall unternommen und die Männer waren in den Gräben abgetaucht. Die deutschen Feldgeschütze hatten kurz darauf geantwortet. Auf solche Geplänkel beschränkten sich die Aktivitäten, mehr war auch nicht möglich, da extremes Schneetreiben herrschte, das jegliche Bewegung, auch wegen des tiefen Schnees, unmöglich machte. Die Männer in ihren Unterkünften waren deswegen auch relativ sicher, dass es an ihrem Abschnitt so lange ruhig bleiben würde, bis sich die Wetterbedingungen änderten. Selbst die Flieger beider Seiten blieben inaktiv, sie mussten am Boden bleiben. Nach langer Zeit konnten die Männer auch wieder Zeit für die Körperpflege aufbringen. Ein Waschen der Unterwäsche oder Uniformen war wegen der Kälte dennoch unmöglich. Günther Weber war wie die anderen seit Wochen nicht aus seinen Sachen herausgekommen. In seinem Sturmgepäck hatte er noch zwei Garnituren Unterwäsche verfügbar. Kurz entschlossen ging er nach draußen, zog sich aus, und dann wälzte er sich nach dem anfänglichen Kälteschock nackt im Schnee. Er rieb sich ab und ließ die benutzten Sachen im Schnee liegen. Als er später noch einmal eine Zigarette rauchen ging fand er seine Kleidungsstücke kaum wieder, der Schneesturm hatte sie zugeweht.
Er presste Unterhose und Unterhemd zwischen seine kältestarren Finger und war peinlich berührt, dass er seine Unterhose mit dem Schnee nicht richtig sauber bekam. Im Schritt war immer noch ein blasser gelber Farbton zu sehen, an der Rückseite war ein schwaches Braun zurückgeblieben. Früher hatte ihm seine Mutter täglich frische Sachen bereitgelegt und es war für ihn selbstverständlich gewesen, die Wäsche ständig zu wechseln. Jetzt musste er manchmal wochenlang mit den Sachen auskommen. Wir müssen doch alle stinken wie die Iltisse sagte er sich, die Männer trugen ihre normalen Dienstuniformen und darüber noch die dicke Winterkleidung, und wenn sie schanzten oder eine andere körperliche Anstrengung ausführten gerieten sie trotz der Kälte in Schweiß. Es hatte schon einige Male im Bunker Ärger gegeben, wenn einer der Männer seine Stiefel ausgezogen hatte.
"Das ist doch nicht auszuhalten, zieh deine Eimer sofort wieder an! Das stinkt doch wie die Pest! Willst du uns alle umbringen?"
„Denkst du vielleicht, deine Schweißmauken duften nach Flieder? Na bitte, dann halt die Klappe.“
Bis auf diese kleinen Reibereien kamen die Männer gut miteinander aus, denn die Zeit des ständigen Rückzugs war vorbei und die Ruhe tat allen gut. Nach den harten Gefechten bei Rshew im Januar und Februar waren die sowohl die deutschen als auch sowjetischen Truppen erschöpft und personell ausgezehrt. Hitler wollte die Bedrohung Moskaus durch die Heeresgruppe Mitte weiter aufrechterhalten, Stalin die Deutschen noch weiter nach Westen zurückwerfen. Die Kämpfe waren mit größter Verbissenheit geführt worden und beide Seiten hatten enorme Verluste erlitten. Webers Kompanie zählte nach Ende der Gefechte nur noch 27 Mann, viele der seit Beginn des Krieges dabei gewesenen Männer waren gefallen oder verwundet worden.
Da die Russen wie gewohnt ungestüm und wenig planlos vorgerückt waren gelang es den Deutschen, die 29. Russische Armee im Waldgebiet von Montschalowo einzuschließen. Günther Weber war es durch die lange Zeit im Krieg gewohnt, Bilder von Zerstörung und Tod als dazu dazugehörig zu begreifen. Bei diesen Kämpfen gab es aber diesmal ein Ausmaß an grauenvollen Metzeleien, die er so noch nicht erlebt hatte. Die Russen trieben ihre Soldaten rücksichtslos Welle um Welle ohne Unterstützung durch gepanzerte Fahrzeuge frontal gegen die deutschen Stellungen vor. An einem dieser Tage hatte Weber den Platz eines gefallenen MG-Schützen hinter dessen Waffe im Schützengraben eingenommen. Er feuerte unablässig wie die anderen Männer neben ihm auf die heranbrandenden Reihen des Gegners. Handgranaten wurden geworfen. Sprenggranaten der Panzer explodierten im Gelände. Viele der Russen brachen getroffen zusammen, die letzten hatten versucht rennend an die deutsche Stellung heranzukommen aber wurden davor niedergemäht. 5 Soldaten waren aber dem Kugelhagel entkommen und Weber zielte auf sie, dann hatte das MG einen Hülsenklemmer. Er griff nach seinem Karabiner und legte auf die kaum noch 15 Meter entfernten Rotarmisten an. Einen traf er, der Mann fiel zu Boden, zwei andere wurden von den anderen Schützen niedergestreckt. Die übrigen kamen schnell näher und Günther Weber war kampferfahren genug, nicht im Graben zu bleiben. Er sprang hoch und war jetzt keine drei Meter von den Russen entfernt. Dem ersten schlug er den Kolben des Karabiners gegen das Kinn, der Mann kippte um. Der letzte der Angreifer war ein bulliger Mann, der das lange Seitengewehr auf Weber gerichtet hatte und zum Stoß ansetzte. Weber war eine Sekunde schneller und die von ihm abgefeuerte Kugel traf den Mann in die Brust. Das Bajonett verfehlte Weber nur wenig und der Russe schlug neben ihm in den Schnee hin. Es war wieder ruhig geworden. Er warf einen Blick auf das vor ihm liegende Gelände. Überall lagen gefallene Russen auf der Erde. Müde sprang Günther Weber in den Schützengraben zurück und beseitigte zuerst den Hülsenklemmer. Dann zündete er sich eine Zigarette an und inhalierte tief.
Es war bereits der zweite Angriff an diesem Tag gewesen und die Russen waren wohl davon ausgegangen, dass die Deutschen kaum über Panzer und Geschütze verfügten und sie allein mit der schieren Masse ihrer Infanterie durchbrechen könnten. Dennoch standen einige deutsche Granatwerfer getarnt hinter den Schützengräben und die hochgehenden und splitterstreuenden Geschosse streckten viele der Angreifer nieder. Jetzt wurde es langsam dunkel und die Wahrscheinlichkeit, dass die Russen noch einmal antreten würden, war gering. Sie hatten eine enorme Menge an Soldaten verloren aber für sie gab es kaum eine andere Wahl, als den Ausbruch zu wagen. Die schwachen und zahlenmäßig unterlegenen Deutschen waren aber ihrerseits auch nicht in der Lage, den eingeschlossenen Gegner zu vernichten, wodurch es zu diesen mörderischen Angriffen kam. Auf dem Gefechtsfeld lagen ganze Gruppen toter Russen wie zu Bündeln verquirlt. Günther Weber hatte noch nie so eine Massierung von Gefallenen gesehen und er konnte sich gut vorstellen, dass diese aussichtslosen Attacken vor allem von den Politkommissaren und NKWD Leuten vorangetrieben wurden, die im Rücken der Soldaten postiert waren.
Der Großteil der deutschen Soldaten konnte sich in den Erdbunker etwas ausruhen, Posten blieben in den Gräben zurück. Da die Versorgung wieder Probleme bereitete hatten sich etliche der Männer mit russischen Maschinenpistolen ausgerüstet, die sie den Gefallenen abgenommen hatten. In der Dunkelheit zogen deutsche Soldaten geduckt über das Gefechtsfeld und durchsuchten die Leichen nach brauchbaren Dingen. Besonders begehrt war Tabak, den sie in den Jackentaschen der Toten oder kleinen Beuteln fanden. Günther Weber hatte sich auch einmal eine Zigarette aus einem Stück Zeitungspapier und dem Machorka gedreht, aber nach den ersten Zügen beschlossen, die Finger von dem extrem kräftigen Kraut zu lassen.
Im Bunker aß er noch etwas Dosenwurst und Brot, dann legte er sich hin und versuchte zu schlafen. Mit Sicherheit würden die Russen morgen wieder gegen die deutschen Stellungen anrennen und wie viele gegnerische Soldaten sich noch im Kessel befanden wusste er nicht.
Fred Beyer, März 1942, Russland
Er wusste, dass Rshew ein strategisch außerordentlich wichtiger Ort war, denn er stellte einen gut 180 Kilometer von Moskau entfernt liegenden wichtigen Verkehrsknotenpunkt nach Smolensk und Wjasma dar. Die Russen würden alles darum geben, wieder in den Besitz der Stadt zu kommen und wie zu erwarten war, hatten sie erhebliche Kräfte im Bereich der Heeresgruppe Mitte konzentriert, um diese weiter nach Westen zurückwerfen zu können. Was Fred Beyer allerdings nicht ahnte war die bald zehnfache Überlegenheit des Gegners auf diesem Schauplatz. Ungünstig war weiterhin, dass das Terrain für den Panzerkampf denkbar schlecht geeignet war, denn rings um die Stadt erstreckten sich Sümpfe, morastischer Boden und viele Wälder.
In den vergangenen Wochen hatten die Russen mächtig Druck ausgeübt, aber trotz ihrer zahlenmäßigen Überlegenheit hatten sie die Deutschen nicht entscheidend schwächen können. Noch immer kam es Beyer so vor, als wäre der russischen Führung der Verlust an Menschenleben vollkommen egal, die Rote Armee hatte sich in den letzten Wochen personell neu aufgestellt und man merkte die Wintererfahrung der sibirischen Truppen deutlich. Die teilweise bis minus 40 Grad machten den Männern nichts aus, die deutschen Soldaten hatten damit große Probleme. Auch die Technik verursachte weiterhin Probleme aber die Männer waren nunmehr findig genug, um aus der Not heraus zu improvisieren.
Ihren Panzer III hatten sie immer wieder mit kaum vorhandener weißer Farbe anstreichen müssen, um die Wintertarnung aufrecht zu erhalten.
„Was kommt denn da für ein Ausschuss an die Front“ hatte sich Müller einmal beschwert „der Anstrich hält doch kaum zwei Wochen.“
„Denk mal drüber nach, unter welchen Bedingungen wir die Farbe aufbringen“ war Lahmanns Antwort gewesen „minus 30 Grad, Schneetreiben. Wie soll die Farbe richtig trocknen und anhaften?“
„Aber da könnten sich die Herren in unseren riesigen Chemiefabriken mal was einfallen lassen“ schimpfte Bergner „schließlich steht seit dem Wintereinbruch im vorigem Jahr fest, dass wir unsere Ziele nicht erreichen würden. Und was ist dem Getriebe- und Waffenöl? Es muss doch möglich sein Stoffe herzustellen, die auch die tiefen Temperaturen aushalten.“