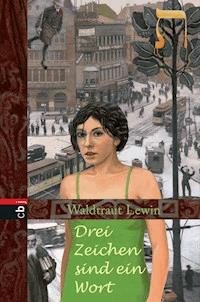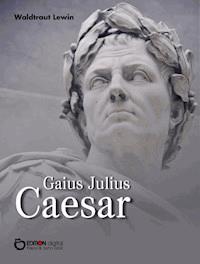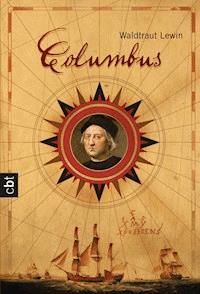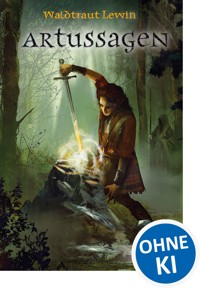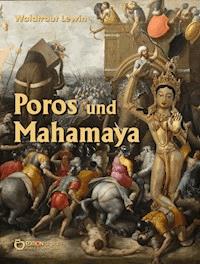6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbj
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Die Vorboten des Dritten Reichs: Zweiter Teil der mitreißenden jüdischen Familiensaga
Nachdem Schlomo, ihre große Liebe, auf offener Straße von einem Deutschnationalen erschossen wurde, reist Leonie nach Wien, um dort nach dem zweiten Zeichen zu suchen. Während auch in der österreichischen Hauptstadt die düsteren Vorboten des Dritten Reichs heraufziehen, setzt Leonie alles daran, um sich ihren Traum von einer Schauspielkarriere zu erfüllen. Dadurch gerät sie in immer größeren Konflikt mit ihrer Tante, der berühmten Burgschauspielerin Felice Lascari. Diese befindet sich in Besitz des zweiten Zeichens. Doch als Leonie ein Engagement am Theater in der Josefstadt erhält und Felices Freund sich Leonie annähert, stellt die eifersüchtige Tante sie vor eine furchtbare Alternative ...
• Meisterhaft erzählt, mitreißend wie der erste Band
• Steht in der Tradition von Klaus Kordon und Willi Fährmann
• Attraktive Schauplätze: Wien und Südfrankreich
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 561
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Waldtraut Lewin
Drei Zeichen sind die Wahrheit
Waldtraut Lewin
Drei Zeichen sind die Wahrheit
cbj ist der Kinder- und Jugendbuchverlag
in der Verlagsgruppe Random House
Gesetzt nach den Regeln der Rechtschreibreform
1. Auflage 2008
© 2008 cbj Verlag, München
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Burkhard Heiland
ISBN 978-3-641-01430-8
www.cbj-verlag.de
Datenkonvertierung eBook:
Kreutzfeldt Electronic Publishing GmbH, Hamburg
www.kreutzfeldt.de
HERMENEAU
1
Im Bahnhof von Port Bou, dem letzten, bevor der Zug Frankreich verlässt und in die finster gähnende Öffnung eines langen Tunnels fährt, sitzen zwei alte Leute im Vorraum der Station.
Isabelle und Gaston. Sie warten auf die junge Frau, die aus Deutschland kommt. Es ist später Nachmittag.
Der Himmel ist wie erstarrt. Es ist Winter an der Côte Rocheuse.
Die beiden haben sich in Pelze gehüllt.
Isabelle zerrt mit nervösen Fingern an ihrem Otterfellmantel, zieht den Kragen fester um den Hals, streicht durch das langhaarige Vlies. Dann fährt sie sich durchs Haar, ringt die Hände im Schoß, bis Gaston den Arm ausstreckt und seine Hand beruhigend auf die ihre legt.
»Liebes!«
»Entschuldige«, sagt sie, ihre tiefe Stimme klingt heiser. »Das Warten!«
»Du hast ein halbes Jahr lang gewartet.«
Sie macht eine Bewegung, als wolle sie etwas verjagen. »Je näher das Ziel ist, desto mehr wächst die Ungeduld.«
»Fürchtest du dich?«, fragt der alte Mann leise.
Sie antwortet nicht. »Ich fürchte mich sehr«, fährt er fort. »Ich fürchte mich vor dem Moment, wenn der Zug einfährt und sich die Abteiltür öffnet. Sie steigt aus ... Was wird sein? Du weißt es besser als ich, dass ihr etwas Furchtbares zugestoßen sein muss. Weißt es anders als ich. Du hast es vorhergesehen.«
Isabelle zieht an ihrem Mantel.
»Blut«, murmelt sie. »Es muss Blut gekostet haben, das Ding, das sie mitbringt. So sollte der Anfang nicht sein. Aber dies Blut sagt mir einmal mehr, wie dringend notwendig es ist, das Werk zu vollbringen.«
Sie springt auf, mit einer jener schnellen, wilden Bewegungen, die ihr Alter Lügen strafen. Verlässt die Station, begibt sich nach draußen. Gaston folgt ihr.
Sie lehnt an der Wand des Bahngebäudes, den Kopf zurückgelegt, tief atmend.
Das Gebirge liegt in violettem Dunst. Von weit unten donnert die unsichtbare Meeresbrandung.
Sie spürt seine Nähe. »Du weißt, was für schreckliche Visionen ich hatte!«, murmelt sie. »Gefahr für das Mädchen. Gefahr, ihr Liebstes zu verlieren. Flammen waren dabei.«
»Ich hatte es ihr nach Berlin geschrieben.«
»Ja. Doch ich fürchte, sie hat es falsch gedeutet. Wir wissen nichts.«
»Ich habe es aus der Zeitung. Es soll Unruhen gegeben haben.«
Isabelle lacht nervös auf. »Was schreiben französische Zeitungen schon groß über Berlin.« Sie dreht den Kopf hin und her, als habe sie Schmerzen. »Sie wollte nicht allein hierherkommen. Sie wollte jemanden mitbringen. Aber nun kommt sie doch ohne Begleitung.«
»Ja.«
»Etwas sehr Schlimmes muss geschehen sein.«
Gaston erwidert nichts.
Die Erde beginnt zu vibrieren. Der Viadukt summt und dröhnt. Der Zug.
Der Mann legt der Frau behutsam den Arm um die Schulter und führt sie zurück ins Innere der Station. Sie durchqueren den Vorraum, in dem sie gesessen haben, und betreten die Bahnhofshalle. Vorher war sie wie ausgestorben, nun belebt sie sich. Der Stationsvorsteher erscheint, setzt die Mütze auf, grüßt das Paar, indem er ehrerbietig zwei Finger an den Mützenschirm legt, öffnet die Schranke. Die Zollbeamten folgen ihm, schnallen im Gehen das Koppel fest, streifen die Handschuhe über.
Schnaufend, in einer Wolke weißen Dampfes, fährt der Expresszug Paris-Barcelona ein, hält mit kreischenden Bremsen hier an Frankreichs Grenze.
Gaston und Isabelle stehen und fassen sich an den Händen.
Der Schaffner öffnet von innen die Wagentür, lässt die Tritte herunter, reicht der einzigen Aussteigenden hilfreich die Hand.
Dann sehen sie ihr entgegen: Da steht Leonie Lasker mit ihrem Koffer auf dem Bahnhof von Port Bou, wo sie vor einem halben Jahr eingestiegen ist, um in Berlin einen Buchstaben zu entdecken und hierherzubringen.
2
Sie ziehen sie in ihre Arme, stumm, heftig, erst Isabelle, dann Gaston, und Leonie erwidert die Umarmung mechanisch. Sie empfindet nichts dabei, weder Freude noch Aufregung. Sie ist einfach da.
»Es ist in dem Koffer ganz zuunterst«, sagt sie statt einer Begrüßung, so, als hätte sie erwartet, dass Isabelle sofort danach fragt oder verlangt, dass sie es gleich vorzeigt, das goldene Ding, das Zeichen.
Dann greift sie sich an den Hals, zieht den Mantel zusammen – genau die gleiche Bewegung wie vorhin Isabelle – und sagt: »Ich friere.«
Und wird sich klar, dass sie eigentlich nichts anderes erwartet hat, als auch hier zu frieren. Überall ist es kalt für sie. Warum sollte es hier an der Côte Rocheuse anders sein?
Gaston schält sich sofort aus seinem fellgefütterten Tuchmantel und legt ihn ihr um die Schultern. Er greift den Koffer, Isabelle nimmt sie in den Arm. So gehen sie zu Gastons großer schwarzer Limousine, die vor dem Bahnhof auf sie wartet. Doch bevor sie die Bahnhofshalle verlassen, wirft Leonie noch einen Blick zurück nach dem davonfahrenden Zug, als müsse sie jemanden bitten mitzukommen.
Jemanden, der nicht mehr reisen konnte ...
»Möchtest du vorn sitzen oder im Fonds?«, fragt Gaston, und sie erwidert: »Das ist mir egal.«
Die beiden alten Leute wechseln einen Blick des Einverständnisses, dann setzt sich Isabelle nach hinten und überlässt der Jungen den Platz neben ihrem Mann.
Der Wagen gleitet die weiten Schleifen der Serpentinen hinunter, biegt kurz vor dem Städtchen Cerbère ab und klettert wieder hinauf zum Château Hermeneau, dem Schloss von Leonies Verwandten, die sie erst seit dem Sommer kennt.
Dieser Sommer, als das junge Mädchen aus Berlin unbedarft und neugierig einer Einladung von Leuten folgte, die von sich behaupteten, zu ihrer Familie zu gehören. Und als sie denn da war, in dieser herrlichen, rauschenden, brausenden Landschaft am Fuße der Pyrenäen, da wurde sie als Erstes damit konfrontiert, dass sie jüdische Vorfahren hatte. Und dann, dass eine Aufgabe auf sie wartete. Die Buchstaben zu suchen; für das magische Werk ...
Die Landschaft ist verschleiert. Im Sommer leuchtete sie in den buntesten Farben. Aber das kommt Leonie so ganz richtig vor. Für sie gibt es keine bunten Farben im Augenblick.
Sie sieht aus dem Fenster, nach rechts und links. Das alles hat sie einmal entzückt. Nun ist es ihr gleichgültig. Wie alles andere auch. Sie wohnt an einem kalten, leeren, abgeschlossenen Ort.
Ihre Hand tastet unter die Mäntel, ihren eigenen und den von Gaston, den sie um die Schultern hat. Sie fühlt nach ihrem zerschnittenen Kragen. Die offene Wunde.
Sie fahren die wenigen Kilometer schweigend.
Leonie fühlt die Spannung, die Erwartung, die zwischen ihnen dreien schwelt. Sie fühlt Isabelles Blicke von hinten, sie lasten schwer, traurig und erwartungsvoll auf ihr, als würde eine Hand auf ihrem Nacken, auf ihrem Haar liegen.
Schloss Hermeneau. Gaston biegt auf den geräumigen Innenhof ein, zieht die Bremse. Er greift vorn an Leonie vorbei und öffnet die Tür, und sie steigt aus, immer noch seinen Mantel um die Schultern, und steht wartend da, ohne sich zu rühren, bis er neben ihr ist, den Koffer in der Hand.
In der Eingangstür taucht für einen kurzen Augenblick die gedrungene Gestalt von Clémence auf, der rötliche Haarknoten, die Schürze – dann verschwindet sie wieder; Clemence, die Zugehfrau aus dem Ort. Die kann sie, Leonie, nicht leiden, weil sie eine »Boche« ist, eine Deutsche, und Clémence’ Mann ist im Krieg gegen die Deutschen vor fünf Jahren, 1918, gefallen.
Sie registriert das alles, erkennt es wieder, ohne etwas dabei zu empfinden.
Gaston berührt sie sacht am Arm. »Ich bring dich in dein altes Zimmer, Leonie. Bist du hungrig? Durstig?«
Sie schüttelt den Kopf.
»Ruh dich aus und dann ... «
»Ich muss mich nicht ausruhen. Ich hab auf der Fahrt Ruhe genug gehabt.«
Sie sieht, dass Isabelle in der Eingangshalle stehen bleibt, während Gaston, den Koffer in der Hand, sie in das schöne Gastzimmer begleitet, in dem sie auch beim ersten Mal gewohnt hat. Wie selig sie war in diesem großen Raum, das breite Bett, das eigene Badezimmer, damals ...
»In Isabelles Boudoir, ja?«
Gaston nickt. Er wirkt bedrückt. »Wenn du aber erst ... « »Ich will es hinter mich bringen.«
Hinter sich bringen. Wie eine unliebsame Aufgabe, eine Pflichtübung. Was ein Glück und ein Fest sein sollte.
Als Gaston gegangen ist, nimmt sie ihren Koffer, stellt ihn auf die kleine Sitzbank, überzogen mit weißem Schleiflack, und öffnet die Schnallen. Ganz unten, unter ihrer Wäsche, eingewickelt in eine Wolljacke, liegt eine abgeschabte alte Geldbörse, wie sie die Marktfrauen benutzen. Sie holt sie heraus und öffnet den Verschluss.
Die blaue Seide. Da ist es. Sie nimmt es in beide Hände, fühlt die Form durch den Stoff.
Es ist hart und kalt. Sie hat nicht das Bedürfnis, es anzuschauen. Ein Buchstabe aus Gold, weiter nichts.
»Nimm es, es gehört dir. «
Hat das jemand gesagt? Hier ist keiner. Auch nicht einer. Niemand außer ihr.
Sie legt das Ding auf ihr Bett, geht ins Bad, wäscht sich Gesicht und Hände, fährt sich mit der Schildpattbürste, die bereit liegt, durchs Haar. Wirft einen kurzen Blick auf ihr Spiegelbild. Das ovale Gesicht, gleichgültig irgendwie. Blass, das schon. Aber hinreichend gelassen, hoffentlich. Die Gelassenheit, den Abstand, den sie braucht, um diese Geschichte zu erzählen, als wäre es eine fremde Geschichte, die nicht sie betrifft. Sonst kann sie es nicht erzählen.
Die Augen dunkle Abgründe, mit malvenfarbenen Ringen. Viel Schminke wäre nötig auf der Bühne. Aber diese Bühne hat aufgehört zu existieren.
Weg. Alles ist weg.
Leonie nimmt ihr Mitbringsel auf und begibt sich zum Turm, beginnt, die Stufen zu ersteigen. Da oben, mit Blick in alle vier Himmelsrichtungen, liegt das Zimmer, das man hier Isabelles Boudoir nennt. Eigentlich ist es so etwas wie ein kleiner Tempel, in dem hebräisch beschriebene und bunt illustrierte Pergamente, Thorarollen, goldene und silberne Kultgegenstände aufbewahrt werden, bunt und funkelnd und fremdartig. Und Isabelle ist die Hüterin all dieser Dinge und all des alten Wissens ihres Volkes.
Leonie öffnet die Tür und tritt ein.
Alle Vorhänge sind zugezogen. Weder Himmel noch Landschaft dringt heute herein in diesen Raum. Eine Wabe, alle vier Seiten geschlossen. Kerzen brennen im siebenarmigen Leuchter mit hoher heller Flamme.
Gaston sitzt im Hintergrund auf einem Berg buntfarbiger Kissen; er ist nur Zuschauer bei dem, was jetzt geschehen wird. Aber was von ihm ausgeht, das kann sie, Leonie, fühlen: Gaston hat Furcht. Furcht vor dem, was jetzt geschehen kann, geschehen könnte.
Isabelle dagegen steht in der Mitte des Zimmers, gerade, den Hals gereckt. Ihr schwarzes Kleid fließt an ihr herab wie ein nächtlicher Wasserfall. Das lockige Haar hat sie streng aus dem Gesicht gekämmt und im Nacken zusammengebunden. Alles an ihr ist Erwartung. Bebende Erwartung.
Warum so feierlich?, sagt irgendetwas in Leonies Innerem. Irgend eine kleine, kalte, böse Stimme. Das ist doch erst der Anfang. Da sind ja noch zwei von diesen goldenen Zeichen zu suchen und zu finden. Und wer weiß, was mir dabei noch alles passiert. Mir, Leonie, und niemand anderem.
Sie hat beide Hände um das Ding in der blauen Seide geschlungen. Nun streckt sie den rechten Arm aus und bietet Isabelle auf der Handfläche an, was sie mitgebracht hat. Dabei schaut sie ihr gerade in die Augen.
Der große Moment.
Die junge und die alte Hand. Die jungen und die alten Augen. Ihre Schwärze. Ihr Wissen. Blick in Blick.
Ein paar Atemzüge lang geschieht gar nichts. Dann greift Isabelle zu, so hastig, als hätte sie Furcht, ihr würde es jemand wegnehmen, das Ding. Sie presst die Seide an ihre Brust, schließt die Lider. Dann stöhnt sie auf. Es ist, als würden die Farben im Raum fahl werden für einen Augenblick, als würde etwas hereinströmen. Isabelle taumelt. Beugt sich vor, als wenn ihr jemand in den Magen geschlagen hätte. Es geschieht mit ihr ... Sie sieht, was geschehen ist.
»Feuer! Es brennt! Es brennt in der Stadt! Das Blut, Ewiger, das Blut! Er liegt auf der Straße! Nein! Nein! So sollte es nicht kommen!«
Gaston springt auf, umfängt sie mit den Armen. Es ist klar, er hat darauf gewartet.
Ich hätte es mir ausrechnen können, dass es geschieht.
Schon einmal habe ich es miterlebt, dass Isabelle von einer ihrer furchtbaren Visionen heimgesucht wurde, in denen sie durch die Zeit wandern kann, in die Vergangenheit und in die Zukunft. Und als ich in meinen letzten Wochen in Berlin diesen Fluch am eigenen Leib erfahren habe, als mich ihre schreckliche Gabe ebenfalls ereilt hatte ... was hat es mir gebracht, dass ich die Dinge vorher wusste? Ändern konnte ich sie doch nicht.
Isabelle durchleidet gerade mein eigenes Leiden. Sie hat es mir abgenommen in diesem Moment. Ich muss es nicht noch einmal durchleben, jetzt, wenn ich erzählen werde, erzählen muss, was geschehen ist. Ich habe Erbarmen mit ihr. Und ich bin ihr dankbar.
Inzwischen hat Gaston sie zu einem der Kissenberge geführt, gibt ihr Wasser zu trinken. Der Anfall war heftig, aber kürzer als damals. Meine Geschichte wird ja auch kürzer ausfallen als gedacht.
Isabelle erholt sich. Sie sieht mich an, mit dem Blick voller Wissen. Bevor sie in der Lage ist, ein Wort zu sagen, schlägt sie mit bebenden Fingern die blaue Seide auseinander und betrachtet das goldene Taw auf ihrem Handteller.
Sicher geht es ihr jetzt so wie mir, als ich, zusammen mit Schlomo, den Buchstaben entdeckt hatte in dem alten verkramten Theatermagazin in der Schendelgasse, das nun ein Raub der Flammen geworden ist. Der sanfte warme Strom, der damals durch meine Adern rieselte, das Gefühl, etwas Lebendiges in Händen zu halten. (Jetzt, jetzt ist es für mich nur ein kaltes Stück Metall.)
Sie beugt sich vor, zieht das Zeichen andächtig erst an ihre Lippen, legt dann die Stirn darauf. Dann sagt sie leise: »Meine arme Tochter. Was für ein schrecklicher Preis.«
Noch immer stehe ich in der Mitte des Raums, wie bei der Übergabe des Buchstabens. Jetzt, wo sich Isabelle wieder gefasst hat, wendet Gaston seine Aufmerksamkeit mir zu. »Willst du dich zu uns setzen?«, sagt er, und es klingt fast scheu. »Fühlst du dich in der Lage, uns etwas zu erzählen?«
Ich nicke. »Früher oder später muss ich es ja doch«, sage ich und zucke die Achseln. (Ich bin so leer, so ausgebrannt. Es ist alles gleich.) Ich registriere den Blick des alten Mannes – halb erschrocken, halb mitleidsvoll –, bevor ich mich neben den beiden auf den Kissen niederlasse.
Gaston schenkt mir Wasser ein. (Sonst gab es hier auch Wein, heute nicht.) Das Wasser ist kühl und klar und lebendig und ich trinke in langen Zügen. Meine Kehle ist schon ausgedörrt, bevor ich überhaupt angefangen habe.
»Es war zu lesen, dass es Unruhen gab in Berlin!«, sagt Gaston zögernd.
»Unruhen? Ja, so kann man es nennen. Die Juden, die aus dem Osten kommen, sagen dazu Pogrom«, erwidere ich. »Aber vielleicht sollte ich von vorn anfangen.«
Und so sitze ich denn zusammen mit den beiden alten Leuten, die beide aussehen, als wären sie kein Ehepaar, sondern Geschwister, und erzähle ihnen, was mir bei der Suche nach dem goldenen Ding zugestoßen ist, das Isabelle nun mit beiden Händen an ihre Brust drückt, als wäre es ein Talisman, aus dem sie Kraft schöpfen kann.
Ich berichte, wie ich beim vergeblichen (und heimlichen) Forschen in unserer kleinen Wohnung auf ein altes Foto gestoßen bin, das mir offenbarte: Es gab noch andere Glieder von Isabelles Familie in Deutschland, nicht nur mich und meinen Vater, wo das Zeichen vielleicht zu finden war. (Ich verschweige ihnen, genau wie bei meinem letzten Besuch, dass mein Vater, der arbeitslose Koch, ein Hasser alles Jüdischen ist, dass er seine Wurzeln verleugnet hat und dass er sich außerdem meiner Suche verschloss – ich verschweige es, weil ich mich schäme deswegen.)
Ich erzähle, wie ich auf das Jiddische Theater im Scheunenviertel stieß, wie ich meine neuen Verwandten kennenlernte, mich in meinen Vetter Schlomo verliebte. Wie ich Theater zu spielen begann und wie wir ein Paar wurden, auf der Bühne und im Leben.
Während ich von all den Begebnissen erzähle, muss ich sehr viel von dem frischen Wasser trinken, weil mein Hals so schnell trocken wird. Das mit dem Abstand scheint mir zu helfen. Es ist, als würde ich berichten, was einer anderen Person zugestoßen ist, nicht mir. Es ist alles wie hinter Glas. Und es kommt mir klein vor, klein und übersichtlich, als würde ich mit einem umgedrehten Fernrohr daraufschauen.
Dann komme ich zu der Nacht, in der im Scheunenviertel der Mob tobte, die Juden aus ihren Häusern zerrte, sie beschimpfte und verhöhnte, plünderte und raubte, wegschleppte, was irgend von Wert war. (Dass wir uns in dieser Nacht, während draußen die Hölle tobte, das erste Mal liebten, Schlomo und ich, das erzähle ich nicht.)
Ich sehe, wie mich Isabelle mit geweiteten Augen anstarrt. Ihr Atem geht schwer.
»In Berlin!«, sagt sie schließlich leise. »In der Hochburg der Toleranz und des Verständnisses, wie sie sagen! Ein Pogrom in Berlin, im Jahre 1923. Es kommt alles noch schneller auf uns zu, als ich befürchtet habe.«
Ich trinke noch mehr Wasser. Ja, es kam alles schneller, als wir befürchtet hatten. Und schlimmer.
»Kannst du weitererzählen?«, fragt Gaston nach einer Pause. »Oder ist es zu viel für dich, Leonie?«
Fast hätte ich gelacht. Was soll daran zu viel sein, wenn ich es erzähle? Es sitzt doch hier drin, hinter meiner Stirn, egal ob ich davon spreche oder darüber schweige.
Zu viel war es, als es passierte.
»Ich kann sehr gut weitererzählen«, entgegne ich. Und füge hinzu: »Wenn ihr es hören könnt?«
Keine Antwort. So fahre ich fort. Berichte, wie ich auf den Gedanken kam, dass unser kleines Theater sich einmischen könnte in die Dinge der Wirklichkeit. Stellung beziehen nach dem, was da geschehen war. Dies alte Stück, »Bar Kochba« so spielen, dass sich unsere jüdischen Zuschauer darin wiederfanden, Kraft und Trost schöpfen konnten.
Berichte von den Randalierern in braunen Uniformen, die uns die Aufführung zerstörten. Vom Versuch, anderswo weiterzuspielen. Von den Drohungen gegen Schlomo, den Hauptdarsteller, mit der Absicht, dass er sich nicht mehr auf die Bühne wagen sollte.
Aber er ließ sich nicht einschüchtern.
»Und dann hat man ihn erschossen. Auf offener Straße. Vor meinen Augen«, schließe ich meine Erzählung.
Die beiden alten Leute starren mich an. Ich habe das Gefühl, dass sie nicht zu atmen wagen.
»Gütiger Himmel«, murmelt schließlich Gaston. »Was ist da auf dich eingestürmt in einem halben Jahr ... «
Ich fingere an meinem zerschnittenen Kragen. Antworte nichts, sehe vor mich hin. Was auf mich eingestürmt ist. Was soll ich sagen: Das Leben? Die Liebe? Der Tod?
»Aber das Taw?«, wirft Isabelle nun ein und hält den Buchstaben im Seidenstoff immer noch an ihre Brust gedrückt. »Wie hast du das Taw gefunden?«
Ich lächle und habe das Gefühl, dass mein Lächeln schrecklicher sein muss, als wenn ich weinen würde, denn sie sehen sich mit weit aufgerissenen Augen an, blicken dann wieder wie gebannt auf mich.
»Wir haben es im Theatermagazin gefunden, dort, wo Kostüme und Requisiten aufbewahrt werden. Schlomo hat es gefunden. Und dann, an dem Tag, diesem letzten Tag ... Es war immer von Feuer und Brennen die Rede in den Drohungen, die er bekam.« Ich muss schlucken. »In der Post war an dem Tag eine Warnung.« (Und auch dies verschweige ich, dass diese Warnung von meinem Vater kam, mit dem ich mich entzweit hatte wegen, ach, so furchtbarer Dinge ...) »Mein Freund, mein Liebster, er war schon losgezogen, um den Buchstaben aus dem Magazin zu holen, als ich die Warnung las. Und dann brannte es auch ... «
Mein Herz schlägt auf einmal wie rasend. Ich fühle, ich bin zu dicht herangegangen. Da ist nichts mehr hinter Glas, da ist es bei mir angelangt, grell und laut und peinigend, und reißt mich fort.
Plötzlich verwirren sich die klaren, weit weggerückten Bilder, kommen näher heran, werden groß, werden laut, schlagen über mir zusammen. Ich verliere die Kontrolle.
Merke, dass ich nur noch stammeln kann: »Er kam auf mich zu – in der Menge – er hat gerufen – er hatte den ledernen Beutel mit dem Taw – er hat gesagt: Nimm mal! – er fiel um ... «
Dann wird mir schwarz vor Augen.
3
Ihr Kopf liegt in einem Schoß. Jemand anderes streicht ihr übers Haar. Etwas Kühles rieselt über ihre Stirn, die Schläfen herunter, verliert sich kitzelnd am Ohr. Sie schlägt die Augen auf.
Dicht über sich sieht sie das besorgte Gesicht Isabelles, die angstvoll-forschend gerunzelten Brauen, den fragend geöffneten Mund. Sie hat den Buchstaben aus der Hand gelegt und stattdessen aus ihren Armen ein Nest für das Mädchen gemacht! »Mein Liebes! Mein Liebes!«, murmelt sie, und wieder taucht Blick in Blick, wie vorhin. »Was ist dir zugemutet worden!«
Gaston ist auch da. Er fährt weiterhin sanft über ihr Haar und aus der hohlen Linken lässt er Tropfen für Tropfen Wasser über ihr Gesicht rinnen.
Sie richtet sich auf. »Verzeihung!«, sagt sie. »Ich ... ich bin wohl doch ein bisschen angestrengt von der Reise. Aber nun geht es schon wieder.«
Sie will aufstehen, aber ihr ist so taumelig, sie kommt gar nicht richtig auf die Beine, fällt wieder zurück. Und eh sie sich’s versieht, hat Isabelle ihren Kopf mit beiden Händen gepackt und drückt ihn an sich, an ihren Hals, ihre Schulter. Sie spürt den Puls der alten Frau an ihrer Wange, stark und gleichmäßig, und ihr fällt ein, wie sie auf Schlomo Laskarows Hals starrte während ihrer gemeinsamen Theatervorstellungen, in den Pausen, wenn er kurz von der Bühne ging, Wasser trank, so wie sie jetzt hier – da sah sie den Schlag seines Herzens in der Halsgrube ...
Nichts spüren, bitte. Nicht daran denken. Zurück hinter das schirmende Glas, Stein sein.
Über ihrem Kopf hört sie Isabelles leise Stimme: »Es ist unvorstellbar schrecklich, was dir zugestoßen ist! Aber ich habe nicht gewusst, in was ich dich da hineinschicke, als ich dich, versehen mit meinem Segen, auf die Suche aussandte nach Berlin, in deine Heimatstadt. Erst später kamen die ... Gesichte. Gaston hat dir ja geschrieben, hat versucht, dich zu warnen. Aber Warnungen ... die helfen meist nichts, nicht wahr?«
»Nein, die helfen überhaupt nichts«, erwidert Leonie müde. »Weil man sie natürlich falsch deutet. Wie ich es auch getan habe.«
Sie löst sich von der alten Frau, bringt Abstand zwischen sie beide, kniet nun vor ihr, auf Augenhöhe. »Aber auch wenn du es vorher gewusst hättest – du hättest mich doch trotzdem auf die Suche geschickt, nicht wahr?«
Isabelle weicht ihrem Blick nicht aus.
»Ja«, sagt sie. »Ich hätte dich trotzdem geschickt. Denn was ich tun muss ... «
»... duldet keinen Aufschub. Ich weiß doch. Den mächtigen Mann aus Lehm bauen, den Golem, ihn zum Leben erwecken, zum Schutz der Juden in aller Welt.«
Sie nickt. Ihre Augen sind erloschen.
»Ja. Verzeihst du mir?«
»Da ist nichts zu verzeihen. Es muss geschehen. Nach dem, was ich gesehen und erlebt habe. So schnell wie möglich. In jedem Jahr eines der drei Zeichen, nicht wahr?«
Sie wendet sich zu Gaston, streckt ihm die Hände hin. »Hilfst du mir auf?«
Sie lässt sich von ihm auf die Füße ziehen. Muss einen Moment die Augen schließen. Ihr ist immer noch ein bisschen taumelig.
»Ich würde vielleicht gern ein oder zwei Tage hierbleiben, bevor ich weiterreise nach Wien«, sagt sie freundlich. Sie lächelt mechanisch, ein Lächeln, das über den Mund nicht hinauskommt. »Darf ich jetzt erst einmal gehen und mich ein bisschen ausruhen? Diese Erinnerung war – einfach zu viel. Nein, mich muss keiner begleiten. Ich schaffe es allein.« –
Als sich die Tür hinter ihr geschlossen hat, sehen sich Gaston und Isabelle bedeutungsvoll an.
»Denkst du wohl auch, was ich denke?«, fragt die Frau leise.
Gaston seufzt. »Dies Mädchen ist krank. Krank an ihrer Seele und verletzt in ihrem Herzen. Sie wohnt in einer Leere.«
»Wie ausgebrannt!«, bestätigt Isabelle. »Als sie mir das Taw gegeben hat, da war – nichts. Von ihr ging keine Empfindung aus, sie hätte mir genauso gut ein beliebiges Schmuckstück reichen können. Oder eine Handvoll Münzen. Das Zeichen lag kalt in ihrer Hand. Erst zwischen meinen Fingern erwachte es zum Leben, begann, sich zu erwärmen und zu strömen.« Sie seufzt. »Warum musste sie nur gleich zu Anfang ihrer Suche so zu Boden geschlagen werden!«
Gaston ist an eines der Fenster getreten und hat den Vorhang zurückgezogen. Es ist die Seite, wo man auf die Berge schaut. Sie liegen da wie große schlafende Tiere, und der Dunst, der sie einhüllt, könnte ihr Atem sein. »Sie ist ein starkes Kind, eine starke junge Frau. Sie wird es überwinden und eines Tages wird sie Kraft daraus schöpfen«, sagt er.
»Ja, aber sie braucht Zeit. Und sie in diesem ihrem Zustand loszuschicken nach Wien, den zweiten Buchstaben zu suchen, das wäre – nun, das wäre grausam. Und es wäre auch nicht sinnvoll.«
»Du meinst ... «
»Ich meine, wenn sie so auszieht, wie sie jetzt ist, in dieser Gemütslage, dann wird sie auch nichts finden können. Sie kann nichts erfühlen, nichts, was sie anfasst, berührt sie. Sie ist jetzt wie ein Leib ohne Seele. Wie soll sie etwas erspüren?«
Isabelle hat sich von den Polstern erhoben, ist hinter ihren Mann ans Fenster gegangen, legt ihm die Hand auf die Schulter. Ein tiefer Seufzer erschüttert sie.
»Ich hab Angst um das Mädchen«, sagt sie leise. »Wer soll sie heilen? Und wie soll es weitergehen, wenn sie sich so verschließt? So das Fühlen aussperrt?«
»Die Zeit wird sie heilen«, entgegnet Gaston bestimmt und streichelt ihre Hand. »Und vergiss nicht: Sie ist eine Lasker.« Er lacht leise auf. »Komisch, dass ich dir das sagen muss. Dass ich dich daran erinnern muss – was ihr für Frauenzimmer seid.«
Nun lacht auch Isabelle.
»Aber du hast recht. Wir dürfen sie jetzt auf keinen Fall nach Wien lassen!«, fährt Gaston fort.
»Auf keinen Fall. Aber du hast ja gehört. Sie will sich sofort auf den Weg machen.«
»Ja. Wie ein Soldat, den es erneut in die Schlacht zieht.«
»Nur dass sie, um im Bild zu bleiben, im Augenblick ein Soldat ist, der nicht weiß, wo der Feind steht.«
»Sie soll hier auf Hermeneau ausruhen, was meinst du? Den Winter vorübergehen lassen. Wieder zu sich finden.«
Isabelle nickt. »So machen wir es, Lieber. Das ist das Wenigste, was wir ihr schulden.« Sie wendet sich ab, nimmt den Buchstaben wieder auf, hält ihn in seinem Nest aus blauer Seide in beiden Händen. »Wenn nur meine Ungeduld nicht wäre!«
»Du und sie, ihr habt ein Jahr Zeit! Das hast du selbst gesagt!«, mahnt Gaston.
Seine Frau nickt. »Ja. In jedem Jahr einen Buchstaben, so sagen es meine Deutungen der Kabbala-Schriften. Noch haben wir Zeit. Aber gerade deshalb sollten wir etwas ihretwegen unternehmen. Damit sie die Kräfte ihrer Seele wieder aufwecken kann.«
»Ich fahre noch heute nach Cerbère«, erwidert er. »Zur Post.«
4
Erst jetzt entdecke ich, was da auf dem Bett liegt, am Kopfende auf der aprikosenfarbenen Tagesdecke: Es ist mein großer Strohhut, den ich im Sommer hier zurückgelassen habe. Der Hut, den ich mir damals in Berlin extra für diesen Urlaub gekauft hatte, unter dessen Schatten ich hier durch Weinberge und Olivenhaine gestiegen und in den Klippen herumgekraxelt bin, den ich trug, als Gaston mir Cerbère gezeigt hat und behutsam anfing, mich einzuweihen in das, was man hier von mir wollte, was Isabelle wollte und wer sie war ...
Schnell nehme ich ihn, öffne die Schranktür und stecke ihn weg, schiebe ihn auf dem Hutfach so weit nach hinten, dass ich mich auf die Zehen stellen muss. Irgendwie habe ich mir wohl einmal ausgemalt, dass ich ihn tragen würde, wenn ich mit Schlomo hier Hand in Hand durch die Gegend wandere – was ja ohnehin Unsinn ist. Denn was soll man im Winter mit einem Strohhut, ob mit oder ohne jemanden, der bei einem ist.
Es lohnt nicht, den Koffer auszupacken. Ich bin ja nur auf der Durchreise. Als ich das vorige Mal hier war, da habe ich alles, was ich mitgebracht hatte, sorgfältig auf Bügel gehängt oder in Schubfächer gelegt. Und dann war ich nach ein paar Tagen, ein paar erhellenden Tagen, schon wieder fort. Nun wird es wohl noch schneller gehen. –
Ich habe keine Ahnung, wie spät es ist. Das Grau des Tages wird dichter. Ob man sich schon schlafen legen kann?
Ich zögere. Und dann gebe ich der Versuchung nach, das wunderbare Gast-Badezimmer hier neben meinem Raum zu betreten und die bronzenen Wasserhähne aufzudrehen, um in der großen Wanne mit den Löwenfüßen zu baden, wie ich es beim ersten Mal auf Hermeneau so begeistert getan habe, berauscht von dem Luxus, der mir hier geboten wurde. (So etwas kannte ich nicht von zu Hause.)
Ich streife meine Sachen ab und steige ins Wasser, schließe die Augen. Denke an nichts, das tut mir gut. Treibe irgendwohin. Bin ich eingeschlafen?
Das Wasser ist kühl geworden inzwischen. Fröstelnd klettere ich aus der Wanne, hülle mich in eins der flauschigen weiß-rosa Tücher. Draußen ist es inzwischen wirklich dämmrig geworden. Ich habe keine Lust, das Licht anzumachen. Nackt, wie ich bin, schlüpfe ich unter die Bettdecke und rolle mich zusammen wie ein Kind im Mutterleib, die Knie angezogen, die zu Fäusten geballten Hände vor dem Mund.
Weiterschlafen. Aber der Schlaf, der mich im warmen Wasser so unvermittelt überrascht hat – jetzt will er nicht kommen. Am liebsten würde ich mich hin und her schaukeln, mich irgendwohin wegschaukeln, wie es die Tiere im Zoo hinter ihren Gittern tun. Irgendwohin, wo ich traumlos und still liegen kann. Aber es geht nicht. Mein Kopf lässt mir keine Ruhe.
Es ist schwere Arbeit, die ich leisten muss. Die Erinnerungen wegschieben, als wenn man große Wände bewegen würde, die Kulissen meines Lebens. Weg, fort, aus! Die Vorstellung ist zu Ende. Ich habe Spielpause. Warum? Der Hauptdarsteller hat sich gerade verabschiedet.
Denk an etwas anderes, Leonie. Denk an Wien, vielleicht. Denk an Gaston und Isabelle.
Isabelle.
Ich richte mich im Bett auf, ziehe die Decke um meine Schultern und starre in das zunehmende Dunkel. Wie konnte es geschehen, dass sie »sah«, vorhin, was mir, was uns passiert war in Berlin? Ich weiß doch, als ich ihr den Buchstaben gegeben habe, da fühlte ich nichts. Gar nichts. Das Taw lag auf meiner Handfläche, als wäre es ein x-beliebiger Gegenstand. Da war nur der Blick zwischen ihr und mir. Die jungen und die alten Augen. Ihre Schwärze. Ein Augen-Blick. Und trotzdem wusste sie gleich alles, durchlebte alles, was geschehen war in Berlin, meine Albträume oder Gesichte, das Feuer, das schließlich wirklich das Theatermagazin vernichtete, das Blut Schlomos, das das alte Leder mit dem geretteten Buchstaben durchtränkt hatte. (Steif und starr war das Behältnis, als das Blut getrocknet war – ich glaube, Selde, seine arme Mutter, hat es an sich genommen und bewahrt es bei sich auf; jedenfalls übergab man mir das Zeichen in jener alten Geldbörse.)
Ich, die ich bereits auf dem Weg war, ebenfalls die düsteren Visionen zu erleben wie Isabelle, ich kann nur beten, dass es mich nicht wieder heimsucht. Vielleicht hat meine »Versteinerung« ja auch die Gabe abgetötet. Der Preis dafür wäre freilich gewaltig...
Damals, als ich hierherkam, hatte ich noch keine Ahnung von meiner jüdischen Familie. Mein Vater hatte alles so sorgfältig vertuscht, als müsse er einen stinkenden Knochen vergraben.
Und dann erlebte ich, wie Isabelle eine ihrer Visionen durchlitt – und wurde mit hineingezogen in den Strudel der furchtbaren Gesichte. Wie hat sich mein Leben umgekrempelt seitdem! Wie sehr bin ich beteiligt. Allzu sehr beteiligt. Oh ja.
Wie auch immer Isabelles magischer Beschützer der Juden, der Golem, entstehen und auferstehen mag, was auch immer er bewirken soll, wenn man denn an ihn glaubt – er tut not. Er tut sehr not. Das weiß ich, nach dem, was ich erlebt habe.
Und darum muss ich mich überwinden, muss mein steinernes Herz in beide Hände nehmen und so schnell wie möglich nach Wien. Den zweiten Buchstaben finden.
Wenn es nur nicht so schwer wäre.
Ich habe mich wieder hingelegt, die Decke, so fest es geht, um mich gezogen.
Schlomo Laskarow, warum musstest du mich so entsetzlich allein lassen? Hattest du nicht gesagt: »Ich will, dass es für immer ist«?
Etwas wie ein Luftzug weht über mich hin, kühlt meine Nasenspitze, die aus dem Deckennest herausschaut.
Vielleicht habe ich das Fenster einen Spaltbreit offen gelassen und der Wind hat sich gedreht.
Dann schlafe ich. Traumlos.
5
Am nächsten Morgen versucht sie, einfach so zu tun, als würden zwischen ihrem letzten Besuch auf Schloss Hermeneau und dem jetzigen Aufenthalt nicht Welten liegen, Welten, in denen sie einmal durch Himmel und Hölle gelaufen ist. Sie zieht sich an (das Kleid mit dem zerfetzten Trauerkragen) und geht die Treppe hinunter, wo sie denn auch, als sei nichts gewesen, den gedeckten Frühstückstisch für sie vorfindet, Kaffee und Tee unter Wärmehauben, frisches, nach Anis duftendes Weißbrot im Korb unter der Serviette, Eier, Butter, Käse, Honig.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!