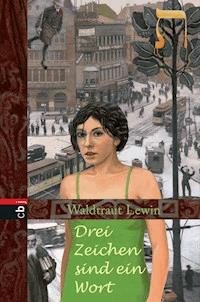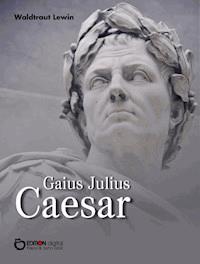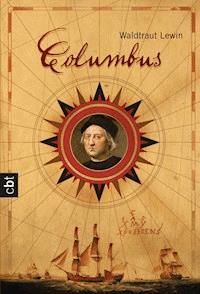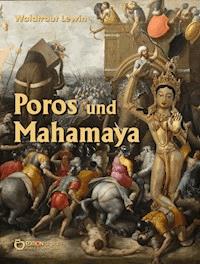Inhaltsverzeichnis
DIE AUTORIN
Widmung
LIED DES GEPRÜGELTEN ZIGEUNERS
PROLOG
GRANADA I
I
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
II
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
HERMENEAU I
I
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
GRANADA II
I
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
II
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
HERMENEAU II
I
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 12
EPILOG
Nachbemerkung
Copyright
Foto: © Andrea Grosz
DIE AUTORIN
Waldtraut Lewin studierte Germanistik und Theaterwissenschaft in Berlin und arbeitete als Opernübersetzerin, Dramaturgin und Regisseurin zunächst am Landestheater Halle und dann am Volks- theater Rostock. Seit 1978 lebt sie als freischaffende Autorin von Hörspielen, Drehbüchern und Romanen, für die sie zahlreiche Auszeichnungen erhielt. Seit 1995 schreibt sie Jugendromane.
Von Waldtraut Lewin sind bei cbt erschienen:
Leonie Lasker, Jüdin – Die drei
Zeichen (40003)
Leonie Lasker, Jüdin – Dunkle
Schatten (40004)
Die Geliebte vom Nil (30346)
Samoa (30371)
Die letzte Rose des Sommers (30345)
Von Waldtraut Lewin ist bei cbj erschienen:
Goethe (12796)
cbj
ist der Kinder- und Jugendbuchverlag in der Verlagsgruppe Random House
Für meinen Sohn Niklas, der mir Granada zeigte und mich dann ins Freie führte
LIED DES GEPRÜGELTEN ZIGEUNERS
Vierundzwanzig Backenstreiche. Fünfundzwanzig Backenstreiche; später, Mutter, in der Nacht lag ich auf Papier aus Silber.
Guardia Civil kommt vorüber. Gebt mir nur ein Schlückchen Wasser. Wasser, Fische drin und Barken. Wasser, Wasser, Wasser, Wasser.
Ach, Patrouille der Civiles, wenn sie kommt in deinen Raum! Es gibt keine Seidentücher mir das Antlitz abzutrocknen.
Federico García Lorca, 1925
PROLOG
Noch ist alles gut. Zwei alte Leute drehen sich im Tanz in diesem Traum, in einer sternenklaren Nacht, auf einem Hochplateau in den Pyrenäen. Die Schlafende weiß: Das sind ihre Verwandten, auch wenn sie nur deren Silhouetten sieht. Das ist Gaston und das Isabelle, ihre Ahnfrau. Noch tanzen sie.
Aber in den Abgründen dieses Traums wohnt schon der Schrecken, bereit, sein Haupt zu erheben.
Die Musik, diese Musik! Eigentlich ist sie ja tröstlich, auch wenn sie traurig ist, auch wenn sie von Verfolgung und Leid erzählt. Aber nun verzerrt sie sich, wird dumpf und dunkel, als wenn sich eine Schallplatte auf dem Plattenteller zu langsam dreht. Immer tiefer, immer tiefer wird der Ton. Sie sollten das Grammophon neu aufziehen, denkt die Träumerin. Oder muss ich das tun? Aber sie kann nicht von der Stelle, ist wie festgebannt.
Dann flackern die Feuer auf. Klein zuerst. Aber sie weiß: Das sind keine freundlichen Lagerfeuer wie damals auf dem Plateau. Das ist der Brand, der sie alle vernichten wird.
Und es gibt nur eine Einzige, die sie retten kann. Isabelle. Die alte, die wissende Isabelle. Denn Isabelle ist kundig, wie man den Helfer baut, den Golem, das magische Geschöpf aus Lehm, unseren starken Retter. Den Retter des jüdischen Volkes.
Die Träumende windet sich im Schlaf. »Isabelle, es ist höchste Zeit!«, schreit sie, will sie schreien, aber kein Ton kommt über ihre Lippen. Und die Feuer wachsen an; sie riecht den Brandgeruch, sie spürt die Hitze.
»Isabelle! Gaston!«
Aber Gaston ist plötzlich verschwunden aus diesem Traum. Und Isabelle kann nichts tun! Gar nichts kann sie tun.
Nichts ohne mich.
Isabelle krümmt sich in der Glut dieser Feuer, als sei sie festgebunden auf einem Scheiterhaufen. Und dahinten am Horizont ziehen die anderen Schreckensbilder vorüber, Bilder, die sie beide sehen können, sehen müssen, sie und Isabelle: Menschen, die schreiend durcheinanderlaufen und seltsame Zeichen an ihren Kleidern tragen, und dann die nackten Leiber der Toten...
Aus den Feuern leuchten Isabelles Augen, ist ihre ersterbende Stimme zu hören: »Wenn du mir hilfst...«
Drei Zeichen. Drei Zeichen muss sie zusammenführen. Die werden den Mann aus Lehm zum Leben erwecken. Drei Buchstaben. Aleph, Mem, Taw. Die bilden das hebräische Wort für Wahrheit.
Endlich gewinnt sie Sprache in diesem Traum. »Ja!«, schreit sie. »Ja, ich tue es!«
Und die Flammen verlöschen wirklich, und sie fühlt den prickelnden Strom von Energie durch ihre Adern fließen, wie sie ihn wahrgenommen hat, als sie die ersten beiden Buchstaben fand.
Es kann alles gut werden. Sie kann sich wieder bewegen, geht auf etwas zu, auf jemanden, der ihr mit so leichten Schritten entgegenkommt... nein, das sind keine wirklichen Schritte. Das ist ein Fliegen. Er fliegt. Das ist der Retter und zugleich ihr Geliebter, der sie auch nach seinem Tod noch begleitet und getröstet hat. Er ist schon ganz nahe bei ihr, sie muss nur noch das dritte Zeichen finden...
Aber dann sagt eine kalte Stimme von irgendwoher: »Und fürjeden Buchstaben muss ein Menschsterben.«
»Das ist nicht wahr!«!, schreit sie in ihrem Traum. »Isabelle, sag, dass es nicht wahr ist!«
Aber Isabelle antwortet nicht, Isabelle geht irgendwo hin, verblasst, verschwindet. Und als sie, die Träumende, sich wieder zu ihrem Liebsten umdreht, da ist der zu Lehm geworden, zur tönernen Gestalt, und etwas ist um ihnherum... die flitterbunte Umrandung einer Kasperbühne. Schlomo Laskarow, ihr Liebster, ist eine Figur auf der Wurstelbühne im Prater geworden, im Prater von Wien. Und voll des eisigen Schreckens sieht sie ihn kommen, den Hanswurst mit seinem großen Knüppel. Der haut Schlomo auf den Kopf, haut dem Juden auf das Happel, bumm! Und Schlomo, der der Golem ist, zerfällt zu Staub, und alles ringsherum freut sich undklatschtin die Hände. Und sie kannnichteinmal weinen.
Bumm! Und noch einmal bumm.
Ein Klopfen an der Tür. »Señorita, es ist kurz nach vier. Sie wollten ins Theater.«
Wie? Was? In welcher Sprache redet man mit mir? Und wieso muss ich um vier Uhr aufstehen, wenn ich ins Theater muss? Habe ich Vorstellung heute? Überhaupt: Ist es Nacht, ist es Tag?
Ich arbeite mich aus Traumtiefen nach oben ins Wachsein, wie sich ein Taucher durch Wassermassen an die Oberfläche quält. Schreckliches ist mir passiert im Schlaf. So Schreckliches, dass ich es hinter mir lassen muss wie eben dieser Taucher den schlammigen Grund.
Es klopft erneut. »Señorita?«
»Sí gracias«, erwidere ich und setze mich auf. Spanisch. Es ist Spanisch. Ich bin in Madrid, im Hotel, und mit der Zeit hat es auch seine Richtigkeit, denn die Vorstellungen im Teatro Español beginnen nachmittags, wie es die alte Tradition will. Bei Tageslicht. Ich habe nur eine Siesta gehalten.
Das wunderschöne Schnitzwerk der Fensterläden wirft ein filigranes Spitzenmuster auf den Teppich. Das Bett, aus dem ich mich erhebe, hat vier gedrechselte Pfosten und einen Baldachin aus Tüll. Gediegen. Ich habe mir erlaubt, in Madrids bestem Hotel abzusteigen.
Nein, ich habe keine Vorstellung (auf Spanisch ohnehin nicht...), kein Engagement. Ich habe seit über einem Jahr auf keiner Bühne mehr gestanden, seit ich in Wien in der josefstadt vorspielte und einen Vertrag bekommen hatte, den ich zerreißen musste wegen meiner Tante Felice Lascari, der Schauspielerin, die eifersüchtig auf mich war...
Weg mit diesen Gedanken jetzt. Dorthin mit ihnen, wo dieser Traum-Schutt liegt. Heute nicht. Heute will ich nicht in den alten Sachen herumstochern. Heute will ich mich nur freuen. So wie sich ein Kind freut an seinem Geburtstag, denn immerhin gehe ich ins Theater. Und in was für eins.
Ich musste einfach nach Madrid, musste einmal in diesem europäischen Ur-Theater sein, bevor ich weiterreise nach Granada, um meine nächste Aufgabe zu erfüllen.
Das haben meine freundlichen Verwandten, Isabelle Laskere und Gaston Lecomte, verstanden.
Ein Dreivierteljahr verbrachte ich wartend bei den alten Leuten, auf Schloss Hermeneau in den Pyrenäen. Kein Theaterspielen. Nicht dran zu denken. In der Nähe nur ein Provinzstädtchen namens Cerbere.
Komödiantin mit Leib und Seele, die ich bin, mit den Händen im Schoß, wie gefesselt, höchstens mal ein paar Rollen lernend oder für mich allein eine Theaterfigur erarbeitend, in freier Luft, oben auf dem Felsvorsprung, den ich mir als Bühne erkoren hatte! Eine Qual! (Auch jetzt habe ich meine Rollenbücher mit im Koffer, aber wohl kaum eine Chance, von ihnen Gebrauch zu machen.)
Ich schwenke die Beine aus dem Bett, das mir diese luxuriöse Mittagsruhe (aber auch diesen scheußlichen Traum) beschert hat, und hole aus meinem Koffer jenes grüne Seidenkleid heraus, das ich nun seit zwei Jahren besitze und in dem ich sowohl gute als auch böse Stunden erlebt habe; aber heute will ich nur an die guten denken. Als der kühle Stoff mit feinem Rascheln über meinen Körper gleitet, ist mir, als wäre ich mit meinem Geliebten in Berlin wieder in jenem Tanzlokal, wo wir, zum Staunen der anderen Gäste, einen fulminanten Tango aufs Parkett legten. Schlomo. Schlomo Laskarow. Wenn du jetzt bei mir sein könntest...
Ein bisschen Make-up. Einmal mit der Bürste durchs Haar – meine Locken machen ohnehin, was sie wollen. Die Tasche. Der Fächer. Unabdingbar für Spanien, auch wenn es erst April ist: ein Fächer. Ich habe ihn heute früh bei meiner Ankunft in der Hotelhalle gekauft; schwarzer Satin mit Pailletten. Ich öffne ihn einmal probeweise, äuge über den Rand, blicke mich so im Spiegel an. Leonie Lasker, du gefällst mir. -
Und nun stehe ich, Kopf im Nacken, vor der rostroten, fahnengeschmückten Fassade des Teatro Españolin Madrid.
Das Teatro Español, das hochberühmte Theater. An eben dieser Stelle gab es vor dreihundert Jahren zwar kein prächtiges Haus, sondern nur einen corral, einen Innenhof mit Stehplätzen – aber hier war es, hier war eine der Geburtsstätten des europäischen Theaters. Hier spielten sie die Stücke der großen spanischen Autoren, die Stücke von Lope de Vega, von Calderón de la Barca, von Tirso de Molina – ede Woche eine brandneue Aufführung vor ungeduldigen, wilden Zuschauern, die ihren Akteuren nichts durchgehen ließen!
Ich schließe die Augen und versuche mir vorzustellen, wie das zuging damals.Wie sie Zustimmung klatschten oder Hohn brüllten, wie sie die Spieler annahmen oder auspfiffen, wie sie die Stücke hochjubelten oder gnadenlos durchfallen ließen – das kritischste, das erbarmungsloseste Publikum, das es je gegeben haben soll.
Wie hätte ich mich wohl gefühlt, wenn ich auf jener Bühne hätte stehen dürfen, deren Holz schon so lange verwittert ist? Wenn ich hier eine Schauspielerin gewesen wäre, damals? Jeden Nachmittag, wenn die Schatten länger wurden, hinter sackleinenen Vorhängen sich ankleiden und schminken, mit einem Ohr auf das Gesumme und Gemurmel der Menge lauschen, die sich stehend im Corral versammelt – wie würden sie wohl gelaunt sein? Gnädig? Missmutig?
Wie hätte ich mich gefühlt beim Hinaustreten in die grelle Sonne, die einem ins Gesicht scheint (man spielte ja im hellen Licht des Tages)? Erwartungsvoll lächelnd, mit großer Geste? Oder fiebernd zwischen Furcht und Hoffnung?
Ja, im spanischen Theater vor dreihundert Jahren konnten Aktricen auf der Bühne stehen; im Gegensatz zur Shakespearebühne in England, wo alle Frauenrollen von jungen Männern gegeben wurden. Ich hätte dabei sein können, zwischen Applaus und Buhrufen, zwischen hochgelobt und niedergezischt...
Nein. Ich hätte nicht dabei sein können. Denn ich, Leonie Lasker, bin Jüdin und um 1600 gab es bestimmt keine Juden in Madrid. Die hatte man gute hundert Jahre vorher verjagt.
Aber das soll mich nicht kümmern, heute. Denn heute kann ich hineingehen, gemeinsam mit dem Strom von Besuchern, der jetzt schon um mich herumwirbelt, als sei ich ein Kiesel im Fluss, und niemand wird mich daran hindern. Hineingehen und mich in eine der teuren Logen einweisen lassen und mit der Gier einer Süchtigen endlich, endlich nach einem theaterlosen dreiviertel Jahr wieder diese Luft einatmen, Theaterluft; Puder und Parfüm der Damen, Pomade der Herren, Staub, nach Verheißung des Kommenden schmeckend.
Da sehe ich den roten Samtvorhang, den Kristalllüster an der Decke, höre das Schwirren der Fächer, das leise Geplauder. Hin und wieder lacht eine Frau auf. Ich registriere mit Vergnügen, dass man mir aus den Nachbarlogen neugierige Blicke zuwirit – eine junge Frau ohne Begleitung! -, und verberge mein Lächeln hinterm Fächer. (Ja, ich weiß, dass ich hübsch bin, Señores)
Das Teatro Español heutzutage ist spezialisiert auf das, was man Zarzuela nennt. Ich habe mich kundig gemacht. Das ist so etwas wie die spanische Form der Operette; es wird also auf der Bühne die Handlung geboten sowohl mittels Gesang und Tanz als auch in Form eines Sprechstücks. Sogar der große Dichter Calderón soll jede Menge Zarzuelas geschrieben haben. Volkslieder werden genauso benutzt wie kunstvolle Kompositionen. Vor allem aber herrscht der Flamenco vor, gitarrenschwirrend, händeklatschend vorgetragen, voller Temperament.
Ich nehme das Programmheft zur Hand, das eine zuvorkommende Billetteurin mir gratis überreicht hat (die weniger exklusiven Besucher auf den billigen Plätzen müssen dafür extra zahlen!), und entdecke zu meiner Überraschung, dass es heute keine jener volkstümlichen Possen gibt, sondern die moderne Bearbeitung eines Stücks aus dem 18. Jahrhundert. Das ist eher eine Ausnahme im Üblichen, Spezialisierten. Aber die Geschichte kenne ich! Sie stammt aus der antiken Mythologie. Acis und Galatea, eine Quellnymphe und ein Schäfer auf Sizilien, die ineinander verliebt sind – doch ihre Liebe findet ein tragisches Ende durch den polternden Riesen Polyphemos (eine Verkörperung des Vulkans Ätna), der Galatea ebenfalls begehrt und den Schäfer umbringt.
Ich bin gespannt. Gespannt auch, inwieweit mein noch kein Jahr altes Spanisch ausreicht, zu verstehen, was da gesungen und gesprochen wird.
Das letzte Klingelzeichen. Das Verlöschen des Saallichts. Das Publikum verstummt. Mein Gott, wie habe ich das vermisst: Theater! -
Der Vorhang teilt sich.
Ein üppig bemalter Hintergrundprospekt. Zwei Pappfelsen. Zwischen ihnen sitzen zu Leonies Erstaunen Musiker: ein Geiger, ein Gitarrist, ein Schlagzeuger. Und dann wirbeln sie auf die Bühne, die Darsteller des Teatro Español, die Sänger und Sängerinnen. Männer in engen Hosen und hellen Hemden. Frauen in bunten Rüschenröcken, Blume im Haar. Hoher Kamm, Schleiertuch aus Spitze, die mantilla. Kein Gedanke an antike Verkleidung.
Das Stück geht los mit dem Geklapper von Kastagnetten und dem Klingen von Gitarrensaiten, aber es ist weder Flamenco noch sonst irgendeine volkstümliche Musik, sondern etwas, das aus einem früheren Jahrhundert stammt – eine ebenso verrückte wie aufregende Mischung. Zu diesen Klängen erklären sich Acis und Galatea ihre Liebe in einer Art von halb getanzter Pantomime.
Leonie kommt aus dem Staunen nicht heraus. Nach relativ kurzer Zeit hat sie es aufgegeben, den Worten hinterherzulauschen, denn die Musik geht mit der Sprache so rigoros um wie ein Kind mit einer ungeliebten Puppe: zerrt und dehnt, schleudert und schleift die Silben in burleske Verbindungen, und einzelne Worte scheinen so unwichtig wie nur was, zumindest bei diesen Musikszenen. Sie, Leonie, kann sich nicht vorstellen, dass der Rest des Publikums viel mehr versteht als sie. Erst als es zu Sprechszenen kommt, kann sie wieder folgen.
Zu ihrer Verblüffung ist das Stück »angereichert« mit Figuren, die es in der klassischen Vorlage überhaupt nicht gegeben hat: Ein zweites Liebespaar treibt sich da zwischen den gemalten Kulissen herum, und deren Diener und Dienerin tragen rote Pappnasen!
Es ist gerade noch hell genug im Saal, einen Blick ins Programmheft zu werfen. Tatsächlich: »Gracioso« und »Graciosa« steht da: ein Clownspärchen!
Und als die beiden dann ein komisches Duett singen und spielen, beginnt das Publikum, als habe es nur darauf gewartet, im Takt mitzuklatschen und schreit zum Schluss »Bis!« Wiederholen! Und die beiden lassen es sich nicht nehmen, das Stück wirklich noch einmal darzubieten.
Das ist für Leonie alles fremd, aber auf eine höchst vergnügliche Art fremd. Eine Mischung von Operette und Volkstheater. Es wird durchgehend gespielt, ohne Pause, damit die Leute noch was vom Abend haben, und obwohl die Geschichte ja eigentlich todtraurig ausgeht, gibt es einen vergnüglichen Schluss: Eine große Balletteinlage am Ende, zu der Galatea ihren Acis wiederauferstehen lässt (schließlich ist sie eine Göttin), und sogar der ungeschlachte Polyphemos in seinem Zottelfell und seinen derben Schuhen hüpft mit herum.
Applaus und viele »Olé«-Rufe.
Beschwingt verlässt Leonie das berühmte Haus; es war zwar kein bewegendes Kunsterlebnis, aber sie hat sich hervorragend amüsiert, und so springt sie die Treppe herunter, leicht und froh wie oft in Berlin, ihrer Heimatstadt, als sie zu jeder der berühmten Theateraufführungen der großen Regisseure lief und hin und weg war, auch wenn sie meistens nur einen Stehplatz ganz oben auf dem letzten Rang hatte.
Es ist noch hell draußen und die Aprilluft ist so weich wie ein laues Wasser.
Zum berühmten Park Buen Retiro ist es nicht weit – einem Ort, so alt wie die Stücke, die in Madrid vor dreihundert Jahren im Corral gegeben wurden: Leonie weiß von dem Park aus der Lektüre des Stadtführers, den ihr Gaston gegeben hat. Buen Retiro, wo sich die Liebenden begegnen, Blicke tauschen, Schwüre flüstern...
Sie nimmt die Straße unter ihre Füße, eine belebte breite Avenida, auf der sich Passanten drängen. Es ist noch nicht Frühling, aber die Sonne hat schon Kraft. Die Männer haben ihre Jacketts ausgezogen und lässig über die Schulter gehängt, Frauen ihre breitschattenden Sonnenhüte vorgeholt. Kinder wuseln mit Geschrei zwischen den Erwachsenen herum, spielen Fangen, treiben hölzerne Reifen mit dem Stöckchen an. Bettler am Straßenrand, unbeweglich, die Hand vorgestreckt. Autos hupen, Bremsen quietschen, die Fahrer schneiden sich gegenseitig den Weg ab und sind in gestenreichem Dialog miteinander, in einem viel zu schnellen Spanisch, als dass Leonie es verstehen könnte – aber irgendwann löst sich alles in Gelächter auf und man braust davon.
Sie genießt es, endlich einmal wieder in einer großen Stadt zu sein, nach der Zeit in der südfranzösischen Provinz in Hermeneau bei ihren Verwandten.
Und dann, urplötzlich, ändert sich das Bild, als würde ein breiter Schatten darüberfallen – dabei scheint die Sonne unvermindert hell.
Die Leute... wo sind die Leute auf einmal alle hin? Leonie steht fast allein mitten auf der Straße. Alles hat sich in Seitengassen oder Torwege verzogen, drückt sich an die Hausmauern. Es ist unnatürlich still. Bis auf Hufschlag, der sich nähert.
Im letzten Moment presst sie sich ebenfalls hinter einen Mauervorsprung, tut es instinktiv den anderen nach. Angst liegt in der Luft.
Gleichsam durch einen Schweigetunnel kommt es heran. Sechs schwarze Pferde, gemessen trabend, Reiter in schwarzen wehenden Capas. Stumpfer Glanz von Pistolen. Eckige Hüte, wie aus poliertem Lack.
Eine Patrouille der Guardia Civil. Eine Polizeistreife.
Warum benehmen sich plötzlich alle so, als wenn sie etwas verbrochen hätten?, fragt sich Leonie, versucht nüchtern und vernünftig zu denken. Alle sind doch nur harmlose Spaziergänger, sie würden doch hier nicht ruhig promenieren, wenn sie was auf dem Kerbholz hätten?
Aber sie selbst steht genauso wie die anderen da und regt sich nicht. Eine kalte, eine tödliche Bedrohung geht von diesen Reitern aus. Leonie sieht die Gesichter der Männer unter den lackschwarzen Dreispitzen – sie sind voller Genugtuung. Genugtuung darüber, dass man sie fürchtet.
Und ihr fällt ein, was Gaston vor ihrer Abreise gesagt hat. »Uerhalte dich so korrekt wie möglich und versuche, nirgendwo anzuecken. Mit den spanischen Behörden ist nicht gut Kirschen essen. Spanien ist eine Monarchie, aber seit zwei Jahren hat der König einem Militär, einem gewissen Rivera, praktisch die Regierung übergeben. In diesem Land herrscht Willkür.«
Sie hatte nicht so recht verstanden, was er meinte. Wieso sollte sie irgendwo anecken? Sie ist doch nur Gast in diesem Land.
Die Patrouille biegt in eine andere Straße ein.
Als wäre eine Wolke hingestreift über den klaren Himmel und nun vorüber, kehren die Leute zu dem zurück, was sie vorher taten. Werden wieder munter, laut, heiter. Ein Spuk ist vorbeigezogen...
Dann endlich – der Park Buen Retiro. Leuchtend grünes Blätterdach wölbt sich über ihrem Kopf, die Rinde der Platanen schimmert wie Seide.
Grün und Grün und dazwischen graziöse Statuen aus weißem Marmor, endlose Wiesen, auf denen sich Kinder tummeln (ihre Mütter oder Nannys sitzen in ernsthaftem Gespräch auf den geschwungenen Parkbänken); junge Leute machen auf ausgebreiteten Decken Picknick, kleine Bengel spielen mit großem Geschrei Ball auf einem mit Kies bestreuten Platz. Luftballonverkäufer und Zuckerbäcker, ein See mit Gondeln, Pavillons, wo man einen Kaffee trinken kann, Musikanten, Wind im Gebüsch, Rufe und Gelächter in der abendlichen Luft.
»Señorita, eh, señorita! Toma, toma el romero! Tóma te la felicidad!«
Sie muss schon eine Weile neben ihr hergegangen sein, die kleine Rundliche, die ihr den romero, den Rosmarinzweig, fast unter die Nase hält. In all dem Lärm, dem bunten Wirbel um sie herum, hat Leonie es nicht auf sich bezogen. Alles ging sie an und auch nichts. Aber die hier hat es eindeutig auf sie abgesehen: eine Person, die ihr gerade bis zur Schulter reicht, umgeben von weiten Röcken und eingebunden in eine Stola mit Fransen, das Haar unterm feurig karierten Kopftuch verborgen, tanzende Ohrringe. Alles an ihr weht und flattert, und sie hält Leonie diesen Rosmarin direkt vors Gesicht und beschwört sie erneut, ihr Glück zu ergreifen. »Tóma te tu felicidad!« Nimm dein Glück.
Leonie bleibt stehen, lächelt. Das ist bestimmt eine Zigeunerin, eine gitana. Und sie, Leonie, wird angebettelt, so viel steht fest. Aber sie wird auf eine seltsam eindringliche Art angebettelt, als gäbe es auf der Welt nur sie, der man im Augenblick Glück prophezeien und Geld abnehmen müsste.
Jetzt packt die kleine Frau sie sogar noch am Arm. »Sé tu destino!«, raunt sie eindringlich und sieht von unten zu ihr auf. Ich kenne dein Schicksal! Ihr warmer Atem riecht nach Minze. Ihre Augen, schmal unter buschigen Brauen, sind ohne zu blinzeln aufgeschlagen, fast starr.
»Ach, Señora«, erwidert Leonie kopfschüttelnd und noch immer lächelnd, »woher wollen Sie mein Schicksal kennen? Sie sehen mich doch zum ersten Mal!«
»Der Rosmarin weiß es!«, entgegnet die kleine Frau entschieden. Ihre Stimme ist fast männlich tief.
»Wollen Sie mir aus der Hand lesen?«
Die andere wiegt den Kopf, und die Ohrringe, die ihr fast bis zur Schulter reichen, klappern blechern. Sie lässt den Arm ihres Opfers nicht los. Wenn ich nicht in so aufgeräumter Stimmung wäre, schießt es Leonie durch den Kopf, hätte ich sie längst abgeschüttelt und weggeschickt. Sie tastet nach ihrem Portemonnaie in der Kleidertasche. »Genügen vier Peseten?«
Die Frau antwortet nicht. Der Druck ihrer Hand an Leonies Arm verstärkt sich. Dann sagt sie leise: »No tomo tu dinero.« Von dir nehme ich kein Geld. »Eres gitana?«
Leonie senkt für einen Moment die Lider. Merkwürdig. Gitana. Zigeunerin? Wie kommt diese Frau dazu, anzunehmen, sie sei Zigeunerin? Wenn man ihr Aussehen daheim in Berlin oder in Wien vielleicht für ein bisschen »exotisch« gehalten hat – ihren bräunlichen Teint, ihre dunklen Augen, die hohen Wangenknochen und den üppigen Mund: Hier laufen lauter Leute herum, die so aussehen wie sie! Fast alle sind sie dunkelhaarig und braunhäutig, fast alle haben sie solche Augen wie sie. Und beinahe überhört sie die zweite Vermutung der Frau: »Judia?«
Zigeunerin oder Jüdin.
Nein, es ist nicht eigentlich ein Schreck. Eine Art von Verwunderung nur, die einhergeht mit einem Gefühl von Kühle. Als wenn all das Bunte, das Wilde, das so wunderschön Alltägliche rings um sie her unwesentlich wird.
»Wie kommen Sie darauf?«, fragt sie und wundert sich, dass sie flüstert. Als wenn ihnen jemand zuhören würde, mitten im Getriebe des fröhlichen Parks Buen Retiro.
Jetzt verzieht die Frau die Mundwinkel, nur ganz kurz, es ist wie ein Aufblitzen. »Es ist um dich herum«, erwidert sie ruhig. »Es umgibt dich. Dich wie mich. Du ziehst die lange Schleppe hinter dir her.«
»Was für eine Schleppe?«, fragt Leonie (sie muss erst in ihrem Kopf kramen, bis sie die Bedeutung des spanischen Wortes findet).
»Du verstehst mich schon«, sagt die Gitana, ohne eine Miene zu verziehen. »Und nun komm. Ich sage dir dein Geschick.« Und noch immer ohne ihren Arm loszulassen, zieht sie Leonie zur nächsten Parkbank.
Die lange Schleppe. Was für ein Bild! Die Schleppe, die man um sich drapieren kann und mit Stolz tragen wie einen Fürstenmantel. Oder die einen beschwert und einem anhängt für alle Zeiten, etwas, das man nicht los wird. Je nachdem. Die Schleppe, die er, Leonies jüdischer Vater, abschneiden wollte, um andere, freie Schritte machen zu können. Aber es ging nicht. Es ging nicht und es geht nicht. Man kann sie, diese Schleppe, nicht loswerden und man kann sie nicht verbergen. Man muss damit leben. Wie diese Gitana, die nun genau das tut, was man von einer Wahrsagerin erwartet, nämlich Leonies linke Hand öffnen und mit schief gelegtem Kopf und gehobenen Brauen die Linien der Innenfläche betrachten.
»Lassen Sie das!«, sagt Leonie. Sie sagt es schärfer, als sie eigentlich wollte, und entzieht der Frau ihre Hand, und der Blick, den sie erntet aus den funkelnden schmalen Augen, ist unverhohlen spöttisch. »Ich muss deine Hand auch gar nicht sehen, mi chica. Ich spür’s im Bauch, was mit dir ist und mit dir sein wird.« Mi chica. Meine Kleine.
Warum kommt es Leonie so vor, als säße sie mit dieser Frau auf einer Insel, von der alles andere abgerückt erscheint – blasser geworden plötzlich, leiser, ferner?
»Sagen Sie schon, was Sie loswerden wollen!«, bemerkt sie. Eine Beklemmung liegt plötzlich auf ihr, anders als die von vorhin, als die Gardisten vorbeiritten. Von innen heraus...
»Du musst dich nicht fürchten!« Es klingt besänftigend. Endlich wird ihr Arm fahrengelassen und sie hört nun die tiefe, ein bisschen heisere Stimme: »An dir hat schon viel gekratzt, seit der Mond zwei Dutzend Mal auf- und wieder untergegangen ist – schlimmer wird’s kaum kommen. Da sehe ich immer noch die Wunden. Aber sie heilen gut.Viele Kräfte stehen dir bei von allen Seiten, von unten und von oben. Nimm den Rosmarin, nimm ihn! Er wärmt und belebt und gibt deinem ohnehin heißen Blut noch den Tropfen Feuer mehr, den es braucht für die Liebe.«
»Ich will nichts wissen von Liebe!«, sagt Leonie abweisend und allzu rasch.
Die Frau lächelt. »Ja, ich weiß. Es tut noch zu weh. Aber der Rosmarin ist auch für treues Gedenken. Damit du ihn nicht vergisst und er bei dir bleibt. Und nun fahr in den Süden.«
»Woher wissen Sie, wohin ich will?«
Wieder der Spott in den Augen. »Ich rieche es. Dort erwartet dich etwas, das du suchst, und etwas, das du nicht suchst. Fahr dahin, wo die Feuer sind.« Was für eine Antwort!
Warum nur lass ich mich auf dieses Gerede ein?, fragt sich Leonie. Sie hat ein Gefühl, als müsse sie sich schütteln, um das hier loszuwerden.
»Bisher haben Sie mir über mein Schicksal ja nicht sehr viel verkündet!«, sagt sie schroff. »Also tun Sie’s nun, und dann lassen Sie mich gehen!«
Die Frau runzelt die buschigen Brauen. »Aber was mach ich denn die ganze Zeit? Chica, begreifst du nicht? Tu destino eres tu.« Dein Schicksal bist du selbst.
»Das hätte mir vielleicht auch noch allein einfallen können!« Leonie wird ärgerlich. »Danke fürs Wahrsagen.« Sie steht auf.
»Und der Rosmarin?«
»Geben Sie her.«Sie streckt die Hand nach dem üppigen Zweig aus.
Jetzt lächelt die Frau und schüttelt ihre klappernden Ohrringe. »Ich hab gesagt, dass ich von dir nichts nehme. Aber der Rosmarin bringt nur Segen, wenn er durch eine Spende erkauft ist.«
Also doch. Hätte vielleicht alles etwas weniger umständlich ablaufen können. Leonie holt die vier Peseten aus der Tasche, die sie von Anfang an geben wollte, tauscht sie gegen den Kräuterzweig.
Die Frau dankt nicht. Sie erhebt sich ohne Weiteres, hat keinen Blick mehr für Leonie, das ganze Getue ist vergessen. Sie marschiert ab mit wehenden Röcken und schlenkernden Fransen, und kaum hat sie sich ein paar Schritte entfernt von dieser Parkbank, da ist es, als wenn die Insel verschwindet, die in Leonies Wirklichkeit war. Alles um sie herum ist wieder bunt und laut und dicht, Gerüche und Bewegungen gelangen an Ohr und Auge, und die Haut spürt den warmen Wind.
Was war das denn nur für eine komische Episode?, fragt sie sich, verblüfft und irgendwie ärgerlich über sich selbst.
Sie sieht der kleinen Frau nach. Die geht quer über den kiesbestreuten Platz auf einen Mann zu, der bei einem nahen Milchkiosk auf einem Stuhl in der Sonne sitzt und seine Zigarette in langer Silberspitze raucht. Der Kerl ist wie aus dem Ei gepellt. Weicher Strohhut, Schlips und Kragen, dunkler Anzug mit einem purpurroten Stecktüchlein in der Brusttasche, Halbschuhe in Schwarzweiß. Spazierstöckchen mit verziertem Griff. Sein gewaltiger Schnurrbart wirkt wie mit Schuhcreme gewichst.
Die »Prophetin« nun tritt auf ihn zu – und steckt ihm ihre vier Peseten liebevoll in die kleine Tasche, hinter das purpurfarbene Tuch. Er erhebt sich, und Arm in Arm entfernt sich das ungleiche Paar; er wirbelt sein Stöckchen.
Nun muss Leonie doch lachen. Sie hat sich bluffen lassen von den Tricks einer ganz normalen wahrsagenden Gitana, wie sie hier an jeder Straßenecke zu finden sind – allerdings einer ziemlich geschickten, die sich nicht festlegt und alles im Nebulösen belässt. Denn was sie ihr gesagt hat, das war nichts, oder? Nur Schall und Rauch.
Dennoch. Sie dreht den Rosmarinzweig zwischen den Fingern. Wieso hat sie sich so – betroffen gefühlt?
Das mit der Schleppe...
Sie hat sie erkannt, durchschaut, diese Frau. Als eine Außenseiterin. Den Blick dafür geschärft durch ihr eigenes Außenseitertum.
Und dann das andere... Hat sie nicht gesagt: Wo die Feuer sind?
Feuer wie in ihrem Traum. Der ist auf einmal wieder präsent, dieser Traum, der sie mittags da in ihrem luxuriösen Hotelzimmer während der Siesta heimgesucht hatte. Dabei, die meinte ja wohl ganz andere Feuer. Liebesfeuer?
Nun, im Nachhinein, hat diese Person es doch geschafft, sie zu verunsichern.
Leonie dreht sich um und läuft aus dem Park. Fort jetzt. Den Koffer fertig machen für morgen früh, für den ersten Zug, der sie nach Granada bringen wird.
Ihre Aufgabe ist es, eine Mission zu erfüllen. Deswegen ist sie unterwegs, und dieser kleine Abstecher hier in den Park, diese Begegnung – nun, das hat sie wirkungsvoll zurückgeführt auf diese Aufgabe. Und der Traum zuvor hat sie gemahnt. Alles ist wieder präsent. -
Es kann nicht schaden, dass ich für mich den Punkt bestimme, an dem ich stehe. Bilanz ziehe: Wo der Weg anfing, was mir zustieß beim Uorwärtsschreiten, und wohin ich will. Damit ich es gelassen tue und mit allem Wissen, das nötig ist.
Vor zwei Jahren hat alles angefangen. Zwei Jahre, die mein Leben umgekrempelt haben, wie es gründlicher nicht sein kann, bis mein Pfad mich hierher in dies Land geführt hat, zu den Ursprüngen meiner Familie. Nach Spanien, in das Land Sepharad, wie es in unserer alten Sprache, im Ladino, heißt, das Land, aus dem wir fortmussten, wir Sepharden.
Es war das unselige Jahr 1492, das fatale Datum. Da siegte das Heer der spanischen Majestäten über die Muslime im südspanischen Andalusien. Da fiel Granada, fiel die Alhambra, die letzte der gewaltigen Festungen, mit deren Hilfe die Mauren das Land beherrscht und befriedet hatten. Da endete das Jahrhundert, das vom friedlichen Zusammenleben zwischen allen drei Konfessionen, zwischen Muslimen, Juden und Christen, geprägt worden war. Da jagten die »allerchristlichsten« Herrscher die Juden allesamt aus dem Land. Es sollte nur noch eine rein katholische Nation geben. Und da zog meine Familie fort von hier, gen Osten, ins Exil.
Wohin immer sie danach kamen, passten sie ihre Namen bald dem jeweiligen Land an, nannten sich Lascari, Laskere, Lasker – verstreut und doch nie ganz voneinander getrennt. Holland oder Deutschland, Türkei oder Osterreich – wo immer sie heimisch wurden. Eine Sippe, die sich immer wieder fand, immer wieder erkannte – an den Liedern, die sie mit sich genommen hatten aus Spanien, an derArt, wie und mit welchen Gewürzen sie ihre Speisen zubereiteten, an den Dingen, die sie taten als ihre Profession, als Tänzer, als Schauspieler, wie ich es auch gern werden möchte. Als meisterliche Köche. Als Wahrer solcher Traditionen.
Aber das alles weiß ich erst seit diesen zwei Jahren. Erst, seit ich meine Verwandten in den Pyrenäen, seit ich meine Ahnfrau Isabelle kennengelernt habe, kenne ich die Traditionen. Zuvor war ich, was meine jüdischen Wurzeln anging, so unwissend wie ein leeres Blatt, denn mein Vater, in seinem verzweifelten Bemühen, deutsch und nichts als deutsch sein zu wollen, hatte mir alles verschwiegen.
Zwei Jahre, und mein Leben ist ein anderes.
Mit Händen und Füßen habe ich mich gesträubt. Gegen alles. Gegen mein Judentum zunächst, aber dann vor allem gegen den, wie mir schien, aberwitzigen Auftrag, mit dem Isabelle meine sechzehnjährigen Schultern belastete. Isabelle, gestraft mit der furchtbaren Gabe, in die Zukunft sehen zu können, geschüttelt von peinigenden Visionen von Untergang und unvorstellbarem Leid der Juden, der mystischen Geheimlehre der Kabbala ergeben – sie lebte und lebt in dem Glauben, einen Beschützer für unser Volk erstehen zu lassen: den Golem, das menschenähnliche Gebilde aus Lehm, das sie, wie einst der berühmte Rabbi Löw in Prag, mittels dreier Zeichen zum Leben erwecken will. Und diese drei Zeichen, diese drei goldenen Buchstaben,Aleph, Mem, Taw, im Besitz der Familie, aber über halb Europa verstreut – die herbeizuschaffen, sollte ich, Leonie Lasker aus Berlin, auserlesen sein!
Wie ich mich wehrte gegen den »mystischen Unsinn«! Weglaufen wollte ich, bis ich dann selbst mit hineingezogen wurde in den Strudel von Isabelles Gesichten und begriff, dass ich ihre schreckliche Gabe geerbt hatte. Dass ich – dazugehörte. Dass ich, wie sie, schier unglaubliche Dinge aus der Zukunft sehen konnte, ohne mich dagegen wehren zu können.
So begann meine Suche nach den drei hebräischen Buchstaben. Meine Mission, die goldenen Zeichen Aleph, Mem und Taw zusammenzubringen, die das Wort »Emeth«, Wahrheit, bilden und den gewaltigen Mann aus Lehm lebendig machen können, wenn sie auf seiner Stirn befestigt werden. Denn diese drei Buchstaben waren fort aus dem Elsass, damals das Land Isabelles, waren hierhin und dorthin gewandert, weil sich ihre Brüder zerstritten. Es war vor dem Krieg von 1870, dem Krieg zwischen Deutschland und Frankreich. Jeder der drei hatte eine andere politische Ansicht. Einer war für die Deutschen, einer wollte gar nichts mehr von Westeuropa wissen, und der dritte schloss sich dem Freiheitskampf eines anderen Volkes an. Und jeder von ihnen nahm einen Buchstaben mit sich: In mein heimisches Berlin ging der eine, das Taw, in die ferne Türkei, nach Istanbul, und danach zurück nach Wien der zweite, Mem. Der dritte und wichtigste schließlich, das Aleph, ging mit dem dritten Bruder nach Spanien, in das Land, aus dem wir einst vertrieben worden waren. Hierher.
Der wichtigste Buchstabe deshalb, weil von ihm die Entscheidung über den Sinn des magischen Wortes abhängt. Denn fehlt er, dann bedeutet das Wort auf der Stirn des Golem nicht »Wahrheit«, sondern »Tod«, und der Retter, so glaubt es Isabelle, zerfällt wieder zu dem Stück Erde, aus dem er geformt wurde.
Und nun bin ich hinter diesem dritten Buchstaben her.
Was hat sie zu mir gesagt vorhin, die Frau mit dem Rosmarinzweig? »An dir hat schon viel gekratzt, seit der Mond zwei Dutzend Mal auf- und untergegangen ist.«
Ja, das hat mich getroffen, mich aufgewühlt. Zwei Dutzend Monde. Zwei Jahre. In jedem dieser Jahre habe ich eines der Zeichen für Isabelle gesucht und gefunden. Habe es ihr übergeben, Auge in Auge mit ihr, von der jungen Hand in die alte, wie es sein muss. Und jedes Jahr habe ich dafür bitter bezahlen müssen.
Zunächst war ich, nach dem ersten Aufenthalt in Hermeneau bei Isabelle und Gaston, wieder zurück nach Berlin gegangen, nach Hause, und da begannen die Schwierigkeiten.
Mein Vater, der wütend leugnete, dass ich, dass er, dass wir irgendetwas mit Juden zu tun haben könnten. Das hätten wir – wie sagte er? – abgestreift. Abgestreift wie einen alten Handschuh. Schließlich war er auch mit einer Deutschen verheiratet. Mein geliebter Vater, der mich aufzog nach dem frühen Tod meiner Mutter, dieser Vater, der diese Herkunft, derer ich mir nach der Begegnung mit Isabelle gerade bewusst wurde, als Schande betrachtete. Der nichts davon wissen wollte. Der mit den sogenannten Völkischen ging, den Männern vom »Stahlhelm«, den ewig Gestrigen, den Judenhassern, und mit ihnen bis hin zu diesem Putsch in München, wo ein Mann auftrat, der Adolf Hitler hieß, und danach stracks ins Gefängnis. -Aber das war später. (Heute bin ich froh, dass ihm später seine Irrtümer bewusst wurden, dass ich ihm vergeben konnte.)
Zuerst suchte ich heimlich unsere kleine Wohnung nach einer Spur des ersten Buchstabens ab, jenes Zeichens, das Isabelles Bruder Jahrzehnte zuvor an sich genommen hatte. Einen Buchstaben fand ich nicht. Wohl aber die Spur von Verwandten, die mein Vater verleugnete. Die Laskarows, eine jüdische Schauspielerfamilie. Vater, Mutter, Sohn. Komödianten!
Theater! Von mir über alles geliebtes Theater. Und der Sohn. Schlomo.
Und nun fing ein ganz neues, ein anderes Leben an für mich. Ein Leben, das ich geheim hielt vor meinem Vater, so lange es nur ging, bis ich es denn doch herausschreien musste: dass ich an diesem jüdischen Theater angestellt war, dass ich dort spielen konnte – und dass ich den Sohn, den jungen Hauptdarsteller, leidenschaftlich liebte.
Die Kluft zwischen mir und dem Vater wurde zu groß. So trennte ich mich von meinem alten Zuhause und zog bei den Laskarows ein. Wärme und Herzlichkeit umfingen mich. Liebend war ich und geliebt. Und dabei immer weiter auf der Suche nach Isabelles Buchstaben.
Ich war im Glück. Nur die Trennung von meinem Vater trübte diese Tage.
Aber dann wuchsen die Wolken auf, wurden schwarz und bedrohlich. Mord und Totschlag rasten durch das Berliner Scheunenviertel, die Wohnstatt der Juden, wo das Theater der Laskarows war. Vandalen störten unsere Ausführungen. Und schließlich, als ich den ersten Buchstaben mit Hilfe meines Geliebten gefunden hatte, als ich mit ihm gemeinsam aufbrechen wollte nach Hermeneau zu Isabelle – da erschoss man ihn vor meinen Augen auf offener Straße...
Da wusste ich dann, wofür Isabelle ihren Golem, den Beschützer der Juden, brauchte.
Das zweite Opfer, das mir abverlangt wurde, war keines von Fleisch und Blut. Es war ein Einschnitt, der mich von meinen Wünschen und Träumen losriss und die Bahn, die ich gerade zu beschreiten mich anschickte, mit einem tiefen Graben unterbrach. Der Riss, mit dem ich meinen Vertrag an einer der wichtigsten deutschsprachigen Bühnen zerfetzte, um für den Verzicht auf dies Engagement im Gegenzug den zweiten Buchstaben zu bekommen... dieser Riss trennt mich nun – zunächst einmal – von meiner Zukunft; von dem, was ich im Leben will.
Nein. Ich habe nicht vor zu lamentieren
Ein Dreivierteljahr war ich nach all dem in den Pyrenäen, in Hermeneau.
Langsam heilten die Wunden meiner Seele unter der unaufdringlichen Fürsorge, unter den liebenden Augen meiner Verwandten. Aber je mehr meine alten Kräfte erwachten, umso ungeduldiger wurde ich.
Und schließlich saß ich wie auf einem brodelnden Vulkan. Habe immer wieder Asche auf den Krater geschüttet, mich gezügelt. Es ging nicht voran. Nicht mit der Suche und nicht mit meinem Leben. Ich wollte endlich meine Aufgabe erfüllen!
Alles Mögliche habe ich gemacht in der Zeit. Ich saß da und lernte. Lernte Spanisch, lernte von Isabelle Ladino, die Sprache der sephardischen Juden, die in hebräischen Buchstaben geschrieben wird, lernte auch gleich noch Hebräisch. Lernte sehnsuchtsvoll meine Theaterrollen, um dereinst denn doch spielen zu können, irgendwo, um meinen Lebenstraum zu erfüllen, wenn ich wieder Fuß fassen würde nach dem Riss, der durch mein Leben ging.
Ich lernte, und ich wartete.
Wartete weiter darauf, dass Gaston den Besitzer des Aleph fand, und die Zeit dehnte sich für mich ins Unerträgliche, denn das war eine schwere Aufgabe.
Unermüdlich war Isabelles Mann auf den Spuren des dritten Bruders, Joseph, der nach Spanien gegangen war.
Abenteuerliche Geschichten rankten sich um diesen Bruder. Als ein Rebell, ein Anarchist, hatte er einst für die Befreiung der Basken im Norden des Landes gekämpft, die die Spanier zur Aufgabe ihrer Eigenständigkeit zwingen wollten. Seither, so hieß es, wird er gesucht und lebt untergetaucht; es hieß, er sei unter wechselnden Namen hier und da als großartiger Gitarrist aufgetreten; mehrmals wurde er verhaftet, aber immer gelang es ihm – den sie den »Mann mit der Knarre und der Gitarre« nannten -, zu entkommen. Ein geheimes Netz von Freunden und Gesinnungsgenossen schien ihn zu schützen. Er lebt im Versteck.
Seinen Aufenthalt schließlich ausfindig zu machen, in Granada, kostete Gaston Kraft... und viel Geld, das in obskure Quellen floss. Schließlich musste er selbst nach Spanien reisen, um diesen Joseph und seine verzweigte Láscaro-Sippe aufzuspüren. Verwandt war ich ja nur weitläufig mit ihnen: Joseph und mein Großvater waren Brüder. Aber immerhin – verwandt.
»Was das für Leute sind, das wirst du dann schon selber feststellen«, sagte Gaston damals, zurückgekehrt, lächelnd zu mir. »Sie sind für eine Überraschung gut. Und sei vorsichtig, Kind! Wie gesagt, du fährst zu einem steckbrieflich Gesuchten, einem Mann, der einmal ein Anarchist war.«
Anarchist – das musste er mir damals auch erst erklären. Jemand, der Bevormundung nicht anerkannte, der für die Freiheit jeder einzelnen Person und jedes einzelnen Volkes eintrat, gegen die brutale Unterdrückung ihrer Besonderheiten. Auch mit der Waffe in der Hand...
All das machte mich neugierig – und ich wurde noch ungeduldiger, als ich schon war.
Doch nun bin ich hier, wo ich meine Suche nach dem dritten Buchstaben, dem wichtigsten, beginnen kann. Morgen werde ich dorthin fahren, wo sein Besitzer lebt, nach Andalusien, der Provinz im Süden Spaniens, woher wir einst kamen. Wir, die Juden. Meine Familie.
Ich werde erwartet. Das Aleph erwartet mich.
Das Erinnern, ich spüre es, hat mir geholfen. Ich bin ruhig jetzt. Morgen bin ich unterwegs.
GRANADA I
I
Der Bahnhof Atocha, von dem aus man Madrid in Richtung Süden verlässt, ist eine gewaltige Glocke aus Stahl und Glas, unter der sich jedes Geräusch vervielfältigt, ein verstörendes Etwas, das einem die Luft raubt. Und so, in der stickigen Treibhaushitze dieser riesigen Halle, attackiert von so viel Durcheinander, kaum in der Lage, die für mich wichtigen Ansagen in der noch ungewohnten fremden Sprache aus dem Lärm herauszufiltern, irrte ich mit meinem Koffer herum, verstand diesen oder jenen Beamten mit imponierender Mütze falsch, als ich ihn um Auskunft bat, und landete schließlich schwitzend und erleichtert in den weinroten Polstern der Ersten Klasse des Schnellzugs – zunächst nach Sevilla.
Ich bemerkte, dass mir in all dem Trubel der Rosmarinzweig abhandengekommen war. Sicher lag er nun auf der Steinbank, wo ich einiges aus der Handtasche in den Koffer umgepackt hatte. Irgendwann an diesem Tag würde ihn jemand wegräumen, auf die Erde werfen und mit einem Besen zum Abfall kehren...
Als der Zug den Bahnhof endlich verließ, dachte ich, in den sonnigen Süden zu reisen. Stellte mir vor, dass es da unten mindestens genauso schön und warm sein müsste wie in Madrid und wie in meinen geliebten Pyrenäen.
Und in Sevilla, da war es auch noch sommerlich warm, und mein unangebrachter heller Mantel bereitete mir Pein. Aber ach, dann wurde alles anders.
Ich stieg um in den Regionalzug.
Und da sitze ich nun, und eine gewaltige blaue Wand wächst fern am Horizont empor, und ich schaue aus dem Fenster meines Abteils und sehe nichts als Wolken. Dicke, schwarze Wolken, auf die der Zug zurast. Über den nackten roten Hängen und der grünen, mit Olivenbäumen bepflanzten Ebene zucken Blitze kreuz und quer. Dicke Regentropfen schlagen gegen die Scheiben.
Das Land wird bergig. Eigensinnige kleine Kuppen recken sich hoch. Auf ihnen liegt verwehter Schnee.
Dann verschwindet der Zug im Dunst; wir fahren durch Nebelwände.
Die Passagiere um mich herum schlafen: ein paar alte Männer in abgeschabten Kordsamt- oder Flanellanzügen, eine Frau in langem Rock, das Haar unterm Kopftuch, neben ihr ein paar Körbe. Das Wetter kümmert sie alle nicht. Jedenfalls scheint es für sie nichts Ungewöhnliches zu sein.
In den Regen mischen sich immer mehr weiße Flocken.
Ich lehne meine Stirn gegen die kalte Fensterscheibe, träume mich weg. Es wird Abend.
Was erwartet mich wohl?
Granada. Ultima estación. Esto tren termina aquí. Dieser Zug endet hier.
Ich schrecke auf. Habe überhaupt nicht mehr auf das Draußen geachtet.
Der letzte Punkt meiner Reise. Eine kleine Station, unüberdacht der Bahnsteig, Leute erwarten die Ankömmlinge. Mich hoffentlich auch, es hieß, ich solle abgeholt werden.
Ich steige aus. Es gießt noch immer, wenn auch die Schneeflocken verschwunden sind. Ich stehe mit meinem Koffer auf diesem schmalen Perron und blicke mich um. Aber da ist niemand.
Die anderen Mitreisenden haben sich schnell hierhin und dorthin verstreut, die meisten sind von fröhlichen Freunden, Verwandten, Bekannten mit umfänglichen Regenschirmen in Weiß oder leuchtendem Rot abgeholt worden.
Also gut. Werde ich einfach losziehen und mir ein Hotelzimmer suchen. – Aber nicht einmal ein Dienstmann oder Gepäckträger ist in der Nähe, geschweige denn ein Taxi... Alles sieht verwaist aus unter dem Regime dieses unerbittlichen Regens.
Gerade als ich mich umwende und meinen viel zu schweren Koffer aufheben will, taucht aus dem feuchten Dunst eine schmale Gestalt auf und nähert sich mir – allerdings aus einer Richtung, aus der ich niemanden vermutet habe. Die Gestalt hüpft über die Gleise, springt mit Schwung auf den Perron, kommt nun auf mich zu. Ein dünner junger Mann, ganz in Schwarz gekleidet, das Haar strähnig und triefend vor Nässe. Er bleibt stehen, mustert mich, sagt dann in einwandfreiem Deutsch: »Leonie Lasker, die Berlinerin, die Schauspielerin?«
Ich nicke, verblüfft, dass mich jemand auf Deutsch anspricht, und außerdem, dass man mich Berlinerin nennt. In Berlin bin ich seit Jahr und Tag nicht mehr gewesen und Schauspielerin will ich erst werden.
»Ich bin dein Cousin Ramiro, ein Enkel von Joseph«, sagt der nasse junge Mann in Schwarz und streckt mir eine regenfeuchte Hand entgegen, die ich ergreife. Die Hand ist schmal, aber ihr Druck ist fest und kräftig.
»So«, sagt er. »Komm. Du wohnst zunächst in Azzurras Zimmer. Sie ist unterwegs.« Seine Stimme klingt leicht heiser, als habe ihr der Regen etwas anhaben können.
Ohne Weiteres greift er meinen Koffer.
Azzurra? Wer ist das, jemand aus meiner Familie? Oder eine Freundin von diesem Ramiro? Und wohin ist sie wohl unterwegs? Ich verkneife mir die Fragen.
»Kein Hotel?«
Er legt den Kopf in den Nacken und sieht mich streng an. »Hotel? Du bist unsere Verwandte. Unser Gast.« Ich begreife, dass jeder Einspruch ihn beleidigen würde. Er erwartet so etwas auch gar nicht. Er stiefelt mit meinem Koffer los und ist sich sicher, dass ich ihm folge.
Unter der Last meines Gepäcks geht er schief, den anderen Arm balancierend zur Seite gestreckt, aber mit leichten federnden Schritten, und zum Glück nun nicht wieder über die Gleise, sondern ganz normal vom Bahnhof fort, und ich hinterher, ohne zu fragen, ob es weit ist; was sich als Fehler erweist, denn sonst hätte ich ja vielleicht meinen Regenschirm aus dem Koffer geholt.
Da geht nun einer, dem das Wasser aus den Haaren in den Kragen läuft und den das gar nicht zu stören scheint, und ich stapfe ihm nach. Merkwürdig.
Granada. Das hab ich mir anders vorgestellt. Ewige Sonne.
Wir marschieren eine Platanenallee entlang, und mir scheint, der Regen lässt nach, aber das war wohl nur so unter dem Schutz des Blätterdachs, denn nun hüllt es uns wieder ein, silbergrau, bräunlichgrau. Dichte Feuchte vom Himmel.
Ein paar Straßen weiter, und ich rutsche auf holprigem, schlüpfrigem Pflaster hinter meinem Koffer her. Jetzt kommt ein Platz, und dann geht es aufwärts. Steile, unregelmäßige Treppen, glänzend vom Wasser, Pfützen. Ein dürrer Hund streift an uns vorbei und winselt kläglich.
Die Häuser rücken immer näher, aus der Straße wird so etwas wie eine Stiege. Ehemals weiß getünchte Häuser, an deren Fundamenten die Farbe abblättert, rostfarben, grindig.
Ramiro wechselt den Koffer mehrfach von der Rechten in die Linke und umgekehrt; endlich bleibt er stehen... ein Glück auch, ich kriege langsam keine Luft mehr vom Treppensteigen.
Da ist eine Lücke zwischen den Häusern, und in der Ferne zwischen Nebelbänken und Wolkenballen erscheint wie ein Phantom ein ockerbrauner Klotz, eine gewaltige Trutzfestung.
»Alhambra«, sagt Ramiro lakonisch. »Wenn es nicht regnet, kann man von hier aus auch die Sierra Nevada sehen. Die Schneeberge.«
Ich nicke. Im Augenblick sehe ich weder Schneeberge noch irgendwelche anderen Berge. Der Wolkenvorhang macht auch ganz schnell wieder dicht.
Einen Augenblick gönnt mein Führer mir noch, und ich starre auf die grau umwallten verschwindenden Umrisse. Dann packt er wieder meinen Koffer; diesmal schultert er ihn, wie das damals die Lastträger in Wien auf dem Bahnhof machten, bloß, das waren stabile Kerle. Mein Cousin Ramiro ist ein Leichtgewicht. Er stützt den Koffer auf seiner Schulter mit dem Handballen und spreizt die Finger ab, geht schiefer geneigt als zuvor, den anderen Arm nun in die Hüfte gestemmt, und ich überlege, ob ich nicht anbieten soll, dass wir das dumme Gepäckstück gemeinsam tragen, aber da würde ich bestimmt nicht gut mit ankommen. Siehe Hotelzimmer!
»Ist es noch weit?«, frage ich, und er, den Kopf zu mir gedreht: »Kannst du nicht mehr?« Es klingt herausfordernd. Also schweige ich und rutsche weiter über die glitschigen, regennassen Kopfsteine.
Noch enger die Häuserzeilen. Kleine, vorspringende Balkone, von schrägen Balken abgestützt, das Schnitzwerk der Fenstergitter schwarz vor Nässe. Nie mehr als zwei Stockwerke.
Dann endlich. Ein paar Stufen, eine rotbraun lackierte Haustür mit einem schönen Messingknauf. Ramiro stellt mein Koffermonstrum ab und zieht aus seiner Hosentasche einen großen Schlüssel. Nachdem er aufgeschlossen hat, übergibt er ihn mir. Wir sind da.
Ein Flur mit blau-weiß gemusterten Kacheln gibt den Blick auf einen winzigen Innenhof, einen Patio, frei. Seitlich führt eine enge steile Treppe nach oben, und wieder wandert mein Koffer schwankend vor mir her, aufwärts. Den Innenhof umgibt eine Galerie, die sich in der Höhe des ersten Stocks rundum zieht. Von der Galerie gehen viele Türen ab. Alles ist still, als wäre außer uns beiden niemand im Haus.
An einem dieser Eingänge macht Ramiro Halt. Wieder wird ein Schlüssel gezückt.
»Hier, Leonie. Hier kannst du vorerst wohnen. Azzurras Zimmer.«
Wer auch immer diese Azzurra sein mag – sie ist eine sehr spartanische Person. Denn in diesem Raum von der Größe einer Klosterzelle findet sich ein schmales Bett mit grauer Decke, ein Regal, ein Tisch, ein Stuhl, aus dessen Polster das Rosshaar der Füllung seitlich hervorquillt. Nichts weiter an Möbeln. Nackte kahle Wände. Vom Plafond baumelt eine ebenfalls nackte kahle Glühbirne – wenigstens haben sie hier elektrisches Licht, schießt es mir durch den Kopf. Der Vorhang vorm Fenster sitzt in einer einfachen Messingschiene. Er ist mit verblichener Blütenstickerei verziert, die sich auflöst, einzelne Fäden hängen müde herunter.
So etwas wie diesen Raum habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Zu Haus in Berlin, bei meinem Vater, ging es auch ziemlich einfach zu, aber so... Und in der letzten Zeit, in Hermeneau – da war ich ja förmlich umzingelt von Behaglichkeit... Kann ich mich wirklich an so etwas wie dies Quartier gewöhnen?
Noch stehe ich in der Tür. Noch habe ich den Raum nicht betreten. Noch kann ich den Kopf schütteln, Danke sagen und Ramiro bitten, mir ein Hotelzimmer zu suchen.
Er hat meinen Koffer an mir vorbei hineingetragen in dies Zimmerchen und ihn auf den einzigen freien Platz gestellt, direkt unterm Fenster. Jetzt dreht er sich um, verschränkt die Arme und sieht mich gleichsam prüfend an.
Wie er mich wohl wahrnimmt?
Verunsichert. Und pudelnass.Wie er ja auch.Wir tropfen beide.
Ramiros Augen werden schmal, als er mich so betrachtet, und in seinen Mundwinkeln erscheint ein Lächeln.
»Warte einmal!«, sagt er und schiebt sich an mir vorbei nach draußen, ohne mir mitzuteilen, was er vorhat.
Was bleibt mir übrig. Ich gehe zögernd über die Schwelle. Ein, zwei Schritte. Werde bleiben müssen, zunächst einmal. Ich habe mir vorgenommen, mich auf sie einzulassen, auf diese meine neue Verwandtschaft, über die sich Gaston in seinen Andeutungen erging; sie »sind für eine Überraschung gut«.
Nun denn, ich will niemanden vor den Kopf stoßen.
Mit zwei Fingern hebe ich den Vorhang vom Fenster.
Unten liegt ein carmen, ein stufenförmig angelegter Hausgarten. Kakteen, ein Hibiskusstrauch mit Blüten, so rot, dass sie selbst im Regen zu glühen scheinen, Töpfe, die überquellen von Stiefmütterchen und Veilchen. Dann die Dächer des nächsten und des übernächsten Hauses, schuppig braun, darüber das Grau des schlechten Wetters. Undurchdringlich, aber keine Enge. Kein finsterer Hof. Das macht ein bisschen Mut.
»Leonie?«
Ich drehe mich um.
Hinter mir steht Ramiro. Er streckt mir ein grobkörniges Handtuch aus Zwirn hin; ein zweites hat er sich selbst übers Haar gelegt.
Und dann stehen wir einander gegenüber und rubbeln uns jeder mit beiden Händen das Haar trocken und wischen uns die Nässe aus den Gesichtern – und grinsen.
Das erste Lächeln, das wir austauschen. (Er hat ein schmales bräunliches Gesicht, gerade Nase, viel Platz bis zur Lippe. Die Augen sind mandelförmig. Pechschwarzes Haar. Hübscher Kerl. Wie alle Laskers...)
»Also«, sage ich und finde es beinah peinlich, wie ich geguckt habe. »Danke für das Zimmer. Danke an Azzurra, dass sie es mir gibt. Danke fürs Abholen.«
Er nickt. Das waren dann also wohl die richtigen Worte.
Ich schäle mich aus meinem Mantel, der eigentlich hell ist, aber nun dunkel vor Feuchte, und er nimmt ihn mir aus den Händen.
Sieht sich suchend um: Wohin mit dem guten Stück? Aber da gibt es weder einen Schrank noch einen Kleiderständer. Kurz entschlossen geht er nach draußen, hängt ihn über das Geländer der Galerie – und ich folge ihm und vergewissere mich mit einem Blick nach oben, dass das Dach übersteht und also der Mantel nicht noch nasser wird, als er ohnehin schon ist.
»So!«, sagt er befriedigt, als wäre nun alles bestens. »Dann bis später.«
»Was meinst du damit?«, frage ich verwirrt.
»Ich hole dich ab«, erklärt er. »Nachts ist Flamenco, drüben im Realejo.«
Das Realejo ist ein Stadtteil Granadas, das habe ich mir vorher auf der Karte angeschaut, die mir der fürsorgliche Gaston gegeben hat, wie den Baedeker, den Stadtführer über Wien, bei meiner vorigen Reise. Und das Realejo ist also »drüben«, was immer das bedeuten mag (ich habe keine Ahnung, wo ich mich gerade befinde), und da ist Flamenco und er holt mich ab.
Das muss wohl so sein.
»Leider tanzt Azzurra heute nicht«, sagt er. »Sie ist die Beste. Aber, wie gesagt, sie ist unterwegs.«
Diese Azzurra ist also eine Tänzerin. Und wohnt in so einem miserablen kleinen Zimmer? Merkwürdig. Sie scheint mit ihrer Kunst nicht viel zu verdienen...
Und dieser Ramiro – kommt er vielleicht einmal auf den Gedanken, dass ich müde, hungrig oder durstig bin und mich für heute lieber unter diese graue Decke legen möchte? Offenbar nicht.
Er nickt mir zu und ist schon fast aus der Tür, da fällt ihm denn doch noch ein, zu fragen: »Brauchst du irgendetwas?«
»Ja«, sage ich. »Eine heiße Dusche könnte ich wirklich gut gebrauchen.«
Er fährt sich mit der Hand übers Gesicht, wie, um etwas wegzuwischen. Und dann lacht er breit und zeigt eine Reihe leuchtend weißer Zähne, spitz wie die eines jungen Wolfs. »Soy descortes!« Ich bin unhöflich, sagt er, und mit einem kleinen Schauer höre ich das erste Mal jemanden Ladino, das jüdische Spanisch, die Sprache meiner Vorfahren, als Umgangssprache benutzen. (In Hermeneau habe ich es ja von Isabelle gelernt, aber außerhalb der Lektionen sprach man Französisch und Deutsch.) Dann fällt er zurück ins Deutsche. »Komm, ich zeige dir alles.«
Er hängt sein nasses Handtuch neben meinen hellen Mantel und prasselt die Stiege hinunter. Das wacklige Geländer zittert und bebt, und ich folge ihm nach unten. Vom blau-weiß gekachelten Hausflur geht eine Tür ab, die er öffnet, indem er sich mit der Schulter dagegenstemmt. Dahinter eine andere Zelle, fensterlos, weiß getüncht, warm, mit einem Abfluss in der Mitte. Ein bronzener Kohlebadeofen, Schüsseln und eine Sitzwanne. Auf einer Etagere ein Stapel jener groben Zwirnhandtücher, wie die, mit denen wir uns das Haar abgetrocknet haben, ein Schwamm, so groß wie ein Brot, und ein Stück olivenfarbene Seife.
»Por fabor!«, sagt er und benutzt die Ladino-Form des spanischen Wortes favor. Er macht eine einladende Handbewegung. »Wir haben extra für dich angeheizt. Du kannst auch baden in dem Ding da. Einfach hinterher den – tapón«, er zögert, das erste Mal sucht er nach dem deutschen Wort: »den Stöpsel ziehen. Das Wasser läuft dann zum Abfluss auf den Boden. Nebenan ist die Küche. Du kannst nehmen, was du willst. Adiós.«
Weg ist er und ich stehe da in dieser Kammer und werde nun also baden oder duschen, und während ich mich ausziehe, entdecke ich, dass man die Tür nicht einmal von innen verriegeln kann, aber das soll mir nun auch egal sein.
Von Isabelles Bruder, den ich ja hier finden soll, fehlt bisher jede Spur. Er wurde von diesem Ramiro nicht einmal erwähnt. Hat das etwas mit der Vorsicht zu tun, mit dem Versteck, in dem er lebt? Viele Rätsel.-
Ramiro ist die Stiegen heruntergesprungen und lehnt nun für einen Moment aufatmend draußen an der Haustür.
Nichts ist merkwürdiger, als ein Mädchen in einem Zimmer unterzubringen, das einer anderen gehört; einer, mit der man bis vorigen Herbst zusammen war. Es ist, als würde man eine Figur aus einem Bild ausschneiden und eine andere in das Bild einsetzen.
Er hält sein Gesicht dem Regen hin, läuft mit halb geschlossenen Augen den Weg zurück; er kennt ihn gut genug, um nicht weiter hinsehen zu müssen, ist ihn oft genug gegangen, als er Azzurra besuchte. Die Hände hat er tief in den Hosentaschen vergraben. Die Finger müssen wieder warm werden, dürfen sich nicht so klamm anfühlen wie jetzt, wenn es nachher an die Gitarre geht.
Das deutsche Mädchen. Leonie. Leonida. Eine junge Frau in einem durchgeweichten Gabardinemantel und buntem Schal; Seidenstrümpfe, feines Schuhwerk. Das Entsetzen über dies ärmliche Quartier stand ihr ins Gesicht geschrieben. Liebend gern hätte sie Nein gesagt und wäre ins Hotel gegangen. Aber sie hat tapfer unsere Familien-Gastfreundschaft angenommen. Er lächelt.
Ich selbst hätte ihr ja auch gern etwas anderes gegönnt. Aber es war eine Anweisung vom Papú, von meinem Großvater José. Und José – oder Joseph, wie sie ihn in Berlin wohl nennen – widerspricht man nicht.
Er wollte, dass sie von Anfang an eingebunden ist in unsere weitläufige und so grundverschiedene Sippe. Räumlich fast genau in der Mitte zwischen den Sesshaften oben am Sacromonte und uns Fahrenden unten hinterm Bahnhof. Kein »Besuch«. Eine von uns.
Ich hoffe, sie wird’s so verstehen, wie es gemeint ist. Es wäre sonst schade.
Ramiro nimmt eine Abkürzung, indem er über ein unbebautes Grundstück läuft und über die Steine einer kleinen Mauer springt, ohne die Hände aus der Hosentasche zu nehmen. Der Regen hat das Straßenpflaster glitschig gemacht, aber er balanciert sich aus.
Wieder muss er lächeln.
Sie ist auf ihren hübschen Schuhen durch die Nässe geschlittert, ohne sich zu beklagen.
Als sie mir gegenüberstand, die Arme erhoben, und sich das Haar trocken frottierte, diese wilden Locken, und die Wimpern regennass, als hätte sie gerade geweint – bendicho Dio, was für ein Mädchen! Diese Lippen, so sanft geschwungen, die Mundwinkel ein bisschen nach oben gebogen, ein ruhendes Lächeln...
Das wird eine aufregende Zeit, solange sie hier ist...
Ich werde heute Abend gut sein an meiner Gitarre. Noch besser als gut.
Er kickt einen Kieselstein vor sich her.
Und ich hol sie mit einem Regenschirm ab.
2
Bisher hat sie noch keinen Menschen wahrgenommen, aber es ist ziemlich klar, dass sie nicht als Einzige hier ist, sondern die anderen Zimmer rund um die Galerie ebenfalls ihre Bewohner haben müssen. In der Küche hat sie Regale mit unterschiedlichem Geschirr gesehen, und dann hängt da so etwas wie ein Putzplan mit abgekürzten Namen. Eb. – Azz. (das ist wohl Azurra) – Dom. – Frec. – Dol. Was heißt, dass alle diese kleine Küche gemeinsam benutzen.
Also mindestens fünf Leute bewohnen das Haus. Aber niemand scheint da zu sein.
Sie hat sich nach dem Duschen (die schmale Sitzwanne wird sie ein andermal ausprobieren) eine Tasse Milch aus einem irdenen Krug eingegossen und ein paar Zwiebacke aus einer offenen Papiertüte genommen und ist, die Kleider überm Arm und eingewickelt in zwei der Handtücher, wieder nach oben gegangen. Ist über den gefliesten kalten Fußboden getappt, hat gegessen, getrunken, sich aufs Bett gelegt und ist dann ganz schnell wieder in ihre Sachen geschlüpft, denn sie begann, nachdem die Wärme des Wassers auf ihrer Haut verflogen ist, ganz erbärmlich zu frieren. Die graue Decke ist hauchdünn.
Es ist inzwischen dunkel, und der Regen rauscht hinter dem offenen Fenster – sie braucht ein bisschen frische Luft und hat inzwischen festgestellt, dass es draußen nicht kälter ist als drinnen.
Die nackte Glühbirne anzuschalten, hat sie keine Lust. Das Ärmliche dieser Behausung muss nicht auch noch bei künstlichem Licht betrachtet werden. Gern würde sie schlafen. Aber sie soll ja noch abgeholt werden. Wann auch immer. Nach ihrem kleinen Reisewecker, den sie aus dem Koffer geholt und neben das Bett gestellt hat, geht es inzwischen schon auf neun Uhr zu. Die leuchtenden Ziffern und Zeiger sind das einzige Helle hier. Das ganze Haus liegt noch immer still und dunkel.
In einer Mischung aus Ratlosigkeit und komischer Verzweiflung fragt sie sich: Wohin, verdammt noch mal, hat es mich hier verschlagen? Und was kommt auf mich zu?