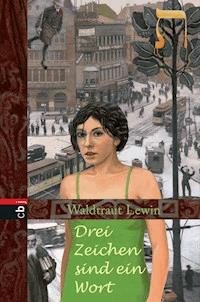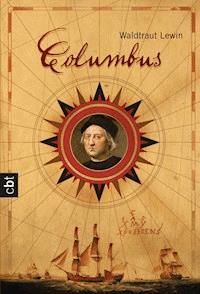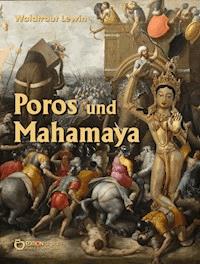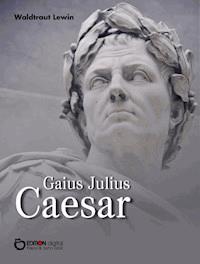
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Autorin spürt dem Leben und Wirken des G. Julius Caesar nach. Sie zeigt die Taten des römischen Feldherren und Staatsmannes im Zusammenhang mit den sozialen und politischen Gegebenheiten dieser Zeit. Gleichzeitig versucht sie, aus dem Überlieferten Rückschlüsse über Caesars Leben im Kreise der engsten Vertrauten, über seine Einstellungen und Gefühle zu ziehen. Dabei werden die Sitten und Gebräuche der späten Republik anschaulich geschildert und durch zahlreiche Zitate antiker Schriftsteller untermalt. INHALT: 1. Im Jahre 100 2. Nobilitas 3. Gaius Marius, der Onkel 4. Das neue Heer 5. Optimaten und Popularen 6. Schule für Demagogen 7. Familienpläne 8. Staatsreligion 9. Kraftprobe mit Sulla 10. Krieg im Osten 11. Seeraub 12. Sklavenkrieg 13. Neue Namen 14. Die Lage normalisiert sich 15. Trauerzug 16. Auf dem Weg nach oben 17. Der Pöbel Roms 18. Die Verschwörung des Catilina 19. Caesar wird Prätor 20. Skandal im eigenen Haus 21. Der hilflose Große 22. Statthalter in Spanien 23. Der geopferte Triumph 24. Das erste Konsulat 25. Die Unternehmungen des Clodius 26. Rom bleibt unsicher 27. Das langhaarige Gallien 28. Das Heer 29. Der andere Caesar 30. Der Krieg gegen die Helvetier 31. Die nordischen Riesen 32. Völker-Schlachten 33. Das „dreiköpfige Ungeheuer“ 34. Der Bau der berühmten Brücke 35. Der gallische Aufstand 36. Die Commentarii 37. Krise in Rom 38. Die Überschreitung des Rubikon 39. Probleme mit der Armee 40. Elf Tage Innenpolitik 41. Der Kampf zwischen den beiden Großen 42. Die Schuldenfrage 43. Der Tod des Pompeius 44. Geschäfte in Alexandria 45. Die welthistorische Liebesaffäre 46. Auf des Messers Schneide 47. Veni, vidi, vici 48. Das Schaf schlachten, ohne das Fell zu ritzen 49. Neues aus Afrika 50. Cato und Anti-Cato 51. Triumphzüge 52. ... den Staat wieder in Ordnung zu bringen 53. Die Provinzen 54. Caesars neue Senatoren 55. Die großen Pläne 56. Die Opposition 57. Melancholie 58. Die Verschwörung 59. Die Iden des März 44 60. Das Testament
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 305
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Impressum
Waldtraut Lewin
Gaius Julius Caesar
Aufstieg und Fall eines römischen Politikers. Biografie
ISBN 978-3-95655-447-6 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien erstmals 1980 im Verlag Neues Leben, Berlin.
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta Foto: Andrea Grosz
© 2015 EDITION digital® Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.edition-digital.com
1. Im Jahre 100
Nach römischem Brauch erhält der erstgeborene Sohn den Namen des Vaters.
Das Kind, das am 12. Juli des Jahres 100 vor unserer Zeitrechnung dank der Kunst griechischer Arztsklaven durch eine Schnittentbindung das Licht der Welt erblickt, wird deshalb mit Vornamen Gaius, mit Gentilnamen Julius, mit Zunamen Caesar genannt.
Wie die Ärzte heißen, weiß niemand. Die Operation, die sie ausführten, wird seitdem Caesar- oder Kaiserschnitt genannt.
Die Wiege ist aus edlem Holz, die Leintücher sind fein und bestickt, die Sklavenschaft ist zahlreich - das kann man voraussetzen.
Selbst in einem politisch einflusslosen und nicht sehr vermögenden Haus, wie das der Julier zu dieser Zeit war, wird das Hausgesinde, die familia, wohl kaum weniger als hundert Sklaven betragen haben. Die großen vorangegangenen Kriege hatten die Ware Mensch billig gemacht. Die Sklavenmärkte quollen über. Es war nicht schwer, sich verwöhnen zu lassen, wenn man Geld genug hatte.
Das Kind, so wird berichtet, hat lebhafte schwarze Augen, ein rundes Gesicht und eine weiße Haut. Seine Gesundheit ist robust. Grund zur Freude für die Eltern.
Ein Heer von kleinen Göttern überwachte die Lebensfunktionen eines Kindes von vornehmer Geburt. Ungläubigkeit bedeutete Gotteslästerung, und so waren die aberwitzigsten Zaubereien auch in den vornehmen Kreisen weit verbreitet. Die Welt war undurchschaubar und voll dunkler Ecken, es half vielleicht, überallhin zu beten. So wurden alle Verrichtungen des Lebens mit Gottheiten bedacht, sicher ist sicher.
Der erste Schrei des Neugeborenen steht unter dem Schutz des Gottes Vaticanus, und seine artikulierte Sprache behüten die drei Helfer Fabulinus, Farinus und Locutius. In Essen und Trinken unterweisen den Knaben (neben seinen Ammen vermutlich) die Göttinnen Educa und Potina. Wenn das Kind zu laufen anfängt, ist das das Verdienst der Genien Abeona und Adeona. Ossipago festigt seine Knochen, Statanus streckt seine Glieder, und Carna fördert die Entwicklung seiner Muskeln, alles zur Zufriedenheit der Familie der Julier.
Neben diesen hilfreichen kleinen Göttern, die weiter nichts waren als personifizierte Begriffe, führt zudem noch der Genius, der Schutzgeist der Person, sein ganz besonderes Eigenleben. Man rechnet durchaus mit ihm. In Petronius’ „Gastmahl des Trimalchio“, dem genialen satirischen Roman der frühen Kaiserzeit, lässt der fette, reiche Raffke von Trimalchio einen Sklaven kreuzigen, weil er „den Genius seines Herrn gelästert habe“.
Der Genius des Kindes, um das es hier geht, erweist sich als recht zuverlässig.
Als Dreißigjähriger wird Caesar anlässlich der Totenfeier seiner Tante vor allem Volk erklären:
„Mütterlicherseits stammt mein Geschlecht von Königen ab, das väterliche ist mit den unsterblichen Göttern verwandt. Denn von Ancius Marcius stammen die Marcii Reges, deren Namen meine Mutter führte, von Venus die Julier, zu deren Geschlecht unsere Familie gehört ...“
So etwas macht Eindruck. In Wirklichkeit war es mit den Familien nicht so weit her. Die Julier, aus denen früher eine Reihe hoher Beamter hervorgegangen waren, spielten keine politische Rolle mehr. Die Aurelier, von denen Caesars Mutter abstammt, waren mittlerer plebejischer Adel.
Immerhin, man gehörte zur Nobilität.
2. Nobilitas
Ursprünglich, zu den Zeiten, als Rom noch kaum etwas Besseres als ein Kuhdorf war und andere Leute sich um die Weltherrschaft plagten, soll es da zwei Arten von Leuten gegeben haben: die Väter (oder Patrizier) und die Plebejer.
„Die Patrizier“, sagte Sallust, Historiker und Publizist der Caesarzeit, „behandelten die Plebs wie Sklaven, sie verfügten über ihr Leben und ihre Person nach der Weise von Königen, verjagten sie von ihrem Land, schoben alle anderen beiseite und regierten den Staat allein.“
Es war das alte Lied. Die Plebs zahlte die Steuern und ging zum Militärdienst, und wenn sie nach Haus kam, war ihr Bauernhof unterm Hammer. So riss ihr denn eines Tages der Geduldsfaden, und sie verließ das römische Gemeinwesen und besetzte den Heiligen Berg. Ihre Waffen nahm sie vorsorglich mit.
Die Patrizier sahen ziemlich schlecht aus ohne die Leute, die für sie die Arbeit machten, und mussten verhandeln. Die Plebs erkämpfte sich eine Reihe von Rechten und Privilegien, unter anderem die Versicherung, dass einer der beiden jeweils auf ein Jahr gewählten Staatsregenten, Konsuln genannt, ein Plebejer zu sein hatte. (Im Lauf der Zeit geriet das wieder in Vergessenheit.) Ein weiteres, ungeheuer bedeutendes Recht war die Einsetzung von Volkstribunen - eines der wichtigsten Charakteristika des römischen Gemeinwesens und bisher ohne Beispiel in der Geschichte. Von ihm wird noch zu berichten sein.
Zu der Zeit, als Caesar geboren wurde, war die alte Feindschaft zwischen Patriziern und Plebejern eine vergessene Sache. Am Prozess der gesellschaftlichen Bereicherung hatten beide Seiten teilgenommen, und inzwischen gab es plebejische Adelshäuser genauso gut wie patrizische. Die alte Kluft war gegenstandslos geworden, und den Namen Plebs führten jetzt die armen Bevölkerungsschichten der Stadt Rom, an denen ein plebejischer nobilis genauso hochmütig vorüberging wie ein patrizischer.
Die Nobilität war der Würdenträgeradel des römischen Reichs - was beileibe nicht mit einer Art von Beamtentum gleichzusetzen ist.
Diese großen Latifundisten, denen ihr Reichtum es erlaubte, in die (ehrenamtliche) Staatslaufbahn einzusteigen, in der Gewissheit, dass sie durch die Verwaltung einer Provinz früher oder später das Zehnfache ihres Aufwands zurückbekommen würden, diese traditionsbewussten Nachkömmlinge ehemaliger Konsuln, deren Sitz im Senat schon durch den Familiennamen garantiert war, diese Leute, die mit dem Hochmut von Weltbeherrschern auf alles Nichtrömische herabsahen, waren eher so etwas wie Fürsten, ihre Familien Dynastien, ihre Töchter Prinzessinnen, die in Ehen verkuppelt wurden, um Ansehen und Einfluss ihres Hauses zu festigen.
Die Hausmacht einer solchen Familie, das persönliche Ansehen ihres Oberhauptes, seine dignitas, bekamen die von Rom unterworfenen Völker oft zu spüren. In beispiellosem Egoismus und Hochmut sahen sich Statthalter und Feldherren nicht als Diener ihres Staates, sondern nutzten die ihnen verliehene Machtvollkommenheit zur Vermehrung ihres privaten Schatzes und ihrer Herrschaftlichkeit.
Solche Generale wie Lucullus oder Pompeius zählten zu ihrer clientela, zur Anhängerschaft ihrer Familie, italische Landstädte ebenso wie unterworfene Könige. Das Imperium, die uneingeschränkte Gewalt eines Statthalters über seine Provinz, erlaubte ihm eine Gerichtsbarkeit der Willkür und ein Auspressen der zu verwaltenden Gebiete.
Natürlich, es gab Unterschiede in der Nobilität. Das lag an den Traditionen innerhalb der Geschlechter und daran, ob eine Familie gerade „oben“ war oder nicht.
Aber hier, wo wir anhalten, im ersten Jahrhundert v. u. Z., waren diese nobiles insgesamt, durch die Verwandlung ihres Stadtstaates in ein Weltreich und die maßlose Machtfülle, die sich in ihren Händen ansammelte, durch Reichtum, Ehrsucht und Größenwahn, entartet, böse und korrupt. „Sie sind“, schreibt unser Gewährsmann Sallust, „auf ungeheuerliche Weise degeneriert. Ihr Reichtum dient ihnen zu wüstem Zeitvertreib, denn anders ist es nicht zu erklären, dass manche Privatleute aus reiner Laune Berge abtragen und Bauwerke im Meer errichten.“
Was diese Maßlosigkeit begünstigte, war das Fehlen eines echten sozialen Gegenspielers.
Die heftigen Kämpfe zwischen Großgrundbesitzern und Kleinbauern, die Jahrhunderte das politische Leben der römischen Republik bestimmt hatten, waren entschieden - zugunsten der Latifundisten. Die römischen Bauern waren dahin, aufgesogen vom riesigen stehenden Heer der Republik und von dem städtischen Lumpenproletariat, der neuen Plebs, einer Schar durch Hunger und Armut korrumpierter Nichtstuer, einer Masse, die Arbeit als Sklavensache verachtete, vegetierend von Kornspende zu Kornspende aus der öffentlichen Hand, zwischen Gladiatorenspielen und Bestechungsgeldern, mit denen die Herren ihre Stimmen kauften. Die schmale Mittelschicht der Handwerker und Pächter war ohne Bedeutung.
Andere indessen, Geldleute, verlangten nach politischem Einfluss. Man nannte sie „Ritter“.
3. Gaius Marius, der Onkel
Caesars Vater schafft es in der Ämterlaufbahn bis zur Prätur. Er verwaltet eine dubiose asiatische Provinz. Die Mutter Aurelia ist eine Dame mit gesundem Menschenverstand, die sich ihren Einfluss auf den Sohn lange bewahren wird. Im öffentlichen Leben spielt ihre Familie keine Rolle.
Aber eine glückliche Heiratsverbindung bringt den Namen der Julier wieder ins Spiel. Caesars Tante Julia ist verehelicht mit einem der bedeutendsten politischen Köpfe der Epoche, mit dem Mann, dessen rühmliches Vorbild Caesar später noch oft für diesen oder jenen Zweck wie einen Schild vor sich hertragen wird: Marius, der Konsul, der berühmte General, der Germanenbezwinger.
Humor hatte er nicht, der große Gaius Marius, wenn man seine Porträtbüste befragt. Dafür eine Menge anderer Eigenschaften, die man zweifellos braucht, wenn man von unten kommt und hoch hinauswill. Zum Beispiel Entschlusskraft und eine gehörige Portion Brutalität.
Sein Gesicht ist im Museo della Civiltà Romana zu studieren: zerklüftete Züge, sinnliche Lippen, eine Löwennase, viel Falten, die eher auf Gewaltsamkeit und Jähzorn hindeuten als auf Leiden der Seele. Darüber buckelt sich eine gewaltige Stirn.
Er kam vom Dorf und hatte weder Rang noch Namen, noch Bildung. Dafür um so mehr Unternehmungsgeist. Klug genug, trat er der clientela des hochmögenden Metellus bei, der ihn protegierte und den er später verriet, indem er ihn aus seinem Posten beim Militär verdrängte. In der Armee diente er sich nach oben, rücksichtslos gegen sich und andere. Um in Schlüsselpositionen zu gelangen, musste er in die Politik einsteigen. Der erste Schritt dazu war die Ehe mit einer patrizischen „Prinzessin“ aus dem Haus der Julier - so wird Caesar später sein Neffe.
Nun geht es aufwärts. Als Volkstribun setzt er einige Bestimmungen zugunsten des Lumpenproletariats durch, gewinnt damit Wählerstimmen für die nächste Stufe der Ämterlaufbahn. Den Rest besorgt das Geld der Julier. Marius wird zum Prätor gewählt, bald auch, aufgrund militärischer Tüchtigkeit, in einer für die Republik peinlichen Situation, zum Konsul. Er besiegt den rebellischen Numiderkönig Jugurtha, der die Weltmacht Rom durch die unerschöpflichen Ressourcen seiner Bestechungsgelder über ein Jahrzehnt an der Nase herumführte. Marius lässt sich nicht bestechen, deshalb siegt er. Der Senat lohnt es ihm, da die Armee hinter ihm steht, mit einem Triumph. Ob man ihn zum anschließenden Dinner einlud, bleibt fraglich.
Homines novi, neue Männer, nennt man damals in Rom Leute, denen es ohne die Zugehörigkeit zur oberen Gesellschaft, ohne alten Adel, aber mit neuem Geld gelang, im Staatsleben eine Rolle zu spielen, und man rümpft die Nase über solche Emporkömmlinge. Es ist zu vermuten, dass es Marius gleichgültig gewesen ist, wie sie von ihm dachten. Ihm kam es mehr auf die Ausübung von Macht an als auf ihre äußeren Formen. Sallust, der den Feldzug gegen Jugurtha beschreibt, lässt ihn sagen: „Ich glaube zwar, dass von Natur alle gleich sind, aber dass der Tapferste auch der Edelste ist.“
Das ist ein hübscher Zweckausspruch. Ganz sicher hielt Marius nicht alle für gleich von Natur aus. Aber die Töne, die hier angeschlagen werden, klingen durch eine lange Reihe von Jahren weiter. Solche und ähnliche, im Grunde antiaristokratische Sentenzen werden zum Renommierprogramm einer politischen Partei, die sich populares nennt und deren Haupt Marius bald sein wird.
Zunächst aber zieht er noch einmal in den Krieg, und diesmal sind Volk und Senat von Rom vor ernster Bedrohung zu bewahren: Die Germanen kommen.
Im Jahre 115 v. u. Z. hatten Sturmfluten in Jütland gewütet. Eine Reihe germanischer Völker hatte ihre Heimat verloren. Große Trecks mit Viehherden und hölzernen Karren, deren Räder aus geschlossenen Scheiben bestanden, zogen gen Süden - auf der Suche nach neuem Land. Andere Völker setzten sich zur Wehr oder wichen vor der Übermacht der wehrhaften Kimbern, das heißt, sie gingen ebenfalls auf Wanderschaft. Wie eine Lawine rollte die „Völkerwanderung“ nach Süden.
Keltische und germanische Gruppen schlossen Bündnisse miteinander, gegeneinander, die nördliche Welt geriet in Aufruhr, Teutonen und Kimbern erreichten die römischen Alpen, die Helvetier wurden von den Sueben nach Gallien abgedrängt. Näher und näher zum Kern des römischen Imperiums fluteten die Heimatlosen, Verzweifelten und Kampfgewohnten. Denn schon Gallien, aber erst recht die Schweiz und Norditalien galten als unbestrittener Kolonialbesitz der Weltmacht Rom.
Mit der ganzen Verachtung einer Hochkultur gegenüber „Primitiven“ und der ganzen Angst Besitzender vor Habenichtsen und Barbaren sieht man in Rom die Entwicklung im Norden. Man entschließt sich, Marius und seine Legionen marschieren zu lassen, und versieht den Feldherrn in der Periode der Abwehrkämpfe fünfmal hintereinander mit dem Konsulat, der höchsten Exekutivgewalt der Republik.
Marius, mit dem Scharfblick des Praktikers und dem Rigorismus des Soldaten, greift zu einschneidenden Veränderungen innerhalb der Armee, ehe er sich den um ihre Existenz kämpfenden Völkern des Nordens stellt. Er reformiert das Heer.
4. Das neue Heer
Anstelle der alten Bürgermiliz, die hauptsächlich aus freiwillig zu den Waffen eilenden Kleinbauern bestand, Leuten, die für ihre Equipierung selbst aufkommen mussten, nahm Marius nun Männer auf, die keinen Zensus besaßen - das heißt kein Vermögen. Damit war der Übergang zu einem stehenden Söldnerheer vollzogen. Die zahllosen Lumpenproletarier, die nun der Armee zuströmten, erhielten Sold und Ausrüstung, und sie verpflichteten sich für sechzehn Jahre, mit der Aussicht auf ein Stück Land zum Besiedeln danach, das heißt, wenn sie überlebten.
Auch die Gliederung innerhalb der Armee und die Bewaffnung vereinheitlichte der erfahrene General. Die Kampfkraft stieg, die Disziplin wurde eisern, der unbeholfene Bauernkampfkoloss erlangte Manövrierfähigkeit und Geschmeidigkeit durch tägliches Exerzieren. Die Führung zentralisierte Marius, indem er die unteren Offiziersstellen aus den Reihen der ihm ergebenen Legionäre rekrutierte. Auf diese Weise konnte er sich auf seine Leute verlassen, und die aristokratischen Jüngelchen, die die mittlere Leitungsebene bildeten, hatten nicht mehr viel Möglichkeit dreinzureden.
Das Heer, das aus dieser Reform hervorging, war ein ideales Machtinstrument in der Hand begabter Kommandeure. Die Soldaten waren keine Bauernjungen mehr, die den Krieg schnell beenden und nach Haus an ihren Pflug wollten. Die Soldaten des neuen Heeres brauchten einen General, der Erfolg hatte und ihnen in vielen Schlachten viel Beute garantierte. Dass er erfolgreich war, lag mit an ihnen. Diese auf „ihren Führer“ eingeschworenen, hartgesottenen Krieger fragten sechzehn Jahre lang nicht, gegen wen sie ihre kurzen Schwerter, ihre wuchtig-handlichen Wurfspieße erhoben. Sie fragten nur, für wen: für ihren Feldherrn, zu dessen clientela sie gehörten, für Gold und einen Bauernhof in Italien, wenn der Dienst vorbei war. Die Soldaten der Republik waren die Söldner eines Condottiere geworden.
Der Neffe des Marius wird später von dem profitieren, was sein Onkel da geschaffen hat, auf dem nämlichen Kriegsschauplatz, an den Nordgrenzen des Reichs.
Der Erfolg der Reform lässt nicht auf sich warten. In zwei großen Schlachten, 102 bei Aix-en-Provence, 101 bei Vercellae in Norditalien, besiegen Roms Soldaten die germanisch-keltischen Eindringlinge auf eine Weise, die man heute Völkermord nennen würde. Damit sie nicht in die Hände der Sieger fallen, so heißt es, zerschmetterten die stolzen Frauen in den Wagenburgen ihren Kindern den Schädel, bevor sie sich selbst das Schwert ins Herz stoßen. Es ist eine ungeheure Schlächterei. Marius, von seinen Soldaten enthusiastisch gefeiert, zieht triumphal in Rom ein.
Obwohl nun keine Gefahr für das Imperium mehr besteht, setzen Freunde - gegen die ungeschriebene Verfassung der Republik - seine sechste Wahl zum Konsul durch.
Es ist das Jahr der Geburt seines Neffen Gaius Julius.
5. Optimaten und Popularen
Marius verlor noch im selben Jahr sein Gesicht. Der latinische Bauernsohn, der tapfere Krieger, der kluge und energische General, der Volkstribun und Vertreter der Populären, verriet seine politischen Ziele - aber hatte er wirklich welche gehabt? Wie ließen sich denn die Prinzipien von Männern seiner Couleur formulieren? Was wollte die Popularenpartei?
Partei darf nicht im heutigen Wortsinn verstanden werden. Es gab kein Statut und kein Mitgliedsbuch, keine Grundsatzerklärung und kein bestätigtes Programm. Es gab allenfalls gemeinsame Interessen. Und die wechselten.
Die Nobilität besteht aus größeren oder kleineren Grundbesitzern. Aber Bargeld ist knapp, wenn man sein Land nicht verkaufen will und auf Naturalwirtschaft eingestellt ist. Und die Herren brauchen viel. Man muss die Würde seines Standes und die Familienehre nach außen wahren, den Massen durch Spiele und Schaustellungen schmeicheln, Wähler bestechen, Verbündete unterstützen. Der Geldsack Crassus soll gesagt haben, niemand könne reich genannt werden, der nicht in der Lage sei, aus eigenem Vermögen eine Armee zu unterhalten. Und er musste es wissen.
Ein Gesetz verbot es den Angehörigen des Senatorenstandes, Handel zu treiben und Geldgeschäfte vorzunehmen - ein Handicap, dem man durch Strohmänner zuvorzukommen bemüht war. So lagen denn Finanzoperation und Warenaustausch in Händen einer anderen, im Prinzip nicht weniger mächtigen Schicht: der equites, der römischen Ritter.
Um Ritter zu werden, musste man einen Zensus, das heißt ein Vermögen von vierhunderttausend Sesterzen, nachweisen. Es war also eine reine Geldfrage. Die equites beherrschten als Bankiers Handel und Industrie, als publicani, Steuerpächter, schlossen sie sich oft zu Gesellschaften zusammen und betrieben en gros die Ausplünderung der Provinzen.
Ob Ritter, ob Senator, keine der beiden Schichten war an einer generellen Neuverteilung des Besitzes interessiert, und wenn es um die entscheidenden Fragen ging, um die Niederschlagung von Sklavenaufständen und Revolten der freien Armen, um die Sicherung der Reichsgrenzen oder die Befriedung rebellischer Vasallen - dann waren sie sich einig.
Eine andere Sache war es, sich um den Anteil an der Beute, um den Anteil an der Macht zu raufen.
Der alte senatorische Amtsadel, konservativ, hochmütig und auf die Wahrung seiner Privilegien bedacht, durch Verwandtschaft und Interessen miteinander verfilzt, bildete den Kern der politischen Clique der Optimaten. Sie stützten sich auf die Macht des Senats.
Die ihnen entgegenstehende Gruppe der Populären, bestrebt, sich auf die Volksversammlung zu berufen, wurde zum Sammelpunkt der Finanzoligarchie und zum Instrument, die Aktionen der Geldleute durchzusetzen. Zu den Hauptstreitpunkten zwischen den beiden Parteien wurden immer die gleichen brisanten Fragen gemacht: das Problem der Umverteilung der Staatsmacht zugunsten der „neuen Leute“ und die Agrarfrage, als speziell gegen die adligen Latifundisten gerichtet.
Die Finanziers wirkten gern im Stillen. Sie schickten andere vor, ihre Sache öffentlich auszufechten. Verarmte junge Adlige wie die Gracchen, manche mit Idealismus, manche mit Karrierehunger, homines novi wie Marius wurden zum Sprachrohr ihrer Forderungen. Die Vorgänge des Jahres 100 legen davon beredtes Zeugnis ab.
In einem Staat, in dem es als verbrecherische Handlung gilt, sich einfach ans Volk zu wenden, bedarf es ausführlicher juristischer Begründung, wenn einer das doch durfte. Das ius agendi cum plebe, das Recht, mit dem Volk zu verhandeln und Volksversammlungen einzuberufen, war ausdrückliches Privileg jener Institution, die sich die Plebejer zu Beginn des römischen Geschichtszeitraums erkämpft hatten: des Tribunats.
Die Volkstribunen waren bestellt als Helfer der Plebs, ihre Tür hatte Tag und Nacht Schutzsuchenden offenzustehen, und sie verfügten über eine eigentümliche Macht. Zwar konnten sie nicht gebieten, dass etwas geschehe (und sind in diesem Sinne auch keine Magistrate), aber sie konnten gebieten, dass nichts geschehe. Ihr Veto („ich verbiete“) konnte außer den Beschlüssen des Zensors und des Diktators alle staatlichen Aktivitäten lahmlegen, Gesetze zu Fall bringen, alles zum Stillstand zwingen. Eine Art Bremse der Macht, eine Gegenherrschaft.
Im römischen Rechtsbewusstsein war die Existenz des Tribunats fest verankert. Noch Augustus lässt von sich sagen, dass seine Machtvollkommenheit eben darin besteht, dass er beide Gewalten in seiner Hand vereint: Imperium proconsulare und Tribunicia potestas.
Es lag auf der Hand, diese Leute in den Machtkampf der Parteien einzubeziehen, sie zum Sprachrohr der Popularenpolitik zu machen.
Die Vorgänge, um die es geht, sind verwickelt genug, und der Kampf ist vehement. Man ist nicht wählerisch in seinen Mitteln, der Bürger nimmt voller Erregung teil, denn es geht diesmal um seine eigenen Belange.
Saturninus und Glaucia, zwei Parteigänger der Populären, brachten spektakuläre Gesetzentwürfe ein. Im Interesse der städtischen Plebs sollte der Getreidepreis entscheidend gesenkt werden - das war das eine. Das zweite bezog sich auf die Landverteilung. Jeder Veteran des Marius, so brachten sie in Vorschlag, sollte hundert Joch Land in Afrika oder in den von den Kimbern zurückeroberten Gebieten (dass die eigentlich den Galliern gehörten, störte niemand) erhalten, und zwar unentgeltlich.
Beide Gesetzentwürfe mussten die großen Latifundisten bis ins Herz treffen.
Es wurde auf beiden Seiten um Lebensinteressen gekämpft, und mit allen Mitteln. Zur Wahlversammlung zog die Plebs mit Knüppeln bewaffnet, um dort auf die Schlägerbanden der senatorischen Clique zu treffen, es gab Straßenschlachten, Blut floss, Vertreter beider Parteien blieben tot liegen. Die Soldaten des Marius sprachen schließlich das entscheidende Wort. Die Anwesenheit ihrer Waffen hatte die Überzeugungskraft, die Gesetze zu verabschieden. Damit allerdings war noch gar nichts entschieden. Nun ging es um die Durchführung. Saturninus wurde wieder Volkstribun, Glaucia wollte, um den Vorlagen mit dem nötigen Nachdruck Leben zu verleihen, Konsul werden.
Die Unruhen dauerten an, Brand, Totschlag, Bandenkämpfe durchtobten die Stadt. Der Senat hielt seine Stunde für gekommen. Man erklärte das Vaterland für gefährdet. Mit dieser Notstandsformel wurde alle Macht zur Niederschlagung der Unruhen in die Hand des Konsuls Marius gelegt.
Der große General belagerte seine beiden Freunde Saturninus und Glaucia, ließ sie gefangen nehmen und sah zu, wie man sie erschlug. Es heißt, er habe sich dann von dieser Tat ausdrücklich distanziert.
Was war geschehen? Eigentlich überhaupt nichts. Aber die Landverteilung in den Provinzen an die Veteranen der Kriege hätte auch die Interessen des Ritterstandes, der Steuerpächter und Finanzleute, empfindlich verletzt. Saturninus und Glaucia waren zu weit vorgeprellt, darin waren sich Senat und Opposition einig. Der brave Wachhund Marius wurde ausgeschickt, sie totzubeißen und die Volksbewegung damit für längere Zeit abzuwürgen.
Übrigens werden einem dergleichen Dienste meist sehr schlecht gedankt. Als die Dreckarbeit getan war, konnten Optimaten wie Popularen den gehorsamen Mann mit den blutigen Händen gleichermaßen ungestraft verachten.
Marius musste für eine Zeit ins Ausland gehen.
6. Schule für Demagogen
Die Geschehnisse, die die ersten fünfzehn Lebensjahre Caesars begleiten, sind an Brutalität kaum zu übertreffen. Der Burgfriede zwischen Ritterstand und Senatspartei war nicht von langer Dauer. Außenpolitische Komplikationen kommen dazu und werden von den Vertretern der herrschenden gangs rücksichtslos für ihre Zwecke ausgebeutet.
Da gibt es den „Bundesgenossenkrieg“, die Kämpfe der italischen Stämme um ihre Gleichberechtigung gegenüber Rom - denn sie werden mehr oder weniger wie Kolonien behandelt, und da lehnt sich der pontische König Mithridates gegen die römische Oberhoheit im Osten auf und wird von den Staaten des einstigen pergamenischen Reichs als Befreier begrüßt.
Die Optimaten nominieren für das Kommando gegen Mithridates den Patrizier Lucius Cornelius Sulla, ehemaligen Unterbefehlshaber des Marius, entschiedenen Anhänger der Senatspartei und darüber hinaus aus Gründen persönlichen Ehrgeizes Todfeind des großen Generals. Mit dem Sieg über den König von Pontus wird er zum furchtbaren Gegenspieler der Populären.
Innerhalb der nächsten fünfzehn Jahre gewinnen die beiden Parteien einander mehrfach die Oberhand ab - mit nackter Gewalt. Rom wird belagert, gebrandschatzt, geplündert - nicht von äußeren Feinden, sondern von Römern, und die Partei, die gerade nicht an der Macht ist, gilt eben als die aufrührerische.
Nach einem Machtwechsel herrscht blutiger Terror, man schlachtet die führenden Persönlichkeiten der Gegenpartei reihenweise und mit System ab, zieht ihre Güter ein und verteilt sie unter die eigenen Anhänger. Sulla, nach seinem endgültigen Sieg, lässt Tausende niedermetzeln und erklärt dem zitternden, von den hereindringenden Schreien in Panik versetzten Senat zynisch, man bestrafe nur einige Verbrecher. Aber auch die Marianer wüten im Jahr 87 eine Woche lang wie die Bestien in der Stadt. Der verbitterte und alt gewordene General selbst tut sich durch besondere Grausamkeit hervor. Mit seinem Tod im folgenden Jahr verlieren die Popularen einen, aber nicht den Führer. Es ist genug ehrgeiziger Nachwuchs da - mehrere Jahre lang macht sich Cinna selbst zum Konsul und kann dank geschickten ökonomischen Manöverns mit der Unterstützung der Plebs rechnen. Die Tochter dieses Cinna wird Caesar später heiraten.
Das Haus der Julier inmitten der Gärten an der vornehmen Heiligen Straße wird von diesem Geschehen sicher nicht unberührt geblieben sein, zumal es ja enge verwandtschaftliche Verbindungen zur Popularenpartei gab.
Zweifellos werden sich einem wach beobachtenden jungen Menschen die Ereignisse dargestellt haben als eine Folge von erbarmungslosen Kämpfen um die Macht, in der jener gewinnt, der ohne Skrupel, stark, schnell und geschickt ist und der es versteht, Ideale zynisch als Mittel einzusetzen. Hohe Schule für Demagogen.
7. Familienpläne
Gemäß den Traditionen patrizischer Adelsfamilien wird dem Kind eine sorgfältige Erziehung zuteil. Es lernt außer seiner Muttersprache Latein auch in Wort und Schrift das Griechische, die Diktion der vornehmen Welt, und spricht es, wie alle seine berühmten Zeitgenossen, mit großer Geläufigkeit und Eleganz. Rhetorik ist Hauptfach für einen jungen Menschen seiner Herkunft. Man trainiert für die politische Karriere. Dann natürlich die Literatur. In seiner Jugend dilletiert Caesar in Versen, auch eine Tragödie ist dabei, wie sich’s gehört. Vielleicht können wir Gott danken, dass beides verloren ging. Die prägnante und sachliche Prosa, die er später zu schreiben versteht, ist ein Genuss zu lesen - falls er sie wirklich selbst verfasst hat und nicht einer seiner Sklavensekretäre.
Von einem ungebildeten Menschen sagte man damals in Rom: Er kann weder lesen noch schwimmen. Zeichen dafür, welchen Wert man auch auf sportliche Tätigkeit legt. Caesar hat später, wenn man den Anekdoten Glauben schenken kann, flüchtend das Meer durchschwommen und dabei mit einer Hand die Schriftrolle mit den eigenen Prosawerken über Wasser gehalten. Auch sonst soll er beachtliche körperliche Zähigkeit an den Tag gelegt haben. Wenn auch der Magen von Zeit zu Zeit streikt, wenn ihn auch die Malaria, die er sich bei der Flucht durch die Pontinischen Sümpfe geholt hat, manchmal umwirft, er hält stand - auch bei den sorgfältig geheim gehaltenen Anfällen der „heiligen Krankheit“, die ihn in den Augen der Umwelt mit einer Gloriole des Unheimlichen umgeben, der Epilepsie.
Die Meinungen, was aus dem Kind einmal werden solle, scheinen in der Familie unterschiedlich gewesen zu sein. Die Verlobung mit Cossutia war schon im Kindesalter geschlossen worden. Sie deutet auf bescheidenere Ziele hin, denn die Braut war zwar reich, aber gehörte nur dem Ritterstande an. Der junge Mann hatte dann auch nach Erreichen der Großjährigkeit nichts Eiligeres zu tun, als sich zu entloben und statt dessen Cornelia zu ehelichen, und sie war immerhin die Tochter jenes Cinna, der einige Jahre lang als Chef der Popularenpartei in Rom den Meister gespielt hatte.
Mit sechzehn verliert er den Vater. Aber noch davor hat sein Onkel Marius dem Knaben ein Staatsamt verschafft: Gegen zwei einflussreiche Bewerber wird Gaius Julius Caesar dank Familiengunst und Bestechung zum Flamen Dialis, zum Obersten Priester des Jupiter, gewählt.
Für einen Nachkömmling der Venus kein unangemessener Posten. Das Amt hat wenig Macht, aber hohes Ansehen, und man wird bekannt, vor allem beim Volk. Eine Reihe verschroben anmutender Beschränkungen und Verbote müssen allerdings in Kauf genommen werden. So darf der Flamen Dialis nicht reiten, nicht schwören und nicht mit unbedecktem Kopf ausgehen, die Berührung von rohem Fleisch, Ziegen, Efeu und Bohnen ist ihm untersagt. Das Amt ist so alt, dass niemand mehr weiß, woher diese Einschränkungen kommen, noch, welchen Sinn sie haben.
8. Staatsreligion
Der Charakter der römischen Religion drückt sich unter anderem darin aus, dass die Priester Staatsfunktionäre sind. Der offizielle Kult reduziert sich mehr oder weniger auf den Vollzug bestimmter exakt festgelegter Riten, die das gesellschaftliche Leben begleiten und die politischen Aktionen sanktionieren.
Eine Reihe von Priesterkollegien mit strengen Zuständigkeitsbereichen regelt, wie in der Staats- und Stadtverwaltung, den Verkehr mit dem Göttlichen.
Die Pontifices zum Beispiel führten den Kalender, legten die Feiertage fest, kannten die „günstigen und ungünstigen“ Tage, kannten sich in Maßen und Gewichten aus und hielten die Erinnerung an historische Ereignisse fest. Ihr Name (wörtlich „Brückenbauer“) deutet darauf hin, dass sie ursprünglich irgendetwas mit dem Tiberstrom zu tun hatten. Ihr Chef, der Pontifex maximus, hatte die Oberaufsicht über alle religiösen Vorgänge in der Stadt.
Die Fetialen waren eine Art sakraler Gesandter im Verkehr der Römer mit ihren Nachbarn. Sie waren für Kriegserklärungen und Friedensschlüsse, Abfassung und Einhaltung von Verträgen nebst den dazugehörigen tradierten Bräuchen verantwortlich.
Hohen Einfluss hatte das Kollegium der Wahrsager, der Auguren, die die Magistrate der Republik über günstige und ungünstige Vorzeichen zu informieren hatten. Deutung von Vogelflug, das Verhalten der „heiligen Hühner“ und Eingeweideschau waren ihre Domäne. Da die Einholung von Vorzeichen nicht nur zum guten Ton gehörte, sondern Pflicht, und die gesamte Antike abergläubischer als eine Rotte alter Hofschauspieler war, lag es auf der Hand, dass ihre Kunst zum Gegenstand politischer Manipulation wurde. Das „Lächeln der Auguren“, das heißt jenes wissende Grinsen und Augenzukneifen, mit dem sich zwei Mitglieder dieses Standes begegneten, war schon damals sprichwörtlich. Aber selbst ein Freigeist und Skeptiker wie Caesar konnte sich dem Vollzug dieser Handlungen nicht entziehen, obwohl er oft genug durchblicken ließ, was er davon hielt. Die Macht der Tradition war allgewaltig.
Die Priesterinnen der Vesta waren sechs an der Zahl. Sie entstammten den ersten Familien und mussten für die dreißig Jahre ihrer Amtszeit das Gelübde der Keuschheit und Ehelosigkeit ablegen. Ihnen oblag es, das ewig brennende Feuer ihrer Göttin zu behüten. Das harte Amt verbürgte großes Ansehen und hohe Ehre auch für die Familie, der das Mädchen entstammte. Die Vorsteherin der Damen, die Virgo Maxima, hatte beispielsweise das Recht, Verbrecher zu begnadigen. Dass die keuschen Vesta-Nonnen im Amphitheater von ihren Ehrenplätzen aus mit blutgieriger Wonne Gladiatorenspielen zusahen und erbarmungslos ihre Daumen nach unten hielten, wenn es galt, Leben oder Tod eines Fechters zu entscheiden, steht auf einem anderen Blatt. Diese Schizophrenie durchzieht viele Schichten der Sklavenhaltergesellschaft.
Die Flamines waren die Priester der einzelnen Götter. Drei davon, darunter eben auch der Flamen Dialis, standen in besonders hohem Ansehen.
Etwas außerhalb der priesterlichen Magistratur, vielleicht alten Feldbaukulten und Schamanentum entspringend, standen archaische Bruderschaften, wie die der Salier. Diese Priestertänzer des Kriegsgottes Mars, die kleine runde Schilde trugen, vollführten wildentrückte Tänze, die in krassem Widerspruch zu der feierlichen Steifheit des offiziösen Staatskultes standen. Ihre Liedertexte, aus grauer Vorzeit überliefert, verstand bereits im Jahr von Caesars Geburt in Rom keiner mehr.
Insgesamt zählten priesterliche Würden eher zu den Vorbereitungsämtern auf eine Karriere, als dass sie zur Frömmigkeit führten. Marius wusste das und muss mit seinem Neffen Großes geplant haben.
9. Kraftprobe mit Sulla
Lucius Cornelius Sulla hatte es nach seinem Sieg über die Marianer für klug gehalten, seine Gewalt vom Senat legalisieren zu lassen. Man tat ihm natürlich den Gefallen; die Köpfe der Oberen saßen alle nicht sehr fest. Sulla wurde zum Diktator auf unbestimmte Zeit und mit unbeschränkten Vollmachten ernannt. Rom hatte seinen Herrn.
Im Grunde genommen, ist er ein König. Er stützt sich auf sein Heer, das er auf Kosten der italischen Städte mit Landbesitz auf der Halbinsel ausstattet, sodass er es schnell wieder unter Waffen rufen kann, und auf die zehntausend Cornelier, die frei gelassenen und mit dem Bürgerrecht ausgestatteten Sklaven jener Bürger, die er hatte umbringen lassen. Der Terror ist vollkommen. Die Proskriptionen, „schwarze“ Listen über verdächtige Personen, verzeichnen Tausende von Namen. Jeder kann jeden anzeigen, jeder darf einen Angezeigten töten. Persönliche Rachsucht, Spitzeltum und Karrierismus feiern Triumphe. Sullas nächste Umgebung bereichert sich aufs Ungeheuerlichste aus dem Vermögen der Proskribierten. Dem Historiker Appian zufolge sollen neunzig Senatoren und zweitausendsechshundert Ritter in dieser Zeit ermordet worden sein.
Aber erstaunlicherweise überstehen die Mitglieder der herrschenden Familien diese Zeit relativ unbeschadet. Die familiären Verästelungen sind so vielfältig, der Einfluss so groß, dass sich immer jemand findet, der Gefährdeten rechtzeitig eine Warnung zustellt. Diese kommt oft auch aus Sullas engstem Kreis und erfolgt möglicherweise mit seiner Duldung. Die Großen können rechtzeitig fliehen oder sich verstecken und zumindest einen Teil ihres Vermögens ins Ausland bringen. Alles bleibt beim Alten. Und die zähe und engstirnige Kaste patrizischer Senatoren, die nichts vergessen und nichts gelernt hat, die Optimaten, ist mit Sulla wieder einmal obenauf.
Der Diktator ist nicht Nur-Soldat und politischer Strohmann wie Marius. Er ist kalt, klug, voll menschenverachtendem Zynismus, raffgierig und grausam. Seine Schreckenstaten begleitet er mit eisiger Ironie, die den Unterlegenen ihre Niederlage noch spürbarer macht.
Der junge Gaius Julius kollidiert mit ihm wahrscheinlich im Jahr 81. Dem Diktator ist die Verbindung mit der Cinna-Tochter Cornelia ein Dorn im Auge. Er nimmt also Caesars Ehe zum Anlass, auszuprobieren, was er von dem Neffen des Marius zu erwarten hat, und verlangt die Trennung dieser Ehe.
Es muss ihn ziemlich überrascht haben, dass der junge Mann sich weigerte. Dergleichen war er nicht gewohnt.
Es beginnt ein Katz-und-Maus-Spiel. Sulla geht schrittweise vor, um seinen Kontrahenten abzutasten. Der furchtlose und für seine Jahre erstaunlich selbstbewusste Jüngling pariert Schlag um Schlag. Zuerst wird ihm die Priesterwürde aberkannt. Er bleibt bei seiner Weigerung. Dann konfisziert Sulla die Mitgift der Ehefrau Cornelia. Caesar zuckt mit den Achseln. Der Diktator zieht die Stammeserbschaften der Julier ein. Caesar bleibt standhaft. Der stutzerhaft gekleidete junge nobilis, der Fransen an den Ärmeln trägt und seine Gürtel leger bindet, nach Parfüm duftet und die neuesten Frisuren zur Schau trägt, wagt es, dem Basilisken ins Auge zu sehen, ohne zu erstarren. Es ist erstaunlich, aber nun reißt Sullas Geduld. Gaius Julius wird zum Anhänger der Gegenpartei und zum Staatsfeind erklärt - was einem Todesurteil gleichkommt.
Aber natürlich findet sich der rechtzeitige Warner, und der Proskribierte kann bei Nacht und Nebel entweichen, eingehüllt in den Rock eines Sklaven, durch die Gartenpforte, weg aus Rom. Frau und Kind bleiben zurück und werden nicht behelligt.
Da auf seinen Kopf ein Preis ausgesetzt ist, geht es ihm wirklich schlecht, denn man verfolgt ihn. Er flieht ins Sabinerland, holt sich in den Pontinischen Sümpfen die Malaria, schleppt sich krank jede Nacht in ein anderes Quartier, fällt einmal in die Hände eines sullanischen Suchtrupps, kann aber dessen Anführer bestechen und entkommt aufs Neue. Der erboste Diktator lässt vergeblich weiter nach dem „schlecht gegürteten Knaben“ fahnden.
Es ist ein riskantes Spiel, in das der junge Mann sich eingelassen hat. Familienstolz, Trotz, das Bestreben, sich und andere zu testen, vielleicht auch echte Neigung zu der schönen und tapferen Cornelia und seiner kleinen Tochter haben ihn in eine Sackgasse getrieben, aus der er sich ohne fremde Hilfe nicht befreien kann. Aber diese Hilfe kommt.
Zwei vestalische Jungfrauen und zwei alte Senatoren von hoher Integrität, mit den Juliern, wie sollte es anders sein, verwandt und verschwägert, machen sich auf zu einem Bittgang. Sie erflehen von Sulla die Begnadigung des adligen Jünglings, dessen Haltung doch nur von treuer Gattenliebe und Römerstolz zeuge, nicht aber von Feindschaft gegen den Diktator. Ausschlaggebend ist, dass auch Sullas Frau sich dieser Meinung anschließt. Sie ist eine Metellerin, und die Metelli sind Kern und Herzstück der sullanischen Herrschaft, die Gens, auf die sich die Macht des Mächtigen bei den Mächtigen stützt. Der Herrscher Roms gibt nach und begnadigt den jungen Tollkühnen - nicht ohne grollend darauf hinzuweisen, dass nach seiner Meinung in diesem Burschen mehr als ein Marius stecke.
Caesar kehrt nach Rom zurück, aber die Situation ist auf der Kippe. Der Diktator ist nachtragend wie ein Elefant, der das Wappentier seiner Helferfamilie, der Meteller, ist, und die Freunde der Julier raten davon ab, das Schicksal herauszufordern. Das Beste wäre ein Tapetenwechsel, bis sich die politische Lage so oder so entschieden habe, meinen sie. Caesar reist ab nach Asien, er will sich erste Erfahrungen in der Kriegskunst und der Diplomatie aneignen. Der Prätor Marcus Thermus, der dort das Kommando hat, ist ein Freund von Caesars Vater gewesen. Der junge Mann kann einer Vorzugsstellung sicher sein.
10. Krieg im Osten
„Wie viel Rom auch von dem tributpflichtigen Asia genommen hat, dreimal mehr wird Asia von Rom zurücknehmen, und für seinen abenteuerlichen Frevel gegen Asia wird es büßen müssen. Wie viele auch aus Asia in den Häusern der Italiker gedient haben, zwanzigmal mehr Italiker werden in Asia im Elend dienen ...“ So die Prophezeiungen der Sibyllinischen Bücher. Das sind unausrottbare Träume stolzer Völker, deren Kultur und Wohlstand blühten zu einer Zeit, als Rom noch ein Dorf mit Lehmmauern war, und die nun zu Provinzen der Weltstadt herabgewürdigt, von Kontributionen erschöpft, von Heimsuchungen aller Art durch die Sieger gepeinigt waren.
In Wahrheit hört der Widerstand im Osten nie auf. Der energische und intelligente König Mithridates, listig, skrupellos und hochmütig, schließt mehrfach Bündnisse mit den Nachbarstaaten und lehnt sich gegen die römische Vorherrschaft auf. Er wird überall, selbst in den Griechenstädten, als Befreier vom Joch der Fremdherrschaft begrüßt.
Einen Krieg nach dem anderen zwingt er seinem Erzfeind auf, Feldherr auf Feldherr Roms versucht sich an Mithridates, wirft ihn nieder, schließt einen Zwangsfrieden, brandschatzt, mordet, plündert. Der Widerstand erwacht stets aufs Neue in den geschundenen und verzweifelten Völkern.
Erst Pompeius gelingt es dann, Mithridates völlig zu vernichten. Es gibt Frieden im Osten, die Stille eines Kirchhofs.
Aber zwischen den großen Kriegen sind da ständig kleine Plänkeleien, Bandenkriege um Küstenfestungen, Seeräubereien, aufmuckende Städte. Also, niemals Ruhe. -
Es geht Marcus Thermus bei seinen Unternehmungen um die Stadt Mytilene - eine bescheidene Angelegenheit, alles in allem. Mytilene hat sich empört, Mithridates hat der stark befestigten Stadt Hilfe auf dem Seewege zugesagt, aber er kommt nicht. Andererseits erwartet Thermus eine Flotte des mit den Römern verbündeten Königs von Bithynien, Nikomedes, um Mithridates auf dem Wasser entgegentreten zu können. Aber auch die bithynische Seemacht lässt auf sich warten. Es ist ein Krieg, der viel Geduld verlangt. Schließlich beauftragt der Prätor den jungen Sohn seines Freundes mit einer diplomatischen Mission. Er wird zu Nikomedes geschickt, um den Säumigen zu mahnen. Für Gaius Julius sicher eine willkommene Abwechslung im Einerlei des Feldlagers und der hellenistischen Provinzatmosphäre.
Die Reise war erfolgreich, und nicht nur im Hinblick auf die Schiffe. Wenn man den bösen Zungen glauben will, wurde es auch ein großer persönlicher Erfolg für den jungen Mann. Es heißt, dass der Souverän an ihm außergewöhnlichen Gefallen gefunden habe, und einige römische Kaufleute, die an einem Empfang beim König teilgenommen hatten, wussten nichts Besseres, als den Skandal gleich daheim herumzutratschen: Gaius Julius, stolzer Abkömmling alten quiritischen Adels, hat dem barbarischen Herrscher im Purpurgewand als Mundschenk aufgewartet.
Dem sei, wie es wolle - auf alle Fälle war damit der Grundstein gelegt zu einem unendlich wuchernden Gebäude von Klatsch und Tratsch, das Caesar bis an sein Lebensende begleiten sollte. Seine Gegner nannten ihn „die Königin von Bithynien“, der Witzbold Cicero ließ sich keine Gelegenheit entgehen, um eine entsprechende Anspielung an den Mann zu bringen. (Er wusste dann brieflich sogar die Geschichte dahingehend auszuschmücken, Caesar sei in bräutlichem Purpurgewande unter Gesang in das Schlafgemach des bithynischen Herrschers geführt worden.) Caesars Soldaten, die eher deutlich als fein waren, sangen später einen Marschschlager mit dem Wortlaut: „Dem Caesar unterlagen die Gallier, dem Nikomedes unterlag Caesar./Seht, Caesar triumphiert, dem die Gallier unterlagen !/Nikomedes triumphiert nicht, dem der Caesar unterlag.“
Im Ganzen gesehen, war es denn doch eher erheiternd als ehrenrührig. Es ist durchaus wahrscheinlich, dass der junge Römer dem sympathischen Monarchen seine Gastfreundschaft durch einige Gunstbezeugungen gedankt hat. Nach Erfüllung seiner diplomatischen Mission ließ er es sich nicht nehmen, noch einmal eine Reise nach Bithynien durchzuführen - angeblich waren Schulden einzutreiben.
Immerhin gibt es aus der Zeit des Aufenthalts im hellenistischen Orient nicht nur Bettgeschichten zu berichten, sondern auch Heldentaten. Beim endlichen Sturm auf Mytilene erkämpft sich der junge Mann eine hohe militärische Auszeichnung, die Bürgerkrone. Es ist nicht feststellbar, wie viel davon aufs Konto der Protektion durch Marcus Thermus kommt, aber immerhin, Gaius Julius ist ehrgeizig, zäh, sportlich und fürchtet sich nicht.
Danach bekommt er ein anderes Kommando: Piratenjagd an der kilikischen Küste unter Servilius Isauricus. Auch nicht gerade geschaffen, Weltruhm zu erlangen. Inmitten dieser Ödnis kommt die Kunde von Sullas Tod aus Rom. Hals über Kopf eilt Caesar nach Hause.
In Rom hingegen ist die Situation bei Weitem nicht so stark verändert, wie er sich das erhofft haben mag. Sulla, „noch im Tode schrecklich“, hängt wie ein finsterer Schatten über dem politischen Leben der Stadt. Durch seine Maßnahmen ist die Oligarchie dauerhaft stabilisiert worden, und die Popularen sind eine Truppe, der es sowohl an Geschlossenheit als auch an Mut mangelt. Man hat gelernt, den Mund zu halten.
Auch Caesar scheint es gescheiter, sich nicht zu stark zu engagieren und lieber das Leben zu genießen, solange man dazu Zeit hat. Er beschäftigt sich mit Literatur, diskutiert mit Freunden, macht kostspieligen Damen den Hof. Zu diesen Zwecken strapaziert er den Kredit der Julier und bringt es fertig, in kurzer Zeit ziemlich hohe Schulden zu machen - was ihm auch später immer wieder gelingt.
Im Bestreben, sich nicht zu stark festzulegen, aber auch nicht in Vergessenheit zu geraten, dilettiert er als Prozessredner. Es heißt, er habe starke und ursprüngliche Anlagen zum brillanten Rhetor besessen, warum auch nicht, er war ja intelligent und wendig. Ob er allerdings, wie die Schmeichler behaupten, nur von Cicero übertroffen wurde, sei dahingestellt.
Caesar vertritt in einem Prozess gegen Cornelius Dolabella die Anklage. Dieser Dolabella, ein Sullaner, ist der Erpressung und Räuberei während seiner Statthalterschaft in Makedonien angeklagt, und viele Städte Griechenlands sagen gegen ihn aus.