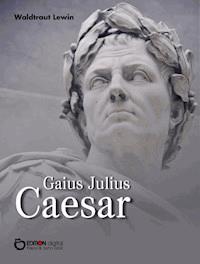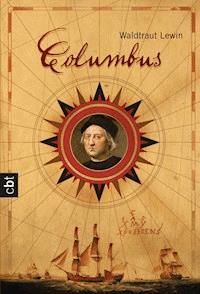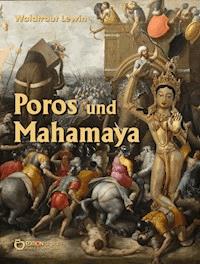8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Elf Erzählungen der bekannten Autorin, die entstanden sind während eines Jahrzehnts — Künstlergeschichten, Liebesgeschichten, Geschichten im Spannungsfeld von Realität und märchenhafter Fantastik. Erzählt wird von der skrupellosen jungen Sängerin, die dennoch ihr Publikum bezaubert, von Kurek, dessen Motorrad plötzlich fliegen kann, und von der Chilenin Teresa, deren Lieder verstummt sind. Eine Braut schmückt sich zur zweiten Hochzeit mit demselben Mann und gewinnt dabei zum ersten Mal Klarheit über ihren Partner. Die junge Straßenkomödiantin Olga sucht in den Wirren brasilianischer Gegenwart nach einem festen Halt. Der ungebärdige Lyriker Jonas Alexander Dort wehrt sich gegen den Vorwurf, seine Freundin geohrfeigt und misshandelt zu haben. Mutter und Tochter finden auf der Insel der Kuckucksrufe wieder zueinander … Elf Erzählungen voller Poesie und Fabulierkraft, die mit glücklichem Zugriff Zeitgeschichte lebendig machen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 310
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Impressum
Waldtraut Lewin
Kuckucksrufe und Ohrfeigen
Erzählungen
ISBN 978-3-95655-801-6 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien erstmals 1983 im Verlag Neues Leben Berlin.
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta Foto: Andrea Grosz
© 2017 EDITION digital® Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.edition-digital.de
Dich hat Amor gewiss …
„Der Professor bittet um eine kurze Geduld“, sagt die dürre Dame mit dem lackschwarzen Pagenkopf und lächelt.
Eine kurze Geduld — wer redet denn so?
Die Dünne geht vor mir her, wobei sie die Knie bei jedem Schritt nach außen dreht und den Fuß mit der Spitze zuerst aufsetzt. Ihre Beine sind lang, hager, mit knotigen Waden. Oben begrenzt von einem schwarzen kurzen Rock, unten von hochhackigen schwarzen Schuhen. Drahtige Beine zwischen Schwarz und Schwarz und ein entschlossener Gang.
An einer Ecke des Gangs dreht sie sich zu mir um, bemerkt meinen Blick und erläutert: „Bevor ich die Sekretärin vom Professor wurde, war ich Tänzerin. Ich heiße übrigens Ziegler.“ Ihr Gesicht ist flaumig von Puder.
Ich erröte — darüber, dass sie mich ertappt hat und auch, weil ich viel zu wenig innere Freiheit habe, ihre Vorstellung jetzt zu erwidern. Außerdem kennt sie mich ja. Weshalb bin ich sonst hier?
Dame in Schwarz — „Ziegler“ — geht mir weiter voran durch dieses Haus. Wir verlassen eine helle Oase, die durch Anschläge und bunte Papiere, große Tafeln an den Wänden und Bretter voll Zeitungsausschnitte harmlos wirkt. Hier könnte man noch vermuten, man sei in irgendeinem Gebäude.
Wir gehen eine kleine steinerne Treppe hinunter und durch zwei Eisentüren. Immer um die Ecke. Man bedarf der Führung. Es ist ziemlich dunkel. Links leuchtet eine Glasscheibe mit einer Aufschrift, magisch erhellt. In einer Nische liegt ein Kamel mit Glasaugen und rosigen Nüstern, daneben lehnen Hellebarden. An der nächsten Ecke taucht ein großes gelbes Schild auf: „Berlin 122 km“. Die Spitze zeigt nach oben, an den Plafond.
Auf einmal kommt ein Riese in einem weißen Bettlaken, mit Sandalen und einem Lederstirnband auf uns zu, der ständig mit hoher Stimme „brrr“ sagt und dabei, dass R rollen lässt. Als er uns erblickt, grüßt er dröhnend. Ziegler dankt und schreitet unbeirrt, und wie ein Schatten schlüpfe ich in ihrem Kielwasser an dem faltigen Ungetüm vorbei.
Wieder Treppen. Halb verborgen hinter einem mannshohen Pfau mit gewaltigem Radschweif lehnt ein blasses Mädchen in Jeans an der gekalkten Wand. Sie hält die Augen geschlossen. Ihre gespreizten Finger suchen unruhig über den Putz.
Von Weitem überflutet mich eine quellende Woge Musik. Die nächste eiserne Schleuse, und nichts ist mehr zu hören.
Meine schwarze Führerin öffnet eine unscheinbare Tür. Tageslicht blendet mich so überraschend, dass ich blinzle. Doch dann zeigt sich, dass es hier nicht so hell ist, wie mir schien, sondern nur ein schmales klägliches Nordfenster für Licht sorgt. Schwaden von Zigarettenrauch stehen in dem kleinen Raum von verschlissenem Bordeauxrot, der seit mindestens zwanzig Jahren nicht renoviert wurde. Um einen Tisch mit überquellenden Aschenbechern sitzen Leute und reden.
Meine Führerin lässt sich mit mir abseits auf einem Bänkchen nieder. Kein Mensch beachtet uns. Rechts von mir tropft Wasser in einen jener abgeplatzten Emailleausgüsse, wie man sie sonst in den alten Küchen der Hinterhäuser aus der Gründerzeit findet. Es tropft in einen großen Buschen gelber Rosen.
„Sie ist unschuldig“, sagt ein schlecht gekämmtes Mädchen mit unreiner Haut und zu großer Nase. („Die Musikdramaturgin“, flüstert mir meine schwarze Tänzerin zu.) „Hört doch auf die Musik. Es gibt Frauen, an deren schimmernden Armen Begriffe wie Gut und Böse abgleiten wie Wasser. Sie ist immer rein, denn was sie tut, tut sie nicht in der Absicht, Böses zu tun. Sie weiß nicht, was das ist …“ Hier zieht sie leidenschaftlich an ihrer Zigarette, verschluckt sich am Rauch und winkt ab.
„Und ich sage euch, sie ist nichts weiter als ein kleines durchtriebenes Aas, wegen der wir nicht die Werte der Welt auf den Kopf stellen müssen. Solche Weiber kenn ich“, sagt ein brünetter schwammiger Mann mit großen Tränensäcken unter den Augen (der lyrische Bariton!). „Wo kommen wir denn hin, wenn solch ein Biest noch gerechtfertigt wird ...“
„Du verurteilst sie einfach“, unterbricht ihn ein Mensch mit Bartkoteletten und Seidenhemd, der vor Hektik unregelmäßige rote Flecke im Gesicht hat, und ringt die Hände. „Machst du es dir nicht zu leicht? Bedenke doch, woher sie kommt und was sie erlebt hat ...“ (der zweite Regisseur).
„Von wem ist die Rede?“, erkundige ich mich flüsternd.
„Von Bilis“, antwortet mir die Ziegler.
„Trotz alledem“, sagt ein kleiner alter Mann mit hartem norddeutschem Akzent. Seine Augen sind hinter einer dicken Hornbrille versteckt, das schüttere Haar liegt in Sardellen über dem kahlen Schädel. Er sieht aus wie ein Buchhalter. „Trotz alledem mag ich sie gern leiden.“
„Ich verstehe das nicht“, erwidert der Bariton mit vibrierender Stimme, ganz am Ende. „Nein, ich verstehe es nicht.“
„Wer ist diese Bilis?“, frage ich leise und erfahre ohne Erstaunen, dass es nur ein Schatten ist, um den man sich ereifert, die Figur einer Oper.
Mag sein, wir haben zu laut geflüstert, denn nun wenden sich die Gesichter uns zu. „Wer ist das?“, fragt jemand laut und ungeniert.
Meine schwarze Begleiterin verzieht die Lippen zu einem maliziösen Lächeln. „Das ist die Dichterin“, verkündet sie.
Sie sagen nichts und starren. Ihre Augen sind abweisend, kalt, hämisch. Keinerlei Entgegenkommen. So bin ich’s gewohnt.
Ja, ja, starrt nur. Das bin ich, ich, Sepher, glühend errötet und voll Hass auf diese Augen, und keiner weiß, wie ich bin, außer mir selbst. Ich, Sepher. Ein Strudel, auf dessen Grund das Nichts wohnt. Halb Wolf, halb Lamm. Vogel mit Schuppen, gefiederter Fisch. Äußeres nicht nennenswert und veränderbar. Mal hink ich, mal flieg ich. Aber ich bin da.
Eben, als ich fragen will, wessen ich denn angeklagt sei, steckt eine persisch aussehende Dame den Kopf durch die Tür und sagt: „Das Mädchen.“
Alle stehen auf, lassen mich links liegen und drängen sich nach draußen.
Die Ziegler erhebt sich ebenfalls und ich mit ihr, was sollte ich allein in dieser rauchgeschwängerten Halle mitten im Labyrinth. Wir gehen wieder durch einen der bunkerartigen Gänge mit rötlichen Lichteraugen. Vor mir wird eine Tür geöffnet, man stößt mich in undurchdringliche Finsternis. Eine Hand fasst nach der meinen und zieht mich vorwärts, stolpernd folge ich, der Boden unter meinen Füßen ist holprig und abschüssig, schließlich finde ich an einer Wand Halt, man drückt mich in einen samtigen Sessel.
„Licht!“, befiehlt eine weithin schallende Stimme.
Erst geschieht gar nichts. Dann öffnet sich vor mir eine sanft-goldene Morgenröte, verstärkt sich zur Gloriole. In dem Schrein aus Licht steht eine zerbrechliche Göttin, die Fingerspitzen der gespreizten Hände gegeneinandergepresst, die Füße weit auseinander, die Augen geschlossen. Es ist das Mädchen in Jeans, das hinter dem Pfau stand.
„Musik!“, befiehlt die allmächtige Stimme.
Aus dem Nichts beginnt ein Klavier zu spielen.
Das Mädchen in Jeans öffnet die Augen, schüttelt das Haar zurück und beginnt zu singen.
Von dem Augenblick an liege ich in Ketten. Der Doppelzauber von Gesang und Liebreiz, das alte Rezept der Sirenen.
Hinter mir beginnt es zu raunen und zu tuscheln. „Die hat keine Hemmungen.“ — „Was zittert sie beim Singen wie eine Maschine, die unter Hochdruck steht?“ — „Saubere Stimmführung.“ — „Aber noch unfertig.“ — „Die Höhe.“ — „Wieso? Die Höhe ist gut.“ — „Sie soll sich mal bewegen.“ — „Sie soll mal ihre Beine bis übers Knie zeigen, wie das früher Sitte war.“ — „Ach, ihre Höschen sitzen doch knapp genug.“
Ich halte mir die Hände vor die Ohren und schließe die Augen. Als ich sie wieder öffne, springt sie da vorn umher und gibt vor, die Unschuld vom Lande zu spielen. Es ist heikel und fast schon unerlaubt, wie sie lässig die Frivole mimt.
Das Raunen und Flüstern hebt wieder an. Ich drehe mich um. Inzwischen unterscheide ich in der Finsternis die blassen Scheiben der Gesichter.
Der Buchhalter mit den scharfen Brillengläsern beteiligt sich als Einziger nicht an dem Chorus. („Beine — Register — Ausstrahlung — schülerhaft — Musikalität — Handhaltung — Natursüße.“) Plötzlich erhebt er die Stimme — ihm gehört sie, die allmächtige Stimme von vorhin — und fordert von da vorn „etwas Altes, in italienischer Manier.
Die Schöne neigt den Kopf, hebt die Hände vor die Augen. Das Haar fällt ihr in die Stirn. Nur ich kann sehen, dass ihre Hände zittern. Sehen, dass ihre Augenlider vibrieren. Ich sehe diese Augenlider durch die Hände hindurch, geschwungen, voll bläulicher Adern. Ich sehe darunter die Sterne der Augen in der vollkommenen Höhlung des Schädels, darin die Funken des Lebens zucken. Das ganze Wesen ist von innen her erleuchtet. Und ich begreife, dass auch das Licht, das sie umfließt, von ihr kommt.
Sie beginnt zum dritten Mal zu singen: „Vivere e non amar.“
Meine Fingerspitzen fangen an zu knistern. Gleich werde ich den Boden unter den Füßen verlieren und davonschweben. Mich könnte es nicht wundern, wenn ich ebenfalls leuchten würde, in kleinen knisternden Flämmchen, die rings um mich aufsprühen.
Vorsichtig schaue ich mich um. Es scheint nichts Sichtbares mit mir vorzugehen. Keiner blickt zu mir, alle richten ihre teigigen Gesichter nach oben.
„Die singt ja wie ein Engel“, flüstert jemand.
Wie denn sonst? — Noch einmal sehe ich mich um. Der kleine bebrillte Mann hockt auf seinem Sessel wie ein Gnom, die Beine angezogen, und beißt sich in die geballte Faust.
Dann ist es zu Ende, das Licht verlischt, wir tasten uns aus dem Raum, wortlos, jeder den Blick für sich.
Auf dem Gang steht sie, die Wangen leicht gerötet. Sie unterhält sich mit einem dicklichen jungen Menschen, der einen Packen Noten unter dem Arm hat, und lacht dabei laut und hemmungslos.
Die an ihr vorbeigehen, lächeln. Sie lächeln befangen, aber versuchen, Herablassung in ihre Mienen zu legen. Jemand sagt: „Ihr Triller ist bemerkenswert.“
Sie erwidert beiläufig: „Den hab ich bei Iolanda Maria Petris gelernt.“
„Da kann ich Sie“, sagt die schwarze Ziegler, „ja gleich beide mit zum Professor nehmen.“
„Also dann.“ Die Schöne verabschiedet sich von dem dicken Jungen und folgt uns. Wir gehen wieder durch das Labyrinth der magisch halbdunklen Gänge, voran die Führerin, Knie nach außen, Füße gestreckt und Fußspitze zuerst aufgesetzt, dann ich, Sepher. Hinter mir: vielleicht sie. Ich höre nichts, ihr Schritt ist zu leise. Aber ich weiß, dass man sich in solchen Situationen nicht umdrehen darf. Wenn man sich umdreht, verliert man alles. Ich werde ja wohl Zuversicht genug haben.
Als wir in einem anderen kleinen, diesmal olivgrün gestrichenen Zimmer angelangt sind, ist sie tatsächlich noch da. Wir werden gebeten zu warten.
„Wir“ zu denken, ist eine erregende Gemeinsamkeit, aber die Schöne beachtet mich nicht. Sie lehnt wieder an der Wand, die Lider gesenkt, die Hände mit gespreizten Fingern zuseiten des Körpers an den grünen Hintergrund gepresst. Die Röte ist aus ihrem Gesicht geschwunden.
Qualvoll eingeschnürt in das Korsett meiner Schüchternheit, wage ich nicht, das Wort an sie zu richten. Vor Verzweiflung über meine Feigheit bin ich den Tränen nah.
Sie wird als erste hineingerufen. Weder beim Kommen noch beim Gehen wirft sie mir einen Blick zu.
Die Schwarze muss mich zweimal ansprechen, ehe ich begreife, dass ich erwartet werde. Sie wirft einen schrägen Blick auf meine Hände, in denen ich ein nicht ganz sauberes Taschentuch zerknülle. Meine Taschentücher sind nie ganz sauber, meine Strümpfe haben meist eine Laufmasche, meine Fingernägel schwarze Ränder. Dinge, die andere wichtig finden, vergesse ich, Unterlassungen, über die sie die Hände ringen, verstehe ich gar nicht. Sicher haben am Ende doch die recht, die meinen, ich sei nicht ganz bei Troste.
Ein neues Zimmer, noch kleiner, graue Seidentapeten und Vorhänge, ein Schreibtisch, der leer ist bis auf eine Reihe von großen exotischen Muscheln an der Stirnseite. Es ist kühl hier. Mich fröstelt.
Der hinter dem Schreibtisch sitzt, der Große Zauberer, der Mächtige, der Professor, ist mein „Buchhalter“ mit den scharfen Brillengläsern und der schütteren Frisur.
Er fordert mich zum Sitzen auf und macht seine allmächtige Stimme samtweich, um mich zu überreden, mein großes Sappho-Buch zu einem Opernlibretto für seines Hauses Komponisten, Musiker und Sänger umzuarbeiten — und ich weigere mich seit einem Vierteljahr, wie er weiß. Literatur und Oper sind einander feindlich. Was die eine aufbaut, missachtet die andere, was jene an Freiheiten lässt, presst diese in eine, nur eine einzige Form. Sollen sie sich einen mittelmäßigen Wortsetzer holen, der das Handwerk versteht und über dessen dürren Knochenideen ein Tonschöpfer seine Kaskaden von Gefühlen modelliert. Doch nicht ich.
Stumm lausche ich den Überredungskünsten des Mannes hinter dem kahlen Schreibtisch. Meine Augen haften an seinen Händen, die an den Knöcheln und an der äußeren Kante dicke Hornhautschwielen haben. Man erzählt, dass er bei seiner Arbeit ständig an den Händen kaut ...
„Hören Sie mir eigentlich zu, Frau Sepher?“
„Nein“, erwidere ich abwesend. Mir ist so kalt, dass ich zittere.
Er erhebt sich. Seine Schultern unter der grauen Samtjacke fallen schmal ab.
„Unter einer Bedingung wäre ich bereit …“
Er setzt sich wieder.
Meine Hände pressen das Taschentuch.
„Das Mädchen, das vor mir hier war — wird sie bei Ihnen singen?“
Er lächelt. „Diese unbekümmerte Vaudeville-Schönheit?“
„Ein kleiner Diamant“, sage ich atemlos.
Er neigt den Kopf. „Aber ein ungeschliffener. Eine Nachtigall, die noch das Flöten lernt. Ein Stück Holz, aus dem man schnitzen kann. Edelholz, zugegeben.“
„Wird sie bei Ihnen singen?“
„Ich müsste ein Narr sein, an so etwas vorüberzugehen. Kleine Anfängeraufgaben zunächst. Wir werden sehen.“
„Meine Bedingung wäre, dass, wenn ich das Libretto schriebe, dies Mädchen die Sappho singen und spielen soll“, stoße ich hervor. Mein Gesicht brennt bereits vor Röte, bevor er sagt: „Aber liebe Frau Sepher, das ist unmöglich.“ —
„Du musst verrückt sein. Größenwahnsinnig. Zu behaupten, ich verdanke dir meine Karriere. Was für eine Karriere denn? Ich hätte auch ohne deine blödsinnige Sappho Karriere gemacht. Gib mir doch mal die Teintschminke rüber. Nicht die, die andere. Was leitest du eigentlich daraus ab, aus dieser Feststellung, ich verdanke dir ... Wie fandest du heute übrigens den ersten Akt? Ich hab Schwierigkeiten mit den leichten Achteln in der Chaconne gehabt, wie? Ich geh gleich noch mal die Szene mit dem Gefangenen durch. Wie war denn nun der erste Akt, he? Ich hab dich was gefragt, mein Gott.“
Ich presse die Handflächen aneinander, um über das Würgen in meinem Hals Herr zu werden. So ist sie. So geht es ständig. Jeden Tag schlägt sie tausend kleine Wunden, die alle zusammenwachsen. Bald wird meine Seele nur noch eine einzige zuckende Wunde sein, verletzte Selbstachtung, zurückgewiesene Liebe, verachtete Zuneigung — und Eifersucht, ach, Eifersucht.
Im Schnee des Spiegels brennt ihr hell erleuchtetes Bildnis, das Gesicht mit dem weiten Schnitt der Augen, umrahmt von riesigen falschen Wimpern und roten Farbfeldern, über der kindlichen Stirn das hoch gebauschte künstliche Gespinst metallischer Haare — fremd und nah zugleich — und der plastisch erhöhte, schwarz umrandete Maskenmund, der singende, Unsinn schwätzende, zutiefst verletzende Mund.
Sie erhebt sich, geht in dem engen Raum hin und her, summend, die Hand hinterm Ohr, Augen halb geschlossen. Wenn sie an mir vorbeigeht, streift mich der harte Silberzindel ihres Kostüms schmerzhaft am Arm.
Das bewegt mich, mit den Augen jene Stelle ihres Körpers zu suchen, die regelmäßig von dem spröden Stoff des Fantasiekleides wund gerieben wird. Auch heute wieder ist der weiche Ansatz der Brust seitlich unterm Arm gerötet, die empfindliche Haut mit kleinen Pünktchen bedeckt.
Als sie das erste Mal in diesem Kostüm spielte, war sie so zerstochen, dass das Blut lief. Während wir tupften, kühlten, Salbe auftrugen, das Kleid zerschnitten, saß sie bewegungslos mit hoch erhobenen Armen, die Augen geschlossen, und summte die nächste Arie vor sich hin.
Ja sicher, sie verdankt es sich selbst. Und ich bin größenwahnsinnig. Verrückt. Was wäre meine Sappho ohne sie. Gewiss. Man kann sogar sagen, wenn es sie nicht gäbe, hätte ich nie eine Bühnensappho geschrieben.
Und trotzdem. Meine Kämpfe gegen schiefes Lächeln, Achselzucken, Tuscheln hinter vorgehaltener Hand. Demütigungen. Einfach, um Sappho für sie schreiben zu dürfen. Die schlecht verhehlten Triumphe der offenen und heimlichen Widersacher, wenn etwas nicht gleich gelang. Der Blick des Komponisten nach dem Versuch, mit ihr die erste Szene probeweise zu gestalten. „Sie lernt nicht. Verstehn Sie — nicht, dass sie nicht wollte. Sie begreift schwer.“ Zum Glück habe ich einen mächtigen Verbündeten. Ihn, den Professor, den Großen Magier, der mir mit so viel sichtbarem äußerem Widerstreben und spürbarem innerem Vergnügen am Wagnis schließlich meine Bedingung zugesteht („auf Ihre Verantwortung, meine Liebe“). Denn auch er ist schon entflammt.
Sie selbst nimmt die Eröffnung, wie sehr ihre Kunst da gleich zu Beginn herausgefordert werde, mit Gelassenheit auf, als verstehe es sich von selbst. Gefragt, ob sie sich nicht freue, bemerkt sie einsilbig, o doch, worauf der Professor, mehr amüsiert als verärgert, feststellt, sie habe wohl keinerlei Zweifel an sich selbst. Und sie: „Muss man das?“ Wieder streift mich das harte metallische Gewebe. Ich sehe zu ihr auf, aber sie schenkt mir keine Beachtung. Die angemalten Augen geschlossen, steht sie und flüstert vor sich hin.
Von der Sappho des Buches blieb freilich sehr wenig, als ich zuschnitt, um die Silhouette der Figur diesem schönen Leib anzupassen. Das allen unverständliche, gehasste und geliebte Wunderwesen, das Menschen vernichtet und gleichzeitig Verse schreibt wie eine Göttin, dieses Geschöpf einer Oper, war nach ihrem Bilde geschaffen.
Der Komponist verstand zum Glück sehr bald, was ich wollte — verstand, als er dazu bereit war. Er hatte sich am hartnäckigsten gegen diese Sappho gewehrt — warum, begriff ich erst, als ich ihn mit der Ersten Sängerin des Hauses, einer malerischen Brünetten, zärtlich flüstern sah.
Ich bringe ihm die ersten Szenen des zweiten Aktes in seine Wohnung, eine alte feierliche Wohnung in einem reich verzierten Steinhaus mit Marmortreppen; durch die riesigen dunklen Räume mit himmelhohen Stuckdecken toben vier bis sechs Kinder. In einem mit Instrumenten vollgestopften mittleren Saal überfliegt er die Blätter — mit einem Seitenblick entdeckte ich bereits Skizzen zum ersten Akt in winziger Notenschrift.
Der Komponist hat trotz seiner Jugend schon einen Namen — so habe ich mir sagen lassen. Wenn man ihn da sitzen sieht, bezweifelt man es. Er trägt einen verwaschenen weinroten Trainingsanzug, auf dessen Kragen sich sein speckiges Haar scheuert. Sein blasses Gesicht ist gedunsen vom Alkohol. Sie sagen, er sitze manchmal im Restaurant eines kleinen Vorstadtbahnhofs und trinke Rotwein, vier, fünf Flaschen hintereinander. Dann gehe er bolzengerade nach Hause, setze sich ans Klavier und schaffe seine besten Sachen.
Er sieht von seinen Blättern auf und betrachtet mich mit jenem leicht befremdeten Blick, den ich kenne; aber bei ihm mischt sich zumindest eine Spur von Nachdenken darunter.
„Sie gefällt Ihnen wohl sehr“, sagt er — mehr als Feststellung denn als Frage.
Ich nicke, Röte im Gesicht und Würgen im Hals.
„Nun gut“, entgegnet er und legt die Papiere irgendwohin. „Aber denken Sie nicht, dass ich sie schonen werde, Ihre Anfängerin. Ich habe mir vorgenommen, eine Virtuosenpartie zu schreiben wie die alten Meister, und es bleibt dabei. Vogel friss oder stirb.“
Ich zucke zusammen. Draußen versuchen die Kinder offenbar gerade, eine Tür einzuschlagen. Dem Lärm nach ist es ein Dutzend. Er lächelt. „Das stört mich nicht. Im Gegenteil. Es regt mich an.“
„Wenn du sonst schon nichts zu sagen und zu tun vermagst, geh doch und hol mir etwas zu trinken. Du weißt, wie ungern ich im Kostüm durchs Haus laufe“, sagt sie. Dann, abgewandt, halblaut, laut genug: „Sitzt da rum und schweigt ...“
Mit blinden Augen stehe ich auf und taste nach der Türklinke. Sie schickt mich fort wie einen Botenjungen. Ich kann mir tausendmal sagen, dass sie so einen jeden behandelt, der es sich eben gefallen lässt, dass sie nicht weiß, wie das wirkt, wenn sie so redet, dass sie sich nichts dabei denkt und dass sie ja recht hat ... Sepher geht für die kleine Komödiantin eine Brause holen.
Unsicher tappe ich durch das Labyrinth der Gänge, in denen ich mich immer wieder verlaufe, so oft ich sie auch durchquere. Sie sehen einer wie der andere aus, magisch erleuchtet von Schildern, die dir Hinweise oder Verbote entgegenschreien, an den Kreuzungen flankiert von stets wechselnden Fabelwesen und Sinnlosigkeiten wie zerbrochenen Uhren und Glassturzen, unter denen verkitschte Madonnen stehen.
Sie hat recht, wenn sie nicht in ihrem Kleid durch das Haus geht. Man liebt sie nicht. Die herablassende Heiterkeit, mit der man zu Beginn der „hübschen kleinen Neuen“ begegnete, stieß auf ihren Gleichmut; den guten Lehren, die ihr Ältere erteilten, setzte sie spöttische Unbelehrbarkeit entgegen. Als dann bekannt wurde, dass sie die Titelpartie der neuen Oper singen sollte, geriet das Haus in Aufruhr. In den winzigen bunt getünchten Räumen mit den Spiegeln und Schminktöpfen brodelte zischend die Empörung, brach sich wie ein Echo an den Wänden der verwinkelten Gänge. Sie erhielt drei, vier Briefe ohne Unterschrift, die mit Scheren und Kleister aus Zeitungen gebastelt waren. Dann gibt es den „großen Eklat“. Eines Vormittags steht sie in jenem Teil des Hauses mit den amtlichen Mitteilungen, in die Lektüre vertieft, neben ihr andere. Hinzu kommt jene Sängerin, deren Kunst vor zwanzig Jahren den Ruhm des Professors mitbegründete und die man allgemein die „Große Mutter“ nennt.
Die Große Mutter führt ihren Namen nicht zu Unrecht. Sie ist eine resolute, altmodische, lebhafte Frau „mit Einfluss“, den sie gern für die geltend macht, die sie verehren. Sie freut sich über jeden, der sich an ihrem Herzen ausweint, sie riskiert mit Humor eine Lippe auf allen Versammlungen, denn sie kann sich‘s ja leisten, und sie verlangt von allen völlige Unterwerfung unter ihre Ansichten. In kluger Beschränkung singt sie nur noch kleine Partien.
Die Große Mutter also, gut geschminkt, mit ihrer Handtasche aus Krokodilleder und den Perlen im Ohr, wird von allen mit freudigem Unterton gegrüßt, da sie jetzt kommt und sich dicht und parfümduftend neben der vertieft lesenden Schönen aufpflanzt. Ihre Haltung verkündet, dass jetzt ein Exempel statuiert wird.
Da die Junge sie ignoriert, sagt die Ältere mit tragender Stimme: „Ach, Sie haben es wohl nicht nötig, mich zu grüßen?“
Die andere, halblaut, ohne sich umzuwenden: „Kann schon sein.“
Die Große Mutter: „Sie wissen wohl nicht, wer ich bin?“
Die andere, etwas lauter, aber immer noch den Kopf zum Zeitungsausschnitt: „Doch. Sie sind eine alte, teure Sängerin.“
Es ist jetzt so still, dass man eine Stecknadel fallen hören könnte. Eigentlich ist der Kampf schon entschieden. Die Pause zwischen dieser Replik und dem neuen Ansatz der Großen Mutter ist viel zu lang, um eine bloße Spannungspause darzustellen. Hier ringt eine Getroffene um einen guten Abgang. Keiner denkt, dass es noch besser kommt.
Die Angreiferin senkt jetzt die Stimme, wechselt die Taktik und sagt betont sanft: „Sie denken wohl, weil Sie hier gleich eine größere Partie singen, können Sie frech werden, mein Kind?“
„Mein Kind“ dreht sich endlich um, Auge in Auge mit der Kontrahentin, sagt lächelnd, laut und freundlich: „Neidische blöde Ziege“, und streckt eine lange rosige Zunge heraus. Dann dreht sie sich auf dem Absatz um und geht.
Sie wurde zum Professor zitiert, weil die Große Mutter eine Entschuldigung verlangte. Sie gab sie bereitwillig, in gelangweiltem Ton, und sah dabei zum Fenster hinaus.
Obwohl sich alle diebisch freuten an ihrer auf die Große Mutter gerichteten bezaubernden Katzenzunge — nun ist sie allein. Es ist weise von ihr, nicht im Kostüm durch das Haus zu gehen. Nur, so weise ist sie nicht immer.
Ich werde mich wieder verlaufen auf dem Weg nach einem Getränk für die Durstige. Ich werde wieder aus Verzweiflung irgendwelche Türen öffnen, und hinter jeder ist ein Rätsel. Manchmal Nackte, die sich mit buntem Tand bekleiden und aufschreien, wenn sie mich sehen, manchmal Singende, die mich mit leeren Augen anstarren, während sie, auf und ab gehend, die Hand am Ohr, ihren eigenen Tönen nachlauschen, auch Liebende, eng umschlungen auf der Erde, habe ich schon angetroffen. Sie bemerkten mich nicht, taub und blind in ihrer Ekstase, und ich schloss die Tür wieder leise.
Es ist so einfach. Aber ich habe nicht den Instinkt. Und zählen — eine Tür rechts, zweimal links abbiegen, drei Türen rechts, dann Stufen —, zählen kann ich nicht. Alle Zahlen verwirren sich in meinem Kopf, ich vermag mich nicht darauf einzustellen. Meine Gedanken laufen andere Pfade, so sehr ich mich auch bemühe.
Jetzt wieder steh ich da, mit einer Schulter an die hässliche Wand gelehnt — ich hoffe, ich weine nicht! Nein, ich weine nicht. Ich gehe, ein Getränk zu holen für Sappho.
Ein bieder aussehender grau melierter Herr, der sein Bäuchlein unter weißer Weste und dem schwarzen geschwänzten Kleidungsstück unserer Vorväter verbirgt, ohne sich der Lächerlichkeit dieses Anachronismus bewusst zu sein, zeigt mir schließlich den Weg.
Blind, wie durch ein brennendes Haus, taste ich mich durch Rauch und Lärm und Lachen, fordere und bekomme, stürze wieder davon ins Labyrinth. Vor mir geht ein Mann, vielleicht will er in dieselbe Etage wie ich, sodass ich ihm folgen kann. Ich schleiche ihm nach und sehe mit wachsender Beklemmung seinen beschwingten Gang, der eilender wird, je näher wir dem Ziel kommen. Er geht in seinen schönen Schuhen und seinem untadeligen Anzug wie zu einer Siegesfeier. An der Ecke warte ich beklommen. Wenn er zu ihr hineingeht, kann ich auch gleich umkehren. Oder das Glas fallen lassen.
Seine Hand drückt die Klinke nieder, ohne anzuklopfen. Er hat dazu die Erlaubnis. Blickt hinein. Geht wieder.
Ich warte, bis er in dem Gangwirrwarr verschwunden ist. Dann husche ich, so schnell ich kann, zu der bewussten Tür, klopfe flüchtig, stürze hinein wie jemand, der sich auf der Flucht verbirgt. Der Raum ist leer, wie ich erwartet habe.
Meine Hand, die das nun halb verschüttete Glas hält, klebt von der süßen Flüssigkeit. Mir ist schwindlig.
Welch Glück, dass er sie nicht angetroffen hat. Er ist einer unter anderen, und was geht es mich an? Aber den hier hasse ich, mit seinen wunderbaren Anzügen und seinem verbindlichen Lächeln im hübschen Gesicht.
Ich spüle mir die bis zum Gelenk beschmierte Hand ab, länger als nötig, bis die Kälte prickelnd meinen Arm emporsteigt und schmerzhaft nach dem Herzen greift.
Wo sie jetzt ist, weiß ich. Wenn ich diesen Bienenstock und seine Waben durchsichtig mache, steht sie schräg rechts über mir, mitten im Zimmer oder an den Flügel gelehnt, den Körper voll Luft. Vor den Tasten sitzt der dicke junge Mensch, der sie immer begleitet. Sie wollte die Szene mit dem Gefangenen durchgehen. An Tagen, wenn die Fenster offen sind oder es sehr still ist im Haus, kann man sie sogar von hier singen hören, verwehte Zauberklänge.
Ich hör sie. Je fester ich die Augen schließe, desto deutlicher vernehme ich ihre Stimme, eine unirdische Stimme, stark, rein und voll Süße, sich verströmend, sich einspinnend in die exotischen Melismen dieser Musik, unbeirrt durch die Irrgärten fremdartiger und ungewohnter Klänge steuernd.
Die Szene mit dem Gefangenen — wie oft hat sie sie schon gesungen ? Wie oft überhaupt jede einzelne Note der Sappho um und um gekehrt, mit dem geduldigen dicken Jungen am Klavier, der wiederholt und wiederholt ...
Es erfüllt mich mit Stolz, dass außer mir — und ihm — wohl keiner weiß, was dies Wesen eigentlich ist: eine Arbeiterin. Bis zur Selbstaufgabe, bis zur Erschöpfung, bis zum Zusammenbruch.
Ich ahne es das erste Mal, als ich mich, vom unwilligen Professor zur Klausur verbannt, um eine Szene zu ändern, neben dem Raum aufhalte, wo sie arbeitet. In den beiden Stunden zwischen zwei „großen“ Arbeitsproben mit ihrem Meister tut sie nichts weiter als ein paar wenige Takte umfassende Passagen aus dem ersten Akt zu repetieren, immer wieder, immer wieder.
Wir verlassen gemeinsam die Räume, sie sieht mich und weiß, dass ich sie gehört haben muss, und so gehen wir zusammen einen Kaffee trinken. Ihr Gesicht ist blass, auch ihre Lippen. Sie ist still und zugänglich, ausgeblutet.
Über den Rand der Kaffeetasse begegnen sich das erste Mal unsere Augen.
„Dieser Beruf fordert viel Kraft“, sagt sie leise.
„Vor allen Dingen, wenn man Ehrgeiz hat“, wage ich zu erwidern, kühn gemacht durch ihre Sanftmut, und lächle.
Sie macht keinen Versuch zurückzulächeln und hebt die Schultern. „Was heißt Ehrgeiz. Man ist gut, oder man lässt es.
Ihre steingrauen Augen halten meinen Blick, ohne jeden Ausdruck. Sie werden einfach hingehalten, dass man hineinschauen kann. Trotzdem ist mir, als stiege ich langsam in ein immer tiefer werdendes Wasser. Bevor mir die Luft wegbleibt, senkt sie gnädig die Augenlider und erklärt, sie sei müde.
Kurze Zeit später spürt niemand etwas von dieser Ermüdung. Sie arbeitet mit dem Großen Zauberer, und das ist ein Wunder für sich. Manchmal kommt jemand zuschauen, verliert sich im Dunkel des riesigen, nach oben offenen Raumes — so wie auch ich — irgendwo auf einem von tausend Sitzen. Es ist sehr kalt, wie es der Magier liebt, die Ränge glänzen matt wie die gebleckten Zähne eines Gebisses, die Kristalle der fernen Lüster funkeln bedrohlich.
Einsam hocke ich in einer Ecke, frierend, weit entfernt von der erleuchteten Insel zwischen den Sesseln, wo an einem improvisierten Schreibbrett die Helfer des Professors sitzen, eine schwangere Blondine mit Rosenwangen und komplizierter Frisur und ein Mensch mit sehnigem Hals und langen Locken. Sie stecken die Köpfe zusammen, tuscheln und bedecken Stöße von Zetteln mit Notizen. Selten gesellt sich auch ihr Meister zu ihnen — immer nur für Minuten.
Die meiste Zeit ist er „oben“. „Oben“, beginnt hinter einem Abgrund, den er auf schwankendem Steg immer wieder überquert, und besteht aus einem bizarren Gewirr von rostigen Metallgestellen, schlampigen Papierwänden verschiedener Größe, die wie verschimmelt aussehen, und Holzpfählen mit Stricken. Dazwischen ein verschlissenes Klavier ohne Deckel auf einem Podest, jammervoll beleuchtet, und das alles eingerahmt von einem schwarzen, aus dem Unendlichen kommenden Lumpenvorhang.
In diesem wirren Albtraum eines Flohmarkttrödlers arrangiert der Zauberer seine Gesichte; mitten zwischen den Agierenden oder zu ihren Füßen auf einer melkschemelartigen Fußbank im toten Winkel des Klaviers.
Sehr oft ist sie allein dort oben. Sie ist die Titelfigur und „hat das meiste“, auch weiß der Professor, dass er viel Zeit braucht bei seinem Experiment mit der „Vaudevilleschönheit“. Das sind schöne stichhaltige Gründe, gegen die niemand etwas einwenden kann. Wer aber zuschaut wie ich, der sieht, dass hier ein alter Musikant ein Instrument gefunden hat, das seinen leisesten Regungen folgt.
Es gibt nichts, was sie, wenn es ihr vorgemacht wird, nicht nachahmen könnte, keine Regung, die sie nicht geschmeidig aufnimmt und wiedergibt, keine noch so hauchfeine Schattierung, die sie nicht präzis kopiert. Der Zauberer, wenn er ihr auf seine bizarre, übertriebene Art vorgespielt hat, gleicht einem hektischen Gnom, der einen Heroen gestalten will (sie steht vor ihm und beobachtet, das Gesicht ausdruckslos vor Konzentration), hockt sich auf seinen Melkschemel, die Faust an den Mund gepresst, den Rücken gebeugt, starrt. Wenn dann sein Instrument genau die Melodie spielt, die er ihm eingefüttert hat, reißt er beide Beine zugleich hoch, krümmt sich auf seinem Bänkchen in einem Freudensprung, den Mund zu einem stummen Schrei aufgerissen, beide Arme in die Luft geworfen.
Einmal sitze ich zwei Reihen vor dem Pult der Trabanten und erhasche ihre halblaut gelispelten Anmerkungen:
„Sie ist ein Phänomen in der Adaption“, sagt er, „aber sie bringt nie einen eigenen Vorschlag, eine eigene Überlegung zur Rolle. Sie ist wie ein Medium.“
„Was willst du“, erwidert sie, „das ist es doch gerade, was unser Meister braucht. Ein Kaiser wie er sucht Untertanen. Ton, den er modellieren kann. Mitregenten braucht er nicht.“
In der Tat hat es etwas Mediales, wie die Schöne den Anweisungen des Meisters folgt. Zumindest in diesem Stadium der Arbeit kennt sie keine Allüren, keine Arroganz. Sie ist pünktlich, hellwach, ruhig und arbeitet, ohne nach der Uhr zu fragen. Ihr Gehorsam gegen die Anweisungen des Magiers ist bedingungslos. Sie hat alle Kräfte ihres Willens nur darauf gerichtet, seinen Weisungen zu folgen.
Einmal lässt er sie fast zwei Stunden mit dem Kopf nach unten auf einem geneigten Metallträger singen, der später einmal eine schräge Grasböschung vorstellen soll, die Beine gespreizt, eine Hand „lässig, wie in Träumen“ seitlich herabhängend.
Schließlich flüstert ihm die schwangere Assistentin ins Ohr: „Aber, Professor, das ist ja eine mittelalterliche Folter! Mir wird vom Zusehen schlecht.“
Die Schöne selbst hat mit keinem Wimpernschlag protestiert. Immer wieder sehe ich, wie er ihre Glieder in die von ihm gewünschten Haltungen biegt und zieht, als sei sie eine Puppe. Folgsam und willenlos lässt sie sich manipulieren.
Das ist die eine Seite. Das Geheimnis aber bleibt die andere Seite: ihre unabdingbare Zuverlässigkeit, mit der sie einmal Festgelegtes immer wieder tut. Es beginnt mit dem Staunen des Komponisten, als er sie seine schwierigen Elaborate fehlerfrei und souverän vortragen hört.
„Das ist ein Rätsel“, murmelt er, neben mir in dem großen dunklen Raum, unruhig auf seinem Stuhl zappelnd. „Zugegeben, sie hat eine gewisse konventionelle Musikalität, aber damit kommt man bei meiner Musik nicht weit. Da braucht man Intelligenz, und davon hat sie nun nicht gerade viel. Als ich mit ihr probierte, dachte ich: Das kapiert die nie! Aber jetzt — sie kann es. Sie kann es perfekt, sozusagen im Schlaf.“ Er schüttelt den zottigen Kopf.
Beim Professor äußert er sich in Entzücken. „Ein Phänomen“, erklärt er mir auf dem Weg vom Pult nach „oben“, „jede festgelegte Nuance kommt bei ihr mit fotografischer Genauigkeit noch nach einer Woche wieder. Diese Geste mit der rechten Hand — wir haben die Szene erst einmal gearbeitet! Als laufe ein Film ab.“
Und ein Adlatus murmelt dem anderen zu: „Ja, unheimlich. Wie eine programmierte Maschine.“
Das Rätsel, das Phänomen — ich könnte es erklären. Es besteht aus halben Nächten am Klavier, gemeinsam mit dem dicken Jungen, aus Repetitionen über Repetitionen. Jede der ausprobierten Gesten und Gänge wird zu Hause vor dem Spiegel wiederholt — zehnmal, zwanzigmal, fünfzigmal. Mit Text, ohne Text, mit Text und Gesang, mit Stimme, ohne Stimme, technisch oder „auf Ausdruck“. Ohne Erbarmen gegen sich und andere.
Wir sind mit der „Sappho“ ziemlich weit fortgeschritten, als der allmächtige Meister seine erste Liebeserklärung abgibt, vor meinen und des Komponisten Ohren. Wir sitzen zu dritt und stecken die Köpfe zusammen wie junge Vögel, die aus dem Nest gefallen sind und beieinander Schutz suchen, sehen und hören „da oben“ in der Welt des Vorläufigen das erste Mal ohne Unterbrechung Sapphos große Szene.
Sapphos Verkörperung trägt Hosen, einen Wollsweater und das Haar in Zöpfen, das Klavier ist verstimmt, und ich friere. Trotz alledem zeichnet sich für uns langsam das Wunder ab, über Disziplin und Arbeit, Medium und maschinelle Repetition hinaus: das Entstehen einer Kunstfigur, so artifiziell, dass sie vollkommen natürlich wirkt. Ein Atem, ein Geist, ein Darüberhinaus. Ja, was eigentlich?
Unser Komponist, ungläubig, da nicht verwöhnt von Wundern in der Kunst, stöhnt auf. „Wie ist das möglich? Ich hielt sie für dumm!“
Da ich zwischen ihm und dem Professor sitze, begegnen sich ihre zueinander geneigten Köpfe fast über meinem Schoß, wenn sie sich etwas sagen wollen, und ich höre gleichfalls dem Professor zu.
„Dumm oder klug, das sind hier keine Maßstäbe. Mag sein, dass sie dumm ist wie Bohnenstroh, draußen, in dem, was man Alltag nennt. Aber hier, mein Bester, hier ist sie erzgescheit. Sie hat den siebenten Sinn der Komödianten. Sie weiß, was wann wohin gehört, ohne erst ihren Denkapparat nach dem Warum zu befragen. Sie ist in der Lage, ihrem Körper Befehle zu erteilen, die er sofort und mit der Geschmeidigkeit einer dressierten Raubkatze ausführt. Und was das Wichtigste ist: Wir alle verstehen diese Sprache. Sie hebt den Finger, und wir brechen in Entzücken aus. Sie senkt die Lider, und tausend Leute hier unten werden vor Weh erzittern. Ich weiß, es ist nicht ganz geheuer. Früher wurden solche Personen als Hexen verbrannt. Was sind Sie eigentlich?“
„Gesandte des Liebesgottes“, stoße ich hervor.
Er sieht mich nachdenklich an, aber ich kann hinter der Brille seine Augen nicht erkennen. Dann seufzt er. „Ja, Eros ist im Spiel. Hört nur.“ Er ergreift krampfhaft unser beider Hände und hält sie fest, als wollten wir entfliehen.
Scheinbar mühelos trägt die beseelte Stimme jetzt eine Tonfolge in den höchsten Höhen vor, ohne dabei an Ausdrucksvermögen zu verlieren, senkt sich dann mit der Kraft und dem Gleichmut eines Raubvogels auf einer Trillerkette nach unten, verhaucht.
„Man könnte heulen, so schön ist das“, flüstert er. Dann plötzlich halblaut, mit seinem harten Akzent: „Mein Gott, ich bin vierundsechzig. Vor zehn Jahren wäre ich hemmungslos in diese Falle getappt. Aber auch heute noch ist es eine harte Prüfung für mich.“
Da weiß ich schon, dass er diese Prüfung nicht bestanden hat. Mein Blick geht zu dem erleuchteten Spiegeltischchen.
Da liegen sie, immer auf demselben Platz: die berühmten Korallen, eine dreifache Schnur, eng um den Hals zu tragen. Geschenk des Großen Magiers an seine neue Primadonna anlässlich der ersten Aufführung der „Sappho“.
Gleichzeitig damit das zweite Geschenk, und war das erste königlich, so ist das zweite das eines Olympiers: ein Name, den sie von da an tragen wird wie den Korallenschmuck: Philomele. —
Die Korallen sind achtlos in braunes Packpapier eingeschlagen, mit einer Sicherheitsnadel daran befestigt ist ein Briefchen ohne Adresse, darin ein Zettel in der unverkennbaren Schrift des Professors, nichts enthaltend als die Goetheschen Verse, wie sie auf einem Stein stehen in dem Park, der von süßen Gesängen widerhallte.
Philomele
„Dich hat Amor gewiss, o Sängerin, fütternd erzogen; Kindisch reichte der Gott dir mit dem Pfeile die Kost. So, durchdrungen von Gift die harmlos atmende Kehle, Trifft mit der Liebe Gewalt nun Philomele das Herz.“
Darunter der Name des Großen Magiers.
Das war ein unglaubliches Geschenk und eine unglaubliche Huldigung, noch nicht da gewesen in der Geschichte des Hauses. Nirgendwo stand, dass es geheim zu halten sei, welchen Gunstbeweis der Meister seiner Schülerin da erteilt hatte, und sie dachte auch nicht daran, es geheim zu halten. Der poetische Übername, zuerst mit ironisch hochgezogenen Brauen angewandt, schließlich als Selbstverständlichkeit gebraucht, verdrängte völlig den anderen, unter dem sie noch auf dem Plakat der Uraufführung angekündigt wurde. Alle benutzten nun den neuen, Freunde und Feinde — nur er, der ihn verliehen hat, redet sie korrekt weiter mit „bürgerlichem“ Namen an, der sonst wohl in Vergessenheit geraten würde.
Das Haus kocht über von Vermutungen, die als Gewissheiten dargestellt werden. Der Professor gilt als geizig. Er hat seinen verschiedenen „Flammen“ in all den Jahren nie große Geschenke gemacht, und schon gar keine öffentlichen. Histörchen werden erzählt.
Gleich nach dem Bekenntnis, dem entrückten Händedruck des Magiers, frage ich sie.
„Puh, die Mumie“, sagt sie. „Der Kopf größer als der Körper“, und schneidet eine gräuliche Fratze, Augen verdreht, Zunge schief aus dem verzerrten Mund.
Sie kann die ausdrucksvollsten und makabersten Grimassen ziehen, die ich je gesehen habe, und sie weiß, wie sie mich mit dieser grotesken Begabung peinigt. Jedes Mal, wenn sie ihr Gesicht zu einer Höllenlarve verunstaltet, sträubt sich mir vor Qual und Widerwillen das Haar.
Ich verstumme und wende mich ab, und sie lacht.
„Passt dir was nicht?“
„Er ist dein Lehrer“, sage ich leise.
„Na eben“, erwidert sie und hält mir, da ich sie anzusehen wage, eine andere Gesichtsverzerrung entgegen: die Lippen zu einem Schweinsrüssel gespitzt, die Augen töricht aufgerissen. „Und darum habe ich ihn ja auch gelassen, als ich merkte, er hält es nicht mehr aus. Trotz seiner dünnen Beine und seiner Glatze. Einmal. Einmal ist keinmal.“ Ihre Augen glitzern. Sie hebt die geballte Faust vor die Zähne, beißt hinein wie in eine Frucht, kneift die Lider zu und zischt mit hartem Akzent: „Du bist wie eine Geige ...“
Mir graust es. Wenn ich nicht entfliehe oder irgendetwas tue, wird sie hemmungslos die Details ihrer Nacht mit dem armen betörten Professor als Parodienummer preisgeben.
Eine tönende Geisterstimme schreckt mich auf und verkündet lautstark das Ende der Pause und den Beginn des zweiten Aktes. Ich habe inzwischen gelernt, dass man diese Stimme mit einer Knopfdrehung ersticken kann, und tue es.
Also wird sie jetzt nicht noch einmal hierherkommen, sondern gleich hingehen, wo man sie erwartet. Ich werde hier sitzen bleiben, werde sie nicht sehen, das erlege ich mir auf, obwohl ich wissen möchte, ob jener Hauch, jener Schatten, der über ein paar Stellen des ersten Aktes lag, jetzt verflogen ist. Das soll meine Strafe sein.
Jetzt beginnt die von mir gedrosselte Geisterstimme heiser nach Philomele zu rufen. Einmal, zweimal. „Wir warten.“
Ich kenne das. Man beschwört sie zu kommen, man bittet, man befiehlt. Man braucht sie. „Wir warten.“ Sie kommt nie zu spät, aber immer im letzten Moment. Unbeteiligt um die Erregung der anderen, die Augen nach innen gerichtet, geht sie auf ihren Platz.
Plötzlich schnappt die hektische Stimme ab, und dann der Beginn der Musik. Stille in der Leitung, nur noch einmal das zufriedene Schnurren: „Der zweite Akt läuft.“