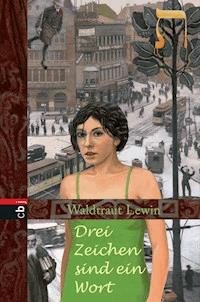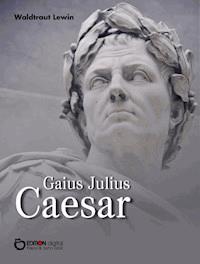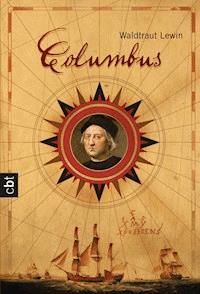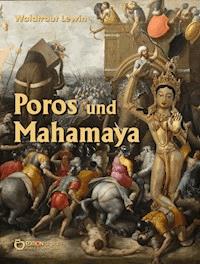12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbj
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Nichts Menschliches war ihm fremd: Goethe – Dichterfürst und Kultfigur.
Schon zu Lebzeiten war er ein Mythos und ist es noch immer: Johann Wolfgang Goethe, der größte deutsche Dichter aller Zeiten, Universalgenie, Naturwissenschaftler und Politiker. Jeder kennt ihn, jeder liest ihn, denn bis heute zählt er fest zum Kanon der Schullektüre. Wer aber ist der Mensch, der hinter diesen Werken steckt?
Goethe zum Leben zu erwecken, ist kein Hexenwerk! Unzählige Anekdoten, viel Amüsantes, Menschliches und Sympathisches gibt es von ihm zu erzählen: Dass er als Fünfzehnjähriger aus übergroßer Verliebtheit zum jugendlichen Straftäter wurde, indem er Schriftstücke fälschte. Oder dass er als Student seiner großen Liebe, der Pfarrerstochter Friederike Brion, aus Jux (oder Schüchternheit?) in verschiedenen Verkleidungen gegenübertrat.
Wie einen großen Roman, in kraftvoller, lebendiger Sprache erzählt Waltraud Lewin Goethes Leben, seine Begegnungen, seine Reisen. Zum Greifen nahe wird er uns beim Lesen, der Mensch Goethe mit seinen Stärken und Schwächen, mit den Gedanken, die ihn bewegten, den Erlebnissen, die ihn formten, und der Zeit, in der er lebte …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 491
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Waldtraut LewinGoethe
Waldtraut Lewin
GOETHE
cbj ist der Kinder- und Jugendbuchverlag in der Verlagsgruppe Random House
www.cbj-verlag.de
Datenkonvertierung eBook:
Kreutzfeldt Electronic Publishing GmbH, Hamburg
www.kreutzfeldt.de
Gesetzt nach den Regeln der Rechtschreibreform (mit Ausnahme der Zitate)
1. Auflage 2004© 2004 cbj, MünchenAlle Rechte vorbehaltenLektorat: Burkhard HeilandISBN 978-3-641-01167-3
»Rätin, er lebt!«
Die Konstellation war glücklich: die Sonne stand im Zeichen der Jungfrau und kulminierte für den Tag; Jupiter und Venus blickten sie freundlich an, Merkur nicht widerwärtig, Saturn und Mars verhielten sich gleichgültig; nur der Mond, der soeben voll ward, übte die Kraft seines Gegenscheins um so mehr, als zugleich seine Planetenstunde eingetreten war. Er widersetzte sich daher meiner Geburt, die nicht eher erfolgen konnte, als bis diese Stunde vorübergegangen.«
Es herrscht helle Aufregung im Haus am Hirschgraben zu Frankfurt an diesem 28. August 1749. Die junge Frau des Hauses liegt in den Wehen, es ist ihr erstes Kind und die Geburt ist alles andere als einfach. Schon am 25. August hatten die Schmerzen eingesetzt und immer noch hat die Quälerei kein Ende.
Unruhig geht Johann Caspar Goethe in seinem Arbeitszimmer auf und ab. Nicht auszudenken, wenn seiner Frau etwas zustoßen sollte! Sie sind gerade ein Jahr miteinander verheiratet und Catharina Elisabeth ist einundzwanzig Jahre jünger als ihr Mann. Johann Caspar liebt seine Frau, seine »Caja«, wie er sie nennt, aber ein bisschen väterlich ist sein Verhältnis zu ihr wohl auch. Immerhin hat er mit einer Heirat gewartet, bis er achtunddreißig Jahre alt war. Da war man schon fast ein »Hagestolz«, ein eingefleischter Junggeselle.
Die Schreie Elisabeths dringen bis in sein Arbeitszimmer. Caspar Goethe ist am Ende mit den Nerven. Er ist ein Mann, der bekannt ist für seinen Ernst, für seine gravitätische Würde.
Aber nun möchte er am liebsten fort, einfach aus dem Haus laufen, bis alles vorbei ist. Jedoch wenn er an die durchdringenden Augen seiner Schwiegermutter denkt, die seit zwei Tagen hier im Hause ist und ihrer Tochter in diesen Stunden beisteht, kommt ihm diese Idee nicht sehr glücklich vor. Mit seinen Schwiegereltern, den Textors, darf es sich Caspar auf keinen Fall verderben. Das sind hoch angesehene Frankfurter Bürger. Der Vater seiner Frau hat das Amt eines Stadtschultheißen, das heißt, er ist Bürgermeister und außerdem, genau wie Johann Caspar selbst, Jurist. Die Mutter nun gar ist eine Person, die ihre Ahnenreihe bis auf den berühmten mittelalterlichen Maler Lucas Cranach zurückführen kann. Und: Sie hat Haare auf den Zähnen. Caspar hat ziemlichen Respekt vor ihr, vor ihrer scharfen Zunge, ihrem Witz und vor allem vor dem Blick dieser Augen.
Er zieht nervös seine goldene Repetieruhr aus der Tasche und lässt sie die verflossene Stunde schlagen. Elfmal klingt der zarte silbrige Ton durch den Raum. Bald ist es Mittag und Elisabeth, seine Caja, schreit und schreit. Ihre Stimme ist schon ganz heiser. Nein, er hält es nicht mehr aus, eilt über Stufen und Stiegen hinunter in den weitläufigen Hausflur.
Das Goethe’sche Anwesen am Hirschgraben ist das reinste Labyrinth. Es besteht eigentlich aus zwei kleineren Häusern, die mittels eines Durchbruchs miteinander verbunden sind, Stufen gleichen die Ungleichheit der Stockwerke aus, und über ein turmartiges Treppenhaus gelangt man zu den einzelnen Räumen. Verwinkelt, verschroben – das ist eigentlich nichts nach Johann Caspars Herzen. Er liebt das Klare, das Überschaubare. Aber das Haus gehört in Wahrheit seiner Mutter, und solange sie lebt, in ihren Räumen unten im Haus, ist an einen Umbau nicht zu denken.
Im Flur gibt es, wie in vielen Gebäuden in Frankfurt, neben der Eingangstür ein hölzernes »Vogelbauer«, eine Art Alkoven mit Gittern, nach draußen zur Straße hin. Man nennt das »Geräms«. So strömen Licht und Luft ins Haus, und dort sitzen gemeinhin in der warmen Jahreszeit die Frauen des Hauses, nähen, sticken, plaudern mit den Nachbarn und beobachten, was auf der Straße vor sich geht. Jetzt ist hier nur eine Magd, die ungerührt Salat verliest, als wenn ihre junge Madame sich nicht da oben abmühen würde. Als der Hausherr erscheint, steht sie kurz auf, knickst, wobei sie das Grünzeug in der Schürze festhält, und fährt in ihrer Arbeit fort.
«Was gibt es Neues? Hat Sie was gehört?«, fragt Caspar Goethe mit gepresster Stimme.
Die Frau zuckt gleichmütig die Achseln. «Hören? Na, hören kann man’s durch alle Zimmer.« Und auf die ungeduldige Handbewegung ihres Brotherrn: «Was weiß denn ich? Da frage der Herr doch bei der Wehmutter nach.«
Das ist zu viel für Johann Caspar. Er soll sich in diesen Weiberkram einmischen? Die Räume seiner Frau betreten, die in den Wehen liegt? Niemals. Einen kurzen, zaudernden Blick wirft er auf die verschlossene Tür hinten am Flur. Das ist das Reich seiner eigenen Mutter. Eine schweigsame, stets weiß gekleidete, große Person, die sich nichts mehr aus den Dingen der Welt macht. Sie ist schon achtzig Jahre – ein biblisches Alter fürwahr. Still und abgeklärt. Aber jetzt, das weiß er, ist auch sie oben in dem Zimmer, wo sich Caja plagt in dem Wochenbett mit den blau gewürfelten Vorhängen.
Er nimmt sich den Dreispitz vom Haken, greift nach dem Spazierstock aus Ebenholz mit dem Silberknauf und verlässt fluchtartig seine Wohnung, um eine Runde um den Häuserblock zu machen. Inzwischen schlägt die Uhr der Kirche Mittag.
«Du hast es überstanden, Töchterchen! Gott sei gepriesen! Und es ist ein Junge, der Stammhalter der Goethes ist da!«
Anna Margarethe Textor streicht ihrer Tochter liebevoll das schweißnasse Haar unter die verrutschte Haube, während die Hebamme sich um das Kind bemüht. Hinter dem Bett sitzt in ihrem Lehnstuhl die alte Frau Goethe, die tapfer alles mit durchgestanden hat.
Elisabeth atmet schwer. Ihre Augen sind geschlossen und sie ist bleich von der Anstrengung, ihr Gesicht, sonst lustig und fast noch kindlich, mit der etwas aufgeworfenen Nase und dem kleinen Doppelkinn, wirkt jetzt schlaff und mitgenommen. Sie tastet nach der Hand ihrer Mutter. Es ist ruhig im Raum. Sehr ruhig. Allzu ruhig.
Plötzlich fährt die junge Frau hoch, öffnet angstvoll die Augen. «Warum – warum schreit es nicht?«
«Warte nur, alles wird gut!«
«Warum schreit es nicht??«
«Die Wehmutter tut ihr Bestes...«
«Gütiger Gott, ist es tot? Ist mein Kind tot?«
«Du musst dich in Gottes Ratschluss fügen!«
«Nein! Müllern, was ist mit meinem Kind?!«
Die Hebamme Anna Dorothea Müller versetzt dem Knaben klatschende Schläge auf das Hinterteil, rüttelt und schüttelt ihn. Was Elisabeth von ihrem Lager aus nicht sehen kann – die beiden Großmütter bemerken es: Das Kind ist bläulich angelaufen, «ganz schwarz und ohne Lebenszeichen«, wie später berichtet wird.
«Eure Wehen waren zu schwach, Madame, das Kind hat zu lange gebraucht – es bekommt keine Luft in die Lungen!« «Bemühe Sie sich weiter, um Himmels willen!«
«Warmen Wein!«, ordnet Margarethe Textor an. «Schnell, hinein mit dem Kind. Und eine Herzmassage!«
Da ihr die Hebamme zu langsam und zu ungeschickt vorgeht, greift sie selbst mit zu.
«Gnädige Frau Rätin, lasst einen Priester kommen! Ich werde dem Kind die Nottaufe geben und...«
«Nichts ist mit Nottaufe! Wenn wir überhaupt jemanden holen, so ist es ein Arzt!«
«Das Kind ist tot!«
«Versteht Ihr Euer Handwerk so schlecht, Müllern, oder was ist los? Bemüht Euch!«
Anna Textor nimmt sich jetzt selbst des blassen Knaben an, drückt ihren Mund auf den seinen, bläst ihm Atem ein, packt ihn bei den Beinen, schüttelt ihn. Schon will sie aufgeben, da sagt die alte Frau Goethe leise: «Aber sieh doch, er atmet ja!«
Ein erster Atemzug hebt die Brust des Kindes. Und dann – der erste quäkende Schrei.
«Rätin, er lebt!« Die Hebamme ist in Tränen aufgelöst. «Das Kind lebt. Ein Wunder des Herrn!«
Elisabeth lässt sich in den hohen Kissenberg zurücksinken, gegen den sie sich bei der Entbindung, halb sitzend, gelehnt hatte. «Bringt ihn mir«, sagt sie schwach. «Bringt mir den Kleinen. Johann Wolfgang. Nach meinem Vater.«
Ihre Mutter mustert die Hebamme mit ihren schwarzen Augen. Es ist kein freundlicher Blick. «Pfuscherin«, murmelt sie vor sich hin. Und dann: «Ich werde meinen Eheherrn bewegen, anlässlich dieses Vorfalls, einen Geburtshelfer für die Armen zu bestellen und die Wehmütter besser unterrichten zu lassen. Sodass denn doch ein Segen entsteht aus dem, was heute beinah zu einer Katastrophe wurde.« – Es gibt viele Zeugnisse über diese Geburt, vor allem die Erzählungen Elisabeths selber, als sie dann eine alte Frau war und eine junge, in ihren großen Sohn verliebte Frau sie nach allen Einzelheiten aus dem Leben Wolfgangs ausfragte. Wer die junge Frau war? – Das hören wir später...
Elisabeth jedenfalls hatte ein gutes Gedächtnis. Sogar dass die Vorhänge ihres Wochenbettes blau gewürfelt waren, wusste sie noch – man hat später anhand ihrer Haushaltsbücher nachweisen können, dass dieser Stoff tatsächlich gekauft worden war.
So also hat sich die Geburt Johann Wolfgang von Goethes mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit abgespielt. Schwerer Sauerstoffmangel in der letzten Phase der Geburt hatte zu der Blaufärbung des Säuglings geführt. Häufig sind mit diesem Befund, falls das Kind überlebt, Hirnschäden verbunden. Da bedurfte es wahrhaftig einer glücklichen Planetenkonstellation! Das Kind war gesund – doch es hing am seidenen Faden, und der Junge wäre bei der Geburt gestorben. Es hätte nie einen Goethe gegeben. Und hier sollten wir auch gleich etwas klären: Die so oft bemühte Geschichte von Goethe als einem Ausbund an geistiger und körperlicher Gesundheit – sie ist eine Legende. Der größte Dichter Deutschlands war häufig schwer leidend, hatte Krankheiten, die die Wissenschaft heute als «psychosomatisch« bezeichnet – und er hatte Zeit seines Lebens Angst vor Tod und Sterben, blieb Begräbnissen fern, kümmerte sich nicht um schwer kranke Freunde und Angehörige. Herzlos? Oder vielleicht ein im Unterbewussten verankertes Erlebnis – das Erlebnis, sozusagen im Moment der Geburt «dem Tod von der Schippe gesprungen« zu sein? Wir können es nur vermuten.
Über andere Dinge wissen wir dafür umso genauer Bescheid. Denn im hohen Alter hat sich der Dichter die Mühe gemacht, seine Lebenserinnerungen aufzuschreiben. Der Titel dieses Buches heißt «Dichtung und Wahrheit«, und es sind viele Vermutungen darüber angestellt worden, in welchem Anteil sich nun die Dichtung, beziehungsweise das Ausgedachte, zur Wahrheit befindet. Keiner weiß es so genau. Und Goethe? Was wusste er noch wirklich, als Mann von fünfzig Jahren? Wie genau sind überhaupt Erinnerungen? Vieles erfuhr er von seiner Mutter selbst. Es hat keinen Sinn, darüber zu spekulieren. Halten wir uns an das, was als Fakten gilt.
Und was ist nun mit diesem Horoskop, das zu Beginn dieses Buches über Johann Wolfgang steht?
Wir Heutigen neigen ja zu der Ansicht, Horoskope als etwas für abergläubische Gemüter und ängstlich in die Zukunft blickende Schwächlinge anzusehen. Natürlich haben sich auch Profi-Astrologen von heute an die Deutung der Goethe’schen Sterne herangemacht. Und wie nicht anders zu erwarten, konnten sie im Nachhinein alle wesentlichen Charaktereigenschaften, Lebensumstände und Entwicklungen des großen Mannes aus den Konstellationen herauslesen. Darüber kann man nur schmunzeln. Es ist einmal mehr ein Beleg dafür, wie dehnbar diese Interpretationen sind. Man findet immer das, was man zu finden hofft oder erwartet.
In früheren Jahrhunderten war das anders. Astrologische Schicksalsdeutungen galten schon seit der Antike durchaus als eine ernst zu nehmende Wissenschaft. Fürstengeschlechter und Königshäuser scheuten keine Mühe, bei der bevorstehenden Geburt eines Kindes die Sterndeuter zu befragen, ja sie möglichst bei der Geburt direkt dabeizuhaben. Denn es kam darauf an, wirklich auf den Punkt genau die sich ständig verändernde Konstellation der Planeten und Fixsterne zueinander festzuhalten. Schon geringste Abweichungen, Sekunden nur, konnten ein völlig anderes Persönlichkeitsbild, völlig andere Zukunftsaussichten ergeben. So glaubte man.
Uns ist nicht bekannt, ob bei der Geburt des kleinen Johann Wolfgang tatsächlich ein Astrologe anwesend war oder ob Goethe sein Geburtshoroskop später selbst erstellt hat. Auf alle Fälle wusste er gut Bescheid über Astrologie, denn er glaubte, dass im Kosmos alle Dinge miteinander verbunden sind, und brachte das in seinen Werken auch des Öfteren zum Ausdruck. Und wichtig genug nahm er sich selbst allemal.
Aber es war durchaus nicht ungewöhnlich, dass auch reiche und angesehene Bürgerfamilien im 18. Jahrhundert einmal einen Astrologen bemühten, wenn es um so etwas Wichtiges wie die Geburt eines »Stammhalters« ging. Und bestimmt war so ein Fachmann, so ein »Wissenschaftler«, nicht billig.
Das allerdings wäre für die Eltern dieses Kindes keine Hürde gewesen. Geldsorgen kannte man im Hause Goethe in Frankfurt am Main nicht. Das Kind, das am 28. August 1749 zur Welt gekommen war, wurde, wie man so sagt, mit einem silbernen Löffel im Mund geboren. Aber woher kam das Vermögen? – Der ganze Segen war ererbt.
Ein behagliches Hauswesen
Caspar Goethe, Erzeuger des kleinen Wolfgang, musste dafür keinen Finger krumm machen. Sein Vater, ein Gastwirt und Schneidermeister im Thüringischen, hatte eine reiche Witwe geheiratet und geschickt verstanden, aus viel Geld sehr viel Geld zu machen. Der Sohn konnte Jura studieren, bereiste halb Europa, nicht nur, um Land und Leute, sondern vor allem, um Kunst und Literatur kennen zu lernen, und ließ sich schließlich in Frankfurt am Main nieder. Das Doppelhaus am Hirschgraben wurde vom Geld seiner vermögenden Mutter erstanden. Im Keller des Hauses lagerten die großen, alten Weinfässer aus der Gastwirtschaft des Vaters, kostbare Tropfen, die nur zu feierlichen Anlässen angezapft wurden und viel später beim Verkauf stattliche Summen erbrachten.
Als Caspar Goethe Elisabeth Textor heiratete, besaß er ein beachtliches Vermögen. Zum Haus dazu kamen zwei Gartengrundstücke, ein Weinberg und – sage und schreibe – siebzehn Geldsäcke, gefüllt mit Gold, nach Währungen geordnet. Insgesamt war Caspar Goethe ein Mann von runden hunderttausend Gulden Besitz.
Natürlich fragt man sich: Wie viel wäre das heute? Man kann ungefähr davon ausgehen, dass ein Gulden heute so um fünfzig Euro wert ist. Aber eins zu eins lässt sich das nicht übersetzen. Die Lebenshaltungskosten präsentierten sich damals völlig anders als heute. Luxusgüter – wie zum Beispiel Kaffee, Kakao, Tee und Zucker – waren nahezu unerschwinglich. Die silberne Zuckerdose im Hause Goethe wurde nach jeder Benutzung von der Hausfrau eigenhändig im Schrank eingeschlossen, denn Rohrzucker wurde aus Übersee importiert, die Herstellung aus Rüben war noch unbekannt. Dafür waren Löhne und Gehälter extrem niedrig. Eine Magd erhielt zwanzig Gulden im Jahr (mit freier Kost und Logis), ein Diener oder die Köchin – eine wichtige Person im Haushalt – fünfundzwanzig. Ein Anzug für den kleinen Wolfgang dagegen kostete fünfzig Gulden, also zwei Jahresgehälter eines Bediensteten. Ein Universitätsprofessor erhielt gerade einmal vierhundert Gulden Jahresgehalt! Und Caspar Goethes Schwiegervater, der das höchste Amt der Stadt Frankfurt innehatte, verdiente nicht einmal halb so viel, wie sein Schwiegersohn an jährlichen Einkünften erzielte.
Es gab demzufolge reichlich Personal im Haus am Hirschgraben, Köchin, Mägde und Untermägde, Schreiber, die Ammen für die Kinder, Diener, später Hauslehrer. Und das alles unterstand der neunzehn Jahre jungen Elisabeth...
Wolfgangs Vater hatte sich in Frankfurt zwar um städtische Ämter beworben, aber das klappte nie. Später kaufte er sich den Titel »Kaiserlicher Rat«. Sein Schwiegervater, der Bürgermeister, war ebenfalls Kaiserlicher Rat, er allerdings »ehrenhalber«, das heißt vom Kaiser selbst ernannt. Der Titel hatte Caspar Goethe runde dreihundert Gulden gekostet – ich weiß nicht, wie viel man heute hinblättern muss, um ein Ehrenamt wie die Konsulwürde irgendeines Zwergstaates zu erwerben. Obwohl er also weder Amt noch Beruf hatte, verwendete er seine Zeit und seinen Reichtum sinnvoll, sammelte mit Hingabe Gemälde und hatte eine hervorragende und viel genutzte Bibliothek. Seine Leidenschaft war es, Bildung weiterzuvermitteln, sei es, indem er seine Kinder Johann Wolfgang und die bald darauf geborene Cornelia unterrichtete oder seine junge Frau. Die Sammelleidenschaft des Vaters hat sich dann auf den Sohn vererbt. – Und wenn man das überlieferte Porträt der energischen Mutter Elisabeths ansieht, weiß man auch, woher Johann Wolfgang noch etwas geerbt hat: nämlich sein Aussehen. Große dunkle Augen, eine ziemlich lange Nase, eine hohe Stirn. Das alles stammt von der Großmutter mütterlicherseits.
Goethes Mutter ist zur Zeit seiner Geburt blutjung, gerade neunzehn, Johann Caspar einundzwanzig Jahre älter als sie. An ihr probiert er zuerst seine pädagogischen Neigungen aus. Es ist überliefert, dass er ihr Unterricht im Italienischen gab, sie im Singen und Klavierspiel unterweisen ließ und sie fleißig zum Schreiben anhielt. Letzteres freilich hat nicht viel bewirkt, denn wenn man später die herzerfrischenden Briefe Elisabeths liest, findet man in ihnen zwar viel Humor und Lebensweisheit, aber auch eine haarsträubende Orthographie, die ihr heute auf der Schule bestimmt eine »Fünf« in Deutsch eingebracht hätte.
Wie Elisabeth selbst zu dem älteren Ehemann stand, darüber ist uns nichts überliefert. Die sonst so offene und beredte Person schweigt darüber bis an ihr Lebensende. Jedoch aus Caspars minutiös in lateinischer Sprache geführtem Haushaltsbuch wissen wir, dass er seine junge Gattin mit Geschenken verwöhnte, und der eher pedantische Mann findet für sie zärtliche Worte: »Carissima Caja – (teuerste Caja) – suavissima costa (süßeste Gefährtin).« Also wird wohl zwischen den beiden alles gestimmt haben.
Elisabeth war eine fröhliche, lebensbejahende und vitale Person. Mithilfe ihrer Mutter hatte sie den großen Haushalt bald bestens im Griff und wurde die Seele des Anwesens am Hirschgraben. In ihren Armen und an ihrer Seite verbrachte Johann Wolfgang seine erste Lebenszeit, obwohl sie weder ihn noch ihre anderen Kinder je gestillt hat. Stillen galt als ungesund für die Mutter. Man besorgte eine Amme. Bei dem damaligen Stand der Medizin und der Hygiene gehörte eine hohe Kindersterblichkeit zum Alltag, auch in Häusern, in denen man sich beste Pflege und einen berühmten Arzt leisten konnte. (Kindersegen, wie er der Kaiserin Maria Theresia von Österreich beschert wurde – zwölf höchst lebendige kleine Erzherzöge und Erzherzoginnen –, gehörte zur Ausnahme.) Abgekochtes Wasser mit Kräutern war das einzige Desinfektionsmittel, außer man griff, wie die Frauen bei Goethes Geburt, auf erwärmten Wein zurück, dessen keimtötende Wirkung mehr als zweifelhaft ist. Und wenn man sich überlegt, dass ein Säugling gleich nach seiner Geburt von Kopf bis Fuß mit einem Wickelband umschnürt wurde, als wäre er eine Mumie, wundert man sich, dass so viele Kinder ohne schwere Wachstumsschäden davonkamen. Überlebte so ein kleines Wesen das kritische erste Jahr, dann lauerten Kinderkrankheiten, gegen die die damalige Medizin machtlos war.
Der kleine Wolfgang konnte gerade die ersten Worte sprechen, als seine Wiege schon wieder belegt wurde: Im Januar des nächsten Jahres kam Cornelia Friederica Christina zur Welt – über lange Jahre Wolfgangs zärtlich geliebte Spielgefährtin, die mit ihm durch dick und dünn ging.
Von den insgesamt fünf Kindern, die Elisabeth Goethe zur Welt brachte, überlebten nur diese beiden. Der kleine Jacob begleitete Wolfgang und seine Schwester noch durch die ersten Jahre, zwei weitere Geschwisterkinder starben schon bald nach der Geburt. Es ging Schlag auf Schlag, und für die junge Frau des Hauses muss die Belastung mit fünf Kleinkindern, trotz aller Hilfe durch Ammen und Mägde, keine Kleinigkeit gewesen sein.
Der Junge, der da wohl behütet und zärtlich umsorgt im verwinkelten Haus am Hirschgraben aufwächst, zeigt zunächst nichts, was auf besondere Gaben hindeuten würde. Wolfgang ist ein ganz normales Kind – freilich fantasiebegabt und überaus sensibel. Und so weckt das verwinkelte alte Haus mit den gruseligen, unüberschaubaren Ecken und Gängen, Treppen und Stiegen, wo man allein nicht gern entlanggeht, dunkle Ängste in dem Knaben. Zudem: Ammen, Mägde und andere Bedienstete sind bestimmt nicht sehr zimperlich im Umgang mit so einem kleinen Jungen. Kinder zu erschrecken, sie mit Spukgeschichten zu ängstigen – das ist ein Erwachsenen- »spaß«, der auch heute zum Teil noch im Schwang ist. Da wartet hinter irgendeiner Tür der schwarze Mann, der sich Kinder holt, die nicht artig sind, da kommt der Geist irgendeines Verstorbenen ohne Kopf um Mitternacht herbei und schwebt klagend durch den Raum, wenn man eine kleine Notlüge gebraucht hat... Jeder, der den »Struwwelpeter« gelesen hat, weiß, dass dergleichen »schwarze Pädagogik« gang und gäbe war in der Kindererziehung, und wenn Elisabeth Goethe keine Freundin von solchem Unsinn war, so ist es ihr in dieser ihrer Zeit umso höher anzurechnen. Dass ihr ganzes Personal die gleichen Ansichten hatte, ist kaum anzunehmen.
Johann Wolfgang reagiert auf die undurchschaubaren Dunkelzonen im Haus wie auf die Erzählungen der Dienstboten mit nächtlichen Albträumen. Schreiend und weinend im Schlaf, schreckt er nachts die Mutter auf.
Sie hat ihn, so ist es berichtet, mit dem Klang eines Glöckchens aus diesen nächtlichen Fantasien geweckt, ist bei ihm gesessen, und gemeinsam haben sie die Spukgeschichten mit einem guten Ende versehen: Der Geist ohne Kopf wird von dem braven Kind erlöst und der schwarze Mann wird von der Sonne beschienen und bekommt ein weißes Gesicht... So erfährt der Junge früh den Trost, dass man Geschichten selbst verändern kann und neue dazu erfinden.
Im Haus gibt es, vom Vater und ein paar Angestellten abgesehen, nur Frauen. Der kleine Wolfgang ist im Allgemeinen umgeben von zärtlichen, um ihn besorgten Frauen. Die Mutter, die Amme, die Mägde, die Köchin erzählen bestimmt nicht nur Geschichten, sondern stecken ihm hin und wieder einen Leckerbissen zu, die Großmutter Goethe in ihrem geräumigen Zimmer, das stets für den Enkel offen ist. Oft spielt er seine Spiele direkt vor ihrem Lehnstuhl und sie erzählt ihm ihre Geschichten.
»Meine Großmutter hatte ein Mährchen vom Magnetenberg, die Schiffe, die zu nah kamen, wurden auf einmal allen Eisenwerks beraubt, die Nägel flogen dem Berge zu, und die armen Elenden scheiterten zwischen den übereinander stürzenden Brettern«, schreibt Goethe später in »Dichtung und Wahrheit«. Sicher wird ein solches Märchen wieder Anlass für Albträume des Kindes gewesen sein. Aber dann kam die Mutter mit dem Glöckchen und sie erfanden sich ein anderes Ende dazu.
Ein Meer von Geschichten dieser und jener Art. Anders waren wohl die selbst erfundenen Erzählungen der frohgemuten Mutter. Bunt, farbig, abenteuerlich.
Im Übrigen war der hübsche Junge der Liebling aller, überall gern gesehen, ob in der Wäschekammer oder im Garten, in den Vorratsräumen, in denen die leckeren Dörrpflaumen und getrockneten Apfelschnitze auf luftigen Holstiegen lagen, oder auf der Bleiche, dem großen Rasenplatz hinter dem Haus, wo die Laken in der Sonne ausgebreitet wurden, um weiter aufzuhellen, und wo die Mägde den süßen, frechen Kerl mit Wasser bespritzten, um ihn daran zu hindern, auf der frischen Wäsche herumzuspazieren. Wir können uns vorstellen, wie sich der kleine Wolfgang in die Küche schleicht, um ein bisschen Topfgucker zu spielen. Was wird es zu Mittag geben? Vielleicht Pastetchen als Vorspeise, Aal in Weinsoße, Lammfleisch in Brühe und als Nachtisch Zitronenkreme? Bestimmt lässt ihn die Köchin kosten. Aber zu seiner Überraschung findet er die Mutter heute selbst in der Küche vor, Schürze vor den umfangreichen Röcken, die Ärmel hochgeschlagen, das hübsche, energische Gesicht gerötet von der Hitze des Herdfeuers. Vielleicht will sie ein neues Gericht ausprobieren, ein Rezept, das sie von ihrer Mutter hat, gefüllte Kalbsbrust mit Kapern. Fröhlich begrüßt sie ihren »Hätschelhans« mit einem Kuss, nimmt ihn in den Arm, verwirrt ihm spaßhaft die braunen Locken. Wie wäre das, wenn er selbst mal etwas kocht?
«Aber Mama, ich kann doch nicht kochen. Ich bin viel zu klein. Ich komme nicht an den Herd.«
«Wir stellen für dich eine Fußbank auf!«, erwidert Elisabeth. «Komm nur, ich zeig dir, wie man’s macht. Eine von deinen Lieblingsspeisen. Such dir was aus.«
Der Junge muss nicht lange überlegen. «Speckpfannkuchen mit Wirsingsalat«, sagt er begeistert.
«Gut!« Die Mutter lacht. «Das ist nicht einmal schwer. Während die Magd den Speck schneidet und anbrät, rühren wir beide den Teig. Du darfst zuerst die Eier aufschlagen. Ich geb das Mehl zu und dann schlägst du alles schaumig.« Eifrig folgt der Kleine den Anweisungen Elisabeths. Und diese gemeinsamen Kochstunden bleiben unvergesslich. Viele Jahre später, als berühmter Autor und hoch dekorierter Minister in Weimar, wird Goethe dem kleinen Carl von Stein, dem Sohn seiner Geliebten, in seinem Gartenhaus an der Ilm das Zubereiten von Speckpfannkuchen beibringen...
Gleichsam als Nachtisch wird es dann eine von Mutters Geschichten gegeben haben. Elisabeth hatte eine lebhafte Phantasie und verstand es, die Einbildungskraft ihrer Kinder zu wecken und ihnen freie Hand im Weiterspinnen und Zu-EndeFühren einer Fabel zu lassen.
Sie berichtet: »Da saß ich, und da verschlang er mich bald mit seinen großen schwarzen Augen, und wenn das Schicksal irgend eines Lieblings nicht recht nach seinem Sinn ging, da sah ich, wie die Zornader an seiner Stirn schwoll und wie er die Tränen verbiß... Nicht wahr, Mutter, die Prinzessin heiratet nicht den verdammten Schneider, wenn er auch den Riesen totschlägt.«
Dies Geschichtenerzählen, so meinen manche Psychologen, könnte das Zentrum gewesen sein, das die geniale Begabung des Kindes weckte.
Die Mutter hat unendliches Verständnis für ihren Erstgeborenen und auch seine dummen Streiche quittiert sie noch mit Lachen. Überliefert ist die Anekdote, dass der kleine Goethe, allein zu Haus und angestachelt von Zuschauern auf der Straße, das gesamte irdene Geschirr des Hauses, so weit es in seiner Reichweite war, aus dem »Geräms«, dem Gitterwerk neben der Tür, hinaus auf das Pflaster wirft. Natürlich bleibt kein Stück heil. Als Elisabeth nach Haus kommt und den Polterabend sieht, kommt ihr das verlorene Geschirr unwichtig vor im Vergleich zu der unschuldigen Freude, die ihr Junge empfindet, und sie stimmt in sein Lachen ein. Also von autoritärer Erziehung mütterlicherseits keine Spur.
Ein Jahr vor ihrem Tode, 1753, macht die Großmutter Goethe den Kindern ein Marionettentheater zum Geschenk, und die beiden »Großen«, Wolfgang und Cornelia, sind bald eifrig dabei, Theater zu spielen, Geschichten aufzuführen, von biblischen Vorkommnissen bis zu den volkstümlichen Stoffen der professionellen Marionettenbühnen, wie unter anderem der »Doktor Faustus«.
Der »Faust«-Stoff geistert seit dem Mittelalter sowohl als volkstümlicher »Roman« als auch als Jahrmarkts-Theaterstück durch die literarische Landschaft. Die abenteuerliche Geschichte vom Gelehrten, der seine Seele dem Teufel verkauft, um Wunderheilungen und Zaubertaten zu vollbringen, hat die Fantasie des Volkes angeregt. Faust ist das Bild des Renaissance-Wissenschaftlers, so wie er sich in den Augen der einfachen Leute darstellt: eben ein Teufelskerl. Goethe wird Zeit seines Lebens nicht von dieser Figur loskommen.
Er selbst meint, dass dieses Spielen mit der Marionettenbühne bei ihm den Grundstein für seine »theatralische Sendung« gelegt hätte, als Stückeschreiber – und auch als Chef einer Bühne, des Weimarer Hoftheaters, das er prägte als Intendant und Regisseur.
Schule? Nein danke.
Vater Caspars Ansichten über Kindererziehung sind ganz bestimmt anderer Art, aber offenbar kann er sich zunächst einmal gegen die Frauenzimmer nicht durchsetzen. Fest steht, dass in seinem Ausgabenbuch nicht ein einziges Kinderspielzeug verzeichnet ist, bis auf eben dies kleine Theater, das er im Auftrag seiner Mutter gekauft hat. Offenbar müssen Elisabeth und die Großmutter solche Anschaffungen aus eigener Tasche oder vom Haushaltsgeld bestreiten. Caspar versucht auch, seine junge Frau von allen Theateraufführungen in der Stadt fern zu halten, für dergleichen »Mummenschanz« fehlt dem ernsten Mann der Sinn.
Dafür ist er ganz besessen von Bildung. Abgesehen von der Unterweisung, die er seiner Frau und seinen Kindern angedeihen lässt, schickt er 1752 seinen Erstgeborenen in eine »Spielschule«. Cornelia und der früh verstorbene kleine Bruder werden sie auch besuchen. Man muss sich darunter so etwas wie ein Gemisch aus Kindergarten und Vorschule denken – jedenfalls können die beiden Ältesten lesen und schreiben, als sie diese Schule wieder verlassen.
Nach dem Tod der Goethe-Großmutter beginnt Wolfgangs Vater mit dem Umbau der beiden verwinkelten Häuser, er lässt sie entkernen und errichtet ein übersichtliches, modernes Anwesen mit großen Fenstern, geschwungenen Treppen, großzügigen Vorsälen und Platz für seine Sammlungen – nahezu zwanzig Zimmer. Seine Liebe zu Italien und der antiken Kunst hat gigantische Ausmaße. Kupferstiche der südlichen Landschaft und Zeichnungen der Bauwerke Palladios, des großen Architekten der Renaissance, der die Bauproportionen der alten Griechen und Römer wiederbelebt hat, sind überall im Haus verteilt.
Während der Bauarbeiten bleibt die Familie im Haus. Für Elisabeth sicher eine Zumutung – aber die Kinder sind begeistert Jeden Tag gibt es etwas Neues. Es wird, wie Goethe schreibt, «die Unbequemlichkeit von der Jugend weniger empfunden«. Es war möglich, «sich auf Balken zu schwingen und auf Brettern zu schaukeln«. Die Mutter lebt in ständiger Angst um ihre wilde Brut und der jüngere Bruder bricht sich dann auch tatsächlich Arm oder Bein...
Während dieser Zeit besuchen Wolfgang und Cornelia das erste und einzige Mal in ihrem Leben eine öffentliche Schule, die Schellhaffer’sche Lehranstalt. Schulpflicht war noch unbekannt, es hing vom Geldbeutel und vom Bildungshunger der Eltern ab, wie und wo man seine Kinder unterrichten ließ.
Die Schule bringt aber jede Menge Ärger ins Haus. Wolfgang, der es gewohnt ist, in seinem kleinen, häuslichen Universum der absolute Mittelpunkt zu sein, ist nun auf einmal einer unter vielen. Für ihn ist es selbstverständlich, dass er die Nummer eins ist, und er kann nicht verstehen, dass er sich gegen die anderen Jungen erst durchsetzen und bewähren muss. Er ist hochnäsig und arrogant, und außerdem langweilt er sich wahrscheinlich zu Tode: Der vorzügliche Privatunterricht in der Zeit davor hat sich seinem Lerntempo angepasst; hier richtet man sich nach dem Schwächsten – und außerdem weiß er das meiste ohnehin schon. Er muss für die anderen ein Ekel sein. So gerät er in Prügeleien, offenbar wollte man es dem vornehmen, verwöhnten Jungen zeigen. Er weiß zu berichten, dass er sich ganz gut gewehrt hat.
Der Junge seinerseits versucht, sein Selbstwertgefühl mit Angebereien und Flunkereien vor den Mitschülern wiederherzustellen. Er gibt an mit der Stellung seines Großvaters, des Bürgermeisters Textor, der angeblich im Rat auf einem Thron unter dem Bild des Kaisers sitzt. Die empörten Knaben kontern mit einem Gerücht: Das viele Geld des Hauses Goethe stamme gar nicht von seinem Großvater, dem simplen Gastwirt und Schneidermeister, sondern die Großmutter Cornelia hätte in ihrer Jugend einen reichen und vornehmen Liebhaber gehabt, und dessen Sohn sei Caspar Goethe. Die fantastische Lügengeschichte macht wie ein Lauffeuer die Runde durch Frankfurt. Wolfgang ist zutiefst verunsichert. Zweifelnd forscht er im Haus nach Spuren einer verborgenen Wahrheit, beginnt, seinen Vater mit anderen Augen zu sehen. Die Familie der Textors, die Familie der Mutter, kommt ihm auf einmal viel wichtiger und viel besser vor.
Inwieweit Caspar diese Gerüchte zu Ohren gekommen sind, wissen wir nicht. Auf alle Fälle nimmt er seine Kinder aus der Schellhaffer’schen Lehranstalt. Sie werden nie wieder eine öffentliche Schule besuchen. Der Vater unterrichtet selbst in alten und neuen Sprachen, in Religion und Bibelkunde, in Naturwissenschaften und Musik, und zwar, das ist das Besondere: Cornelia nimmt gleichberechtigt mit ihrem Bruder am Unterricht teil. Später kommen Privatlehrer dazu, und von Französisch über Zeichnen, Tanzen und Fechten wird nichts ausgelassen, was man damals können und wissen musste, um standesgemäß auftreten zu können.
Beide Kinder sind hochbegabt und eifrige, wissbegierige Schüler. Während Cornelia äußerst gewissenhaft ihre Hausaufgaben macht und sich besonders durch ein virtuoses Klavierspiel hervortut, liegt Wolfgangs Begabung auf dem Gebiet der Sprachen, er hat »mehr Plapperwerk als Gründlichkeit«.
Er lernt ungeheuer schnell, es fließt ihm zu, und vor allem, es macht ihm Spaß zu lernen. Das können selbst die pedantischen Unterrichtsmethoden von Vater Caspar nicht hintertreiben. Denn der Papa ist unerbittlich. Fällt eine Unterrichtsstunde durch Krankheit aus, so wird das doppelte Pensum nachgeholt. So werden die Stunden bei ihm oft zur Qual. Und was einmal begonnen wurde, wird zu Ende geführt. Auch bei der gemeinsamen Lektüre.
»Hatten wir an langen Winterabenden im Familienkreis ein Buch angefangen vorzulesen, so mussten wir es auch durchbringen, wenn wir gleich sämtlich dabei verzweifelten.« Zum Beispiel ein Buch über die Geschichte der Päpste! Eine unendlich langweilige Aufzählung von mehr oder weniger belegbaren Ereignissen. Wahrscheinlich langweilt sich Caspar Goethe bei diesem Buch genauso wie seine Familie – aber es war angefangen und musste zu Ende gebracht werden. »Vor diesen didaktischen und pädagogischen Bedrängnissen flüchteten wir gewöhnlich zu den Großeltern.« Sicher ist Elisabeth mit den Kindern gemeinsam zu den weltläufigen Textors ausgerissen, wenn es ihr Mann zu bunt trieb.
Immerhin – im Hause am Hirschgraben wird weder geprügelt noch anderweitig drakonisch gestraft. «Wer sein Kind liebt, der züchtigt es!« Dieser Bibelspruch bestimmt die Pädagogik vieler Jahrhunderte. Sobald man den Windeln entwachsen war, gab es bei jedem noch so kleinen Vergehen die Rute. In einer Zeit, in der es gang und gäbe war, ungezogene Kinder auf Erbsen knien zu lassen, sie in dunkle Keller einzusperren, in Säcken im Kamin zu «räuchern« oder bis aufs Blut zu peitschen, ist das Goethe’sche Haus ein Muster an Fortschritt. Aber die Wutausbrüche Caspars sind gefürchtet. Er ist der Herr im Haus, und wenn er brüllt, ist es eben, als wenn der Löwe des Rudels seine Stimme erhebt.
Im Jahr 1758, also mit neun Jahren, bekommt Wolfgang zuerst die Röteln, dann, zum Entsetzen der Familie, die Pocken. Keines der Goethe’schen Kinder war geimpft, obwohl es die «Kuhpocken-Inoculation« bereits gab. Aber da man sich weder in der zu beachtenden Hygiene noch in der zu verabreichenden Dosis auskannte, war diese Methode mit Recht umstritten. Wolfgang überlebt – die blassen Narben zieren zeitlebens sein Gesicht. Aber er steckt den jüngeren, zarteren Bruder an. Jacob stirbt 1759 und im selben Jahr folgt ihm eine kleinere Schwester nach. Die Goethe-Kinder sind wieder zu zweit, Wolfgang und Cornelia, ein Herz und eine Seele.
Frankfurter Katastrophen
Es ist Krieg. Der Siebenjährige Krieg, in dem sich König Friedrich II. von Preußen mit der österreichischen Kaiserin Maria Theresia um den Besitz der schlesischen Silbergruben raufte, geht an Frankfurt am Main nicht vorüber – und er schlägt auch eine tiefe Bresche in den Familienfrieden. Bürgermeister Textor und seine Frau, also die Großeltern mütterlicherseits, waren Parteigänger Österreichs, Wolfgangs Vater Caspar Goethe war ein Anhänger des Preußenkönigs.
In diesem Krieg versuchen alle Großmächte Europas mitzumischen, Frankreich auf der Seite Österreichs. Bündnisse, Beistandspakte und Feindschaften innerhalb des Kontinents sind in dieser Auseinandersetzung – wie auch in vorhergegangenen Feindseligkeiten – für unsere Augen so willkürlich wie instabil. Dass später eine österreichische Kaisertochter namens Maria Antonia als Marie Antoinette französische Königin werden soll, hat nichts mit dieser Liga zu tun. Man balanciert und trickst sich einfach aus – und der aufstrebende preußische Staat ist den meisten anderen ein Dorn im Auge, also sieht man zu, dass man Friedrich II. duckt.
1759 bekommt Frankfurt eine französische Besatzung – willkommen geheißen von Bürgermeister Textor! Überall in der Stadt werden Soldaten in Privathäuser eingewiesen. Und natürlich kommen die Offiziere in die schönsten Häuser – so auch in das am Hirschgraben. Caspar Goethe bricht Knall und Fall die Beziehungen mit den Schwiegereltern ab. Man grüßt sich nicht einmal mehr auf der Straße. Für Elisabeth und ihre Kinder sicher ein grässlicher Zustand.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!