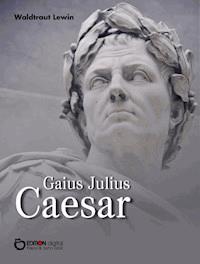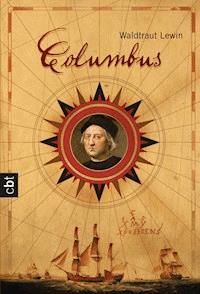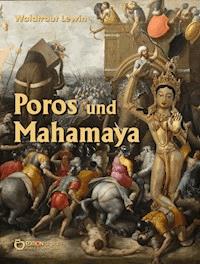7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Reisen in Italien - Versuch der Annäherung an ein Land, das zum Handlungsort bekannter Romane der Autorin wurde. Die erste Reise führt nach Rom, Venedig und Mailand, zu den Weinbauern der Campagna, aber ebenfalls nach Pompeji. Faszination der Historie, beeindruckende Gegenwart - Altes und Neues durchdringen einander.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 151
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Impressum
Waldtraut Lewin
Katakomben und Erdbeeren
Notizen einer italienischen Reise
ISBN 978-3-95655-540-4 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien erstmals 1977 im Verlag Neues Leben Berlin.
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta Foto: Andrea Grosz
© 2017 EDITION digital® Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.edition-digital.de
Reisen, sagt der junge Arzt aus Rostock, der auch Bücher schreibt, Reisen erlebt man eigentlich erst hinterher. Vorher: Angst vorm Unbekannten, dabei: Blendung durchs Neue und andere. Erst danach weiß man, was es war. Weiß man s wirklich?
Präludium
Wer als erster die Meinung aufgebracht hat, dass Reisen ein Vergnügen ist, muss ein Schwindler oder ein Tollkühner gewesen sein.
Es beginnt mit Kofferpacken. Allein die Entschlüsse, die notwendig sind über den Inhalt der Koffer, über das, was man weglässt oder nicht, fordern eine Konzentration wie die Generalprobe einer Wagneroper mit Chor und Statisten - oder, um im Stil des Reiselandes zu bleiben, wie die Inszenierung von Verdis „Aida“ auf der Freilichtbühne zu Verona mit Elefanten und Bären. Schließlich hat man sich auf das Allernötigste beschränkt und stellt fest, dass die Gepäckstücke so schwer sind, als wenn sie voller Wackersteine wären. Allein das Wissen darum, dass man die Koffer von Flughafen zu Flughafen, vom Bahnhof zum Hotel und zurück wird schleppen müssen, kann einem jeden Reisemut rauben.
Dann kommen diese entnervenden Geschichten mit dem Pass und dem fremden Geld, die Frage, ob man der Landessprache denn auch wirklich so mächtig ist, wie man sich erkühnt hat anzunehmen. Schlaflose Nächte vorher. Man träumt von verpassten Maschinen und unverständlichen Durchrufen auf Airports und kann nachts kein Wort Italienisch mehr.
Irgendwer erzählt dir, Handtaschenabschneider lauerten in allen südlichen Ländern hinter jeder nur erdenklichen Ecke und klauten dir deine paar Devisen vom Motorrad aus, und rät dir, dein Geld im Brustbeutel zu verstauen. - Überhaupt: eine allein reisende Frau! Freiwild, meine Dame!
Und irgendwann, wenn man eigentlich schon keine Lust mehr hat, steht man dann tatsächlich auf dem Flugplatz, nach Landessitte bei uns hier eine Stunde zu früh bestellt, wühlt in der Handtasche nach den verlangten Papieren, Zählkarte, Zollerklärung, die immer gerade im anderen Fach stecken, überblickt die Gepäckstücke wieder und wieder, versteht tatsächlich die Durchrufe nicht, landet am falschen Schalter, versucht mit Grandezza zu kaschieren, dass man sich wie das berühmte Huhn in der Bahnhofshalle fühlt, und war noch nie so voll Sehnsucht nach seiner gemütlichen Provinzwohnung.
Ja, es übertrifft alle Prophezeiungen.
Diese Flugzeuge, in denen man immer das gleiche Menü bekommt, diese lärmenden Handballmannschaften auf dem Weg zu irgendeinem Länderspiel, diese mehr oder weniger biederen Handlungsreisenden - und immer Wolken. Ich bin noch nie geflogen, wenn keine Wolken waren.
Und während die Italiener die zollfreien „Lord“ stangenweise kaufen, sitze ich trostlos und grimmig da und finde, dass man dem Reisenden ein Denkmal setzen sollte. Und der reisenden Frau erst recht.
Auf dem Flughafen von Mailand ist dicker Nebel und kein Grad Wärme mehr als bei uns, und ich habe auch gar nichts anderes erwartet. Mit meinen Koffern schleppe ich mich dahin und warte darauf, dass Zoll- und Passkontrolle mich zerfetzen werden. Aber es ist viel schlimmer. Sie schenken mir überhaupt keine Aufmerksamkeit. Der routinemäßige Stempel, die routinemäßigen Fragen. Nie war ich so verlassen. Als echter Hinterwäldler habe ich geglaubt, alle Welt müsse sich für mich interessieren. Ganz Italien, habe ich wahrscheinlich angenommen, wartet nur auf die Signora L., um sie übers Ohr zu hauen, zu berauben, sich ihres Gepäcks zu bemächtigen und sie in einer dunklen Ecke zu vergewaltigen. Ich bin über nichts so erstaunt wie darüber, dass keiner etwas von mir will.
Immerhin, das weiß ich schon an diesem nasskalten, dämmrigen Nachmittag auf Mailands Allerweltsflughafen, irgendwann, sicher sehr bald, wird dieses Gefühl des Verlassenseins umschlagen in Unbekümmertheit, ja Rausch, und das „Hier kennt mich niemand“, das ich jetzt noch entgeistert vor mich hin murmele, wird dann die Losung des Entzückens sein. Irgendwann (spätestens, wenn ich diese Gepäckstücke los bin) wird meine Entdeckerlust erwachen, die eigentlich die Lust ist, mich selbst zu entdecken.
Ich habe mir vorgenommen,
mich nur in der Landessprache zu unterhalten, und nur mit Einheimischen,
mutig zu sein wie ein Löwe,
die Heiterkeit nicht zu verlieren, vor allem nicht über mich selbst,
gelassen zu bleiben, was auch komme,
schonungslos auszunutzen, dass ich eine Frau bin, wenn das schon so viele Nachteile mit sich bringt.
Und nun los!
Zwischenstation Genua
Das ist meine erste italienische Impression - ein milder Abend in Genua, die Luft wie eine streichelnde Hand, später kommt dann ganz sacht der Regen.
Hier wurde Mr. Levi geboren, der später, nach Amerika ausgewandert, auf die Idee kam, die Arbeitshosen der Hafenarbeiter seiner Heimatstadt, auf Rand genähte derbe Produkte aus indigoblauem Leinen, unter dem Namen Jeans auf den Markt zu bringen.
Nun, die jungen Genueser erweisen seinem Erzeugnis alle Ehre. Auch was in der knappen Bekleidung steckt, dürfte nicht zu verachten sein. Mir fällt auf im Halbdunkel: Die Jungs sind durchweg kleiner als bei uns mit fünfzehn, sechzehn Jahren, bewegen sich weniger schlaksig, legen im Gegenteil jenes Imponiergehabe an den Tag, das ich schon auf den Bahnhöfen von Mailand und Genua und im Zug beobachten konnte. Fast alle Männer, bis ins angespannte mittlere Alter, sind schlank, gepflegt, bewusst gekleidet, Miene und Habitus voll unglaublich maskulinen Selbstbewusstseins. Und selbst Halbwüchsige, die sich laut und angeberisch gebaren, tragen zu ihren Jeans und Rollkragenpullovern einen großen schwarzen Schirm, den sie bei dem leisesten Anzeichen von Regen aufspannen werden - offenbar wird man hier nicht gern nass.
Auf dem Bahnhofsvorplatz steht, umrahmt von Palmen in Kübeln, das pompöse Kolumbusdenkmal im Stil der Gründerjahre mit der Widmung vom „Vaterland“. Es ist nicht erwiesen, dass Kolumbus wirklich Genueser war, und wie er aussah, weiß man auch nicht. Aber Denkmal bleibt Denkmal.
Langsam färbt der Nieselregen die Fahrbahnen schwarz. Ich steige aufs Geratewohl Stiegen und Treppen hinauf. Die Stadt ist von hier aus ein riesiger Trichter, ein Arena-Halbrund, auf dessen Grund sich Bahnhof und Hafen befinden. Straßen scheint es zwei Arten zu geben. Die einen sind in Serpentinen gebaut. Auf ihnen braust, durch viele Kurven unübersichtlich, der Verkehr. Die anderen sind große Treppen, an denen rechts und links die Häuser oder die Gartenmauern liegen. Ich steige und steige. Mit mir, immer vereinzelter, Frauen mit schweren Einkaufsnetzen. Ihre Kinder laufen ihnen die letzten Meter entgegen und gehen dann mit ihnen ins Haus. Spiele werden beendet, Lichter gehen an.
Das weiche Grün der Gärten wird in der zunehmenden Nässe tiefer, üppiger.
Oben ist das hydrografische Institut. Von dort, kurz vorm Dunkelwerden, der Blick auf Hafen und Meer, ganz überraschend, denn obwohl man weiß, dies ist eine Hafenstadt, schien man doch ins Gebirge versetzt zu sein, und die sanfte Luft, die Palmenzweige und Weinranken deuten auf den Süden hin.
Seltsame Sache, eine Stadt in ein oder zwei Stunden Zwischenaufenthalt aufnehmen zu wollen. Vielleicht ist alles, was ich da im Regen und in der Dämmerung gesehen habe, ganz falsch, vielleicht beginnt das eigentliche Genua hinterm Berg, was weiß denn ich, und ist völlig anders. Aber für mich wird es dies bleiben, für immer fixiert wie eine fotografische Aufnahme: Stadt zwischen Berg und Wasser, die halbierte Spitztüte, Stiegen, Lichter, regnerische Milde. Erste Stadt Italiens, sei gegrüßt, auch wenn du dich mir nicht zuwendest.
Gegenüber dem Kolumbus mit seinen Palmenwedeln setze ich mich in ein überdachtes Straßencafé und trinke das Finkennäpfchen voll oder halb voll Mokka, den man hier als Kaffee verkauft. Bahnhöfe sind, wie sie sind. Übrigens: Angepöbelt wird man hier wie dort nur von Angetrunkenen.
Wartesäle gibt es zwei. Der eine hat Holzbänke und ist für die Reisenden zweiter Klasse. Für die erste Klasse gibt es Ledersitze, Marmortische und, hinreißend absurd, einen imitierten Kamin mit Säulchen und rot angestrahlten Papp-Holzscheiten. Übrigens kontrolliert niemand, ob die Passagiere, die hier auf ihren Zug warten, wirklich erste Klasse gelöst haben.
An einem Tisch steht eine schwachsinnige Alte, verludert und offenbar betrunken, eine skurrile Figur, wie man sie oft auf großen Bahnhöfen antrifft. Ihr zottliges Haar hängt ihr bis über die Augen. Sie trägt einen Mantel und Filzpantoffeln und hat den ganzen Tisch mit Päckchen in Zeitungspapier bedeckt. Das eine ist geöffnet. Es enthält Radieschen, die sie mit einer alten Schere sorgfältig schält. Die roten Schalen bringt sie jedes Mal quer durch den Raum zu einem Papierkorb. Das nackte Radieschen wird in eine andere Tüte getan. Dazu singt sie leise.
Niemand lacht sie aus. Niemand wirft sie vor die Tür.
Unterwegs
Reisenden, die knapp an Zeit, aber bei guter Konstitution sind, sei empfohlen, längere Zugfahrten nachts zu unternehmen. Man spart einen Tag und Hotelkosten und schläft zur Not, wenn’s denn kein Schlafwagen sein kann, auch ganz komfortabel auf einer Polsterbank erster Klasse. So fahre ich von Genua nach Rom, während draußen der Regen an die dunklen Fenster schlägt.
Mit mir im Abteil ein älteres, süditalienisch aussehendes Ehepaar und ihr Sohn. Sie sind einfach, fast ärmlich gekleidet. Der Sohn streckt sich mir gegenüber aus, während die beiden alten Leutchen im Sitzen schlafen, aufrecht, nur den Kopf leicht in die Ecke gedrückt, ohne einen Versuch, die Jacke aufzuknöpfen, die Schuhe auszuziehen, die Beine auf den Sitz zu nehmen.
Wann immer ich an einer Station erwache, sehe ich sie beide dasitzen wie zwei schlummernde Wächter im Märchen - sie scheinen ihre Haltung nicht zu verändern.
Im Morgendämmern steht der alte Mann auf - er öffnet die Augen und ist ohne Übergang wach -, nimmt aus dem Pappkoffer ein Leinenhandtuch mit bunt gestickten Säumen und sein Rasierzeug und geht in den Waschraum des Waggons. Als er wiederkommt, riecht er streng nach Seife und Haarpomade. Er weckt seinen Sohn und schickt ihn denselben Weg - alles ohne ein Wort zu sagen. Dann erst geht auch die Mutter, sich für den Tag in Rom zurechtzumachen. Sie hat verarbeitete Hände von der Farbe gebrannten Tons, der Trauring ist tief in das Fleisch des Fingerglieds eingewachsen.
Blick aus dem Fenster: sanfte Bergrücken in der Ferne, Buschwerk, Weinberge, fremdartige Bäume. Manchmal verfallene einsame Häuser. Auf einmal, kurz vor Civitavecchia, ist da rechter Hand das Meer, ganz unprätentiös, ohne den üblichen Aufwand an Dünen und Vorland. Es ist perlgrau wie die Ostsee, heißt aber: Tyrrhenisches Meer.
Stazione Termini in Rom ist neben dem Warschauer Hauptbahnhof der großzügigste und modernste Bahnhof, den ich kenne, weiträumig, architektonisch klar, elegant. Das entzückt mich, da ich von zu Hause aus zu wissen glaubte, dass Bahnhöfe hässlich sein müssen.
Wenn man auf den Bahnhofsvorplatz kommt, erwarten einen im lautstarken Wirrwarr der Autobushaltestellen mit der zeitlosen Gelassenheit von Grabsteinen ein paar große quadratische Tuffsteinblöcke: Reste der ältesten Stadtmauer Roms, der im vierten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung erbauten Servianischen Mauer, die das Ur-Rom, das alte „Roma quadrata“, einschloss. Es sind die Relikte von einstigen elf Kilometern.
Vor Übermüdung in der Morgenfrische fröstelnd, stehe ich davor und bemühe mich, beeindruckt zu sein. Sie liegen so gut placiert, diese Quader, so architektonisch gekonnt, richtig wie eine moderne Skulptur. Sie stören so gar nicht. Es ist beinahe beängstigend.
„Eh, bella, vieni“, ruft mir ein Motorradjunge zu und umkreist mich ein paarmal und dann in einer italianisierten Variante klassischen Spruchgutes: „Vieni, vedi, vici.“ Und da gebe ich meine erste schlagfertige Antwort in der Landessprache, nämlich: „Cesare si, tu no“, und bin mächtig stolz, als er lachend abzieht.
Von diesem Erfolg ermutigt, trabe ich in den Bahnhof zurück, nehme meinen Mut zusammen und telefoniere mir ein Hotelzimmer herbei. Dann rufe ich unsere Botschaft an. Italienisch, versteht sich. Und nach einem kurzen Dialog sagt die Stimme am anderen Ende der Leitung zögernd: „Sagen Sie, sprechen Sie auch deutsch? Es geht vielleicht doch einfacher.“
Zu Fuß durch die Ewige Stadt
Zu Fuß, wie denn sonst. Nur so lernt man eine Stadt kennen. Außerdem gibt es einen Kurzstreik der Busfahrer. Man verlässt sich wirklich am besten auf sich selbst.
Zunächst muss ich mich mit der italienischen Art, die Straße zu überqueren, vertraut machen. Die ist leicht beschrieben: Man geht einfach los. Wozu allerdings für ein zu Disziplin erzogenes Wesen ebenso viel Selbstüberwindung wie Mut gehört.
Zuerst traue ich mich nicht allein, sondern warte, bis sich ein paar Leute am Straßenrand zusammengefunden haben und hänge mich dran. Nach und nach begreife ich das Wunder: Dass einem nämlich als Fußgänger hier viel weniger passiert, als wenn man in einem Wagen sitzt. Die Römer fahren zwar mit südlicher Aggressivität und, wie mir scheint, völlig regellos, aber offenbar steckt in jedem Auto ein Mensch. So sieht man immer wieder durch den sechsspurigen Verkehrsstrom wie auf Wogen einen Fußgänger dahintreiben, der nun mal partout auf die andere Seite will, vertrauend auf seinen guten Stern und die Reaktionsschnelligkeit der Fahrer. Auch Autobusse stoppen, und Hupen oder Schimpfen habe ich nur erlebt, wenn irgendein anderer Wagen nicht schnell genug in eine Lücke einbog.
Auch Ampeln werden hier anders als bei uns verstanden. Startete man erst bei Grün, käme man nie vom Fleck. Das Rot der Gegenrichtung gilt als Zeichen für die Abfahrt, so einfach ist das. Was ich allerdings nicht begriffen habe, ist die Funktion von Verkehrspolizisten. Sie dienen wohl hauptsächlich dazu, den Touristen den Weg zu sagen. Deshalb tragen sie so wunderschöne Operettenuniformen in Dunkelblau mit Rot und weißem Lederzeug. Meistens halten sie sich raus, da sie sonst sofort von den Autofahrern einmütig beschimpft werden. Sie stehen während ihres Dienstes am Straßenrand, rauchen eine Zigarette und gucken zu, wie die Römer sich selbst den Verkehr regeln.
Straßenverkehr in Rom ist ein Chaos, aber eins, das durch Herz und wachen Verstand erträglich wird. Übrigens habe ich nie erlebt, dass ein Autobus nicht nochmals anhielt, wenn noch ein Fahrgast gelaufen kam, und manchmal stoppten sie sogar zwanzig Meter von der Haltestelle entfernt noch einmal, wenn jemand wild gestikulierend am Straßenrand auftauchte.
Junge Mädchen fahren Moped in Stiefeln mit Zehnzentimeterabsätzen, dazu tragen sie Hosen. Denn ohne Hosen würden sie nur auf einem Soziussitz Platz nehmen, und zwar, versteht sich, im Damensitz. Und wenn auf der Via del’ Corso zwei Schöne ihr Maschinchen anschieben müssen, dann schlagen alle rücksichtsvoll einen großen Bogen um sie - auf Kosten des wild hupenden Gegenverkehrs.
Für uns, die wir in der Kindheit von zerstörten Städten umgeben waren, eine Ungeheuerlichkeit: stilistisch einheitliche, kilometerlange, völlig intakte Fassaden. Riesige Straßenzüge. Die Massen des verbauten Steins. Nichts gequält, nichts aufgesetzt, alles organisch gewachsen. Angesichts dieser weit ausgedehnten Stadt begreift man auf einmal, dass wir irgendwie immer nur nördliche Barbaren geblieben sind. Welche Maße an Raum und Zeit. Sie machen sogar die Cola-Büchsen in der Ecke der Ausgrabungen verständlich. Man weiß wohl, dass sie vergehen, „zuwachsen“. Solche Größe produziert Fatalismus.
Und ich werde mich bis zuletzt in Rom verlaufen. Die spröde Schöne lässt sich nicht bezwingen. Wenn man meint, sie zu kennen, zeigt sie einem die kalte Schulter und bedroht einen mit ein paar Kilometer Straßenfront mehr, darauf kommt es ihr nicht an. Meine Abfahrt ein paar Tage später ist eine Kapitulation.
Keine Wand, die nicht genutzt wird. Zunächst einmal für Reklame, am grandiosesten die für Jeans, die sowieso von aller Welt getragen werden. Es gibt zum Beispiel Jesus-Jeans, gepflegt und glatt, oder Judas-Jeans, zusammengesetzt aus lauter Flicken. Dann eine Mauer voller Plakate, auf denen jeweils ein junges Mädchen oder ein junger Mann verschiedener Hautfarbe mit gekreuzten Jeans-Beinen hockt und ein Stück Brot knabbert. Unterschrift nach antikem Vorbild: Pane e Jeans. Brot und Jeans. Oder nur bezaubernde Popos in Jeans. - Jede Richtung ist vertreten, Religion, Konsumverzicht, Porno ..., wie man wünscht.
Daneben die roten oder weißen Sgraffiti der verschiedensten politischen Richtungen. Nachts ist die herabgelassene Jalousie eines Ladens im Nu neu beschriftet, so sorgfältig der Besitzer die Parolen auch am frühen Morgen abgewaschen oder abgekratzt haben mag. Neben „Hoch lebe die Sowjetunion!“ und einem Streikaufruf der KPI die Aufforderung „Tod den Roten!“ oder „Es lebe der Papst!“. Der politische Kampf ist wild, der Wirrwarr unbeschreiblich. An den Pfeilern der Tiberbrücke allerdings steht in riesigen weißen Lettern: „Ama vivi al ringrazio amore“ (Liebe, du lebst dank der Liebe). Wobei auch das mehr politische Losung ist, als man zunächst denkt.
Alle Frauen rauchen auf der Straße. Die jungen Mädchen tragen alle die obligatorischen Jeans, lange offene Haare und große Ohrringe. Sie sind schlank wie Rehe, erst in der Ehe werden sie rundlich, weil sie sich dann keinen Zwang mehr antun müssen - die Versorgung scheint ja gesichert.
Bevor ich anfangen kann, die Stadt systematisch zu entdecken, habe ich vielerlei schon en passant gefunden: die blumen- und studentenübersäte Spanische Treppe; den Pincio; den Corso; die Fontana di Trevi, in die ich gehorsam über die Schulter jene Münze werfe, die mir die Rückkehr nach Rom sichern soll; die elegante Via Veneto mit ihren Juwelierläden, den Luxusklubs und Luxushuren.
Die berühmten Brunnen, sagt man, seien das Wahrzeichen Roms. Aber mehr als die gestalteten Wasserkünste gefallen mir die einfachen gebogenen Metallhähne, die allüberall ihr Nass ausspucken, es verschwenderisch im Rinnstein versickern lassen.
Auf der Oberseite haben diese Wasserhähne ein kleines Loch. Ist man durstig, legt man einfach den Daumen auf die Brunnenöffnung und hält den Mund über dies kleine Spundloch, und der Strahl kühlen, reinen, mineralisch schmeckenden Wassers ergießt sich direkt auf die Zunge.
Sowohl auf gusseisernen Kanaldeckeln als auch auf den Schildern, die das Blumenpflücken im Park untersagen, zeichnet der römische Magistrat stolz mit SPQR: Senatus Populusque Romanus. Senat und Volk von Rom. Wenn das kein Traditionsbewusstsein ist!
Das sogenannte alte Rom
Da hat man nun seinen Stadtführer und mehrere Karten und bildete sich bisher ein, guten Orientierungssinn zu haben. Aber ich bin so große Städte nicht gewohnt und müde dazu. Doch unversehens kommt, was sich entdecken lässt, freiwillig zu mir, nachdem ich mir die Füße wund gelaufen habe. Verzwickt.
Unterwegs plötzlich, einfach so, bei einem Blick auf die linke Straßenseite, zwischen den Treppen und Häuserfronten hindurch: das Kolosseum. Mir bleibt fast das Herz stehen. Auf nahezu römische Art überquere ich die Straße, stelle fest, dass der eben so nah erscheinende Bau noch seine dreihundert Meter entfernt ist, und finde endlich die richtigen Wege, um in die Nähe des alten Monstrums zu gelangen. Ich brauche für diese dreihundert Meter gute zwanzig Minuten.
Und das ist er nun also, der alte Imponierbau, der seinen Zweck, nämlich zu imponieren, noch immer so wunderbar erfüllt. Flavisches Amphitheater, Schlachthof zum großstädtischen Vergnügen, Lust- und Gruselstätte für fünfzigtausend Zuschauer. Manipulation eines Volkes, das seine Aggressionen abreagierte gegen die, die nicht dran schuld waren. Was ist dagegen schon Fußball oder Stierkampf? Hier ging man aufs Ganze.
Vielsprachige Andenkenhändler preisen lautstark Dias, Prospekte und Bücher an, auch inmitten der alten Steine.
Ich gerate einmal wieder in eine deutschsprachige Gruppe. Schwäbisch teilen sie sich mit, dass „die hier“ die armen Sklaven gepeitscht und den wilden Tieren vorgeworfen haben. Es hört sich an, als traue man’s den Italienern in gleichsam überzeitlicher Sippenhaft heute noch zu.
Welch ein Aufwand, welche Menge Steine! Wenn wir den Rekonstruktionen trauen dürfen, war es das schönste Hollywood. Jetzt liegt es im Schatten und ist der Tummelplatz unzähliger Katzen; vor allem eine Familie von Schwarzbunten scheint hier dynastisch zu herrschen. Sanftes Mauzen, weiche Sprünge, man wird um Futter angeschnurrt. Mit zuckender Schwanzspitze hocken die Katzen zwischen Torbögen und Nischen.
Wie muss das gewesen sein, wenn die Sonne in diesen riesigen Trichter einbrach, auf die Köpfe derer prallte, die für einen ganzen Tag gekommen waren, um sich und ihre Sorgen zu vergessen?
Aber, so hört man, da habe es ein Ding gegeben, genannt velarium, ein Ungeheuer von Sonnensegel, eine Kombination aus Planen, Seilen, Stangen und Flaschenzügen, bedienbar und einrichtbar bei voll besetztem Hause, das den Verschmachtenden Erleichterung brachte und Halbrund und Arena überschattete. Matrosen der kaiserlichen Flotte, hundert oder mehr an der Zahl, sollen es bedient haben. Es war monströs wie alles hier.