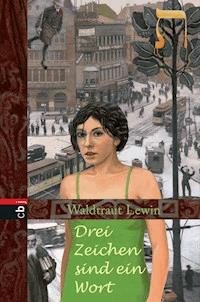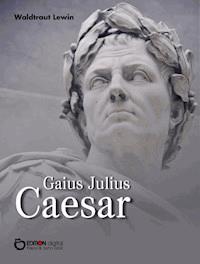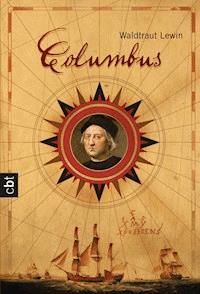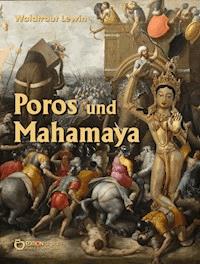15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Gütersloher Verlagshaus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Helfer, Tröster, Seelsorger:
Leo Baeck – Symbol für Mut und Beständigkeit
Leo Baeck ist eine herausragende historische Figur des 20. Jahrhunderts. Als die einflussreichste Persönlichkeit des liberalen Judentums während der Weimarer Republik wurde er mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten zum alles überragenden Hüter und Tröster seines bedrängten Volkes. Diese Biografie Leo Baecks folgt nicht einfach den Ereignissen und Taten seines Lebens. Vielmehr wird Baecks Lebensweg zum roten Faden, an dem die Geschichte der Juden in Deutschland im 20. Jahrhundert erzählt wird. Formal geht das Werk dabei einen besonderen Weg: Literarisch ausgestaltete »Spielszenen« wechseln mit dokumentierenden Sachbuchteilen. So entsteht ein spannend zu lesendes und umfassendes Bild der jüdischen Geschichte, konzentriert am Lebensweg eines herausragenden Menschen.
- Die Geschichte des deutschen Judentums dargestellt am Weg eines herausragenden Mannes
- Spannend und umfassend: die Lebensgeschichte Leo Baecks
- Eine dokumentarische Biografie
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 403
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
GÜTERSLOHER VERLAGSHAUS
Weitere Informationen QR-Code scannen
Inhaltsverzeichnis
1
WIE EIN GAUL IN DEN SIELEN
Nass und kalt ist der Februar des Jahres 1943.
Häftling 187.894 schleppt den Karren mit Abfällen durch den Morast der Gassen.
Die Räder mahlen im Schlamm, im tiefen, zähen Schmutz.
Häftling 187.894 kommt nur langsam vorwärts. Mühsam setzt er Fuß für Fuß, atmet keuchend. So einen Karren zu ziehen, das ist eine viel zu schwere Arbeit für einen alten Mann.
Das Gesicht des Häftlings ist eingefallen, der weiße Bart struppig und verwirrt. Sein Mantel ist grau und verdreckt, so grau, so verdreckt wie alles rund umher. Seine Augen blicken trüb und unstet, wie die eines Menschen, der schlecht sehen kann. Das einzig Leuchtende ist der gelbe Stern, aufgenäht auf der linken Seite, der Herzseite. Der Stern mit dem Wort »Jude«.
Während der alte Mann sich vornübergebeugt zwischen den beiden Holmen des hölzernen Karrens dahinschleppt, murmelt er ununterbrochen etwas in einer fremden Sprache. Es ist Hebräisch.
Der alte Mann betet.
Dies hier ist das Ghetto Theresienstadt, das manche hochtrabend »eine Stadt für die Juden« nennen, obwohl es auch nichts anderes ist als ein KZ. Ein »besonderes« KZ vielleicht. Mag sein.
Diejenigen, die hier leben müssen, haben keinen Vergleich. Und von denen, die fortgeschafft wurden in andere Lager, ist noch nie ein Lebenszeichen gekommen. Kein einziges Lebenszeichen.
Der alte Mann ist jetzt fast einen Monat hier. Hundert Tage, so heißt es, müssen die Neuankömmlinge »Arbeitseinsatz« leisten, gleichgültig, wie alt oder wie jung, wie gesund oder wie gebrechlich sie sind. Hundert Tage, von denen jetzt erst ein Drittel vorüber ist.
Häftling 187.894 weiß, dass von denen, die mit ihm gemeinsam kamen, schon viele gestorben sind. Wie viele, das sagt niemand. Täglich rumpeln die Leichenkarren durch die Gassen. Sie unterscheiden sich nicht von diesem Karren mit anderen ... Abfällen, den er hinter sich her zerrt.
Ja, sie starben wie die Fliegen. Durchweg alte Leute, das soll ja hier das »Altersghetto« sein – unter anderem. Sie steckten sich mit einer Krankheit an. Sie bekamen eine Lungenentzündung in den ungeheizten Baracken, in denen man sie einquartiert hatte. Ihr Herz machte schlapp. Sie starben vor Hunger. Und manche starben einfach vor Entsetzen. Vor Entsetzen und vor Verzweiflung.
Zu diesen Toten gehört auch die Schwester des alten Mannes. Diejenige, die er noch lebendig hier gesehen hat: Rese. Drei andere waren schon im Lager gestorben, bevor man ihn hierher gebracht hatte: Lise, Anna und Frida.
Häftling 187.894, der den Karren zieht, ist dank Gottes Gnade noch immer gesund. Nicht einmal eine Erkältung hat er sich bis jetzt geholt. Aber seine Schwäche kann er nicht leugnen. Auch ist er es nicht gewohnt, schwere körperliche Arbeit zu leisten. Er ist ein Mann des Geistes, einer, der seine Tage am Schreibtisch, in den Bibliotheken oder auf dem Katheder vor einer Schar von Schülern und Studenten verbringt.
Diese seine Schwäche, er fühlt sie bis ins Mark.
Und doch ist er inmitten des Grauens, das ihn hier umgibt, auf eine merkwürdige Weise froh.
Über dem Kasernentor – denn eine alte Garnison ist das hier, eine Kasernenstadt, in der Österreichs Kaiser ihre Soldaten stationierten –, über diesem Tor also befindet sich ein großes Schild, darauf ist zu lesen: Arbeit macht frei.
Das ist grausam und zynisch. Und doch trifft es auf ihn zu. Wenn auch nicht so, wie es die im Sinn hatten, die diese Buchstaben anbringen ließen.
Denn diese Sklavenarbeit hier befreit ihn von der Last der grauenhaften Verantwortung, die seit zehn Jahren auf seinen Schultern lag.
Seit 1933, seit der Machtergreifung durch die Nazis, war Häftling 187.894 der Vorsitzende der »Reichsvertretung der Juden in Deutschland«, 1938 von den Nazis in »Reichsvereinigung« umbenannt und unter staatliche Kontrolle gebracht. Er war der Mann, der zwischen den Fronten stand. Derjenige, der vermitteln musste zwischen den Machthabern und den Juden.
Ein Amt, das hundertfach schwerer lastete als der Zuggurt, der jetzt auf seinen knochigen Schultern ruht. Und wenn ihm sein Herz bis in den Hals schlägt, so ist es wegen der körperlichen Anstrengung und nicht aus Gewissensangst, und wenn seine Beine zittern, so einfach wegen seiner Hinfälligkeit und nicht, weil er sich fürchtet.
Denn hier, vor diesem Karren, ist er nur für sich selbst verantwortlich, nicht für die hunderttausenden von Verfolgten und Gedemütigten und Verschleppten seines Volkes.
So setzt er Schritt vor Schritt vor Schritt.
Die Holme des Karrens sind feucht und kalt, so feucht und kalt wie alles hier. Seine erstarrten Finger können sie nur mühsam festhalten. Immer wieder rutscht er ab. Trotzdem. Es muss weitergehen.
Aber er kann nichts sehen. Da ist irgendetwas im Weg. Er stolpert. Er fällt.
Und plötzlich sind Stimmen um ihn. Wo kommen die her? Er hatte doch eben noch das Gefühl, ganz allein zu sein mit sich und den Worten des Gebets auf seinen Lippen!
Und Hände sind da. Man hilft ihm auf. Irgendjemand versucht, ihm den Schmutz von Mantel und Hose zu entfernen.
»Mein Gott, er ist es!«, hört er. Und: »Herr Doktor, wie geht es ihnen? Können Sie stehen bleiben?«
Denn er schwankt. Es ist die Schwäche. Und um ihn herum ist alles farblos und verschwommen.
»Meine Brille«, sagt er mühsam. »In der Innentasche vom Mantel. Auf der Seite, wo der Stern ist.«
Jemand schiebt ihm die Gläser vor die Augen, befestigt die Bügel.
Die Schwäche bleibt, aber zumindest der Nebel lichtet sich. Um ihn besorgte Gesichter, genauso grau und eingefallen, wie seines wohl ist. Niemand, den er kennt.
»Ich danke Ihnen sehr«, sagt er, mit jener Höflichkeit, für die er bekannt ist, »ich hoffe, Sie bekommen meinetwegen keine Unannehmlichkeiten.«
Seine Brille beschlägt, er nimmt sie mit steifen Fingern ab, versucht, die Gläser am Revers seines Mantel zu putzen. Man nimmt sie ihm aus der Hand. »Darf ich, Herr Doktor?«
Sie kennen ihn. Ja, natürlich kennen sie ihn. Zehn Jahre lang hat er im Rampenlicht gestanden, im gnadenlosen Scheinwerferlicht der Despoten, die ihm Entscheidungen über Leben und Tod seiner Mitbürger aufbürdeten.
Und er wundert sich, dass die um ihn herum ihn nicht hassen.
»Wissen Sie«, sagt er, um etwas zu sagen, »ich benutze die Brille nur noch gelegentlich. Es ist besser, das hier alles nicht unbedingt gestochen scharf zu sehen.«
Sie lachen. Wirklich, sie können lachen.
Er nimmt die Gläser entgegen, setzt sie sich nun selbst auf. Da ist Wärme, spürt er. Ja, inmitten dieser Menschen ist ihm nicht ganz so kalt wie vordem.
Sie murmeln, raunen miteinander, sehen ihn an, scheu, mitleidsvoll.
Und nun entdeckt er unter den Gesichtern doch eins, das ihm bekannt vorkommt.
»Sind Sie nicht – warten Sie – ja, natürlich, Sie waren in einer meiner Vorlesungen damals. Sie sind ...«
Er erinnert sich an den Namen, lächelt.
»Rabbi!« Jemand küsst ihm die Hand.
»Das ist nun ganz und gar nicht nötig!«, sagt er. Mild und streng zugleich.
Sie helfen ihm, seinen Karren weiterzuschieben.
2
»ALTERSSITZ THERESIENSTADT«
Einen Monat zuvor geht ein Mann durch die totenstillen Straßen des nächtlichen winterstarren Berlin.
Es ist Rabbiner Dr. Leo Baeck, Vorsitzender jener Institution, die sich seit 1933 »Reichsvertretung«, jetzt auf höheren Befehl hin »Reichsvereinigung« der Juden in Deutschland nennt. Er hat die Hände in den Taschen seines Mantels verborgen, den Kragen hochgeschlagen, den Hut tief ins Gesicht gezogen.
Die Sirenen haben geheult. Es hat Voralarm gegeben. Das heißt, amerikanische Bomber fliegen wieder einmal einen Angriff. Höchstwahrscheinlich auf die Nazi-Hauptstadt. Auf Berlin eben.
Wie immer haben die Straßen sich rasch geleert. Die Menschen sind in aller Eile in den Luftschutzräumen verschwunden. Leo Baeck wurde vom Lärm der Sirenen auf dem Heimweg überrascht, aber er kann nicht in jeden beliebigen dieser Räume gehen. Der gelbe Stern, den er auf seinem Mantel trägt und der ihn als Juden ausweist, verhindert das. Es gibt spezielle Kellerräume nur für seinesgleichen, und von so einem Raum ist er genauso weit entfernt wie von seiner Wohnung.
Es ist stockfinster, denn laut Vorschrift sind alle Fenster verdunkelt, um der Gefahr von oben, den Fliegern, keinen Anhaltspunkt zu geben. Und Straßenbeleuchtung ist etwas, was es in Friedenszeiten gab. Nur die Suchscheinwerfer der FLAK, der Fliegerabwehrkanonen, lassen tastende Finger über den Nachthimmel gleiten.
Die Dunkelheit macht Rabbi Baeck nicht viel aus. Er kennt hier jeden Pflasterstein, setzt ruhig seinen Weg fort. Solange er nicht einer Polizeistreife in die Hände fällt, ist alles gut. Er wird noch vor Beginn des »Vollalarms« zu Haus sein. Und wenn nicht – auch gut.
Aber derart fatalistische Gedanken verwehrt er sich im Allgemeinen. Sein Leben steht in der Hand Des Herrn. Und er hat seine Pflicht zu erfüllen.
Diese Pflicht.
Eine Pflicht, die immer schlimmer wird. Täglich kommen Befehle von der Gestapo, der Geheimen Staatspolizei, neue Deportationen betreffend, oder, wie es amtlich heißt: Evakuierungen zum Arbeitseinsatz in den Ostgebieten.
Und die Reichsvereinigung der Juden hat diese Befehle zu überbringen, sie hat die Betroffenen vorzubereiten, ihnen beim Packen zu helfen, moralischen Beistand zu leisten ...
Leo Baeck tut Letzteres an vorderster Front. Mit den Verfolgten und Bedrängten zu sprechen, sie zu trösten, wenn er ihnen schon nicht helfen kann – darin sieht er seine eigentliche Aufgabe, die eines Mitmenschen und Seelsorgers.
Das ist die eine Seite. Er ist der oberste Repräsentant der Juden in Deutschland – dieses immer mehr zusammenschrumpfenden Häufleins von Menschen –, der oberste Gefangene sozusagen. Er und mit ihm die Mitglieder des Gremiums werden durch die Befehle der Gestapo gezwungen, die jüdischen Insassen des Gefängnisses Deutschland von einer Stätte zur anderen zu »verschieben« (um im Sprachgebrauch der Nazis zu bleiben), in eine ungewisse Zukunft. Was die Deportierten im Osten erwartet – noch weiß er es nicht. Er weiß nur: Es ist noch nie einer zurückgekommen.
Und als dieser oberste Repräsentant hat er mit den Nazigrößen zu verhandeln, er hat zu dulden, dass zwei Gestapo-Beamte an den Sitzungen der Reichsvereinigung teilnehmen, er hat Protokolle zu unterschreiben und Aufrufe zu verfassen. Ihm bleibt keine Wahl. Wenn er sich weigert, werden sie ihn einsperren, und das ist noch die mildeste Antwort.
Aber das kümmert ihn weniger.
Er weiß, er wird gebraucht. Die Juden Deutschlands brauchen ihn – so lange es sie noch gibt. Er ist Helfer, Tröster, Seelsorger – und Symbol für Mut und Beständigkeit, vor den Seinen und vor der Welt.
Während er sich durch die dunklen Straßen vorwärts bewegt, ist ihm bewusst: Es kann nicht mehr lange dauern, und auch er ist Opfer einer solchen »Verschiebung« wie Hunderttausende vor ihm.
Noch während des Jahres 1942 hat die deutsche Wehrmacht versucht, die Deportation der Judenheit insgesamt zu verhindern – nicht etwa aus Menschenliebe. Man braucht die jüdischen Zwangsarbeiter in der Rüstungsindustrie. Aber nun ist zu spüren, dass das Blatt sich wendet. Zwar braucht die Rüstungsindustrie noch immer die Juden, aber offenbar gewinnen andere Kräfte in der Naziführung die Oberhand. Die Deportationen nehmen zu.
Auch die jüdische Reichsvereinigung bekam das direkt zu spüren. Im Sommer wurde ihr Gebäude in der Kantstraße ins Visier genommen.
Kurz vor acht Uhr morgens – zu Beginn der Arbeitszeit – fiel die Gestapo in das Haus ein.
Jeder, der zu spät erschien, und sei es auch nur eine Minute, kam auf den nächsten Transport.
Reine Schikane. Druck sollte ausgeübt werden!
Er, Leo Baeck, ist ein Mensch, der früh aufsteht. Er war schon seit sieben Uhr früh dort an seinem Schreibtisch.
Seine Proteste nutzten nichts ...
Man hat ihn bereits viermal ins Gefängnis gesteckt während der Zeit seines Vorsitzes, aber immer wieder nach einer gewissen Frist freigelassen. Er weiß: Wenn sie jetzt kommen, jetzt, im Januar 1943, wird es endgültig sein. Dann blüht auch ihm die Deportation. Man hat ihm bereits, wie anderen Mitgliedern der Reichsvereinigung, einen »Vertrag« für den »Alterssitz Theresienstadt« aufgezwungen. Weigerung gab es nicht. Angeblich, um sich in eine Art Altenheim einzukaufen.
An das Altenheim kann er nicht glauben. Drei seiner Schwestern waren bereits in diesem »Alterssitz« angeblich »ansässig« geworden. Erst kamen Postkarten mit belanglosem, eindeutig zensiertem Inhalt. Dann Stille.
Es ist eine Frage der Zeit, bis man ihn ebenfalls holt.
Leo Baecks Schritte hallen auf dem Pflaster. Wie lange wird er die vertraute Straße noch unter den Füßen spüren? Es kann jeden Tag das letzte Mal sein.
Entwarnung. Offenbar haben sich die amerikanischen Verbände heute nun doch eine andere Stadt als Berlin ausgesucht.
Entwarnung diesmal für die geplagten Berliner, die schon den vierten Kriegswinter hungern, frieren und unter den ständigen Bombenangriffen leiden.
Keine Entwarnung für die Juden.
Rabbi Baeck hat seine Wohnung Am Park 15 in Schöneberg erreicht.
Er geht die Treppe hinauf, schließt auf, macht Licht.
Als seine Frau Natalie – Der Herr war barmherzig! – bereits 1937 starb, hatte seine alte Wohnung ihre Seele verloren. Eine leere Höhle für ihn.
Er zog um.
Mitgenommen hat er freilich die Erinnerungsstücke ihres gemeinsamen Lebens: die Spitzentagesdecke auf dem Bett, die Nathalie so schön fand, die Serviettenringe mit ihrer beider eingravierten Namenszügen.
Die Dinge des Glaubens: der Sabbatleuchter, ein sechseckiger Messingstern mit hebräischen Lettern.
Und die Bücher. Hebräische Bücher, deutsche Bücher. Bücher bis an die Decke. Still schimmern die kostbaren Ledereinbände im weichen Licht der Lampe.
Darunter seine eigenen Werke. Und, in einem Ordner, seine unvollendete Arbeit.
Das Abendgebet.
Wie lange noch in dieser Umgebung?
Seine Haushälterin kommt früh am Morgen, wie immer. Sie kennt den Tagesablauf des Herrn Doktor. Der steht mit den Hühnern auf, betet, liest und arbeitet meist bereits seit fünf Uhr. Gern trinkt er dann um sechs Uhr einen Kaffee – auch wenn es neuerdings nur noch Ersatzkaffee ist.
Um halb sechs klingelt es an der Wohnungstür.
Zwei Herren in Zivil. »Herr Dr. Baeck?«
Er bejaht ruhig.
»Wir haben den Befehl, Sie abzuholen. Ihr neuer Wohnsitz ist Theresienstadt.«
Er erbittet sich eine Stunde Zeit, hinterlegt das Geld für seine offene Gas- und Stromrechnung, schreibt über eine Deckadresse einen Brief an die Familie seiner Tochter und packt mit Hilfe seiner Haushälterin einen Koffer. Es gelingt ihm auch, das Manuskript darin zu verstecken, an dem er arbeitet.
Lebensmittelkarten, Rentenbescheid und Sparbücher werden auf dem Tisch deponiert. Sein Vermögen und das Inventar gelten als beschlagnahmt. Die Schlüssel zur Wohnung werden den Beamten übereignet.
Man bringt den Verhafteten zur Sammelstelle in der Großen Hamburger Straße. Am nächsten Tag wird er, gemeinsam mit anderen leitenden Mitgliedern der »Reichsvereinigung«, deportiert.
Leo Baeck ist zu diesem Zeitpunkt neunundsechzig Jahre alt.
Er wird die Hölle des Lagers überleben.
DAS LAGER
Terezín – so heißt es auf Tschechisch – ist Ende des 18. Jahrhunderts vom österreichischen Kaiser Franz Joseph II. als Festungsstadt errichtet worden, zur militärischen Sicherung des Eger-Übergangs kurz vor deren Mündung in die Elbe. Die Stadt gliedert sich in zwei Teile: in die ummauerte »Garnisonsstadt«, wo das Militär stationiert war, sowie den befestigten Brückenkopf, die »Kleine Festung«.
Nachdem die Faschisten Böhmen und Mähren annektiert haben, richtet zunächst, 1940, in der »Kleinen Festung« die Gestapo ein Gefängnis ein.
Im Oktober 1941 beschließt Reinhard Heydrich, der Chef des Sicherheitsdienstes der SS und stellvertretender »Reichsprotektor« für Böhmen und Mähren, aus der Garnisonsstadt eine Sammelstelle für die Juden »seines« Gebiets zu machen, die von dort aus in die Vernichtungslager deportiert werden. Die nichtjüdische Bevölkerung des Ortes wird ausgesiedelt.
Im Januar 1942 findet in Berlin die so genannte Wannsee-Konferenz statt, in der die Naziführer die strategischen Einzelheiten für die völlige Vernichtung der Juden Europas festlegen. Dort wird beschlossen, in Theresienstadt ein besonderes »Ghetto« einzurichten: Deutsche, österreichische und tschechische Juden über 65 Jahre, die im Ersten Weltkrieg »fürs Vaterland« schwere Kriegsverletzungen erlitten hatten, sowie in den Augen der Welt besonders verdienstvolle Männer und Frauen sollen hier, neben der üblichen Belegung mit allen Altersgruppen, ihren Platz finden. (Etwa ein Drittel der Insassen mit ihren Familien fallen in dieses »Raster«, was Theresienstadt den Beinamen »Altersghetto« einträgt.)
Die Nazi-Führung will auf diese Weise nach außen den wahren Charakter ihrer Judenpolitik verschleiern: Ausländische Delegationen, vor allem das »Rote Kreuz«, werden zweimal durch einen vordem »geschönten« Bereich »der Stadt« geführt.
Außerdem will man mit diesem Schritt verhindern, dass es möglicherweise Interventionen aus dem Ausland gibt: Bekannte Persönlichkeiten konnte man schlecht zum »Arbeitseinsatz im Osten« abkommandieren, ohne weltweites Aufsehen zu erregen.
Den Höhepunkt findet die Politik der Täuschung mit dem Propagandafilm »Der Führer schenkt den Juden eine Stadt«, der ein gefälschtes Bild des »jüdischen Siedlungsgebiets Theresienstadt« liefern soll. Sein Regisseur Kurt Gerron, bekannter Theatermann und Filmemacher und selbst Insasse des Lagers, wird sofort nach der Fertigstellung des erzwungenen Machwerks nach Auschwitz verschleppt. Zur Aufführung des Films kommt es nicht mehr. Die Ereignisse überstürzen sich: Es geht aufs Kriegsende zu, und Theresienstadt wird nun immer mehr nur zur Durchgangsstation von Deportierten auf dem Weg in die Vernichtungslager.
Letzteres wissen die Betroffenen, die künftig dort hausen sollen, natürlich nicht. Um sie in Sicherheit zu wiegen, bietet man ihnen, so wie Leo Baeck auch, so genannte »Heimeinkaufsverträge« an. Damit garantiert man den Menschen angeblich Unterkunft, Verpflegung, Wäschedienst und ärztliche Versorgung bis hin zu einem Krankenhausaufenthalt.
Pro Person sind tausend Reichsmark aufzubringen. Wer das Geld nicht hat, dem muss von der Reichsvereinigung geholfen werden.
Allein mit diesen »Heimeinkaufsverträgen« presst der deutsche Staat über die Jahre mindestens 140 Millionen Reichsmark aus den nach Theresienstadt Verbrachten. Zählt man die beschlagnahmten größeren Vermögen der Deportierten hinzu, kommt man gar auf 400 Millionen.
Die Kosten, die pro Monat und pro Person für den Unterhalt aufgewendet werden, betragen nach Aussage der Nazibehörden 150 Reichsmark.
Die Realität sieht anders aus.
Im Jahre 1943 werden in Theresienstadt im Monat genau 11 Reichsmark und 13 Pfennige für jeden Häftling ausgegeben. Die deutsche Buchhaltung ist sehr akkurat ...
Während der Zeit vom November 1941 bis zum April 1945 werden über 141.000 Menschen nach Theresienstadt deportiert. Den Statistiken nach sind davon 88.000 sehr schnell weiter in die Massenvernichtungslager, vor allem nach Auschwitz, verbracht und dort ermordet worden. Über 33.000 Menschen in Theresienstadt sterben allein an Hunger und Krankheiten.
Wer ist der Mann, der am 27. Januar 1943 seinen »Heimeinkaufsvertrag« unterschreibt und sein gesamtes Vermögen, immerhin 15.400 Reichsmark, in die Hände der Mörder seines Volkes überantworten muss?
Der sich einen Monat später durch den Schlamm des Lagers quält, wie ein Zugtier vor einen Karren mit Unrat gespannt? Und dem es trotz allem gelingt, dies Inferno zu überleben?
Gehen wir zu den Anfängen zurück.
3
VON DEN WURZELN
Mi-gesa rabbanim, aus dem Stamm von Rabbinern, so steht es auf dem Grabstein von Leo Baeck. So hat er es gewollt und kurz vor seinem Tode im Jahr 1956 selbst bestimmt.
Und tatsächlich finden sich im Stammbaum Leo Baecks und seiner Frau nicht weniger als sechs jüdische Geistliche. Am weitesten zurück liegt die Geburt von Urgroßvater Abraham Baeck, der das Amt in Holitsch ausübte, einer Stadt im Südwesten der Slowakei, und zudem Landesrabbiner von Mähren war. (Solch eine Position entspricht etwa der eines Superintendenten in der evangelischen oder eines Bischofs in der katholischen Kirche.)
Der Name Baeck – teilweise auch Bäck geschrieben – hat übrigens nichts mit dem Beruf des Bäckers zu tun. Er steht für das hebräische Ben kadosch, Sohn eines Märtyrers. Der Familienüberlieferung zufolge war ein Vorfahr im Mittelalter in Süddeutschland einer der üblichen Judenverfolgungen ausgesetzt und beging rituellen Selbstmord, Kiddusch ha Schem (Heiligung des Namens), um einer drohenden Zwangstaufe zu entgehen und um seinen Glauben nicht zu verleugnen.
Leos Vater Samuel übt den traditionellen Familienberuf des Rabbi in Lissa (dem heutigen Leszno) aus. Die Stadt gehört zur preußischen Provinz Posen – im Jahr 1793 hatten sich die europäischen Großmächte Russland, Österreich und Preußen über das schwache Polen hergemacht und sich nach einem ersten Teilungsakt im Jahr 1772 gegenseitig erneut weite Gebiete des Territoriums zugeschoben.
Lissa ist eine reiche Kommune. Es gibt eine beachtliche Tuchmacherindustrie, und die Stadt ist einer der wichtigsten Märkte der Region. Handel und Wandel blühen. Sie beherbergt zugleich die größte jüdische Gemeinde des Posener Landes.
Nach der Annexion durch Preußen wandern allerdings viele Juden aus, zumeist in Orte des verbliebenen Rest-Polens. Schnell verringert sich die Zahl der jüdischen Einwohner laut den Statistiken der Stadt von fast fünftausend auf knappe tausend Menschen »mosaischen Glaubens«, wie man dazumal sagte.
Was mag der Grund für diese Flucht gewesen sein?
Das einstige Polen war ein Land, das seinen Juden große Freiheiten gewährte und ihnen sogar, im Gegensatz zu anderen europäischen Staaten, den Besitz von Grund und Boden erlaubte. Das bedeutete Sesshaftigkeit und eine gefestigte Position innerhalb der Gesellschaft. Der Adel Polens vor allem schätzte und nutzte die Fähigkeiten der Juden. Sie waren geachtete Verwalter ihrer Güter, man ließ sich von ihnen Luxuswaren beschaffen und borgte sich Geld, für das gern üppige Zinsen gezahlt wurden. Aber auch: Die Vertrautheit mit dem Adel brachte den Juden in anderen Volksschichten Hass und Unwillen ein; es kam zu vereinzelten Übergriffen bis hin zu Pogromen – der Verwüstung ganzer Gemeinden und hemmungslosen Ausschreitungen gegen die jüdischen Bürger.
Dagegen herrscht nun unter den Preußen ein sicheres, streng reglementiertes, ein eingeengtes jüdisches Dasein. Die Juden sind in ein ganzes Netzwerk von Gesetzen und Geboten eingespannt. Welchen Beruf sie wählen dürfen, wie viel Geld sie verdienen, wie viel (nicht unbeträchtliche) Steuern sie zu entrichten haben, ja, sogar, mit welcher Frau sie sich verheiraten dürfen, wird staatlich bestimmt.
So scheint es, dass viele eine Unsicherheit in relativer Freiheit dem preußischen »Knebel« vorzogen und ihr Heil in der Flucht suchten.
Aber das ist ein Jahrhundert her, und diese Probleme scheinen die Rabbinerfamilie Baeck in Lissa nicht mehr zu berühren. Zu dem Zeitpunkt, an dem wir uns befinden, also Ende des 19. Jahrhunderts, herrschen weitgehend liberale Verhältnisse, und die Baecks »fühlen deutsch«, wie fast alle anderen jüdischen Bürger der Stadt auch.
Mehr noch: Die Juden Lissas waren über Nacht zu Deutschen geworden. Sie hatten die traditionelle Tracht der polnischen Juden, den breitkrempigen Hut oder die Pelzmütze zum schwarzen Kaftan, abgelegt und trugen Anzug mit Weste, weißem Hemd und Schlips. (So wird uns auch Leo Baeck sein Leben lang entgegentreten.) Sie wurden deutsche Beamte, wurden Juristen, die bei Rechtstreitigkeiten zwischen Polen und Deutschen meist die deutsche Seite vertraten, wurden Mitglieder einer deutschen politischen Partei. – Was sie aber nicht davon abhielt, ihr Judentum eifrig und traditionsbewusst weiter zu pflegen!
Zu den polnischen Minderheiten in der Stadt haben diese jüdischen Deutschen einen guten Kontakt und scheinen (da sie fast alle wohlhabend und »Wohltäter der Kommune« sind) zu diesem Zeitpunkt wohlgelitten zu sein.
Wir können davon ausgehen, dass der Umgangsstil der einzelnen Bevölkerungsgruppen untereinander und das soziale Klima in Lissa zu dieser Zeit ziemlich moderat waren.
FAMILIENBANDE
Rabbiner Samuel Baeck ist seit 1862 verheiratet mit der Tochter des Landesrabbiners von Mähren, Eva, geborene Placzek.
Das Paar hat elf Kinder, fünf Jungen und sechs Mädchen – wie sie Gott gegeben hat. (Bei frommen jüdischen Familien, auch wenn sie eher über einen schmalen Geldbeutel verfügen, ist Verhütung tabu.)
Leo, geboren am 23. Mai 1873, ist in diesem bunten Reigen, der zunächst von vier Mädchen angeführt wird, das sechste Kind, bewegt sich also im Mittelfeld. Die Kinder tragen typisch deutsche Namen wie Anna, Friederike, Louise oder Martin (ein sehr christlich-evangelischer Vorname) und Alfred. Wir wissen aber, dass Leo auch noch zwei andere Vornamen besitzt. Es gibt ein Dokument, in dem er mit ihnen unterzeichnet: Arje Lipman Baeck. Der erste Name, Arje, ist die hebräische, beziehungsweise jiddische Entsprechung zum lateinischen Leo. Beide Namen, der deutsche und der hebräische, bedeuten: Löwe.
Wie es frommen Juden übrigens selbstverständlich ist, werden die männlichen Kinder bereits im Säuglingsalter beschnitten – das traditionelle Zeichen des Bundes zwischen den Juden und ihrem Gott.
Die Amtssprache im preußischen Lissa war natürlich Deutsch – aber dass in den jüdischen Familien auch Jiddisch, der hebräisch-deutsche Mischdialekt der Aschkenasim, der Ostjuden, gesprochen wurde, kann man als sicher annehmen. Sonst hätte Leo gewiss nicht diesen typisch jiddischen Namen »Arje« bekommen, gleichsam als eine Alternative zu der deutschen Variante ...
Lipman dürfte eine Namensgebung aus dem Jiddischen sein; etwas Zärtliches: Lieb-mann, liebes Kind – so wie Mädchen gern Glückel oder Freude genannt werden.
Dass im Hause Baeck auch Hebräisch in Wort und Schrift eine Rolle spielte, ist selbstverständlich. Schließlich war das die Sprache der Tora und des Talmud, der täglichen Gebete und des Gottesdienstes in der Synagoge.
Samuel Baeck, der Vater Leos, ist nicht nur Rabbiner der jüdischen Gemeinde von Lissa, er unterrichtet auch deren Kinder im Comenius-Gymnasium der Stadt; auf seine Veranlassung hin war jüdischer Religionsunterricht dort überhaupt erst in den Lehrplan aufgenommen worden (seine Lehrbücher musste er selbst verfassen!).
Ein Foto zeigt das Kollegium der Schule: siebzehn würdevolle, mehr oder weniger bärtige Herren mit ernsten Mienen. Samuel Baeck sitzt in der ersten Reihe, durchaus aufgenommen in den Kreis der christlichen Amtsinhaber, nicht minder ernst, nicht minder seriös. Grüblerisch geht sein Blick in die Ferne.
Leo Baecks Vater ist ein bedeutender Gelehrter. Bevor er den Beruf des Rabbiners ergreift, hat er nicht nur an verschiedenen renommierten Jeschiwa-Schulen (also an Akademien, in denen jüdische Bildung vermittelt wird) sein Wissen erworben, sondern auch Philosophie und Orientalistik an der Universität in Wien studiert. Er hat seinen Doktor gemacht und verfasst verschiedene wissenschaftliche Werke. Am bekanntesten ist die »Geschichte des jüdischen Volkes und seiner Literatur«, ein Werk, das für die damalige Zeit erstaunliche drei Auflagen erreichte.
Allerdings, als er im Jahre 1864 seine Stelle als Rabbiner in Lissa antritt, ist seine Gemeinde eher skeptisch. Hier hängt man am Althergebrachten, und wenn ein Rabbiner kommt, der auch an einer »weltlichen«, nichtjüdischen Universität studiert und dort einen Doktortitel erworben hat – weiß man da, ob er nicht angesteckt ist von »modernem« Gedankengut, vom so genannten Reformjudentum, in dem die alten Bräuche und Sitten aufgeweicht und verändert werden? Ob er gar, zum Beispiel, eine Orgel in die Synagoge bringen will, den Gottesdienst auf Deutsch abhalten oder sich – Gott behüte! – gar für weibliche Rabbiner einsetzt? Und ist er überhaupt noch so richtig bewandert in den religiösen Schriften des Judentums?
Nun, Samuel führt tatsächlich eine Orgel in den jüdischen Gottesdienst ein, wie in christlichen Kirchen, er predigt auf Deutsch und hat zumindest »theoretisch« nichts dagegen, dass irgendwann einmal eine Frau zur Rabbinerin berufen wird. Er ist also ein »Gemäßigter«, ein Reformrabbiner – aber trotzdem ist er in Tora und Talmud beschlagen wie kein anderer, und als die Gemeindeältesten ihn bei seiner Amtseinführung einer scharfen Befragung unterziehen und ihn mit kniffligen Problemen aus dem Talmud auf den Zahn fühlen, erweist er sich als allem gewachsen. Ja, um den Traditionalisten in seiner Gemeinde gerecht zu werden, führt er sogar von sich aus regelmäßige Talmuddiskussionen ein.
Es sei hier erklärt, was es mit diesen beiden Säulen des jüdischen Glaubens, mit Tora und Talmud, auf sich hat.
Die Tora ist der wichtigste Teil der jüdischen Bibel, des Tanach: die fünf Bücher Mose. Dieser Tanach wird später fast vollständig zum christlichen »Alten Testament«. Er ist die größte literarische und ethische Leistung des jüdischen Volkes, sein Geschenk an die Welt.
Der Talmud nun ist der schriftliche Niederschlag der Bibel auslegung über viele Jahrhunderte hinweg – er beinhaltet Gesetze, Rituale und Lebensvorschriften der Juden und dient der ständigen Anpassung der biblischen Lehre an die sich verändernde Umwelt. So entstand ein wahres Dickicht von Erklärungen, Textanalysen, Debatten, Geschichten, Mythen und Sagen und deren erneute Ausdeutung. Um sich einen Weg durch dieses Dickicht bahnen zu können, bedurfte es großer Belesenheit, Kenntnis und der Fähigkeit, in einem Disput zu bestehen und selbst Entscheidungen zu treffen in den Fragen, wie sich ein Jude in bestimmten Situationen zu verhalten hat – etwa, ob man am Sabbat, wo ja keinerlei Arbeit erlaubt ist, sein Schaf aus dem Brunnen ziehen darf, in den es gefallen ist, oder, falls man von einem Geschäftsfreund zum Essen eingeladen wird, auch Speisen anrühren darf, die nach den Speisegesetzen nicht erlaubt sind ...
Die jahrhundertelange »Schulung« im Denken, Auswendiglernen und Interpretieren, in der Neudeutung des Überlieferten und der Anpassung an die Verhältnisse machte unter anderem die (häufige) geistige Überlegenheit der Juden über ihre Umgebung aus – jedenfalls in der Vergangenheit.
Dr. Samuel Baeck, Leos Vater, war ein Ass in dieser alten Kunst. Und darüber hinaus auch noch ein hochgelehrter Mann im allgemeinen Sinne – und seine Leidenschaft war das Lehren.
So nimmt es nicht Wunder, dass auch im Familienkreis nicht nur jüdisches Brauchtum gepflegt, sondern auch offen und vorurteilsfrei diskutiert wurde. Eine Atmosphäre von Wissbegierde und Offenheit muss in diesem Elternhaus geherrscht haben, und sicher war keine Frage von einem Tabu belegt.
Das Werk jüdischer Persönlichkeiten aus weit zurückliegender Zeit, die von den gestrengen Wahrern der Tradition (als die sich die Rabbiner einst vor allem sahen) verfemt und aus der Gemeinde ausgestoßen wurden, spielt in diesem Haus gewiss eine Rolle. Namen von »Querdenkern« wie Uriel da Costa, der die unsterbliche Seele leugnet, oder Baruch Spinoza, dem großen Philosophen, für den Gott ein Teil der Natur ist, werden dem Jungen Leo durchaus geläufig gewesen sein. Nicht ohne Grund wird der Titel seiner Doktorarbeit (1895) lauten: »Spinozas erste Einwirkungen auf Deutschland«.
Gleichermaßen unverkrampft gestaltete sich die Begegnung zwischen Juden und Christen in dieser Stadt, ähnlich dem schon erwähnten Verhältnis zwischen polnischen und jüdischen Volksgruppen. Zu einer Zeit, in der überall in Europa und vor allem in Deutschland der Antisemitismus seine fauligen Blüten trieb (wir werden davon hören), war das Verhältnis zwischen den religiösen Bekenntnissen hier erfreulich tolerant.
Beispielsweise wohnte Leos Familie zur Miete in einem Haus, das einem Pfarrer gehörte, einem calvinistischen im Übrigen, einer Glaubensrichtung der protestantischen Kirche (nach ihrem Gründer, dem Prediger Johannes Calvin, benannt), die bei ihren Mitgliedern besonders großen Wert auf Arbeit und Tüchtigkeit im Alltag legt.
Samuel Baeck und sein christlicher Amtsbruder hatten eines gemeinsam: Ihr Gehalt war jämmerlich. Und als Vater einer ständig wachsenden Kinderschar musste Baeck sich nach der Decke strecken.
Der calvinistische Hausherr wusste das natürlich, und deshalb verlangte er von Samuel Baeck nur eine minimale Miete, ja, er wollte der Familie das Haus sogar schenken. Aber Leos Vater weigerte sich, solch ein Geschenk anzunehmen, dafür war er zu stolz. Der »edle Wettstreit« zwischen den beiden Männern zog sich jahrelang hin und kam nie zu einem Abschluss.
Vielleicht ist in der Großherzigkeit dieses Pfarrers einer der Gründe zu finden, warum Leo Baeck später behauptete, der Calvinismus stehe dem Judentum am nächsten – in seiner Betonung moralischen Handelns.
BEHÜTETE KINDHEIT
Man steht früh auf im Haus des Rabbiners Samuel Baeck. Während die drei älteren Schwestern, Frieda, Tina und Lieschen, der Mutter Eva zur Hand gehen, um das Frühstück für die Familie vorzubereiten, und sich diese außerdem um den Jüngsten der Familie, den kleinen Salo, kümmert, ist Vater Samuel zusammen mit Leo und seinem vier Jahre älteren Bruder Alfred in sein Arbeitszimmer gegangen. Sie haben die Kippa aufgesetzt, jenes Käppchen, das jüdische Männer tagsüber in jeder Situation zu tragen haben, und die Söhne beobachten, wie der Vater Teffilin und Tallith anlegt: uralte Zeichen, die – Anweisungen aus der Bibel, den Büchern Moses folgend – die Verbundenheit der Juden mit ihrem Gott symbolisieren.
Die Teffilin sind lederne Riemen, die um den linken Arm und die Stirn gebunden werden. Beide Riemen tragen eine Kapsel, in der sich Bibelworte befinden – so ist man gerüstet mit den Worten der Schrift. So hat der Vater es seinen Söhnen erklärt.
Und auch für den Tallith fand er eine Sinndeutung, die den Kindern einleuchten kann: Dieser Umhang ist ein Gebetsmantel, der mit schwarzen oder blauen Streifen verziert ist, und die so genannten »Schaufäden«, Quasten, die sich an den vier Ecken befinden, dienen zur Erinnerung: Sobald man sie ansieht, soll man daran denken, dass man ein Geschöpf Gottes ist!
Auch die Jungen folgen nun dem Beispiel des Vaters und legen sich einen solchen Mantel um, denn er soll getragen werden, sobald die Kinder sprechen können.
Nun sind sie alle drei bereit zum Morgengebet.
Samuel Baeck holt das Gebetbuch, den Sidur, hervor. Es ist auf Hebräisch verfasst und enthält Gebete, die viele Jahrhunderte alt sind. Und während Alfred, der ältere der beiden Brüder, zwar den Sinn kennt, aber die einzelnen Worte nicht versteht, betet Leo mit seinen sechs Jahren ganz bewusst: Der Vater unterrichtet ihn bereits, seit der Junge reden kann, in der »Heiligen Sprache«, und manchmal berichtet der Rabbi schmunzelnd seinen Freunden, dass sein zweiter Sohn schon jetzt in der Lage ist, mit ihm über den Talmud zu diskutieren ...
Während die drei die Worte des Gebets sprechen, wiegen sie den Oberkörper vor und zurück, wie es Brauch ist.
Wann diese Form des Gesprächs mit Gott entstanden ist, weiß man nicht, aber sie ist bereits aus dem 11. Jahrhundert belegt. Es heißt, man bewegt im wiegenden Takt die Seele – es ist eine alte Technik der Versenkung und der Meditation.
In den »modernen« Synagogen der Zeit wird man ihr kaum noch begegnen. Aber so aufgeschlossen für alles Neue der Rabbiner Samuel Baeck auch ist – in diesem Fall wahrt er die Tradition.
Im Übrigen begegnet er keinesfalls traditionell-engstirnig, wie viele andere der Judenheit, den Neuerungen, die diese Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts an technischer Revolution bereithalten!
Und so bricht er mit seinen Söhnen eines Tages zu einem wichtigen Ereignis auf ...
Von Posen über Colmar und Schneidemühl soll sie führen, die Bahnlinie in diesem Distrikt. Eine Sensation!
Das findet zumindest Rabbiner Samuel Baeck, und er erklärt, dass diese neue Art des Reisens die Schranken zwischen den Völkern niederreißen und Handel und Wandel zum Blühen bringen wird. Sie fahren zu dritt nach Posen, um mit anzusehen, wie sich der erste Zug in Bewegung setzt.
Ein Händler nimmt sie mit auf seinem Reisewagen, ohne etwas dafür zu verlangen, schließlich ist es der Rabbiner, den er befördert ... und sie übernachten in Lubon bei einem Amtsbruder Samuel Baecks.
Für Alfred und Leo ist es das erste Mal, dass sie Lissa verlassen. Schon dies ist aufregend. Noch aufregender, an einem fremden Tisch zu sitzen, in fremden Betten zu übernachten.
Und dann die Aussicht auf den nächsten Tag! Sie können lange nicht einschlafen und tauschen flüsternd Vermutungen über diese Eisenbahn aus, während der Vater im Nebenzimmer noch mit ihrem Gastgeber »fachsimpelt«. Wie mag sie aussehen, diese Dampflokomotive? Was für ein Kutscher führt sie und wer heizt sie an? Ob es stimmt, dass sie auf Schienen fährt, wie überall erzählt wird? Ob da jemand vorweg laufen muss, der diese Schienen fegt? Und wie viele Wagen wird sie wohl ziehen?
Viel zu spät machen sie die Augen zu. Und viel zu früh werden sie geweckt. Von Lubon nach Posen sind es noch einmal fast zwei Stunden Fußmarsch.
Auch wenn der Morgen erst graut – man muss sich beeilen. Das Frühstück auszulassen ist kein Problem. Aber nicht das Morgengebet. Unerbittlich besteht Rabbi Samuel Baeck darauf, mit seinen Söhnen, Tallith und Teffilin angelegt, die Morgenandacht zu vollziehen – und trotz aller Ungeduld sehen die beiden das auch ein. Nie würden sie auf die Idee kommen, den Tag zu beginnen, ohne mit Gott gesprochen zu haben.
Als sie sich schließlich auf den Weg machen, ist die Zeit schon bedenklich fortgeschritten. Diese Eisenbahn, so erfahren sie, hat einen Fahrplan, und den wird sie auf die Minute genau einhalten.
Zum Schluss rennen sie fast. Aber als sie in die Straße zum Bahnhof von Posen einbiegen, hören sie einen gellenden Pfiff: das Abfahrtssignal. Sie können nicht weiter, denn direkt vor ihren Augen senkt sich mit warnendem Geklingel ein weißrot gestreifter Schlagbaum herab: Und da sind sie, direkt hinter dieser Barriere, die Schienen!
Der Vater atmet schwer vom schnellen Gehen. Er zieht sein Taschentuch und trocknet sich die Stirn.
»Nicht so schlimm!«, tröstet er die Jungen. »Der Zug kommt schließlich hier vorbei. Da können wir ihm doch wenigstens noch zuwinken.«
Und dann kommt es heran.
Ein Ungeheuer braust schnaubend aus dem Schatten der Gebäude hervor. Lichter glotzen sie wie Augen an. Schwarze Rauchwolken puffen in regelmäßigen Abständen aus dem hohen Schornstein, als wären sie der Atem eines Feuerdrachen.
Leo flüchtet sich hinter seinen Vater, er klammert sich an dessen Rock fest, starrt mit weit aufgerissenen Augen auf die vorbeirollenden riesigen Räder und die wie ein Blasebalg hin- und hergehenden eisernen Arme, die sie antreiben – eine Höllenmaschine! Dampf wallt auch von diesen Rädern auf, umnebelt alles. Und unter Donnergetöse folgt Wagen auf Wagen: Tatsächlich! Es sitzen Menschen darin, sie stecken ihre Köpfe zum Fenster hinaus, lachen, winken.
Samuel Baeck winkt zurück, beeindruckt.
Aber seine Söhne sind sehr still geworden. Besonders Leo. Der Junge zittert.
Der Vater ist nicht gewillt, solche Ängstlichkeit zu unterstützen. Er übersieht sie. Sagt lächelnd: »Schade, dass wir nicht erleben konnten, wie der Zug im Bahnhof losgefahren ist. Da gab es bestimmt Musik und Reden und viele Leute, die ihre Hüte schwenkten.«
»Wir haben eben zu lange gebetet«, sagt Alfred verzagt.
Samuel Baeck wirft ihm einen strafenden Blick zu.
Leo schüttelt den Kopf. »Wir haben nicht lange genug gebetet. Hätten wir länger mit Dem Herrn gesprochen, dann hätten wir dieses schreckliche Ding nicht sehen müssen. Es kommt daher, als ob es alle zerschmettern würde, die nicht so schnell und so stark sind wie es selbst. Solche Gewalt ist – böse.«
Der Vater zieht das Kind an sich. Leo ist sechs Jahre alt. Und manchmal spricht er wie jemand, der schon alles weiß. Altklug? Ja, das auch.
SCHULZEIT
Leo besucht das Gymnasium, an dem sein Vater unterrichtet. Und wenn er auch kluge Sprüche loslassen und mit dem Papa über den Talmud disputieren kann – er ist kein Musterkind, sondern ein ganz normaler Junge.
Lang aufgeschossen und schlaksig ist er. Zu Sport – damals sagt man »Leibesübungen« – hat er allerdings keine Lust, wahrscheinlich findet er die angebotene Art von Freiübungen öde. Was nicht bedeutet, dass er ein Stubenhocker ist. Er ist viel draußen, schwimmt, läuft, wandert. Wie später deutlich wird, muss er sogar Reitunterricht genossen haben.
Da ihm das Lernen keine Mühe macht, ihm der Stoff einfach zufliegt, langweilt er sich häufig im Unterricht – das Problem vieler Hochbegabter auch heutzutage. Unordnung und mangelnde Disziplin wird ihm einmal bescheinigt, sicher sehr zum Ärger seines Lehrer-Vaters.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://portal.dnb.de abrufbar.
1. Auflage
Copyright © 2012 by Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, München
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Umschlagmotiv: Leo Baeck, 1930, © Marianne C. Dreyfus, New York/USA Lektorat: Burkhard Heiland
eISBN 978-3-641-08368-7
www.gtvh.de
www.randomhouse.de
Leseprobe