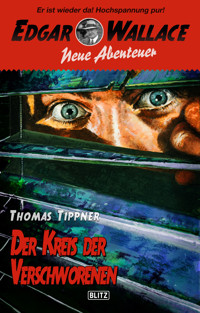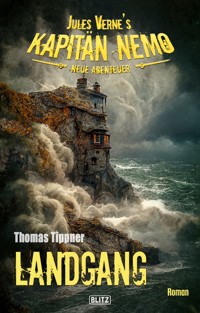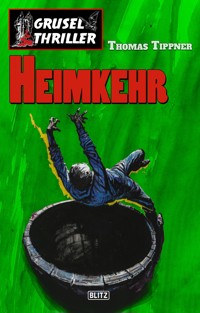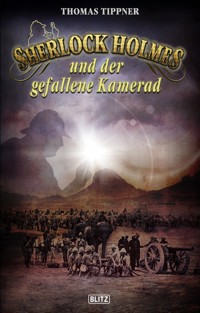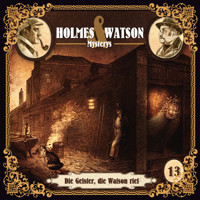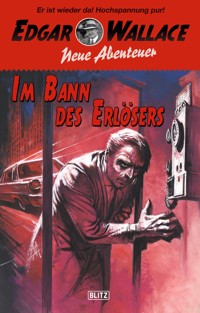
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Edgar Wallace - Neue Fälle (Kriminalgeschichten)
- Sprache: Deutsch
Inspektor Pommeroy steht vor seinem schwersten Fall. Ein Serienmörder, brutale Mafiabosse und eine wunderschöne Journalistin – wie passt das alles zusammen? Die Printausgabe umfasst 158 Buchseiten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 158
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
In dieser Reihe bisher erschienen
1901 Dietmar Kuegler Der unheimliche Pfeifer von Blending Castle
1902 Dietmar Kuegler Die goldenen Mönche
1903 Thomas Tippner Im Bann des Erlösers
1904 J. J. Preyer Der Spieler
1905 Reiner F. Hornig Das Geheimnis der toten Augen
1906 Thomas Tippner Die verlorenen Mädchen von London
1907 Thomas Tippner Die Flussratten von London
1908 Thomas Tippner Der Kreis der Verschworenen
1909 Reiner F. Hornig Das Erbe des Magiers
Im Bann des Erlösers
Edgar Wallace - Neue Abenteuer
Buch 3
Thomas Tippner
Als Taschenbuch gehört dieser Roman zu unseren exklusiven Sammler-Editionen
und ist nur unter www.BLITZ-Verlag.de versandkostenfrei erhältlich.
Bei einer automatischen Belieferung gewähren wir Serien-Subskriptionsrabatt.
Alle E-Books und Hörbücher sind zudem über alle bekannten Portale zu beziehen.
Copyright © 2019 Blitz Verlag, eine Marke der Silberscore Beteiligungs GmbH, Mühlsteig 10, A-6633 Biberwier
Redaktion: Jörg Kaegelmann
Titelbild: Rudolf Sieber-Lonati
Umschlaggestaltung: Mario Heyer
Logo: Mark Freier
Satz: Gero Reimer
Alle Rechte vorbehalten.
ISBN: 978-3-95719-073-4
1903 vom 25.08.2024
Inhalt
1. Eine Leiche
2. Beim Don
3. Eine Journalistin
4. Der Erlöser
5. Zwei Morde
6. Wer ist der Erlöser?
7. Überführung
8. Die Jagd geht weiter
9. Ein Geheimnis lüftet sich
10. In letzter Minute
Eine Leiche
Roy Hutchison hatte noch nie viel besessen.
Das wenige, was er am Leib trug, war das, was ihm ehrlich gehörte. Es war weder gestohlen noch anderweitig geliehen. Nicht so, wie die wenigen Pence, die er in der Tasche mit sich führte, oder die um seinen Hals hängende, für sein schmales Gesicht viel zu große Brille. Pence und Brille hatte er an sich genommen, als er an einem geöffneten Fenster vorbei gegangen war. Ein Fenster, das den Geruch nach abgestandener Luft und viel zu selten gewechselter Kleidung ausgeströmt hatte. Der typische, ihm die Wut in den Körper treibende Gestank des East Ends, der ihn schon sein Leben lang begleitet hatte.
Hier, auf den schlecht gepflasterten viel zu engen Straßen und schmalen Gassen war er aufgewachsen. Hier hatte er gelernt zu lügen, zu stehlen und Dinge an sich zu nehmen, die Menschen erst nach mehreren Stunden vermissten.
Die Brille, die er gestohlen hatte, konnte er bei einem der zahlreichen Pfandleiher der Stadt verkaufen. Viel würde er dafür zwar nicht bekommen, das wusste er, aber es würde reichen, um den heutigen Abend und den kommenden Morgen nicht hungrig ins Bett gehen zu müssen.
Was für ihn schon viel war.
Denn es hatte mehr als genug Tage und Nächte gegeben, an denen Roy mit knurrendem Magen eingeschlafen und wieder aufgewacht und mit knurrenden Magen ziellos durch die Straßen geirrt war, in der verzweifelten Hoffnung, auf irgendeinem Hinterhof in einer der zahlreichen Mülltonnen etwas Essbares zu finden.
Allein die Aussicht darauf, sich in spätestens einer Stunde Brot, Wurst und Käse leisten zu können – und ein kühles Ale – ließ ihn sich übermütig fühlen, sodass er die Nacht zum Tag machen wollte.
Einmal ordentlich auf den Putz zu hauen.
So wie es sich für einen Jungen deines Formats gehört. Wann hast du das letzte Mal ausgelassen gefeiert und getanzt, Big Roy? Das ist schon Monate her. Du warst so herrlich ausgelassen und betrunken, dass du dir ernsthaft überlegt hattest, mehr aus deinem Leben machen zu wollen.
Erinnerst du dich noch daran, Big Roy?
Du hast über eine Stunde darüber geredet, wie man das Elend des East Ends hinter sich lassen kann, um in die Mittelschicht aufzusteigen. Du hast ernsthaft mit dem Gedanken gespielt. Aber das, was am allerschlimmsten war, war, dass du wirklich daran geglaubt hast, es zu schaffen.
Du wolltest es schaffen!
Allein diesen Gedanken auch nur zu denken, tat Roy weh. Er erinnerte sich nur zu gut an jenen besagten Abend. Er erinnerte sich daran, wie er das eine oder andere Bier zu viel getrunken hatte ... dass er mit einem jungen Mann ins Gespräch gekommen war ... den er natürlich hatte einladen müssen, weil dieser pleite gewesen war ... und wie er darüber geredet hatte, wie es wohl sein würde, wenn man ein eigenes Geschäft leiten würde.
Nicht solche, wie die heruntergekommenen und zwielichtigen Kaschemmen, in denen sie sich den ganzen Tag über aufhielten. Nein, er hatte ein Lokal im Sinn gehabt, in dem sich gut situierte Damen zu einer kleinen Pause niederließen, während sie erschöpft daran dachten, wie anstrengend der gerade getätigte Einkauf gewesen war. Junge Burschen, die zu ihm kommen würden, um eine Leberpastete zu essen, ein Ale zu trinken und sich dabei amüsiert darüber unterhalten würden, wie sie auf der Rennbahn einige Pence gewonnen hatten.
All das hatte er so klar und deutlich vor seinem inneren Auge gehabt, dass er sich schon hinter dem Tresen hatte stehen sehen. Ordentlich angezogen, die Haare geschnitten, den weißen Kragen seines Hemdes gestärkt, um den Bauch eine Schürze und im Laden eine Bedienung, die so hübsch war, dass man sich Hals über Kopf in sie verlieben konnte.
Doch all diese Vorstellungen waren jetzt nicht mehr vorhanden.
Sie waren in einem Nebel aus Alkohol, Kummer und selbst herbeigeredeten Leid untergegangen. Sie schwammen jetzt nur noch selten an der Oberfläche seines getrübten Bewusstseins, das immer kurz davorstand, im Alkohol zu ertrinken.
Roy leckte sich über die trockenen Lippen, während er die wenigen Pence, die er gestohlen hatte, mit den Fingerspitzen betastete.
„Wie sieht es aus, Kleiner, Lust auf etwas Spaß?“
Abrupt aus seinen Gedanken gerissen, hob Roy überrascht den Kopf und schaute zu der schlanken, sich grazil bewegenden Frau hinüber. Obwohl sie alles versucht hatte, um ihr abgehalftertes und heruntergekommenes Äußeres mit Rouge, Schminke und viel zu stark aufgetragenem Parfüm zu verbergen, konnte man den Kummer des East Ends doch allzu deutlich in jeder ihrer Bewegungen und Blicke erkennen. Die Oberlippe war starr, um die dahinterliegenden, schlechten Zähne zu verbergen. Die rechte Hand lag fest am Saum des Rockes, damit Roy das Loch in ihrem Kleid nicht auffiel. Der ausladende Gang, um zu verheimlichen, dass sie sich mit Opiaten oder Alkohol die Sinne vernebelt hatte. Dazu noch die streng hochgesteckten Haare, um die lichten Stellen auf ihrem Kopf zu verbergen.
„Jetzt nicht.“
„Komm schon. Kostet dich auch nur einen Pence. Da hinten können wir ...“
„Nein!“
Roy, der versuchte, so schnell wie möglich viele Meter zwischen sich und der Prostituierten zu schaffen, ging nicht nur deshalb nicht auf das Angebot der schwankenden Frau ein, weil er sie unattraktiv fand, sondern weil sein Blick in diesem Moment auf sie gefallen war.
Sie, das war die junge, zierliche, ihm immer wieder den Kopf verdrehende Esther Morgan. Die Frau war noch nicht lange hier, das wusste er. Obwohl Roy immer schnell an die gewünschten Informationen kam, die er brauchte, hatte er über die rothaarige, unverbrauchte Esther noch nichts in Erfahrung bringen können. Das eine oder andere Gerücht hatte besagt, dass sie ursprünglich aus Glasgow stammte, ein anderes, dass sie aus Liverpool hierhergekommen wäre, um ihrer kranken Schwester beiseitezustehen.
„Wer ist denn ihre Schwester?“, hatte er daraufhin gefragt, aber nur ein Schulterzucken als Antwort erhalten.
Jemand anderes hatte gemeint, dass sie überhaupt nicht aus England stammte, sondern dass sie den weiten Weg von der Adria oder dem Po hierhergemacht hatte.
„Um sich hier im East End zu verkaufen?“
Doch wieder war ihm nur ein Schulterzucken geschenkt worden.
Roy hatte anschließend ein oder zwei Mal versucht, mit Esther in Kontakt zu treten – was ihm aber leider nicht gelungen war. Einmal hatte sie ihn nur verständnislos angeschaut, das andere Mal war sie am Bordstein stehen geblieben, um auf ein näherkommendes Auto zu warten, das knatternd und Abgase hinter sich ausspuckend auf sie zugefahren war.
Jetzt, wo er gerade versuchte, seine trüben Gedanken abzuschütteln, die ihm sagen wollten, was er für ein Versager war, sah er sie wieder. Sie stand in einem Hauseingang, unschlüssig, die Hände aneinandergelegt, den Blick unruhig hin und her schweifen lassend.
Roy, der sich die Chance, mit Esther zu sprechen, nicht entgehen lassen wollte, hob die Hand und rief: „Hey, hast du vielleicht mal einen Moment Zeit für mich?“
Esther schaute hoch, und als Roy näherkam, begriff sie, dass er wirklich sie gemeint hatte.
„Du kannst dich mich nicht leisten“, sagte sie mit einem merkwürdigen Akzent, den er nicht zuordnen konnte.
Das hat nichts mit Glasgow zu tun, und schon gar nichts mit dem breiten Slang Liverpools, dachte er und malte sich aus, wie es wohl war, mit einer Frau zusammen zu sein, die von der Adria stammte oder am Po groß geworden war.
„Ich habe Pence“, sagte er und hielt ihr die Handvoll Münzen entgegen, die er gestohlen hatte. „Reicht das?“
Sie zuckte mit den Schultern und musterte ihn dabei so, wie er gerade eben die Prostituierte gemustert hatte. Ein geringschätziger abwertender Blick, der ihm deutlich zu verstehen gab, was für ein Erscheinungsbild er bot.
„Ich will nicht!“
„Das kannst du dir aber nicht aussuchen“, meinte Roy und erwischte sich dabei, dass er genauso abfällig über die Werte dieser Frau sprach, wie alle Männer hier im East End.
So wollte er doch gar nicht sein.
Das hatte er nie gewollt.
Ich bin zu etwas Besserem bestimmt, als das hier, dachte er nicht zum ersten Mal und streckte seine schmutzige Hand noch weiter vor, damit Esther alle Münzen sehen konnte, die er darin hielt.
„Ich möchte aber nicht mit dir gehen“, sagte sie erneut und bemühte sich, die richtigen Worte zu finden.
„Dann lass uns nur reden“, bat er sie.
„Reden?“
Er nickte. Mit einem Lächeln, das seine schiefen Zähne offenbarte, versuchte er, ihre Zweifel beiseitezuschieben. Was ihm allerdings nicht gelang, denn er sah, dass sie am liebsten in die Tür zurückgewichen wäre, aus der sie gerade eben erst getreten war.
Erneut pöbelte die Prostituierte hinter ihm einen vorbeiziehenden Mann an, der ihre Dienste nicht angenommen hatte. Irgendwo schlug eine Tür krachend ins Schloss und das, was ihm am stärksten in Erinnerung geblieben war, als sich Esthers Gesicht plötzlich versteifte und sie einen Schritt zurücktaumelte, war, dass sich in der Etage über ihm eine Frau und ein Mann stritten, sich mit Schimpfwörtern bedachten und kurz davorstanden, handgreiflich zu werden.
Doch das alles wurde zu einem undurchdringlichen, diffusen Brei aus Eindrücken und Wahrnehmungen, wie Roy sie noch nie zuvor erlebt hatte. Alles war irgendwie verschoben. Die Perspektiven passten nicht mehr zusammen. Da war zum einen das Leben auf der Straße und dann war dort der Tod im Hauseingang. Eine in sich zusammensackende Esther, auf deren Stirn sich plötzlich ein kreisrundes Loch befand, aus dem ein kleines Rinnsal Blut floss. Es sah so aus, als wäre es ihr auf die blasse Haut gemalt worden ...
* * *
Pommeroy mochte Schießstände nicht.
Sie waren ihm regelrecht zuwider. Denn hier lernte man, wie man anlegte, zielte und anschließend auf einen Menschen schoss.
Obwohl er Polizist war und mehr als einmal in einen Schusswechsel geraten war, verstand er nicht, wie sich jemand an Waffen ergötzen konnte ... wie jemand mit der Pistole in der Hand aufbrechen konnte, um einen anderen Menschen kaltblütig zu erschießen.
Er seufzte, als er an all seine zurückliegenden Fälle und Untersuchungen denken musste. Als er sich daran erinnerte, wie oft er schon in den dunklen, todbringenden Lauf eines Revolvers geschaut hatte und sich sicher gewesen war, dass das Letzte, was er in seinem Leben sehen würde, das Aufblitzen eines abgegebenen Schusses sein würde.
Ebenezer verabscheute Waffen, und zwar in jeglicher Form.
Sie waren seiner Meinung nach die Geißel der Menschheit.
Ebenezer Pommeroy hatte sich bis zum heutigen Tag niemals wirklich als großer Poet gesehen, geschweige denn als offensiver Weltverbesserer. Doch das, was er eben gedacht hatte, während er auf den Schießstand Nummer 4 zuging, an dem sein Vorgesetzter, ehemaliger Partner und bester Freund stand, meinte er ehrlich.
Auch Patrick war jemand, der keine Skrupel kannte, wenn es um den Gebrauch von Waffen ging. Er selbst hatte sogar angeordnet, dass die Polizisten in seinem Distrikt bessere und effektivere Waffen bekamen.
„Damit sie der immer mehr zunehmenden Gewalt auf der Straße Herr werden können“, hatte er Pommeroy in einer ruhigen Minute, mit einer Zigarre und einem Ale, versucht zu erklären. Ein Gespräch, das sich die ganze Nacht hingezogen und dazu geführt hatte, dass Pommeroy und Patrick das erste Mal in ihrem Leben als geschiedene Leute nach Hause gegangen waren.
Das in hohen Mengen fließende Ale, die späte Abendstunde und das Gefühl, seine Position weiter verteidigen zu müssen, hatten leider zu einem unangenehmen Bruch geführt ... zu einem Bruch, den Pommeroy so nicht hatte kommen sehen und auch nicht erwartet hatte. Bisher war ihm immer alles so selbstverständlich erschienen. Besonders die Freundschaft mit Patrick.
„Du wirst akzeptieren müssen, dass ich daran interessiert bin, dem Verbrechen die Stirn zu bieten, Ebenezer“, waren Patricks harsche Worte gewesen, als Pommeroy versucht hatte, den zwischen ihnen entstandenen Streit zu schlichten. „Rüsten sie auf, rüste ich auf. Ob es dir nun gefällt oder nicht.“
„Und deshalb schießt du wieder mit deinem Gewehr?“
„Ja, auch deshalb!“
Ebenezer hatte seine Frage gar nicht so anklagend klingen lassen wollen, wie sie schließlich herübergekommen war. Er hatte an Patricks Gesichtsausdruck sofort gesehen, wie dieser sich verschlossen hatte ... wie er die Worte innerlich abwog und sich überlegte, ob er sie als Angriff und als Fortsetzung ihres Streites sehen wollte oder einfach nur als unbedacht dahingesprochene Lappalie, die man mit einem Schulterzucken übergehen konnte.
Er hatte sich letzten Endes für das Schulterzucken entschieden und sich dann dazu hinreißen lassen, zu erklären: „Es ist wohl auch ein wenig Nostalgie. Damals, im Krieg, hatte ich das Gefühl, mit jedem abgegebenen Schuss etwas Gutes getan zu haben. Verstehst du? Wir haben immerhin verhindert, dass die Deutschen den Kontinent ins Verderben stürzen.“
„In London herrscht aber kein Krieg“, erinnerte ihn Pommeroy.
„Zum Glück.“
Damit war ihre Unterhaltung beendet gewesen und sie hatten sich danach bestimmt zwei Wochen nicht mehr gesehen.
Bis heute.
Doch er musste etwas mit Patrick besprechen, konnte es aber nicht verhindern, dass die Gedanken, die Gefühle und einfach alles, was in ihm hochgekommen war, als sie sich gestritten hatten, nun wieder an die Oberfläche seines Bewusstseins gespült wurden.
Pommeroy seufzte, als er daran dachte, wie viele unzählige Nächte er sich den Kopf darüber zerbrochen hatte – so wie er es auch seit geraumer Zeit über Gloria Samfield tat –, was Waffen anrichteten und wem sie nützten. Schließlich war er zu der Erkenntnis gekommen, dass es letztendlich die Waffen waren, die die Abgründe der menschlichen Seele öffneten. Dass sie es waren, die einem das Gefühl verliehen, stärker zu sein als der andere.
Aus diesem Grund gab es das organisierte Verbrechen in London überhaupt.
Verbrecher, die keinerlei Skrupel mehr kannten. Ein Menschenleben zählte überhaupt nicht mehr, nur der Profit. Niemand scherte sich mehr darum, ob eine Prostituierte mit einem Kopfschuss niedergestreckt wurde. Keinen kümmerte es, dass die Verbrecher sich gegenseitig an die Gurgel gingen, um ihre intern abgesteckten Territorien zu verteidigen.
Polizisten waren da nur noch ein unangenehmes Übel. Ein Übel, das man ohne mit der Wimper zu zucken aus der Welt schaffen konnte ... und zwar mit einer Waffe in der Hand.
Patrick O’Tool, der am Schießstand 4 stand, kümmerte sich anscheinend nicht um solche Details. Er hielt es offenbar für nötig, dass man ebenso gerüstet war wie die Verbrecher.
Eine kontroverse Diskussion, die die beiden schon oft miteinander geführt hatten.
Ebenezer konnte nur mit einem Schaudern daran denken, dass ihre Diskussion zu einem handfesten Streit ausgeartet war, weil sie an diesem Abend zu viel Ale und zu viel Whiskey getrunken hatten.
Ich hätte ihn geschlagen, wenn wir nicht voneinander getrennt worden wären, dachte Pommeroy jetzt, als er auf Patrick zuging, der gerade mit seiner Lee-Enfield Rifle No.4 Mark drei kurze, trockene Schüsse abgab. Das Enfield hatte er, wie er Pommeroy einst erzählt hatte, aus seinem Militärdienst mitgenommen. Der Weltkrieg, der Europa erschüttert hatte, hatte auch bei O’Tool seine Spuren hinterlassen. Obwohl er sich immer wieder darüber beschwerte, wie unhandlich und schwer das Gewehr war, ließ er doch nicht davon ab, damit zu schießen.
Er übte beinahe schon versessen damit.
„Ebenezer“, wurde Pommeroy nun begrüßt. Dieser, ganz in Gedanken versunken, zuckte zusammen und schaute dann den ebenfalls hochgewachsenen, schmalen Mann an, dessen herber Humor ihm im wahrsten Sinne des Wortes ins Gesicht geschrieben stand. Allein die Zahnlücke, die er besaß, hatte etwas Spöttisches an sich, wenn William O’Tool mit einem Gesprächspartner redete. William, der ältere Bruder von Patrick, hatte sich während des Krieges dem Geheimdienst Security Service angeschlossen und war seitdem immer wieder an der Seite von Patrick zu sehen, wenn es darum ging, Verbrecher zu verhaften und polizeiliche Ermittlungen zu führen.
„William“, meinte Pommeroy lächelnd. „Mit dir habe ich hier nicht gerechnet. Ich dachte, du hast mit Gregory zu tun.“
„Auch ein Mitarbeiter des Security Service muss sich mal entspannen.“
„Hier?“
„Gerade hier“, bestätigte ihm William, hob sein Gewehr und lächelte verschmitzt. „Manchmal muss ich mir einfach den Pulverdampf um die Nase wehen lassen.“
„Meine Welt ist das nicht.“
„Ich habe schon von euren Diskussionen gehört“, erwiderte William lächelnd, knuffte Pommeroy und fragte ihn dann mit einem spöttischen Unterton in der Stimme: „Und? Wann nimmst du die schweren Jungs hoch?“
„Ich arbeite noch daran.“
„Mit welchem Fall bist du denn gerade beschäftigt?“
„Als ob du das nicht wüsstest!“
Ebenezer war noch nie ein Mann gewesen, der es geliebt hatte, Geheimnisse zu haben. Ehrlichkeit war für ihn das A und O in der Suppe des Lebens.
Menschen wie William, die immer mehr wussten und mehr durften und die oft außerhalb der bestehenden Gesetze agierten, mochte Pommeroy nicht sonderlich, denn sie hatten immer etwas Überhebliches an sich.
William ausgeschlossen.
Denn bisher war ihm Patricks Bruder immer ausgesprochen kooperativ und freundlich gegenübergetreten.
Was bestimmt daran liegt, dass wir uns schon seit der Schulzeit kennen. Wir sind schließlich nur eine Straße voneinander entfernt aufgewachsen.
Pommeroy mochte die Erinnerungen an damals. Er liebte es, in den Bildern der Vergangenheit abzutauchen und sich dabei zuzusehen, wie er schon damals mit Patrick und William versucht hatte, das Gesetz in die Hand zu nehmen. Dass sie gegen die Schläger und Möchtegernverbrecher vorgegangen waren und richtige Strategien entwickelt hatten, um die Jungs und Mädels dingfest zu machen.
Sie hatten dabei einen Eifer entwickelt, der sich in ihrem späteren Leben auszahlen sollte.
Denn jeder von ihnen hatte letzten Endes einen unterschiedlichen Weg eingeschlagen, um erfolgreich gegen das Verbrechen vorgehen zu können.
Jeder von ihnen hatte das damals gesteckte Ziel – Gerechtigkeit in die Welt zu tragen – nie aus den Augen verloren.
„Steht die Razzia bei Gregory immer noch an?“, wollte William wissen, als er sein Gewehr lud.
„Ja, so wie mit Patrick besprochen.“
„Ich hoffe, ihr findet die Unterlagen, die ihr braucht, um den Hund endlich verhaften zu können.“
„Das hoffe ich auch.“
„Dir macht aber etwas anderes Sorgen, das sehe ich dir an“, meinte William, der in Pommeroy noch immer lesen konnte, wie in einem Buch.
„Leider“, antwortete Ebenezer seufzend.
„Um wen geht es denn?“
„Um Revera!“
„Oh“, meinte William, ließ das Gewehr sinken und schüttelte den Kopf. „Ein wirklich unangenehmer Mann. Hat in Neapel für ordentlich Unruhe gesorgt und ist nicht dafür bekannt, sich Freunde zu machen.“