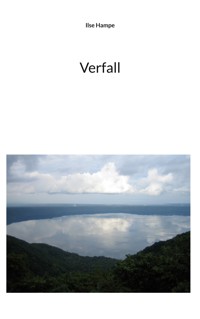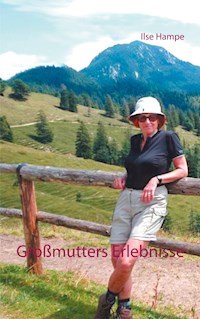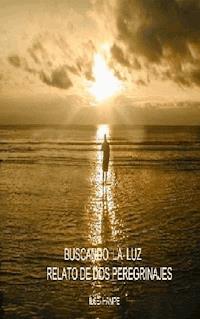Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Geboren am Ende des 19. Jahrhunderts, gestorben am Ende des 20., durchlebte Elfriede das letzte fast vollständig. Im wohlbehüteten Schoße einer bürgerlichen Familie aufgewachsen, konnte sie nicht ahnen, welche Strapazen ihr das Leben aufbürden würde: Zwei Weltkriege, eine geschiedene Ehe, Kinderlosigkeit, keine weitere anhaltende Beziehung zu einem Mann, Pflegejahre ihrer Mutter, die letzten zwanzig Jahre ihres eigenen Lebens im Pflegeheim. Reisen war bis in die 60-er Jahre keine Selbstverständlichkeit, sodass sie ihren Geburtsort Braunschweig kaum verlassen hat. Im Geiste tat sie es doch; ihr jüngster Bruder war hierfür verantwortlich. Er zog nach Uruguay im entfernten Südamerika. Somit breitete auch sie ihre Flügel aus, weitete ihren Horizont und wuchs in die Höhe. Wir lernen sie in diesem Werk nur indirekt kennen durch die Korrespondenz an sie beziehungsweise an ihre Mutter von verschiedenen Schreibern und im Verlaufe der Jahrzehnte. Die meisten Briefe stammen von ihrem jüngsten Bruder, beginnend aus seiner Studentenzeit, später aus dem entlegenen Südamerika. Es ist vor allem er, der sie mit neuen Aufgabengebieten betreut, die sie alle meistern wird. Aber noch weitere Männer spielen eine herausragende Rolle in ihrem Leben, der Ehemann, hier vor allem in der Zeit nach ihrer Scheidung, und Roland, ein junger italienischer Kriegsgefangener, neben anderen kurzen Männerbekanntschaften. Zum besseren Verständnis sind die Briefe mit den geschichtlichen Begebenheiten in Zusammenhang gebracht. Sie stellen letztendlich ein historisches Zeitdokument dar. Elfriede, eine Frau ohne besondere Ausbildung, sollte in ihren Fünfzigern reifen und dazulernen, wie durch einen Crashkurs geführt. Sie, die weder eine Wissenschaftlerin noch eine Nobelpreisträgerin war, die zu den Unzähligen gehörte, die nur im kleinen familiären Rahmen eine Leistung erbracht haben, die in keinem Geschichtsbuch honoriert wird, die dennoch unersetzlich und unentbehrlich ist für das Gedeihen und den Fortschritt der Menschheit, sie steht exemplarisch für all die anderen unerwähnten, vergessenen Menschen, die in ihrer reduzierten Umgebung von großer Bedeutung waren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 393
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Edgar, der freche Student
Hansemann
Bruder Edgar entweicht dem Krieg
Eine pikante Bekanntschaft
Elfriede, die Arbeiterin und mehr!
Sisto oder Liebe auf Italienisch
Die Neue Welt hilft der Alten
Elfriedes neues Metier: Bankkauffrau
Elfriede, das Mädchen für alles
Elfriedes letzte Etappe
Bibliographie
Einleitung
Die Initialen E.B. ragen mir auf Bettwäsche, Hand- wie Geschirrtüchern freundlich entgegen. Sie sehen fein säuberlich gestickt aus, dabei nehme ich doch an, dass sie maschinell aufgetragen wurden. Dabei handelt es sich um solche Unmengen dieser Haushaltswäsche, dass sie sich mittlerweile auf mehrere Haushalte verteilt befindet, auf die meiner Geschwister, auf meinem eigenen und dem meiner Tochter. Ja, und dabei treffen die Initialen auf keinen einzigen von uns zu.
Sie sind die meiner Tante. Bei jedem neuen Wäschestück, das sie sich zulegte, ließ sie sich verewigen, ja das kann man fast behaupten, da zumindest diese Dinge sie um bereits mehrere Jahrzehnte überlebt haben. Sie erfüllen durchaus einen Zweck: Wir werden immer wieder an unsere Tante erinnert! Es sind schöne Erinnerungen! An eine fröhliche, lächelnde, durch ein Osteoporoseleiden gekrümmte Frau, die ihre Schmerzen voller Tapferkeit ertrug, die Stunden lang mit ihren Freundinnen telefonierte, wobei sie früher statt zum Hörer zur Feder gegriffen und endlose Seiten mit ihren kaum entzifferbaren Hieroglyphen gefüllt hatte. Sie besaß eine Ausstrahlung, die ihr ständig neue Bekanntschaften bescherte, auch im hohen Alter und zwar auch von deutlich jüngeren Menschen.
Sie hatte offensichtlich eine Sammelwut für die nichtigen Dinge des täglichen Lebens entwickelt, wahrscheinlich als Reaktion auf die durch beide Weltkriege erlittenen Entbehrungen. Konnte man Vertrauen haben ins blühende deutsche Wirtschaftswunder? Würde es tatsächlich halten oder gar durch ein neues Massaker zunichte gemacht werden? Sie wähnte sich nicht in Sicherheit und hortete vorsichtshalber, ohne Vertrauen in die Beständigkeit des Warenangebots.
Offensichtlich empfand sie selber die Anzahl von Stapeln an Tischdecken und dazugehörigen Servietten als durchaus angemessen für ihren Einpersonenhaushalt. Zumindest musste ich es so interpretieren, als es beim Gespräch um ein Hochzeitsgeschenk für mich darum ging. Sie fragte mich, was ich mir wünsche oder brauche. Ich antwortete, sie solle kein Geld ausgeben, - von dem ich wusste, dass sie nicht viel besaß, da unser Vater sie finanziell unterstützte - sondern mir doch etwas von ihrer unzähligen Haushaltswäsche überlassen. Erstaunt erwiderte sie, sie besäße nichts Überflüssiges. Da ich nicht ihre Schränke aufreißen und ihr die endlosen fein gebügelten und gestärkten Tücher aus den verschiedensten Epochen, von hundertjährig bis neuwertig, aufzeigen konnte, einigten wir uns auf einen Teil des Familiengeschirrs. Die Zeit der großangelegten Bewirtungen war für sie eh längst vorbei.
T.E., wie sie verkürzt in unserem schriftlichen Familienjargon bezeichnet wurde, hat bleibende Erinnerungen in uns hinterlassen. Sie mutierte zur Fee, die mit ihrem Zauberstab die schönsten erdenklichen Dinge über den Ozean wandern ließ. Sie bewies bei der Auswahl ihrer Geschenke einen raffinierten Geschmack und besaß obendrein die Eigenschaft, das für das jeweilige Alter Treffende auszusuchen, für Kinder, die sie nicht kannte oder über einen langen Zeitraum nicht mehr gesehen hatte, die sie nicht dank einer modernen Technik per Computerclick zu Gesicht bekommen konnte. Weihnachten im warmen Südamerika bekam sein i-Tüpfelchen aufgrund der Gaben aus dem entfernten Deutschland. Ich fieberte immer danach, ihre Geschenke auszupacken. Sie waren stets die Krönung des Abends, und ich wusste, dass meine Kusinen vor Neid erblassen würden. Es waren besondere, ausgefallene Kleidchen, Blusen, egal was, es stimmte und passte immer. Alles war mit Liebe, mit Aufwand ausgesucht worden. Man spürte ihr Interesse für uns, ihre Ersatzkinder. Es war kein Kommerz dahinter, kein Pflichtabhaken.
Mit diesen Dingen und mit ihren endlosen, mit Tinte auf hellblauem Briefpapier verfassten Berichten knüpfte sie Bande, stark wie Taue.
Aber das wichtigste Geschenk, das sie mir hinterließ, das waren die an sie gerichteten Briefe, die sie fein säuberlich mit einem Bändchen zusammengebunden in Schächtelchen, teilweise über Jahrzehnte aufbewahrt hatte. Sie konnte sich nicht von diesen Erinnerungen trennen, obwohl einige sie doch schmerzen mussten. Ich stelle mir vor, sie rechnete damit, dass jemand diesen Schatz eines Tages bergen, dass sie mit ihm auferstehen würde. Ich stelle mir auch vor, sie habe ihn für mich, für meine Entdeckung im elterlichen Hause auf dem Dachboden deponiert. Samt aller Briefe ihres Bruders Edgar, der sie des Öfteren ermahnt hatte, sie zu vernichten. Aber sie tat es nicht. Damit ich mein Bild über meinen leicht zur Wut neigenden Vater korrigieren konnte, damit ich die anderen Facetten seines Charakters kennen lernte, seine Großzügigkeit seiner Mutter und seiner Schwester gegenüber, seinen Humor und sein Pflichtbewusstsein.
Und so komme ich dazu, diese Hommage an meine Tante zu schreiben, eine gewöhnliche Frau, eine aus der Masse, die keinen Doktortitel besaß, die keine wissenschaftlichen Erkenntnisse für das Weiterkommen der Menschheit lieferte, eine Frau von vielen, die im Hintergrund steht, deren Taten nichts Weltbewegendes bewirkt hat, die dennoch exemplarisch für alle jene gelten soll, die im kleinen, reduzierten, versteckten Raum wirken. Und hier erbringen sie Leistung, wachsen mit den neu entstehenden Aufgaben über ihren eigenen Rahmen hinaus und stellen unter Beweis, dass ja jede von uns zu größeren Werken fähig ist, als sie sich zugetraut, angenommen, vorausgeahnt hat.
Elfriede wurde Ende des 19. Jahrhunderts geboren und durchlebte das 20. Jahrhundert fast vollständig. Die zwei großen, schlimmen Ereignisse des letzteren, die beiden Weltkriege, vor allem die Nazizeit beeinflusst ihr Privatleben enorm, während der erste hier unerwähnt bleibt. Er ist in einem anderen Band dargestellt, hauptsächlich anhand der Briefe und Karten des Vaters von der Front, wobei das Lesen seiner altdeutschen Schrift, obendrein aus der Hand eines Arztes, eine wahre Herausforderung bedeutete (s. Ilse Hampe, „Papsch im Ersten Weltkrieg“, Norderstedt 2015).
Hunderte von Briefen habe ich durchforstet, die Sütterlin-Schrift erlernt, um Omas Geheimnisse zu lüften, und darüber hinaus den historischen Zusammenhang hergestellt zum besseren heutigen Verständnis der damaligen Lebensumstände. Es handelt sich somit um ein Zeitdokument, in dem sich die geschichtlichen Ereignisse unweigerlich mit den persönlichen Inhalten der Briefe vermengen. Die heftigsten Erlebnisse hat Elfriede vor, während und in der Zeit unmittelbar nach dem 2. Weltkrieg. Sie steht in Beziehung zu sehr unterschiedlichen Menschentypen, einerseits zu Familienangehörigen, wie Mutter und Bruder, andrerseits zu zwei italienischen Militärinternierten während des 2. Weltkrieges und zu anderen Männern, wie Ehemann oder, nach der Scheidung, Liebhabern. Hierdurch ergibt sich für Elfriede, ebenso wie für jeden Leser, eine breite, reichhaltige Palette von verschiedenartigsten Ereignissen und Erfahrungen. Später wird ihr Leben belangloser, ohne herausragende Begebenheiten; der körperliche und später der geistige Abbau setzen ein.
Edgar, der freche Student
Die Korrespondenz Edgars, des Studenten der Germanistik, der Romanistik und der Geschichte, aus drei verschiedenen Studienorten, zuerst München, dann als kurzes Intermezzo Wien, gefolgt von Heidelberg und schließlich retour in München, erstreckt sich über die Jahre 1931 bis 1936. Sie reflektiert, neben einigen Schilderungen des damaligen Zeitgeschehens, in erster Linie die enge familiäre Bindung Edgars, vor allem an seine Mutti Emma und gleich nach ihr an die verheiratete Schwester Elfriede. Er, der als Nesthäkchen die verwitwete Mutter verlässt, um als einziger Sohn in die Ferne zu gehen, während die anderen drei Kinder in nächster Umgebung der Mama verbleiben, weiß ganz genau, wie viel Leid er ihr durch sein Fortgehen verursacht. In diesem Bewusstsein vernachlässigt er seine Pflichten ihr gegenüber durchaus nicht und beehrt sie allwöchentlich mit mehrseitigen Briefen und Karten, die durch seine spritzige Jugend- und Schelmenhaftigkeit eine köstliche Note erhalten.
Zu den hervorragenden Charakteristika seiner Briefe gehört die Erwähnung des Standortes des Schreibers:
„Es regnet schon wieder einmal; der Schauplatz meiner Schreibhandlung ist verlegt auf die Geländerbrüstung des Universitätslichthofes, 2. Stock. Sollte der Brief etwas unvermutet aufhören, so diene das zum Zeichen, dass ich plötzlich hinuntergefallen bin.“ (10.6.31)
Nicht gerade eine beruhigende Angabe für die sich um ihn sorgende Mutter, die aber wohl seine Scherze zu interpretieren weiß. Beim nächsten Mal ist die Schilderung harmloser:
„Im Spazierengehen lässt sich schlecht schreiben, deshalb sitze ich auch schon wieder.“
Ein anderes stets wiederkehrendes Thema sind die Paketsendungen von zu Hause:
„Das Paket ist am Freitagnachmittag eingetroffen, sein Inhalt unter Freudengeschrei bereits fast völlig aufgezehrt. An alle bei dem Werk Beteiligten meinen herzlichsten Dank! Der Kuchen schmeckte ausgezeichnet, die Menge der Rosinen war erdrückend.“
Beim Inhalt der Pakete handelt es sich erstrangig um Lebensmittel, die er eigentlich am Aufenthaltsort käuflich hätte erwerben können. Dennoch ist die Freude über das Geschickte jedes Mal groß:
„Hurra, es (das Paket) ist da!“
Er erhält aber auch Sendungen anderer Art:
„Am Montagmorgen weckte um 7.30 Uhr mich Entsetzten der Briefträger mit dem Geld, das sich angenehmerweise unterwegs scheinbar um 10 Mark vermehrt hatte (ich fand das nett von dem Geld, recht nett, hm.), wodurch sich das Entsetzen in wohlgefälligere Empfindungen auflöste. Und dann kam am gleichen Tag auch noch das zweite Paket, sodass ich beschlossen habe, diesen Tag von nun an als Nationalfeiertag für mich anzusehen!“
Somit ist klar, welchen Stellenwert diese mit Liebe gesendeten Dinge für ihn haben. Dennoch mag er die Daheimgebliebenen gerne schäkern:
„Also das Geld habe ich dankend erhalten, wenn ich es bloß nicht zum Abschied noch vollzählig vertue?? Ich garantiere für nichts, leider.“
Wie mag die Witwe, die mit ihren Mieteinnahmen haushalten muss, um die mühsam zusammengetragenen Beträge zittern? Das Spielchen wiederholt er genüsslich des Öfteren:
„Ich hätte eigentlich Lust, die 400 M gleich auf einmal um die Ecke zu bringen, aber ich hoffe mich bezähmen zu können. Einstweilen.“
Wo er doch gerade der Meinung gewesen ist, sich im Zaume halten zu können, muss er sofort mit dem Adverb „einstweilen“ (weiter oben war es „leider“) diese Feststellung entkräften, nur in der Absicht die Mutter ein wenig nervös zu machen, sie zu kitzeln, zu necken. Ein weiteres Mal ist die Äußerung nicht so gefährlich oder zumindest der in Frage kommende Betrag geringer:
„In den Geschäften sind herrliche Sachen ausgestellt, vor allem wunderbares Obst in allen erdenklichen Sorten; es wird mir immer ganz wehmütig davor ums Herz und einmal werde ich doch noch hineingehen und mir einen Fresskorb für 50 Mark oder so durch Kauf erstehen. Aber jetzt habe ich ja die drei Äpfelchen, über die ich mich sehr gefreut habe, zwei sind allerdings schon weggegessen. Der letzte wird mir noch lange als Gegengewicht gegen alle böse Versuchungen dienen müssen.“
Also doch Entwarnung und Eingeständnis seiner großen Bescheidenheit. Ein anderes Mal dafür entsetzliches Lamentieren:
„Ach des Leidens und des Kummers, die ich zu erdulden habe!“, denn eine Geldsendung ist nicht eingetroffen! Demzufolge „schlage ich mich so durch, nehme eine Anleihe nach der anderen auf.“ Edgar als richtiger Komödiant! Auch in einem anderen Zusammenhang:
„Und so viel Erdbeeren hast Du gegessen? Das hätte ich vor einiger Zeit wegen großen Neides nur ungern gehört, aber jetzt wo ich so viel Geld habe, stört es mich nicht mehr, da kann ich mir so etwas auch leisten!“
Aber Emma erfährt sowohl in diesem wie im nächsten Brief eine wohltuende Genugtuung:
„Die Erdbeermarmelade versetzte mich in einen Taumel des Entzückens, ich laufe des Öfteren zum Schrank und werfe schnell einen verliebten Blick auf sie. Die Pralinés sind schon aufgefressen, die Ananasdinger (gut, gut!) werden vorsichtig aufbewahrt, um den Genuss zu verlängern, ich schwöre mir, nie mehr als drei an einem Tag zu essen. Aber ich vermute, dass ich bald als Meineidiger dastehen werde.“
Für unsere moderne Zeit kaum vorstellbar, dass sich jemand über solch banale Sachen dermaßen freuen könnte! Mit vollkommener Natürlichkeit bringt er seine Zufriedenheit zum Ausdruck:
„Alles (im Paket) ist herrlich, wie von Dir ja nicht anders zu erwarten ist.“
Der junge Mann hat offensichtlich einen gesunden Appetit:
„Ich stürzte mich, endlich glücklich, zufrieden und froh, über den Inhalt des Pakets, in dem ein Riesenloch war (im Inhalt), als ich mich endlich wieder davon erhob.“
Oder:
„Der Kuchen ist schon lange aufgefressen, der prosaische Alltag herrscht wieder bei mir.“
Manchmal geschehen kleine Malheurs:
„Der Kuchen schmeckt ausgezeichnet, die Eier waren mit Ausnahme von zweien allerdings zur formlosen Masse in innigstem Verein mit der Umhüllung zusammengeschmolzen. Sie schmeckten aber trotzdem sehr lieblich, ebenso wie die schon beseitigten Pralinés.“
Ein weiteres Mal:
„Der Kuchen hat recht gut geschmeckt, nur ist mir aufgefallen, dass die Rosinen alle nach unten gepurzelt sind; das konntest Du doch sonst so großartig vermeiden. Das soll aber beileibe kein Tadel sein, im Gegenteil, so ein großer Haufen von Rosinen aufeinander schmeckt auch sehr gut, und die rosinenfreieren Stellen bieten nette Abwechslung.“
Herrlich, wie er es schafft den Tadel noch halbwegs in Lob umzuwandeln! Es wird klar, dass Emma eine exzellente Köchin sein muss:
„Ich habe in der Mensa meinen Mittagsschmaus eingenommen, der meist aus zusammengekochtem Essen besteht, das ich immer brav herunterschlucke. Aber wenn ich einmal bei Dir Zusammengekochtes bekomme, dann spucke ich!“
Was er mit seiner Leberwurst anstellt, hört sich aber auch nicht gerade appetitlich an:
„Übrigens habe ich heute gemerkt, dass die Leberwurst beim Transport von hinten bis vorn geplatzt ist. Ich habe sie also kurzerhand in mein leeres Marmeladenglas gestopft. Jetzt sieht es aus wie eine Schlange in Spiritus.“
Guten Appetit, Edgar!
Die Pakete stellen kleine Höhepunkte in seinem Dasein dar:
„Ich fuhr dann wieder nach Hause, wo ich dann das Paket in meiner Stube auf mich warten sah. Das Warten war gegenseitig gewesen, auch ich wartete auf das Paket oder vielmehr mein einziger Kragen und mein einziges Hemd, die im zwingenden Ablauf der Zeit immer schmieriger und schmieriger wurden, warteten auf Erlösung aus ihrem Schmierdasein. Nun liegen sie zufrieden auf dem Grund der Kommodenschieblade und sehen der Auferstehung in der großen Wäsche entgegen.“
Alles wird personifiziert, das Paket, seine schmutzige Kleidung, wodurch Edgar die Bedeutung dieser Dinge deutlich hervorhebt. Die Pakete tragen ein Eigenleben in sich und sind zugleich ein Lebenszeichen von der Familie, stehen stellvertretend für diese da.
Er weiß sich geliebt und erwidert dieses Gefühl:
„Liebe Geburtstagsmutter (denn –Kind darf man doch nicht mehr sagen), nun sollst Du recht herzlichst begratuliert sein! Auf dass Du hübsch munter und gesund bleibest im neuen Lebensjahr und nur eitel Freude und Gutes erntest von allen Kinderchen und sonstigen Leuten! Und Dein jüngstes dieser besagten Kinderchen möge nie zu weit von Dir wegfahren (?), damit Deine Gedanken nicht so furchtbar weit zu laufen brauchen, bis sie bei ihm ankommen! Und schön feiern sollst Du auch inmitten der schlechteren Hälfte der Anverwandten.“
Und dennoch wird er nur sieben Jahre später durch Abenteuerlust getrieben das Weite suchen und nach Südamerika auswandern, im vollen Bewusstsein des Schmerzes, dass er seiner Mutter zufügt. Aber zuerst geht es im Mai 1932 nur nach Wien:
„Du sollst schnell einen kleinen Gruß von mir bekommen, damit Du weißt, dass ich an Dich denke und an Deine Trauer. Ich begleite Dich schon mit zum Friedhof – leg ein paar Blumen von mir aufs Grab – und passe auf, dass Du Dich nicht zu sehr Deinem Schmerz hingibst. Aber Du musst auch an mich denken in meinem Wien hier, der ich Dich doch noch nötig habe, wenn Du es auch nicht so recht glaubst, und musst schön tapfer sein, nicht wahr? Dann will ich Dir auch immer große Briefe schreiben und mich mit Dir unterhalten von fern.“
Einen rührenderen Brief kann keine Mutter erwarten!
Obwohl die Anrede in seinen Briefen ziemlich monoton: „Liebe Mutti“ lautet, so sind die Abschlussbezeichnungen für ihn selber im Gruß umso vielfältiger: Vom einfachen „Der Junge“, „Der Sohn“, „Dein Pummel“ oder „Euer Söhnchen“ über „Dein treuer Sohn und Nesthäkchen“, „Dein netter Sohn“, „Dein Kleinster“, „Der Herr Sohn“ bis zu „Der ferne Sohn“, „Das verlorene Söhnchen“ oder „Dein vielgereister Sohn“. Er kennt seinen Wert und seine Bedeutung innerhalb der Familie und schmückt sich selber reichlich mit Kosenamen, die ihm seine Angehörigen hätten geben können.
Aber die Mutter muss sich immer wieder anhören, welch große Ehre ihr der Sohn durch seine Briefe erweist:
„Auch sorgfältig zu schreiben will ich mich bemühen, damit Du nicht in Aufregung geratest. Das wird ein schweres Opfer, das Dir da gebracht wird!“
Ab und zu schont er ihre Gefühle überhaupt nicht:
„Es ist eigentlich erstaunlich, dass ich Dich nie vergesse, aber ich vermute, ich täte es, wenn ich nicht die feste Sitte der Sonntagsbriefe eingeführt hätte.“
Aber dann sind seine Äußerungen wieder voller Liebe:
„Eben hat der Professor eine Pause gemacht, und ich fliehe von Grimmelshausen zu Dir, um Dir endlich über die Uni zu berichten.“
Aber ebenso heftig können seine Wutausbrüche gegen seine geliebten Familienangehörigen sein:
„Eigentlich hatte ich ja in meinem wutschnaubenden Herzen erwogen, dass ich Euch am besten die Hälse umdrehte, Euch ans Rad flechte oder sonst wie mit fürchterlicher Strafe zu belegen hätte; nun aber, da sowieso Elfriede, wie mir scheint, am Rand des Grabes liegt, bin ich beruhigt.“
Er hat nicht die Absicht, seine weiblichen Anverwandten mit Zärtlichkeit zu behandeln. Wie eng seine Bindung an die von ihm verlassene Familie dennoch ist, zeigt er durch rührende Besorgnis, beispielsweise um die kranke Mutter. Er rät Elfriede:
„Ihr müsst ihr (der Mutter) immer furchtbar viel auf den Teller tun, das isst sie dann ohne weiteres auf in ihrem Pflichtbewusstsein, das kenne ich von früher.“
Allerdings, bei der noch herrschenden wilhelminischen Erziehung. Nur wird Edgar in diesem Falle erfahren, dass er mit seinen Heilmethoden völlig falsch lag, denn Emma ist die Einhaltung einer strengen Diät angeordnet worden! Sie fragt er direkt:
„Hast Du es vorgezogen, wieder kränker zu werden? Wie hat Dir denn das Aufstehen gefallen? Hetes Karte entnehme ich, Du habest ab und zu ein bisschen „geknört“, was höre ich da, wie?? Aber sonst sollst du ja ganz brav gewesen sein. Nun, das gehört sich.“
Eine ein wenig eigenartige Weise mit der Frau Mama umzugehen! Als hätte er die Rollen mit ihr vertauscht und er bemuttere und tadele sie. Im gleichen kommandierenden Ton weiter:
„Also, Du überlegst Dir, ob Du mich von der Bahn abholen kannst? Dass Du Dich ja nicht unterstehst, Dummheiten zu treiben!“
Ein 20-Jähriger, der seine 60-jährige Mutter etwas sehr harsch angeht, dem das Befehlen offensichtlich Spaß macht:
„Alles weitere dieser Art (und es ist viel) werde ich mündlich anordnen.“
Zwar bezieht er sich hier nur auf die Köstlichkeiten, die er zu Hause bei Tisch verzehren möchte, dennoch gefällt er sich in der Rolle des Herrn des Hauses, durch die er den Platz des verstorbenen Vaters einnimmt. Der gleiche herrische, aber zugleich frech umsorgende Ton:
„Ein bisschen Arbeit bekommt sehr gut, also Du kannst durchaus zufrieden sein, ich hoffe, dass ich das über Dich auch sein kann!! Bist Du denn auch immer vernünftig? Oder muss ich dringend bald wiederkommen?“
Oder er zieht die gegenteilige Konsequenz:
„Aber ich bitte mir aus, dass Du vernünftig bist. Sonst komme ich überhaupt nicht.“
Arme Emma. Sie erzittert wohl vor ihrem kommandosüchtigen Sohn!
Aber seine Mutter gibt ihm auch Anlass zu Bewunderung, nicht nur durch ihre Kochkünste:
„Also, Du bist ja entsetzlich unsolide geworden, eine Reise nach der anderen, Du willst wohl die Vorsfelder große Reise im Kleinen nachmachen, na, da veschwindest Du aber doch! Es freut mich aber doch, dass Du ein bisschen auf die Walze gehst, das bekommt sehr gut.“
Mit der großen Reise bezieht er sich auf jene, die er im Wagen mit Elfriede und ihrem Mann Hans durch Österreich und Jugoslawien machen wird. Aufgrund dieser Reise wird Edgar erst zwei Wochen nach Semesterferienbeginn nach Hause zurückkehren, was die Mutter eigentlich traurig stimmen müsste:
„Bist Du denn eigentlich nicht traurig, dass durch die Reise meine Ankunft verspätet wird? Du bist doch ein gutes altes Mütterchen, davon sagt es gar nichts.“
Und darauf folgt seine Empfehlung:
„Begieß Du nur ordentlich die Stachelbeeren und stell den Schnitzel kalt!“ (damit er dann alles essen kann!)
Von der adriatischen Küste aus droht Emma schon wieder Unheil:
„Vielleicht machen wir noch einen kleinen Abstecher nach Afrika!“, geschrieben auf einer Postkarte mit der Abbildung eines Schiffchens auf hoher See. Oh, wie muss Emma in ihrem nordischen Braunschweig erschaudert sein! Aus dieser Verlängerung wurde natürlich nichts. Dann mal wieder eine Postkarte, die das Markttreiben in Sarajewo zeigt, d. h. die fremdartige türkische Bevölkerung mit ihren Säcken voller Waren. Für die bodenständige Emma eine unverständliche Welt gefüllt mit angsterregenden Geheimnissen.
Im Grunde genommen liebt Edgar halt das Schäkern:
„Die Fahrt war schön, wenn auch etwas anstrengend, vom Hochwasser bin ich nicht bedrängt worden, aber in Magdeburg ist mir ein Schnürsenkel gerissen, was ich durch Neuanschaffung eines ähnlichen wieder gut gemacht habe.“
Eine lauernde Gefahr wird übertüncht durch eine nicht einmal erwähnenswerte Begebenheit. Ebenso:
„Ich sitze nun im Rathauspark, vor mir die Sonne, hinter mir ein Mann, der sowohl die Blumen als auch meinen Buckel mit Wasser bespritzt.“
Oder zu des Bruders Geburtstag:
„Ich glaube, Helmut hat bald Geburtstag. Er verlangt doch wohl hoffentlich nicht, dass ich ihm dazu gratuliere. Das habe ich einmal gemacht, wenn ich nicht irre, und damit wird es wohl genug sein. Er kann sich ja die Karte vom vorigen Mal, die er sicher noch haben wird, auf den Geburtstagstisch legen.“
Welcher Einfallsreichtum! Edgar rafft sich dann aber doch noch zusammen und schreibt seinem Bruder! Wie so oft möchte er den coolen Mann markieren, um es in Neudeutsch auszudrücken. Er schreibt:
„Um Geld zu sparen, andrerseits meinen Bruder nicht durch Vernachlässigung zu beleidigen, soll aus dem üblichen Sonntagsbrief ein Samstagsbrief werden, der zugleich meine herzlichsten Glück- und Segenswünsche dem lieben Helmut zu seinem übermorgigen Jubeltage überbringen soll. Er möge überzeugt sein, dass ich den ganzen Tag seinem Gedächtnisse weihen werde und dass meine Gedanken stets um das liebe glückliche Geburtstagskind kreisen.“
Danach wechselt er zu einem persönlichen Thema über:
„Damit gehe ich zum zweiten Punkt der heutigen Briefordnung über, nämlich zu meinem eigenen leiblichen Wohl, das dringend einer Auffrischung aus dem immer sprudelnden Quell des Hampeschen Geldbeutels bedarf. Ich bitte höflichst, am Montagmorgen, möglichst früh, 125 Mark an meine Adresse zu senden.”
Eine wirklich charmante Art, um Geld zu bitten!
Bei seiner Anfrage:
„Freut Ihr Euch wohl auch auf Euren lieben Familienangehörigen, der bald, ach bald wieder mit Euch vereinigt ist?“ klingt sehr stark seine eigene Freude bei der Heimkehr durch, welche allerdings noch mit einem Fragezeichen behaftet ist:
„Die Herren Lehrer sagen immer erst so spät wie möglich, wann sie aufhören, um der akademischen Freiheit Rechnung zu tragen. Ihr könnt ja jedenfalls alles zum Empfang rüsten. Heute Abend gehe ich wahrscheinlich zum letzten Mal in eine Mozartserenade, ach mir wird ganz wehmütig. Aufrütteln kann mich nur die Hoffnung auf das heimatliche gut gebratene Essen.“
Einerseits Seitenhiebe an die Dünkel der Professoren, deren Launen man ausgeliefert ist, andrerseits ein weiteres Leitmotiv in seinen Briefen: Der ständige Besuch von Opern und Konzerten, die er akribisch beschreibt und kommentiert, viel zu genau im Vergleich zu den spärlichen Berichten über sein eigentliches Anliegen an den Studienorten, nämlich über das Studium selber. Stattdessen höhnische Kritik des Studienbetriebes:
„Jetzt kommt ein humpelnder und kreischender Philosoph an die Reihe, seine nähere Würdigung ist im Brief an Elfriede nachzuschlagen.“
Oder:
„Und nun kommt unser verehrter Hohepriester, das ist nämlich der übelste Mensch, den ich bislang auf der Universität gesehen habe. Er besteht ganz aus Würde und Eitelkeit, macht einen scheußlichen Schmus, und ich weiß nicht, weshalb ich ihn höre.“
Und ein wenig weiter:
„Das Hohepriesterwesen ist da!“
Auch der Inhalt der Vorlesungen versetzt ihn nicht in Begeisterung:
„Der Herr Professor ist schon da. Aber da er doch immer wieder dasselbe sagt, brauch ich ja schließlich nicht auf ihn zu hören.“
Manchmal ist er hin und her gerissen zwischen Verachtung und Bewunderung:
„Eben habe ich der Antrittsrede des neuen Rektors in der Großen Aula beigewohnt, es war sehr feierlich, Studenten in Wichs, Professoren im Ornat, wunderbar! Die Leute sehen sehr ulkig aus in ihren Nachtmützen und großen Pelzen, die bis über die Ohren hinaufgehen, es ist wie die reine Polarexpedition anzuschauen, wenn sie hereingewandelt kommen. Aber schön sieht es doch aus.“
Ein Beispiel seiner Musikrezensionen vom 13.11.31:
„Der Pfitzner war eine ziemliche Enttäuschung. Er ist doch reichlich dünnblütig, dieser letzte Mohikaner der Romantik, wenn er sich auch in den Geisterbeschwörungen zu fürchterlichen Orchestertumulten aufreckt. Sogar eine Sirene wendet er an, die durch 5 Oktaven ungefähr heult und mit Ohren zerreißendem Geräusch die Nerven des Publikums behelligt. Der Text ist das üblich romantische Gebräu wie im Freischütz. Im Ganzen lässt einen das Werk doch kalt, es ist zu sehr gemacht, der Pfitzner hat nicht genug von seinem Herzen in „Das Herz“ hineingetan, weil er eben überhaupt, wie es scheint, nur ein zartes kleines Herz hat, fein und vornehm ohne Zweifel, aber ohne genialische Größe. Es ist keine einzige fließende Melodie darin, und die kann man von einem Romantiker schließlich verlangen. Der Beifall war enorm, das kleine Männchen mit seinen dünnen Beinen und seinem großen Plastron auf der Brust musste andauernd hervor, bis er schließlich mit einem riesigen Lorbeerkranz unter dem Arm verschwand.“
Edgar hat eindeutig der Uraufführung von Pfitzners Werk „Das Herz“ beigewohnt, das im Jahre 1931 gleichzeitig in München und in Berlin das Licht der Welt erblickte, auf jeden Fall aber in München vom Komponisten selbst dirigiert wurde. Der 1869 in Moskau geborene Pfitzner war ab 1929 Professor an der Akademie der Tonkunst in München und hier auch als Dirigent tätig. Allerdings kennzeichnet sich seine Musik durch großgeschwungene Melodik und eine auf der Tonalität beruhende Harmonik, die Edgar aber in diesem Werk mit Recht nicht wiedergefunden hat. Laut Opernführer „verbindet diese Oper Gruselromantik mit dem Anspruch des Tiefsinns, überhäuft eine höfische Begebenheit mit Symbolen und verzichtet auf melodische Unmittelbarkeit.“
Offensichtlich wurde sie nicht zu einem Erfolgsschlager, wie Pfitzner allgemein nicht zu den beliebtesten Komponisten gehört… Nichtdestotrotz hält Edgar ein unerfreuliches Erlebnis nicht davon ab, sich weiter der Musik zu widmen:
„Am Donnerstag dirigiert dann schon Bruno Walter wieder, und so geht dies bis ins Unendliche fort, es ist verdammt schön.“
Und sein Urteil fällt auch meist billigend aus:
„Abends war ich dann im Rosenkavalier, er wurde bis in jede kleinste Einzelheit glänzend gespielt, es schwebte wirklich leichte weiche Wiener Luft darin, wie sich das so gehört.“
Dann aber wieder:
„Außerdem habe ich jetzt von Puccinis Zuckerbrei genug!“
Als Student nimmt er schon einige Marter auf sich, um den Aufführungen beiwohnen zu können:
„Am Sonnabend war ich im Burgtheater, Faust, I. und II. Teil, 6 Stunden habe ich gestanden! Und morgen wird es ähnlich, da gibt es Erstaufführung von Verdis „Don Carlos“ in der Oper.“
Der Geldbeutel wird doch stark strapaziert durch sein feines Hobby, sodass er sich hin und wieder in Zurückhaltung übt:
„Ich denke, bis zum Montagabend also wahrscheinlich nicht auszugehen, der Abwechslung wegen.“
Am 3.7.31 dann eine Erwähnung des Tagesgeschehens:
„Jetzt habe ich erst mal eine Woche Ferien. Du hast wohl die Geschichte in der Zeitung gelesen. Am Montag geht der Betrieb erst wieder an. Dann wird man nur noch zu einem Tor hereingelassen (Umweg für mich, da muss ich mindestens 5 Minuten früher aufstehen!) und muss jedes Mal seinen Studentenausweis vorzeigen, damit sich keine lichtscheuen Elemente mehr einschleichen können. Die ganze Sache ist natürlich fürchterlich übertrieben, der Professor Nawiasky hat lediglich erklärt, dass der Vertrag rechtlich durchaus gültig sei, politisch aber natürlich von Deutschland angefochten werden müsse, und außerdem hätten es die Deutschen in anderen Verträgen, wie Brest-Litowsk, ebenso gemacht wie die Entente. Über das letztere lässt sich streiten, es ist zumindest unnötig, darüber jetzt Streitereien heraufzubeschwören, aber insofern, dass jeder so viel wie möglich auf seinen Vorteil sieht, hat Nawiasky schon Recht, und es ist eine ungeheuerliche Idiotie von den lieben Nazibabys, die Sache dermaßen aufzubauschen. Andrerseits war es natürlich eine Frechheit, die Polizei in die Universität zu rufen; sie schlug schließlich mit gezogenem Säbel auf die Leute ein. Ich war jedenfalls ziemlich erstaunt, als ich nachmittags zur Vorlesung wollte, und die ganze Gegend von Polizisten wimmeln sah. Die Universität war vollkommen gesperrt, es war ein ergötzliches Gefühl für den studierenden jungen Mann, vor den geschlossenen Toren seiner Universität die blöden Gesichter der Polizisten zu sehen, die mit ihrer rohen Gewalt in den reinen Tempel der Wissenschaften eingedrungen waren.“
Der erwähnte Professor Hans Nawiasky war Staatsrechtslehrer, der an der bayerischen Verfassung von 1946 mitarbeiten sollte. Edgars Einstellung zu den Nazis kommt deutlich heraus. Sie wird sich auch in den nächsten Jahren nicht ändern, obwohl sein Bruder Gerold zu ihnen stößt. Ein Ereignis, das Edgar nicht daran hindern wird, seine Verachtung über Hitler am 3.11.31 zum Ausdruck zu bringen:
„Für Gerold teile ich mit, dass ich am Sonntag mit seinem erlauchten Führer im selben Lokal speiste, was ich allerdings erst merkte, als er in klirrenden Stulpenstiefeln aus dem Saal zog unter Zurücklassung eines erschauernden Publikums. Ja, das war ein Augenblick!“
Es handelt sich um eine Zeit, in der Hitler noch kein allgemeines Furore in der Bevölkerung bewirkt. Dies beweisen auch die beiden nächsten Anmerkungen zu politisch angehauchten Zwischenfällen:
„Eben habe ich in der Studentenzeitung gelesen, dass 3 Studentenführer je 3 Monate Gefängnis bekommen haben, weil sie zwei nationalsozialistische Standarten im Zuge mitgeführt haben lassen bei irgendeiner Veranstaltung.”(6.11.31)
Und eine Woche später bezüglich einer Gedenkfeier für die gefallenen Kommilitonen im belgischen Langemarck, das besonders im Oktober und im November 1914 stark umkämpft gewesen war:
„Ganz stimmungsvoll, die Rede des Studentenvertreters, höchst nationalsozialistisch gefärbt; es ging so gerade noch am Erlaubten hin.“
Das Gedenken an einen Krieg soll offensichtlich in dieser Zeit dazu dienen, die Überleitung zum nächsten herzustellen. Aber noch ein Ereignis erwähnt er am 3.7.31:
„Heute Abend höre ich Thomas Mann an, der zu Gunsten der Glaspalastkatastrophe aus seinem neuen Roman „Josef und seine Brüder“ lesen wird.“
Bis Ende 1931 befindet sich auf den Umschlägen der aus München gesandten Briefe ein Aufdruck mit dem Wortlaut: „Spendet zur Glaspalast - Künstlerhilfe“, begleitet von dem Abdruck einer Plastik, die einen Frauenkopf darstellt. Der Glaspalast war in Anlehnung an den Londoner Cristal Palace 1854 als Ausstellungsgebäude in München, im heutigen Botanischen Garten, errichtet worden. Er brannte am 6. Juni 1931 zur Zeit einer Ausstellung nieder. Ob es sich um Brandstiftung gehandelt hat oder nicht, steht nicht einwandfrei fest. Auf jeden Fall war das Gebäude, dessen Konstruktion sehr viel Eisen und Glas aufweist, zu diesem Zeitpunkt schon sehr reparaturbedürftig.
Mal äußert er sich auch kurz über die wirtschaftliche Lage:
„Nach den Telegrammberichten, die ich manchmal und höchst zufällig zu sehen bekomme, wenn mal etwas angeschlagen ist, scheint mir die wirtschaftliche Lage unseres lieben Vaterlandes nicht rosig zu sein.“
Damit hat er bekanntlich Recht, denn die Weltwirtschaftskrise hat ihre Spuren hinterlassen, die Hitler gerade ausnützen wird. Wie schlecht die Lage ist, bekommt Edgar direkt zu spüren:
„Gestern sagte der eine Professor, der Senat habe zunächst beschlossen, am 12. März aufzuhören, dann aber wegen Kohlenersparung den Schluss der Vorlesungen für den 27.2. angeordnet.“(1932)
Den dennoch vorhandenen Vergnügungsdrang bringt Edgar sehr poetisch zum Ausdruck:
„Es ist die letzten Tage hier schon wieder kälter geworden, die Nächte sind ungemein klar und hell, die Bäume haben ein Kleid aus echtem Raureif angezogen. Sie wissen eben, dass sich auch für sie eine Anpassung an den Karneval geziemt, und verändern demnach ihr Äußeres, soweit es in ihren Kräften steht. Ich finde es sehr nett von den Bäumen; mancher Mensch tut es nicht, weil er zu faul ist, sich ein Maskenkostüm zu kaufen, oder weil er kein Geld hat, oder keine Lust, oder weil er überhaupt nicht mitmachen will. Nun sehet die Bäume an, auch in dieser schlechten Zeit lassen sie den Mut nicht sinken, fröhlich tun sie das Ihre, um das Herz der Menschen zu erfreuen. Was hingegen tut der Mensch zur Erfreuung der Bäume?“
Der Fasching scheint es ihm angetan zu haben, obwohl er mit dem üblichen Treiben nichts zu tun hat:
„Es gibt hier ein längeres Gastspiel zum Fasching. Es dreht sich hier überhaupt alles um den Fasching, selbst mein Brief, denn ich komme immer wieder darauf zurück. Neulich habe ich meine braunen Schuhe besohlen lassen, wodurch meine künstlerischen Interessen sehr erschreckt wurden, denn sie hatten eigentlich vor, mich in das kleine süße Residenztheaterchen zu schicken, wo es „Così fan tutte“ gibt. Aber da die 4 Mark den 3,50 für das Theater mehr als die Waage hielten, so musste ich den armen Interessen einen derben Fußtritt versetzen, weswegen sie jetzt maulen.“
Die Kultur muss manchmal vor den banalen Bedürfnissen des Alltags zurücktreten. Aber auch einer erfreulichen Erscheinung seiner Zeit begegnet er:
„Abends kam dann noch der Zeppelin angeflogen. Es sah süß aus, wie das riesige Ding wie ein weißer Schatten mir beängstigend dicht über den Kopf flog. Der Kasten vollführt einen irrsinnigen Krach, er störte meine Ruhe! Übrigens ist er vor einigen Monaten schon einmal dagewesen.“
Die Errungenschaften der Technik machen ihre Auftritte!
Da Edgar das Sommersemester 1932 in Wien verbringt, lässt er sich selbstverständlich über diese Stadt aus:
„Aber was am fürchterlichsten ist, das ist doch die Linksfahrerei. Man wird ganz konfus.“
Entzückendes erlebt er aber durchaus:
„Ich habe ja schon geschrieben, dass alles „Servus“ sagt, dass jede Dame mit „Küss d’ Hand, Gnädigste“ begrüßt wird, dass jeder zweite Mann einen Schnurrbart trägt; dass alle sehr freundlich und zuvorkommend sind, das ist ja bekannt. Den Schnurrbart muss ich mir wohl auch stehen lassen, ich überlege schon angestrengt darüber. Was meinst Du?“
Es ist kein Foto Edgars mit Schnurrbart vorhanden, woraus zu schließen ist, dass es sich nur um einen Spleen des Augenblicks handelt, vor allem, da er bestimmt nicht beabsichtigt, dieser Hitlerschen Modeerscheinung Folge zu leisten. Aber der Führer besitzt in Wien eine starke Anhängerschaft:
„Es sind jetzt überhaupt in der Stadt ziemlich viel Unruhen, in der Uni auch schon öfters, bis es dann am vorigen Dienstag richtig und ausgiebig zum Klappern kam. Ich saß gerade in der Bibliothek, als ich plötzlich fürchterliche Schreierei vernahm und eine große Menschenschar in den Bibliothekraum stürzen sah. Ich ließ mich aber in meinen Studien nicht stören (man ist das da nämlich gewohnt!), erst als ich später herauswollte, merkte ich, dass die Bibliothek abgesperrt war. Auf Nebenwegen gelangte ich dann hinaus und erfuhr, dass die blöden Nazibengels wieder mal Spektakel machten. Die gehen nämlich so vor: Wenn sie mal schlechte Verdauung haben oder sonst wie missgestimmt sind, suchen sie in der Uni ein paar arme Juden heraus und verprügeln sie nach Noten. So auch jetzt; sie hatten gerade vor der Bibliothek ein paar gefasst, die retteten sich gerade noch hinein und hinter ihnen wurde geschlossen, sonst wäre noch die Bibliothek draufgegangen. Ich gehe also hinunter in den Remter und bekomme gerade den erfreulichen Anblick zu sehen, wie eine johlende Bande dieser Schufte hinter einem kleinen verschüchterten Jüdchen herrennt (ich sehe noch seine verzweifelten Augen vor mir, werde sie vermutlich nie vergessen), ihn zu fassen kriegt und auf ihn einhaut. Ihr System war sehr gut. Sie hatten den ganzen Remter besetzt, nur eine schmale Gasse freigelassen, durch die alle hindurch mussten. Hatte einer dann zufällig eine krumme Nase, dann war es um ihn geschehen. Auf diese Weise gab es dann mehrere Verletzte (darunter eine Studentin). Polizei kam nicht in die Uni hinein, weil doch seit alters das heilige Gewohnheitsrecht besteht, allerdings mehr eingebürgertes Übereinkommen als Recht, dass Polizei den wissenschaftlichen Staat der Universität, der auch seine gewisse Autonomie hat, nicht betreten darf. In Deutschland bekümmert sich darum natürlich niemand mehr, in München, z. B. während der Unruhen damals hat die Polizei sofort das Gebäude betreten, aber hier in Österreich wagt man es nicht; es können sich lieber die Kerle totprügeln. Natürlich gab es deswegen auch eine Zeitungsdebatte großen Ausmaßes, aber es ist alles beim Alten geblieben, der Boden der Universität bleibt weiter geheiligt, wenn es auch nicht sehr heilig da zugeht. Jedenfalls kann man mehr als genug von den Nazis kriegen, es ist eine unglaublich alberne Bande, und schuftig dazu. Daraufhin wurde die Uni mal wieder geschlossen und vier Tage hatte der geplagte Student, der so viel zu lernen hat, Zeit, um der Ruhe zu pflegen.“ (4.6.32)
Edgar ist nicht gut auf die Nazis zu sprechen, obwohl er eindeutig nichts zur Verteidigung der unschuldigen Juden unternommen hat. Er wäre selbstverständlich selber verprügelt worden, aber außer Hass den Nazis gegenüber kommt bei ihm nichts heraus. Seine Verhaltensweise entspricht jener der Mehrheit der Bevölkerung, leider. Dabei hat gerade Edgar von den Nazis seines Aussehens wegen nichts zu befürchten: Abgesehen davon, dass er von der Statur her eher kleinwüchsig ist, gehört er entschieden dem Typus des echten Ariers an, blond, blauäugig, griechische Nase, ein gutaussehender, attraktiver Germane.
Edgar wird aber noch ganz andersartige Erfahrungen mit Juden machen, als er aus Versehen in deren Viertel inmitten Wiens landet. Die Beschreibung dieses Stadtteils ist äußerst verwunderlich:
„Eigenartige uralte Kirchen habe ich besichtigt, auf der Suche nach einer von ihnen geriet ich in ein übles Judenviertel, ach war das schön. Die ganze Bevölkerung sitzt nicht etwa in ihren Häusern (vielmehr Spelunken), sie sitzt auch nicht davor, sie geht auch nicht spazieren, nein, sondern sie steht, sie steht mitten auf der Straße und wartet darauf, dass jemand kommt und Geschäfte macht. Man wird ganz verwirrt, wenn man an all den herumstehenden Menschen vorbeigeht, fühlt tausend Blicke auf sich haften und kommt sich ganz verzaubert vor. Wenn man sich dann noch vorstellt, dass hinter den halberblindeten Fensterscheiben schöne Reckas und Judiths auf ihren Lumpen liegen in all ihrer Pracht, ha, dann verliert man beinahe das bißchen Verstand, das man sich noch bewahrt hat in all der Unheimlichkeit. Dazu kommt, dass man direkt zu spüren meint, wie ein dichter Hagel von Flöhen und Wanzen sich auf einen stürzt. Aber das war scheinbar doch nur Phantasie, denn bislang habe ich noch nichts Reelles von ihnen gemerkt. Am meisten habe ich doch die arme Kirche bemitleidet, die ich endlich auch noch fand. Sie sieht schon ganz verzweifelt aus inmitten all der Kerker.“
Eine Beschreibung, die man sich für Warschau passend denkt, nicht aber für das vornehme Wien. In diesem Ghetto scheint auf jeden Fall die Zeit stehen geblieben zu sein; Edgar könnte genauso gut dabei sein, eine mittelalterliche Judengasse zu beschreiben. Der Grund dafür, dass sich so viele Menschen auf den Straßen aufhalten, liegt in der Wohnungsnot, in der Enge des Judenviertels. Die geringen Behausungen sind zu klein für die ständig wachsende Zahl der Juden, denen nichts anderes übrig bleibt, als auf die weitere Straße zu flüchten. Wenn diese nun ihrerseits schmutzig ist, dann liegt es an der Überbevölkerung des von den Stadtbehörden mit Absicht auf ein reduziertes Areal belassenen Ghettos. Das Bild des schmutzigen Juden übernimmt Edgar allerdings vorurteilsvoll von der allgemein verbreiteten Sicht über diese Gemeinschaft.
Edgar bringt noch andere Interna über die Metropole und ihren Universitätsbetrieb:
„Der ganze Laden hier in Wien ist viel schulmäßiger als in Deutschland. Man wird viel mehr bevormundet. Die entsetzliche österreichische Bürokratie ist in vollstem Schwunge... Die studierende Masse von 13.000 Leuten weist erschreckende Exemplare von Seltenheitswert auf, von schmierigen stinkenden Kroaten bis zu feinsten Großstadtdandys, ein wunderbares Völkerscharengemisch, ganz interessant. Die Ärmlichkeit ist doch im Allgemeinen groß hier, das Bettelwesen eklig; man kann keine drei Sekunden auf einer Bank im Park sitzen, schon hält einer die Hand auf. Dabei verdienen die Kerle allesamt bestimmt mehr als ich.“
Sein Urteil über die Universität wird er auch noch schärfer und niederschmetternder ausdrücken:
„Der Betrieb an der Uni ist einfach saumäßig, und zwar in jeder Beziehung, wissenschaftlich wie verwaltungstechnisch wie politisch.“
Er fühlt sich dennoch wohl in Wien:
„Es wäre auch komisch, wenn man in dieser Wiener Gemütlichkeit ungemütlich werden wollte. So etwas geht nicht. Man wird so angesteckt von dieser Wiener Atmosphäre von Wurschtigkeit und fröhlichem Laufenlassen aller Dinge, dass es eine Freude ist. Hoffentlich vertrottele ich nicht ganz. Ein dickes Fell muss man hier jedenfalls haben, für nervöse Leute ist Wien kein Aufenthalt. Man muss zu allem grinsen und „Hobe die Ähre“ sagen. Schimpfen nützt gar nichts.“
Ein bestimmtes österreichisches Produkt hat es ihm angetan:
„Schon allein der Heurige war es wert, dass man seinetwegen nach Wien kam, aber deshalb brauchst Du auch nicht zu glauben, dass ich als Säufer wieder in Deine mütterlichen Arme zurückkehre.“
Nach dem Sommersemester in Wien beschließt er in Heidelberg weiter zu studieren, von wo aus er am 28.10.32 seine Unterkunft beschreibt:
„Zwar muss ich meinen Mantel immer draußen lassen, nicht weil er nicht mit mir hineinginge, so klein ist die Behausung doch nicht, sondern weil der Schrank draußen steht auf dem Korridor. Die Toilette befindet sich entsprechend vor der Korridortüre, das ist schon unangenehmer, aber auch darin findet man sich. Dass es nach 10 Uhr kein Licht mehr im Treppenhaus gibt, daran bin ich ja von Wien aus gewöhnt. Mein Bett ist nur vermittels Leiter zu ersteigen, so hoch ist es, und wenn ich noch darin lesen will, muss ich meine sämtlichen dicken Bücher auf den Nachttisch legen und die Lampe oben drauf stellen, sonst leuchtet sie nicht herauf und ich liege da oben in Finsternis. Aber sonst ist es ein sehr heimisches, gemütliches, billiges Zimmer. Das Wasser ist außerordentlich weich, die Seife gibt ungewohnt viel Schaum und lässt sich nicht von den Händen wegbringen.“
Manch verwöhnter Student aus der heutigen Zeit wird bei diesem Bericht erschaudern und sich an Spitzwegs piktorischen Darstellungen eines „Armen Poeten“ oder eines Bücherwurms erinnert fühlen.
Eine Woche später verwendet Edgar die Rückseite eines Schreibens der Deutschen Allgemeinen Zeitung als Briefpapier. Der Mutter erläutert er:
„Habe ich nicht schönes Papier ausgesucht? Da kannst Du gleich mal sehen, was mir alles zugeschickt wird. Dieses Schreiben bekomme ich regelmäßig zu Anfang jedes Semesters, allmählich wird es langweilig.“
Es handelt sich um ein Werbungsschreiben der DAZ zur Gewinnung von Abonnenten und der Inhalt ist äußerst illustrativ für die damaligen Zeitumstände und damit brisant, ganz im Gegensatz zu Edgars Meinung! Der Text:
„Sehr geehrter Herr!
Sie gehen in ein entscheidungsvolles Semester. Die Arbeit für Ihren zukünftigen Beruf ist heute untrennbar verknüpft mit dem Schicksal Deutschlands, über das in diesem Winter die Würfel fallen werden. Auch bei der schwierigen wirtschaftlichen Lage des deutschen Studenten ist die Lektüre einer großen Tageszeitung daher heute kein Luxus, sondern eine im eigensten Interesse liegende Notwendigkeit... Der zuverlässige Nachrichtendienst, die besten Mitarbeiter auf allen Gebieten, Qualität und Niveau in jeder Beziehung, diese Eigenschaften sind die Hauptursachen der weiten Verbreitung der DAZ unter den Akademikern.
Der zweite, nicht minder wesentliche Grund für die ständig wachsende Bezieherzahl der DAZ unter den Studenten liegt in der Art und Weise, wie die DAZ ihren politischen Kampf führt. Nicht einer Partei dient die DAZ, sondern nur dem starken nationalen Willen, der unser Volk wieder emporführen wird, nicht für den kritiklosen Anhänger dieser oder jener Gruppe ist die DAZ da, sondern für den denkenden Menschen mit dem heißen Herzen, der nichts anderes will, als den Wiederaufstieg Deutschlands...“
Kein Wunder, dass Edgar die Zeitung nicht abonniert, denn, wenn schon ein Reklameschreiben mit so viel Hetze durchsetzt ist, wie wird dann erst der Inhalt der Zeitung selber aussehen? Sie gibt zwar vor, keiner Partei verpflichtet zu sein, dennoch bleibt dem Leser nicht verhüllt, welcher sie sich verbunden fühlt! Es muss sehr bedrückend gewesen sein, in solch einer Atmosphäre von plattwälzender Rhetorik aufzuwachsen.
Am 11.11.32 dann ein direkter Kommentar zu den Nazis:
„Was sagt denn die Familie zur Wahl? Den Nazis ist es entschieden zu gönnen. Sie sollen jetzt nur machen, dass sie verschwinden. Wenn sie jetzt einen Teil der Macht annehmen sollten, sind sie doch blamiert.“
Bei dieser Wahl hat die NSDAP im Gegensatz zu jener von 1930 Stimmen verloren. In der Zwischenzeit hat sich die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland auf 6 Millionen erhöht. Edgar bleibt unbeirrbar bei seiner Stellungnahme gegen die von ihm verhassten Nazis. Leider fehlt die Korrespondenz nach Hitlers Vereidigung auf die Weimarer Verfassung am 30.1.33. Ob diese Briefe wirklich einen Kommentar zu den geschichtlichen Veränderungen enthielten, ist fraglich, denn ganz allgemein ist ja festzustellen, dass die historischen Ereignisse wenig Spuren in privaten Schreiben hinterlassen haben. Nicht etwa aus Angst vor der Zensur, denn sonst würde Edgar seine Meinung über die „Nazibabys“ nicht so offen darlegen. Eher, weil man das berichtet, was man selber erlebt und was einen bewegt, während das Tagesgeschehen in den Zeitungen und im Rundfunk verfolgt werden kann.
Und dennoch legt sich ein schwarzer Schatten auf Edgars betont antinationalsozialistische Einstellung. Es liegt sein „Leistungsbuch“ vor, angelegt am 23.5.1935. Mit Foto! Edgar in Uniform der SA, angehörig zum „Sturm 43/L, Brigade 85“. Er hat darin auch „auf Ehre und Gewissen“ die Erklärung unterzeichnet, dass er „deutsch-arischer Abstammung und frei von jüdischem oder farbigem Rasseeinschlag“ sei und „keiner Freimaurerloge oder einem sonstigen Geheimbund angehöre.“ Nach diesen hochtrabenden Bekundungen, die ein ernst zu nehmendes Projekt vermuten lassen, erfährt der Leser des dunkelgrünen Büchleins, wovon dieses handelt: Es dient der Erlangung des Sportabzeichens, jenes der SA. Ins Leben gerufen wurde es im November 1933 und konnte ab dem 18. Februar 1935 auch ohne Mitgliedschaft bei der SA erworben werden. Demnach hätte Edgar es in einem Sportverein erhalten können. Vielleicht kam die Änderung für ihn zu spät, vielleicht hatte er bei der SA trainiert, und alles war für die Prüfungen vorbereitet. Immerhin steht Edgar nicht alleine da: Über eine Million Sportabzeichen in Bronze, Silber und Gold wurden erteilt. Es war übrigens eine Auszeichnung nur für Männer. Der Grund liegt klar auf der Hand: Im Grunde genommen bedeutete sie eine Präselektion der Tauglichkeit für den Krieg. Denn Bedingung für die eigentlichen sportlichen Übungen war die Ausstellung eines ärztlichen Attests. Die Untauglichkeit war bedingt u. a. durch den „ausgesprochen undeutsche(n) Rassentyp“ ebenso wie durch „alle Krankheiten und Verletzungen an den Beinen, Füßen und Zehen, die das Gehen beeinträchtigen, ...Plattfuß, Hohlfuß, ...Missbildungen des Fußes, den Gang beeinträchtigende Zehenverbildungen, Verlust mehrerer Zehen mit Beeinträchtigung des Gehens“. Klar und deutlich steht die Marschfähigkeit der Betroffenen im Vordergrund! Festgehalten wurden weiterhin „frühere Erkrankungen und Verletzungen“, so wie „Erbkrankheiten in der Familie“, neben dem „Kräftezustand“ (bei Edgar „befriedigend“), der „Körpermuskulatur“ (bei Edgar „gut“), dem „Zahnschema“, „Herz“, „Atmungsorgane“, „Augen“, „Ohren“, „Harnbefund“ und „Sonderbefund an Gliedmaßen und sonstigen Organen“. Edgar erhielt das Gesamturteil „geeignet“, zum „besonders geeignet (fehlerlos)“ reichte es bei ihm nicht! Somit war Edgar befähigt, an der Leistungsprüfung teilzunehmen. Diese bestand aus drei „Gruppen“. Die erste beinhaltet „Leibesübungen“, ganz alltägliche Leichtathletik: „100-m-Lauf, Weitsprung, Kugelstoßen, Keulenweitwurf und 3000-m-Lauf“. Aber schon die zweite hat es in sich: „25-km-Gepäckmarsch“, bei dem das Tempo, die „Halte“ und deren Dauer genau angegeben sind. Obendrein muss der Sportler durch „den Schiedsrichter nach der Gesundheitsbesichtigung als noch leistungsfähig entlassen“ werden. Anschließend stehen „Kleinkaliberschießen“, „liegend aufgelegt“ und „liegend freihändig“, und „Keulenzielwurf“, „liegend, kniend und stehend“ auf dem Plan. Die dritte, als „Geländesport“ bezeichnete Gruppe zeigt noch offensichtlicher, worum es der SA geht. Die Übungen beinhalten „Gelände-Sehen“, „Orientierung“, „Geländebeurteilung“ „für Vorgehen eines Spähtrupps“, „Melden“, „Tarnung“, „Entfernungsschätzen“, „Geländeausnutzung“ und „allgemeines geländesportliches Verhalten während der Prüfung“.