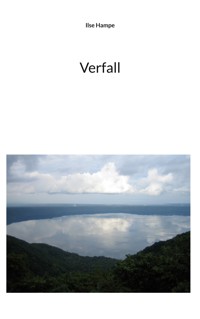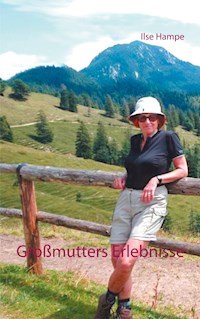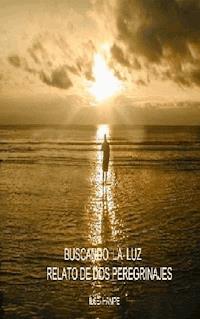Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Derzeit beläuft sich die Zahl der Pflegebedürftigen in Deutschland auf ca. 2,3 Millionen Menschen, Tendenz steigend. Die Mehrzahl wird zuhause von Angehörigen gepflegt. Die enorme Belastung, die dieser meist von den Ehefrauen geleistete Einsatz bedeutet, wird immer wieder erwähnt, in Zeitungsreportagen, Dokumentationen oder sogar Filmen. Das vorliegende Buch befasst sich mit diesem Thema. Es handelt sich um die Tagebucheintragungen einer pflegenden Gattin. Sie vertraut dem Papier ihre innigsten Gefühle an, die nicht immer angenehmer Natur, dafür aber umso ehrlicher sind. Einige Leser werden sich hier mit ihren eigenen Erfahrungen wiederfinden, andere wiederum besser für die Zukunft vorbereitet sein, denn unsere Gesellschaft steuert auf ständig wachsende Alterung und Pflegebedürftigkeit zu. Den betroffenen Angehörigen können Berichte über ähnliche Pflegesituationen große Entlastung bedeuten. Sie offenbaren ihnen das Gefühl, mit ihren Problemen, mit ihrer Ausweglosigkeit, nicht alleine zu sein. Sie fühlen sich verstanden. In die Berichte des Alltags mit einem Pflegebedürftigen sind Anekdoten aus der früheren, ereignisreichen und glücklichen Zeit des Ehepaars eingestreut. Sie bilden das Stützkorsett, das es der Ehefrau ermöglicht, die veränderte Lage zu meistern, zu ertragen. Sie hat gelebt, erlebt, Grenzsituationen überstanden, die ihr vielleicht zur Lehre für die Bewältigung der Gegenwart wurden. Die Erlebnisse laden ein zum Durchatmen, zum Hinauswandern in die weite Welt, zum Miterleben. Dieses Werk ist gewidmet all denen, die ihre Kraft, ihre Zeit, ihre Liebe, ihr Durchhaltevermögen für einen Pflegebedürftigen einsetzen. Möge ihnen dieses Beispiel ihre Zugehörigkeit zu einer großen Gruppe Gleichbetroffener zeigen, möge es ihnen Energie, Mut und Bestätigung vermitteln.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 251
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
9. September 2005
17. September 2005
22. Oktober 2005
Katharinenkloster
25. Oktober 2005
31. Oktober 2005
1. November 2005
3. November 2005
23. November 2005
Qazvin
24. November 2005
1. Dezember 2005
24. Dezember 2005
Eine abenteuerliche Geburt
31. Dezember 2005
15. April 2006
18. Mai 2006
Aeroflot oder besser nicht mehr fliegen
19. Mai 2006
26. Mai 2006
10. Juni 2006
2. Juli 2006
11. Juli 2006
27. Juli 2006
28. September 2006
Darf es auch mal mitten im Bürgerkrieg sein?
30. September 2006
5. Oktober 2006
6. Oktober 2006
22. Oktober 2006
4. November 2006
31. März 2007
2. April 2007
23. Juli 2007
8. August 2007
Abwasser durch die Ritzen
22. August 2007
25. Oktober 2007
24. Januar 2008
1. Februar 2008
18. Februar 2008
18. Juli 2008
20. Dezember 2008
Taschkent
3. Februar 2010
22. Januar 2012
3. Februar 2012
4. Februar 2012
9. April 2012
Einleitung
Das Jahr 2005 sollte für unsere Familie ein ereignisreiches werden. Als erstes stand die Geburt unseres Enkels Numero eins Ende März in Kanada auf dem Plan, dann die Hochzeit unseres Sohnes Sebastian mit Ulrike am 30. Juni in Düsseldorf. Da mein Ehemann bereits im August 2000 das Rentnerdasein angetreten hatte, pendelten wir seitdem zwischen Frankfurt und meinem Geburtsland Chile, in dem meine vier Geschwister mit ihren Familien lebten. Ende Februar 2005 machte ich mich alleine von Santiago aus mit einem Abstecher über Frankfurt zum Aufenthaltsort meiner Tochter in Toronto auf den Weg. Mein Mann Manuel wollte Anfang April nach Frankfurt nachkommen.
Aber es sollte anders werden. Am 9.3. erhielt ich in Frankfurt einen Anruf aus Santiago: Mein Mann liege mit Schlaganfall im Krankenhaus. Ich wusste nicht einmal, was das war und noch weniger, was das für uns bedeuten würde. Eine Freundin klärte mich auf, auch oder vor allem über die möglichen Konsequenzen. Ich machte mich sofort daran, ein Ticket nach Santiago zu besorgen. An Toronto war nicht mehr zu denken, das Flugticket habe ich nie verwerten können. Meine Tochter würde ohne mich zurechtkommen müssen, und tatsächlich gebar sie dann am 23.3. einen gesunden Sohn, Max.
Für den 10.3. am Abend erhielt ich einen teuren Platz im Flieger, packte meine Habseligkeiten zusammen und fing an zu grübeln. Wir würden das gemeinsam schon meistern, der Ärzteschaft unmissverständlich beweisen, dass man mit vereinten Kräften und eisernem Willen unschlagbar sei und den medizinischen Vorhersagen trotzen könne. Im Flugzeug kullerten mir dann die Tränen über die Wangen; die Blicke der fremden Sitznachbarn trafen mich nicht im Geringsten, eingesperrt und gepanzert wie ich war in meinem Schmerz.
Manuel lag in der Intensivstation, seine Augen hellten sich auf, als er mich sah. Er hatte auf mich gewartet, atmete sichtlich erleichtert auf. „Schön, dass du gekommen bist. Ich brauche dich“, las ich aus seinem Gesichtsausdruck. Denn sprechen konnte er kein Wort. Nach zwei Tagen wurde er in ein Einzelzimmer verlegt, wo ich mir einen Monat lang jeden Abend auf der ausziehbaren Couch neben ihm mein Lager bereitete. In Chile ist es üblich, dass Verwandte einen Kranken begleiten. Tagsüber nahm ich mir ein paar Stunden frei, um Besorgungen zu machen oder im Internetcafé meine Mails zu schreiben. Auf der Straße unterwegs, aller Hemmungen entledigt, heulte ich jedes Mal los. Ob die Passanten nach mir schauten oder nicht, blieb mir verborgen. Ich ignorierte sie, war nur mit mir selber und meinem Kummer beschäftigt.
Manuel, seine rechte Körperhälfte war komplett gelähmt, musste das Elementarste wieder erlernen: das Stehen. Er wurde aufrecht an ein Gestell gebunden, das an ein Folterinstrument erinnerte. Anfangs nur für wenige Minuten, dann wurde diese für ihn sehr anstrengende Tortur langsam gesteigert. Auch das Sitzen in einem komfortablen Sessel bedeutete Anstrengung. Aber die Kräfte wuchsen mit Hilfe der täglichen Krankengymnastik, und nach einem Monat war er nicht mehr nur ein schwerer Sack.
Auch in der siebenwöchigen Reha in Hessen teilte ich mit ihm das Zimmer, abgesehen von wenigen Ausnahmen. Anfang Juni zogen wir nach Frankfurt in unser Reihenhäuschen, im Erdgeschoss gab es kein Schlafzimmer und kein Bad mit Dusche. Inzwischen konnte er mit einem Stock, wenn ich sein gelähmtes Bein nachzog, langsam vorwärtskommen. Und der Therapeut hatte mit uns das Treppensteigen geübt: Auch dabei schob ich sein Bein hoch oder hinunter. Da wir nur auf der linken Seite ein Geländer haben, stieg er dann die Treppe rückwärts hinab. Die Laufereien zur Physiotherapie und zur Logopädie begannen. Der Transfer in den Rollstuhl strapazierte meinen Rücken. Dennoch unternahmen wir die Mammutreise nach Berlin zur standesamtlichen Trauung unseres Erstgeborenen und anschließend zur Feier nach Düsseldorf. Der Neurologe hatte mir gesagt: „Es wird ihren Mann nicht umbringen, aber anstrengen“, und so war es auch, obwohl ich nicht weiß, wer fertiger war, er oder ich.
Auf jeden Fall hatte Manuel seinen beiden Kindern die Show gestohlen. Als Ines mit Partner und Max im Juni nach Frankfurt zu Besuch kamen, konnte ich mich ihnen kaum widmen, geschweige denn ihre Anwesenheit genießen. Meine neue Lebenssituation nahm all meine Energie in Anspruch. Auf der Hochzeitsfeier unseres Sohnes, wo Manuel in gesundem Zustand mit spritzigen Anekdoten sicherlich geglänzt hätte, waren wir nur ein Häufchen Elend und vermasselten dem jungen Paar die fröhliche Stimmung. Sebastian hätte sich im Innersten bestimmt gewünscht, dass wir dem Ereignis in Düsseldorf fernblieben; der Vater bestand aber eisern darauf teilzunehmen. Manuel ist 2005 als erster von den dreien in Szene getreten und hat seine Kinder in den Schatten gestellt. Ja, eine Krankheit kann man nicht herbeizaubern, und dennoch verließ mich nicht das Gefühl, er bezwecke damit, meine gesamte Aufmerksamkeit an ihn zu binden.
In der Zwischenzeit war ich über einige Tatsachen bezüglich seiner Krankheit aufgeklärt worden: Bis zu seinem Lebensende – und das könne in 10 Jahren oder später sein – müsse er Blutverdünnungsmittel einnehmen, um der Bildung neuer Blutgerinnsel vorzubeugen, vor allem aber würden die Behinderungen, die Hemiparese rechts und die vollkommene Sprechunfähigkeit, bleiben. Seine linke Gehirnhälfte sei komplett zerstört, im Falle eines erneuten Schlaganfalls sei die rechte dran, und dann wäre auch seine linke, noch gesunde Körperhälfte geschädigt. Tolle Aussichten!
Mit den Kindern kamen wir zu dem Schluss, zur Schonung meiner Gesundheit, vor allem meines Rückens, sei es ratsam, mit Manuel nach Santiago umzusiedeln. Dort konnte ich Entlastung durch finanzierbare Hilfestellung im Haushalt und bei der Pflege bekommen. Im August flogen wir auf unbestimmte Zeit dorthin.
9. September 2005
Im Krankenhaus hatte ich fast täglich meine Notizen aufgeschrieben. Eines Tages hörte ich damit auf. Ganz plötzlich. Ich ertrug es nicht mehr, die Geschehnisse noch einmal durchzugehen, durchzukauen. Das Erlebte reichte. Und erstaunlicherweise fasste ich das Heft nicht mehr an. Ich hatte einen Horror davor. Noch einmal mich durchwühlen lassen? Nein, danke. Es sind uns Menschen doch Grenzen gesetzt. Starke Frau hin oder her. Ich war nun mal seelisch erschöpft, gab und leistete, was ich konnte, musste aber mit meinen Kräften haushalten.
Inzwischen sind fünf Monate vergangen. Sechs seit dem Ereignis. Es geschah an einem 9. März und heute schreiben wir den 9. September. Es ist immer noch hart, fast unerträglich, unverständlich, sogar unfassbar. Dabei erleiden weltweit Millionen Menschen jährlich dieses Schicksal. Schlaganfall. Der Schlag, der das Leben von Grund auf verändert. Das des Betroffenen und seiner Angehörigen, in meinem Fall der Ehefrau.
Dabei geht es uns ja noch relativ gut. Eine liebe, geschickte, fleißige Krankenschwester steht uns täglich nebst einem Dienstmädchen zur Verfügung. Mein Mann braucht ja Verpflegung rund um die Uhr. Er geht inzwischen sehr gut mit Hilfe eines Vierkantstocks. Der Arm taugt noch zu gar nichts. Und mit der Sprache hapert es enorm. Manchmal werden wir aus seinem Nanana nicht schlau. Er gestikuliert zwar tüchtig, moduliert, benutzt Handzeichen, aber es hilft alles nicht. Und dennoch muss ich sagen, dass er uns immer etwas Bestimmtes, Sinnvolles mitteilen will.
Zum Beispiel heute. Ich versuchte, die möglichen Sachgebiete anzusprechen. „Meinst du etwas von den Therapien?“ „Nein!“ „Etwas bezüglich Cristina (der Krankenschwester)?“ „Nein!“ „Vielleicht beziehst du dich auf die Häuser?“ (denn ich war auf Haussuche) „Ja.“ Und er bewegte die Hand, um mir anzudeuten, dass ich nahe dran wäre. „Soll ich den Versuch unternehmen, das Haus zu besichtigen, das wahrscheinlich schon verkauft ist, mir aber der Beschreibung nach zusagt?“ „Nein.“ Weiter bin ich nicht gekommen. Wir geben auf. Denn diese Laut-Mimik-Gespräche sind sehr anstrengend. Sie erfordern hohe Konzentration, das Herausfinden von Themen, die in Frage kämen. Sie erschöpfen mich, frustrieren uns beide. Und das tut uns nicht gut. Also wechseln wir zu etwas anderem über.
Aber was hat er mir sagen wollen? Ein paar Stunden später stellt es sich heraus, als ich ihm offenbare, dass ich kurz Einiges einkaufen, sowie die Zeitung mit den Immobilienannoncen holen möchte. „Jaaaa!“, schreit er auf. „Ach so, das wolltest du mir vorhin sagen! Entschuldige! Du denkst aber wirklich an alles!“ Das stimmt überhaupt nicht, denn sein Dasein beschränkt sich nur auf ihn selbst. Er sieht kaum über seinen eigenen Horizont hinweg. Dazu gehört selbstverständlich das Heim, das wir uns anschaffen wollen.
Gestern waren wir auf Marias Kindergeburtstag. Bevor wir uns auf den Weg machen, zeige ich ihm, dass ich die soeben von unserem Sohn Sebastian angekommenen Fotos in meine Tasche stecke, um sie auf der Party meinen Geschwistern zu zeigen. Wir fahren hin, setzen uns, und ich quatsche fröhlich mit den Anwesenden. Nach einiger Zeit sucht mein Mann nach etwas. Es ist meine Tasche. Ich erkläre meiner Schwester, dass er immer um meine Tasche besorgt ist, da sie wertvollen Inhalt birgt, mir manchmal sozusagen als Büro dient. Er möchte diesmal aber nicht nur das Vorhandensein der Tasche kontrollieren, sondern sie vor sich gestellt bekommen. Er öffnet sie und schaut hinein. Ich denke, er möchte feststellen, dass nichts abhandengekommen ist. Dabei weiß er doch gar nicht, was sich dort im Einzelnen befindet. Also schaue ich in meine Tasche. „Ach ja! Die Fotos!“ Nun sehe ich den Umschlag und weiß, was er suchte, woran er mich erinnern wollte, denn ich hatte – wie so oft – vollkommen vergessen, dass ich die Hochzeitsfotos dabei hatte. Er muss sich ja um sehr wenige Dinge kümmern, während ich die Finanzen, nebst den alltäglichen Angelegenheiten manage. Seine Welt reduziert sich auf seine persönlichen Bedürfnisse. Wenn er einmal eine Frage nach seinen Kindern stellt, so handelt es sich um eine Ausnahme. Es schmerzt unglaublich, dass sich der Umfang seiner Interessen so verkleinert hat. Man könnte es für Egoismus halten, aber nein, sein Gehirn ist durch den Schlaganfall geschädigt und unfähig, über bestimmte Grenzen hinweg zu denken, zu agieren. Dennoch ist es für mich nicht leicht, mit diesem Defizit zurechtzukommen. Ich kann bei seinen Gesprächen immer davon ausgehen, dass er etwas mitteilen möchte, das in seinen Lebensbereich fällt. Das Suchen nach dem Thema ist dementsprechend nicht sehr weitreichend, was seinerseits die Kommunikation vereinfacht. Zu erleben, dass er nie eine Frage zu meinem Befinden stellt, nie nach seinen Kindern fragt, die ihrerseits rührend oft anrufen, um sich nach ihm zu erkundigen, das tut im Innersten weh.
Man muss andrerseits mit einigem zu Rande kommen, das früher nicht zu unserem Leben gehörte. Vor allem Schmerzen, leibliche Schmerzen. Seit sechs Monaten höre ich seine Klagen darüber. Wenn ich ihm Tabletten als Abhilfe anbiete, so lehnt er ab. Ich sage ihm - und der Neurologe ebenso -, er müsse konsequent sein: Entweder nimmt er Medikamente gegen die Schmerzen ein, oder er erträgt sie still und leise. Aber nein, weder das eine noch das andere tut er! Er jammert und jammert, tagein, tagaus, Woche für Woche, Monat für Monat, tagsüber und nachts, bei Sonnenschein und bei Regen. Es ist kein Zusammenhang festzustellen zu klimatischen Ursachen oder zu Überanstrengung. Vielleicht zu seelischen Konflikten, ja, wenn wir beide uns gestritten haben. Muss ich alles schlucken? Muss ich alles wortlos mit Haltung ertragen? Muss ich diese Fähigkeit besitzen oder gar entwickeln, wenn ich sie von Natur aus nicht in die Wiege gelegt bekommen habe? Ich schaffe es nicht. Manchmal sage ich ihm meine Meinung. Ist das falsch? Kann er gar nicht reagieren oder kann er nicht anders agieren, als er es tut, eingeschränkt durch den Verlust unzähliger Nervenzellen? Ich denke mir, es ist nicht fair, sein egoistisches, eintöniges Verhalten ertragen zu müssen. Man sollte ihn in seine Schranken weisen, oder doch nicht? Wenn ich ihm erkläre, dass sich das Leben ja nicht nur für ihn geändert hat, dass auch meins, obwohl in voller Gesundheit, nicht das gleiche ist wie früher, dann nickt er. Ob er etwas verstanden hat, bezweifle ich. Er sieht ja nur sich selbst und sein Leiden in dieser Welt, sonst nichts.
Die Schmerzen werden durch Spastik verursacht. Wahrscheinlich wird er sie nie mehr los. Ich also auch nicht. Ich spüre die Schmerzen ja nicht, aber sein Wehklagen geht mir durch Mark und Bein, und vor allem durch meine Psyche. Ich kann ihm nicht helfen, fühle mich überfordert. Was unternehme ich nicht alles, damit es ihm gut geht, oder so gut wie möglich! Und dennoch fehlt ihm etwas! Aber was? Was soll ich noch auftischen? Ich lese von der Burgenko Wassertherapie, aber die wird nur in den USA an ausgewählten Orten angeboten. Ich lese von Biofeedback, aber wer soll mir das hier in dem kleinen südamerikanischen Staat bieten? Es ist zum Verzweifeln! Ist er nicht zur Genüge gestraft mit der halbseitigen Lähmung, mit der Sprechunfähigkeit, d.h. mit der Isolation von der restlichen Menschheit, muss er obendrein noch physische Schmerzen erleiden? Die Neurologen geben sich zaghaft bis machtlos. Wenn man Schmerzmittel verschreibt, heißt es, sind Nebenwirkungen nicht auszuschließen. Sein Mitwirken an den Therapien sei gefährdet, sein Willenszustand eventuell gedämpft.
Ich ringe mich dazu durch, ihm ein bestimmtes Schmerzmittel eine Woche lang zu verabreichen. Ich sage mir, es ist nicht mehr zu ertragen, dass er fünf bis sechs Mal pro Nacht aufwacht, sich im Bett aufsetzt, wozu er meine Hilfe benötigt, dass weder er noch ich durchschlafen können, dass wir beide doch die Erholung durch den Schlaf benötigen, dass die Schmerzen aufhören müssen. Er lässt sich die Tropfen eintrichtern als wären sie Gift. Die Schmerzen lassen ein wenig nach, nicht wesentlich. Dafür verändert er sich in seinem Wesen und im Verhalten. Er ist nicht mehr er selbst, sodass wir den Versuch nach einer Woche abbrechen. Wir leben weiter mit den Schmerzen, mit dem ewig sich wiederholenden Thema des Wehleidens.
Oft muss ich die Krankenschwester in Schutz nehmen. Wenn es nach Manuel ginge, so müsste sie 24 Stunden zur Verfügung stehen. Sklavenhaltung. Sie hat sich soeben zu einem Nickerchen niedergelegt und soll nun zur Massage erscheinen. Ich versuche, ihm klarzumachen, dass sich ihre Arbeitszeit auf acht Stunden täglich beschränkt. Er wirkt verständig. Dennoch soll sie mit zu seinen Therapien, soll dabei sein, um andere Techniken zu erlernen. Ich wiederhole, dass sie auch Erholung braucht, dass wir mit ihren Kräften haushalten müssen. Er verzichtet auf ihre Anwesenheit.
Gestern fuhren wir zur Handklinik. Der Plan war, dass Manuel ohne Rollstuhl, nur mit Stock, bei uns zu Hause den Fahrstuhl hinunterfährt und ein paar Schritte bis zum Auto geht. Er soll sich von dem Hilfsmittel lösen, so viel wie möglich gehen. Großes Gezeter, der Herr möchte partout nicht ohne seinen Stuhl von dannen. Also fahren wir ihn im Rollstuhl sitzend bequem hinunter. Er setzt sich um in das Auto, Cristina kehrt in die Wohnung zurück. Als Manuel das bemerkt wird er nochmals wütend, zum ersten Mal überrascht er mich damit, dass er die Handbremse zieht. Da ich sehr langsam fuhr, war es nicht weiter schlimm. Ich gebe nach, fahre ums Karree, um Cristina wieder einzuladen, die noch nicht ins Gebäude hineingegangen war. Kaum sind wir 20 Meter gefahren, wird Manuel schon wieder zornig. Er zieht noch mal die Handbremse. Nun verstehe ich erst genau den Grund für seine Wutausbrüche. Er fühlt sich hintergangen, nicht weil Cristina nicht mitgekommen ist, sondern weil der Rollstuhl nicht mitfährt. Es ist verständlich, dass er sich sicherer, d.h. mobiler fühlt, wenn der Rollstuhl dabei ist. Ich erkläre ihm, dass er doch schon immer in die Handklinik auf eigene Faust, genauer, auf eigenen Füßen hineinspaziert ist, dass der Rollstuhl überflüssig ist. Er sieht es ein und willigt sogar darin ein, dass Cristina aussteigt und zu Hause auf unsere Rückkehr wartet.
Nun lese ich ihm aber die Leviten: So geht es nicht. Er darf nicht einfach die Handbremse ziehen. Das ist lebensgefährlich. Er nickt und verspricht, es nicht mehr zu wiederholen. Aber durch seine Handlungsweise wird mir klar, dass er die Mechanik und das Funktionieren bestimmter Dinge noch kennt. Denn wahrlich, was er sonst noch weiß, was er noch versteht, was er noch beherrscht, ist uns ein Rätsel. Er spricht ja nicht. Schreiben kann er auch nicht. Die Verbindung zwischen Gedanke und Ausdruck ist blockiert, er kann sie nicht mehr herstellen. Somit ist jeder spontane Ausdruck unmöglich. Wenn man ihm etwas sagt, mimt er Verständnis.
Er lernt ja auch hinzu. Zum Beispiel zeigt er nun auf seine Augen, wenn er seine Brille verlangt oder den Spiegel, in dem er immer wieder die Verzerrungen seines Mundes betrachtet. Vor einigen Monaten war es noch unmöglich, dass er mittels Gestik auf einen betreffenden Körperteil deutete, um ein Bedürfnis auszudrücken.
17. September 2005
Es ist ein Kampf. Ein ewiger Kampf. Sind alle neurologischen Patienten so stur? Manchmal könnte ich ihn erwürgen, erdrosseln, kleinhacken, in Stückchen schneiden, martern, foltern, gegen die Wand schmeißen. Ja, es reicht. Es ist wunderschönes Wetter. Die Sonne scheint. Es herrscht eine angenehme Temperatur. Ich möchte aufs Land fahren. Nein, er will nicht. Er hat Angst vor der Kälte, was soll er dort, denn das Einzige, wofür er lebt, sind seine Therapien. Dass diese Eintönigkeit mich langweilt, dass ich Abwechslung brauche, dass ich mich darauf freue, das spielt für ihn alles keine Rolle. Das Leben muss sich nach ihm richten.
Cristina schlägt vor, wir sollen in die Altstadt fahren, da sind samstags Darbietungen um einen kleinen Antiquitätenmarkt herum. Darauf bekommt er Lust. Ja, er möchte hin. Wir sagen, okay, aber nur mit Stock, ohne Rollstuhl. Er argumentiert, er humple dann durch die Gegend und er brauche ja den Rollstuhl. Ich sage: „Gut, ich willige darin ein, dass wir den Rollstuhl vorsichtshalber im Auto mitnehmen. Du gehst hier bis vor die Haustür, steigst ins Auto, und am Markt fahre ich dich vorne ran, damit du wenig zu gehen hast. Dort gibt es auch Bänke, auf denen du dich immer wieder ausruhen kannst.“ Nein, er will nicht. Es wäre ja auch eine Premiere. So etwas hat er noch nie gemacht. Aber irgendwann müssen wir damit beginnen!
Gestern hat er mir noch versprochen, dass er im Sommer mit mir an den Strand geht, dass wir unseren Enkel Max dorthin begleiten werden. Wie soll er das schaffen, wenn er nur die paar Schritte in der Wohnung zurücklegt? Es fehlen nur einige Monate bis dahin. Er muss üben. Wie kriege ich ihn dazu?
Dann sage ich mir wieder, er braucht Zeit. Die Entwicklung ist langsam. Und große Fortschritte hat er bereits geleistet. Die er natürlich nicht honoriert. Er zuckt nur abschätzig mit der Schulter, wenn man ihn darauf anspricht. Irrsinnig frustrierend für uns, die ihn ständig begleiten, unterstützen, immer wieder etwas ausdenken, um ihn von den Schmerzen zu befreien oder sie zu lindern suchen. Wir brauchen ein kleines Feedback von ihm, in der Form eines Lächelns z.B. Aber er ist so geizig damit. Egal ob Therapeut, Krankenschwester oder ich als Ehefrau, wir bitten ihn alle inbrünstig um ein Zeichen von Gefühlen, von Anerkennung, von Wohlbefinden. Er scheint eingekerkert in seinem Turm des frostigen, eisigen Fühlens. Ist er dermaßen verarmt, dass er nichts mehr geben kann, aber vor allem auch nicht einmal die Fähigkeit besitzt, wahrzunehmen, welche Bemühungen von unserer Seite kommen? Man prallt immer wieder an seiner starren, glatten Rüstung ab. Ist seine Gefühlswelt abgestorben? Ich flehe ihn an, mich zumindest anzuschauen, wenn ich mit ihm rede! Was ist da oben an der Decke so Hübsches, Interessantes zu bewundern, dass er mich keines Blickes würdigt? Natürlich nichts. Aber sich mit dem Nichts statt mit einem lebendigen Wesen zu befassen, ist viel einfacher, als sich mit der Realität auseinandersetzen zu müssen. Eine Streicheleinheit seinerseits, ein Küsschen, ein liebevolles Augenzwinkern sind eine Seltenheit. Wie soll ich geben, wenn ich nie etwas bekomme? Wie lange werde ich durchhalten können?
Sein Gefühlsleben ist dermaßen abgestorben, dass es ihm wenig ausmacht, dass Cristina gegangen ist. Den neuen Krankenpfleger nimmt er an, als wäre er ein Roboter oder ein Sklave. Dabei schien er an Cristina zu hängen. Sie verstanden sich sehr gut. Ich hätte nicht geglaubt, dass Manuel den Wechsel so leicht hinnehmen würde. Auch den jungen Krankengymnasten, der Manuel zum selbständigen Gehen, sogar ohne Stock, gebracht hat, vermisst er nicht. Er nimmt den neuen auf, als wäre er schon immer da gewesen. Ein weiteres Zeichen für seine zunehmende Gleichgültigkeit, seine verheerende Gefühlskälte.
Ich muss mich wohl an den Gedanken gewöhnen, dass mein Leben nun einen neuen Inhalt hat. Es gibt ja viel schlimmere Fälle. Man nehme nur die Kinder, die behindert auf die Welt kommen, die nie das Leben in vollen Zügen genossen haben, noch je genießen werden. Ein aussichtsloses Leben in unseren Augen. Nicht so vielleicht in den Augen der Eltern oder des Kindes selbst.
Inzwischen durch die Umstände gereift, sage ich mir nun, das unbeschwerte Leben, das wir führten, konnte ja nicht ewig andauern. Es war zu schön, um wahr zu sein. Krankheit, Tod, Katastrophen waren uns fern geblieben. Wie viele Menschen erleiden nicht schlagartige Veränderungen durch einen Unfall, an dem sie überhaupt keine Schuld tragen? Es ist schwierig, sich mit diesem Schicksal abzufinden, aber es bleibt mir nichts anderes übrig. Es handelt sich um eine harte Prüfung. Sie wiederholt sich täglich. Sie ist nie abgelegt, nie bestanden, eher das Gegenteil. Soll ich an ihr reifen? Wozu? Zu welchem Zweck? Habe ich bis dato zu leichtsinnig, zu bequem gelebt? Soll mir das Ganze mehr bringen als nur Schmerz? Womit habe ich es verdient? Oder überhaupt, warum ich und nicht jemand anderes? Habe ich egoistischer gelebt als die anderen? Soll es Strafe oder Läuterung sein? Ein Besserwerden wofür? Soll ich etwa noch Großes leisten? Das kann ich nicht glauben. Also nur die Belehrung und das Korrigieren an einem Menschen um der Tatsache willen? Masochistisch bin ich noch nie gewesen!
22. Oktober 2005
Fortschritte werden nicht errungen. Sie werden erkämpft! Und zwar von uns. In kleineren und größeren Schritten.
Zuerst ging er mit meiner Hilfe. In Frankfurt, im Juli, hob ich sein Bein, damit er sich vorwärts bewegen konnte. Auch beim Treppensteigen oder Hinuntergehen half ich mit. Seit August hebt er nun das Bein selber, stützt sich auf einen Stock mit vier Füssen. Seit September geht es auch ganz ohne Stock, aber zur Sicherheit wird er noch immer benutzt.
Das Gehen bedeutete nicht selbstverständlich, dass nun der Rollstuhl ad acta gelegt war. Aber peu à peu haben wir auch ihn abgeschafft. Er fährt also stehend im Fahrstuhl hinunter und geht an den Straßenrand, um ins Auto zu steigen. Da die Straße sehr befahren ist, gelingt es mir (bis dato nur einmal!), dass er den anderen Hauseingang hinausgeht, wo er zusätzlich noch eine Treppe bewältigen muss. Es sind Fortschritte, die für uns alle sehr viel bedeuten. Der nächste Schritt wäre, dass er nicht mehr mit diesem wulstigen Stock geht, sondern einen einfachen zur Hand nimmt. Dies würde ein neues Stück Freiheit und Sicherheit bedeuten. Im Allgemeinen sind diese Fortschritte, wenn sie einmal erreicht sind, etabliert. Es gibt kein Zurück mehr in frühere Phasen. Einmal geschah es dennoch, ein paar Tage lang, als er wieder den Rollstuhl benutzen musste, weil er angeblich einen verstauchten Knöchel hatte.
Im Grunde genommen wechseln die Schwerpunkte seiner Schmerzen. Der Knöchel war nach einigen Tagen kein Thema mehr, dafür traten Schmerzen entlang der Innenseite des Beines auf. Oder war es Taubheit? Ich werde nicht immer schlau aus seinen Beschreibungen. Vielleicht fluktuiert es auch. Manchmal Gefühllosigkeit kombiniert mit Muskelschwäche, dann wieder Schmerzen. Das alles behindert sein Laufen, somit auch sein und unser Wohlbefinden. Und dabei muss er sich bewegen, raus aus dem Bett, in das er immer wieder flüchtet, obwohl er nicht schlafen kann.
Er, der keine Schmerzmittel einnehmen möchte, bittet mich eines Nachts um die Schlaftabletten. Damit wir beide besser schlafen, habe ich uns eine leichte Schlaftablette verabreicht. Und zwar ganz offen vor seinen Augen habe ich eine genommen und ihm auch eine angeboten. Er akzeptierte. Ich wollte die Wirkung am eigenen Leibe erproben. Nach drei bis vier Nächten brach ich das Experiment ab, obwohl eine erholsame Wirkung eingetreten war. Da verlangte Manuel nach der ausbleibenden Tablette, die ich ihm gewährte. D.h. auch er hatte bemerkt, dass er tiefer und länger geschlafen hatte.
Man muss ihn immer wieder fordern. Zumindest ist das meiner Meinung nach die einzige Möglichkeit, ihm Leistungen abzuverlangen. Wir sind zu einer Hochzeit eingeladen. Er ruht sich den ganzen Nachmittag lang aus. Wir ziehen uns an. Er steht auf, geht ein wenig und sagt: „Nein, es geht nicht!“ Ich flehe ihn an: „Bitte, streng dich an. Es wird dir gut tun, aus deinen vier Wänden herauszukommen, etwas anderes zu sehen, unter Menschen zu gelangen!“ Er willigt ein. Er kommt mit. Es ist geschafft. Und er meistert die ganze Nacht vortrefflich. Steigt einige Stufen hier hinauf, dort hinunter, wir kehren schließlich um 3 Uhr morgens nach Hause zurück.
Oder er meint, er könne die Treppe nicht erklimmen. Nein, heute geht es partout nicht. Mit viel Geduld und Überredungskunst schafft er sie dann doch. Man muss ständig gegen seine Sturheit ankämpfen. Handelt es sich um seine Eigenheit, eine Charaktereigenschaft, oder ist es allgemein so, dass neurologische Patienten schwieriger werden in ihrer Verhaltensweise? Wenn er sich bloß fügen würde! Wenn ich nicht ständig gegen seinen Willen auftreten müsste!
Einerseits will er ganz offensichtlich das Verlorene wieder erlernen. Mit den Therapeuten arbeitet er mit, als ginge es um eine Auszeichnung. Nicht so im häuslichen Ambiente. Da lässt er sich gehen. Es ist für uns sehr aufreibend, ihm immer wieder klar zu machen, wie wichtig die Übungen für ihn sind. Während er bei den Therapien keine Anstrengung meidet, lässt er sich bei uns hängen. Jede seiner Leistungen können wir als einen Triumph verzeichnen, der nicht nur seinen Schweiß, sondern auch unseren gekostet hat!
Ich habe mich mit meiner Schwester verabredet. Wir sollen bei ihr vorbeikommen. Ich teile es Manuel mit. Ein entschiedenes „Nein“ erhalte ich zur Antwort. Er sei zu müde. Also muss ich meine Schwester anrufen und sie bitten, zu uns zu kommen. Dabei wollte ich doch gerade, dass er rauskommt. Aber nein, der Herr weigert sich. Aber es ist nicht nur Müdigkeit, Trägheit, Faulheit, die ihn zu seiner Weigerung führen. Er scheut natürlich das Gehen von unserer Wohnung bis zum Auto, dann das Marschieren vom Fahrzeug bis zu Bertas Wohnzimmer. Es kommt sicherlich noch eine Überlegung hinzu. Die Krankengymnastin hat angerufen und mitgeteilt, sie komme um halb sechs. Er möchte in den Therapien glänzen. Deswegen geht er davor sparsam mit seinen Energien um. Er hat gelernt, seine Kräfte schonend einzusetzen, mit ihnen hauszuhalten. In den letzten Monaten hat er eine Strategie entwickelt, um in den Therapien immer möglichst fit zu sein.
Ich gelange zu folgendem Schluss: Es hat keinen Sinn mehr, auf seine Schmerzen einzugehen. Ich werde mich nicht mehr verrückt machen mit überstürzten Arztbesuchen, weil wieder mal neue Schmerzen in einem anderen Körperteil aufgetaucht sind. Eine greifbare Ursache ist nicht vorhanden. Schon in der Reha waren die Neurologen nicht auf seine Schmerzen eingegangen. Ganz eindeutig, weil man sie nicht ausschalten kann. Ich nehme mir vor, ihn zu beschwichtigen und basta. Ob das klappen wird? Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall weiß ich, sie werden immer wieder auftreten, mal hier, mal da, und er wird sie ertragen müssen. Abhilfe kann ich kaum schaffen. Er muss lernen, mit den Schmerzen zu leben. Wie er sich dazu äußert, kann ich nicht mehr ertragen.
Ich frage ihn, ob er Vertrauen in mich hat. Er versichert mir, es sei so. Gott sei Dank! Wenn er eines Tages kein Vertrauen mehr haben sollte, was dann? Lieber nicht daran denken!
Katharinenkloster
Mein Mann arbeitete eine Zeit lang in Israel, inmitten der Wüste Negev, wo drei Jahre zuvor der Sechstagekrieg getobt hatte. Auf Panzern, die in der Einöde liegengeblieben waren, sprangen Beduinenkinder herum und spielten Krieg. Sie hatten auch dafür gesorgt, dass die neu verlegten Telefonkabel nicht ordnungsgemäß funktionierten: Die Kleinen machten sich einen Spaß daraus, aus den noch nicht verdeckten Muffen den Druck entweichen zu lassen. Das Zischen war eine lustige Abwechslung in ihrem eintönigen Dasein. Welchen Schaden sie anrichteten, war ihnen nicht bewusst, auch nicht, wie viele Ingenieure sich wegen des mysteriösen Gasverlustes den Kopf zerbrachen. Bis mein Ehemann erschien und den Jungen auf die Schliche kam – allen technischen Trugschlüssen zum Trotz.
Mein Gatte hatte sich in seinem religiösen Eifer vorgenommen, das aus dem 6. Jahrhundert stammende Katharinenkloster auf der südlichen Sinai Halbinsel zu besuchen. Denn dort, auf dem 2.285 Meter hohen Berg Sinai, hat Moses von Gott die Gesetzestafeln in Empfang genommen. An einem Samstag stiegen wir also in den VW Passat und fuhren auf der erst kürzlich von den Israelis in Windeseile gebauten Asphaltstraße durch die Wüste und anschließend die Küste des Golfs von Suez entlang. Mein Mann kam mit den nur hebräisch beschriebenen Schildern gut zurecht. Er hatte in Beer Scheva einen Sprachkurs für Ausländer besucht, und die erworbenen Kenntnisse reichten zur Entzifferung der Beschriftung aus, auch wenn er das Auto dafür kurz anhalten musste! Wir erreichten einen Militärposten, der uns passieren ließ und bogen bald in die ca. 100 km lange, kaum erkennbare Wüstenfährte ab, deren einzige Markierung aus Steinhäufchen bestand. Die, wie konnte es anders sein, verschwanden des Öfteren in den Händen der besagten Beduinenkinder, die sich einen Scherz daraus machten, Ortsunkundige in die Irre zu leiten. Es dauerte nicht lange, und wir standen unschlüssig in diesem Sandmeer, in der glitzernden Sonne; nirgendwo war eine Menschenseele, geschweige denn eine
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: