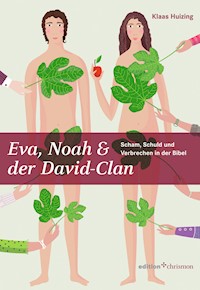
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: edition chrismon
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Wie aus Scham Schuld wird. . und warum es so entlastend ist, zur buckligen Verwandtschaft des biblischen Personals zu gehören: Für Klaas Huizing, den versierten Theologen, Philosophen und Schriftsteller, gehört die Scham zur Urausstattung des Menschen nach dem Auszug aus dem Paradies. In ihr haust die Angst, die Bestimmung zum liebenden Miteinander zu verfehlen. Um der Scham über die eigene Unvollkommenheit nicht hilflos ausgeliefert zu sein, wird sie oft in Schuld und Verbrechen umgewandelt. Dieses psychologische Grundmuster zeigt sich bei allen herausragenden biblischen Gestalten: bei Kains Brudermord und Noahs Trunksucht, im Inzest von Lots Töchtern, beim tricksenden Jakob und beim mörderisch liebenden David. Der Bibel ist nichts Menschliches fremd.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 213
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Klaas Huizing
Eva, Noah &der David-Clan
Scham, Schuld und Verbrechen in der Bibel
„Oh meine Freunde! So sprichtder Erkennende: Scham, Scham, Scham –das ist die Geschichte des Menschen.“
Friedrich Nietzsche, Also sprach Zarathustra
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek: Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
Gestaltung: Kristin Kamprad Illustration: Sylvia Neuner 1. digitale Auflage: Zeilenwert GmbH 2014
© Hansisches Druck- und Verlagshaus GmbH, Frankfurt am Main 2012. Alle Rechte vorbehalten. Das Werk einschließlich seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Nutzung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts ist ohne schriftliche Einwilligung des Verlags unzulässig.
ISBN 9783869211671
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titel
Impressum
Einleitung
Onkel Ernst – der Bodyguard von Emma Peel und das schwarze Schaf der Familie
Adam & Eva
Peinlich nackte Ur-Eltern
Kain
Das Drama des unverschämten Kindes
Noah
Der schamlos Betrunkene
Lots Töchter, Lea & Rahel, Tamar
Drei Schamgeschichten
Esau
Der späte Held der Scham
Simson
Zwischen Eifersucht und Scham
Der David-Clan
Scham-Stück in mehreren Akten
Jesaja & Hosea
Die Performer der Scham
Jesus
Der Meister der Scham
Schluss
Wird uns die Scham überleben? – Über falsche Scham und die Kunst der Entschämung
Anhang
Anmerkungen und Literaturverzeichnis
Onkel Ernst war offenbar auf den falschen Vornamen getauft worden. Sein zweiter Vorname, Hinnerk, passte sehr viel besser, erinnerte an einen Schluckauf – aber den zweiten Vornamen las ich erst auf seiner Todesanzeige. Onkel Ernst war der Mann der Schwester meiner Mutter, der Mann von Tante Annegret, auf die meine Mutter immer etwas neidisch war, weil ein anderer Onkel, Onkel Georg, der Onkel mit der dicken Zigarre, nicht müde wurde, Tante Annegret auf jedem Familienfest als ungekrönte Kaiserin der Grafschaft Bentheim zu titulieren. Nach der Geburt der Kinder war sie als einzige meiner Tanten, wie die Bilder im Familienalbum verraten, schlank geblieben, sie trug immer Pumps, liebte paillettenbesetzte Handtaschen und schminkte sich im Stil von Soraya, der entlassenen Kaiserin aus Persien.
An den Geburtstagen, wenn, wie meine Mutter sagte, „die ganze bucklige Verwandtschaft zum Essen kommt“, wollten alle immer neben Onkel Ernst in den schweren Sessel versinken, auch die, die im Alltag über ihn herzogen und ihn das schwarze Schaf der Familie nannten. Er war die Stimmungskanone, die spätestens bei den Silberzwiebeln einen Witz nach dem anderen abfeuerte. „Untenrum-Lyrik“, die in einem calvinistischen Haushalt eigentlich nicht geduldet wurde. Die Geburtstage mit Onkel Ernst dienten der verbalen Triebhygiene. Alle lachten, aber am anderen Tag wurden die Lippen meiner Mutter schmal, wenn ich einen Witz von Onkel Ernst wiederholte. „Onkel Ernst sollte sich schämen, solche Sachen vor Kinderohren aufzutischen. Der hatte einfach keine gute Kinderstube. Beim nächsten Geburtstag schicke ich dich früher zu Bett, wenn du weiterhin diese schmutzigen Witze nacherzählst. Hast du mich verstanden?“ Ich hatte sie verstanden, nickte, protestierte nicht gegen den Ausdruck „Kinderohren“ und freute mich auf die Schulpausen; dort hatte ich dankbares Publikum für meine Unterleibwitze. Ich schämte mich nicht für Onkel Ernst.
„Onkel Ernst musste sehr früh in die Krieg ziehen“, pflegte meine Mutter zu sagen, wenn ich wissen wollte, welchen Beruf Onkel Ernst ausübe. Onkel Ernst leitete keine Firma und war kein Pastor – die klassischen Berufsbilder meiner calvinistischen Verwandtschaft. „Onkel Ernst arbeitet bei Povel.“ Povel war neben Nino und Rawe in den sechziger und siebziger Jahren eine der großen Textilfabriken in Nordhorn. Viele Väter meiner Schulfreunde, oft ehemalige Kleinbauern, gingen in die Fabrik. Meine Mutter sagte niemals über ihren Schwager: Onkel Ernst geht in die Fabrik. Wer in die Fabrik ging, verdiente sein Geld als Textilarbeiter, Onkel Ernst arbeitete offensichtlich etwas anderes. Auf jeden Fall war er kein Arbeiter. Meine Mutter verstand es ausgezeichnet, mich am Nachfragen zu hindern, nur einmal sagte sie ganz unvermittelt: „Der passt auf, dass nichts passiert. Das ist kein ordentlicher Beruf, Onkel Ernst schämt sich auch ein bisschen dafür, aber solche Menschen muss es wohl auch geben. Und nun lern bitte die Vokabeln. Ich hör sie nach dem Abendbrot ab.“
Onkel Ernst mochte mich. Er hatte zwei Töchter, die wie die nie geborenen Töchter der Soraya aussahen, aber keinen Sohn. Einige Male nahm er mich heimlich mit zum Sportplatz, wenn Sparta Nordhorn an einem Sonntag Fußball spielte – heimlich, denn Besuche von Sportveranstaltungen am Sonntag waren für Calvinisten wegen der Sonntagsheiligung streng untersagt. Hinterher gingen wir dann in der Stadt ein gegrilltes Hähnchen essen. An einem anderen Sonntag fuhr er mit mir zur Fabrik, begrüßte den Pförtner mit Handschlag, stellte mich als Juniorchef vor, dann schloss er mit seinem riesigen Schlüsselbund alle Türen und Tore auf und zeigte mir alles: sonntagsberuhigte Webstühle, den Spinnereiturm, eine verwaiste Schlosserei und Tischlerei, die Färberei, Baumwollberge so hoch wie der Ararat, einen endlos langen Korridor mit zahllosen Türen. Hallende Stille. Das kalte Licht der Neonröhren wischte sogar die Bräune von Onkel Ernst weg. Wir gingen lange schweigend in den Trichter, der an ein Megafon erinnerte, hinein, bis Onkel Ernst eine Tür aufmachte: Ein Büro mit zwei riesigen Schreibtischen, auf einer Arbeitsplatte stand ein noch voller Aschenbecher. „Eigentlich ist das hier immer picobello. Muss der Putzfrau mal auf die Finger klopfen, aber vielleicht war der Gert auch gestern Abend lange im Büro. Gert ist unser kleines Genie. Die Konkurrenz von Nino hat einen Stoff produziert, Nino-Flex, der macht ziemlich viel Wind und uns viel Ärger, aber Gert und seine Jungs arbeiten an einem noch besseren Stoff und einer Starkollektion, die alles in den Schatten stellen wird. Aber das ist streng geheim. Du weißt es als Erster, darfst aber nichts verraten. Versprochen?“ Ich nickte und fragte wieder nicht, was Onkel Ernst eigentlich arbeite, war froh, als wir im Aufzug wieder nach unten fuhren.
Dann stand Onkel Ernst in der Zeitung. Die meisten Grafschafter schafften es nur als Schützenkönige oder über die Todesanzeige in die Zeitung. Nicht so Onkel Ernst. „Onkel Ernst steht heute in der Zeitung“, sagte meine Mutter, als ich mittags aus der Schule kam. Es klang leicht vorwurfsvoll. Strichschmale Lippen. Ein Anflug von Rot auf ihren Wangen. Als müsse sie sich erneut für Onkel Ernst schämen. Die Grafschafter Nachrichten lagen bereits aufgeschlagen auf dem Schreibtisch. Tatsächlich. Onkel Ernst saß, seine Augen hinter seiner Sonnenbrille verborgen, an einem Tisch neben einer Schauspielerin, die ich sofort erkannte: Es war Emma Peel aus „Schirm, Charme & Melone“. „Warum sitzt Onkel Ernst denn neben Emma Peel?“ „Onkel Ernst sitzt nicht neben Emma Peel, sondern neben der Schauspielerin Diana Rigg, die die Emma Peel verkörpert.“ Ich verdrehte kurz die Augen. „Okay, und warum sitzt er neben Diana Rigg?“ „Es ist völlig unnötig, dass du deine Augen überanstrengst, ich sage es dir gerne: Povel hat eine Emma-Peel-Kollektion auf den Markt gebracht, alles untragbarer Plunder, alberne Sächelchen, aber damit schafft man es immerhin in die Zeitung.“ „Und was macht Onkel Ernst?“ „Diana Rigg ist eine kleine Berühmtheit und Onkel Ernst passt auf, dass sich ihr nicht ein Verrückter nähert. Die Welt ist mit Verrückten überfüllt.“ „Onkel Ernst ist Bodyguard?“ Meine Mutter schaute von ihren Buchungen auf: „Tausendmal habe ich dir bereits gesagt: Du sollst nicht immer diese verdrehten englischen Wörter benutzen, wenn es einen deutschen Ausdruck dafür gibt. Schlimm genug, dass du dauernd Deutsch und Holländisch vermischst. Onkel Ernst ist der Leibwächter und Hüter von Emma Peel. Und jetzt geh in die Küche und iss dein Mittagessen, bitte, ich habe dir frische Kartoffeln kochen lassen.“
Beim nächsten Besuch schenkte mir Onkel Ernst eine Autogrammkarte von Diana Rigg: Für Klaas!, stand da. Ich bekam vor Aufregung rote Ohren. Als ich mit Onkel Ernst zwei Tage später Minigolf spielen ging, war er so unkonzentriert, wie ich ihn noch nie erlebt hatte. „Eine tolle Frau, die Diana Rigg. Bundesliga, wenn du verstehst, was ich meine. So ein Erlebnis vergisst man nie.“ „War es denn schwierig, sie zu beschützen?“ Onkel Ernst machte noch einen Schlag, sagte dann: „Die hat sich bei mir total sicher gefühlt.“ Der Ball konnte sich nicht dazu entscheiden, ins Loch zu fallen. „Und zeigst du mir mal deine Pistole?“ „Woher weißt du, dass ich eine Pistole habe?“ „Jeder Bodyguard hat eine Knarre.“ Onkel Ernst knurrte nur. Die Pistole hat er mir nie gezeigt. „Gangster haben heute Fotoapparate. Die schießen nicht mehr. Die knipsen.“
Onkel Ernst gehörte zu meiner buckligen Verwandtschaft. Ursprünglich, so wird man von der Berliner „Tageszeitung“ („Letzte Fragen“) belehrt, war es die ärmere Verwandtschaft, die nur im Souterrain oder in engen Mansarden hauste, sich keine geraden Wände leisten konnte und somit immer vom Buckel bedroht war. Kam die ärmere Verwandtschaft zu Besuch (meistens unangekündigt), dann musste man sie durchfüttern. Das ging, wenn Freunde zufällig vorbeischauten, oft nicht ohne Scham ab, weil vor Dritten die eigene, wenig strahlende Herkunft im Dunkeln bleiben sollte.
Der Ausdruck „bucklige Verwandtschaft“ hat die negative Bedeutung teilweise abgeschliffen, gewinnt zunehmend einen spielerisch-ironischen Unterton. Oft nerven Verwandte und man muss sich manchmal für sie schämen, ja, aber ganz ohne die bucklige Verwandtschaft ist das Leben ärmer. Und am spannendsten in der buckligen Verwandtschaft sind diejenigen, die gegen den Strom schwimmen. So wie Onkel Ernst. Die Gerüchte über seine Frauengeschichten und seinen Hang zu Schulden, die mir nach seinem Tod zu Ohren kamen, haben an der Zuneigung zu ihm nichts geändert. Ich wäre zu ihm gegangen, wenn ich im Holozän meiner Pubertät nicht weitergewusst hätte.
Dramatischer verhält es sich mit der biblischen Familie. Der familiäre Stammbaum ist aufregend krumm und schief. Taugt nicht zum Weihnachtsbaum. Keine heile Welt, nirgends. Dummköpfe, Alkoholiker, Prostituierte, Totschläger, Vergewaltiger, Betrüger, gefallene Helden. Strahlende Siegertypen sind selten. Man kann es sich aussuchen: Starten wir den Stammbaum mit Adam, dann ist unser mythischer Ur-Vater ein Feigling, starten wir mit Noah, dann ist unser zweiter Ur-Vater Alkoholiker. Starten wir mit dem zweiten Adam, mit Jesus, dann darf man zumindest so viel sagen: Die inoffizielle Vaterschaft ist höchst anrüchig. Seltsamerweise hat das kulturelle Gedächtnis verdrängt, dass der biblische Stammbaum windschief ist. Und die in der Frömmigkeitspraxis beheimatete heilige Scheu vor den biblischen Figuren, denen man umstandslos Tugendhaftigkeit unterstellt, unterschlägt die radikale Gebrochenheit des biblischen Personals. Diese lebenssatten Geschichten will ich aus dem Tresor falscher Erinnerung befreien. Noah ist ein genialer Schiffbauer, ja, das ist bekannt, aber ein Alkoholiker? David ist der Mann mit der sagenumwobenen Schleuder, ja, aber auch ein mafiöser Mörder? Jesus von Nazaret ist der Christus, aber vielleicht auch die Frucht einer extrem skandalösen Beziehung? Nichts Menschliches ist den biblischen Geschichten fremd.
In diesem Essay soll an ausgewählten Beispielen die Gebrochenheit biblischer Biografien vermessen werden. Es ist eine extrem bucklige Verwandtschaft. Literarischer suspense, den beinahe kein Gegenwartsroman bietet. Die Erzähler verschweigen nichts, sparen offenbar absichtsvoll nichts aus. Vielleicht ist die Bibel deshalb ein so überzeugendes Buch, weil es nicht am Beispiel des Idealen und Schönen Überzeugungen und Haltungen stiftet, sondern am Beispiel des Hässlichen, Krummen, Schiefen. Dieser Zugang ist entlastend und hat menschliches Maß. Wie im richtigen Leben. Deshalb auch haben die Geschichten an ihrer Gegenwartstauglichkeit nichts eingebüßt, denn wir stoßen bei der Lektüre auf Eltern-, Eltern-Kinder-, Geschwister-, Lehrer-Schüler-, Gott-Mensch-Konflikte, die exemplarisch uns Lesern typische Krisen, Krisenverschärfungen und Krisenlösungen vorspielen.
Es geht in diesem Essay nicht in erster Linie um eine Psychogeschichte des beschädigten biblischen Personals, sondern diese literarischen Geschichten sollen im Rahmen einer kulturgeschichtlichen Fragestellung neu gelesen werden. Es ist die Scham, die unterschwellig die biblischen Geschichten steuert. Vielleicht verstehen wir uns besser, wenn wir anhand der Geschichten erkennen, wie Scham heimlich auch unsere Handlungen lenkt.
Was aber bedeutet Scham, dieses oft mit Groll in der Stimme hervorgepresste Wort, genauer? Im Hebräischen bringt die Vokabel busah „sowohl das subjektive Empfinden eines Menschen wie seine objektive Lage in der Beziehung auf Gott wie in der Beziehung des Menschen zur Sprache“.
Die antike Scham in der philosophischen Umwelt des Alten und Neuen Testaments hat viele Gesichter. Im Griechischen gibt es zwei Begriffe für die Scham, die sich nur wenig unterscheiden: aischyne beschreibt präzise, wessen man sich schämt; aidos ist dagegen ein naturwüchsig angelegtes Gefühl für das, was man tut, was ehrenvoll und nicht schändlich ist. Als „internalisiertes Anstandsgefühl“, das durch die Erziehung ausgebildet wird, ist aidos „ein emotionaler Ausdruck der gesellschaftlichen Normen“ und garantiert „eine gewisse moralische Durchschnittlichkeit und Einheitlichkeit in einer Gemeinschaft“.
Aristoteles hat die Scham als „Widerfahrnis“ bestimmt und die „normative gesellschaftsbildende Funktion der aidos“ auf die Bedeutung einer „Furcht vor einer Rufminderung“ zugeschnitten. Daneben hat sich in der griechisch-römischen Antike immer das Wissen erhalten, dass die Scham in der Geschlechtlichkeit beheimatet ist, denn aidos meint auch Genitalien. „Die Genitalien als Symbol der Lebendigkeit sind etwas, das Scheu auslöst. Daraus entwickelt sich bei Männern und Frauen die aidos im Sinne eines unwillkürlichen Gewilltseins, seiner eigenen und der Geschlechtlichkeit der anderen mit ehrfürchtigem Feingefühl und dezenter Zurückhaltung zu begegnen.“
In der Bibel ist die Scham ein dezidiert religiöser Begriff. Einerseits, wie zu zeigen, kann Gott beschämen und dabei den Ruf einzelner Menschen mindern, andererseits kann Jesus Menschen von „falscher Scham“ entlasten. Und Paulus ruft wiederholt die Gläubigen dazu auf, man solle sich des Evangeliums von Jesus Christus, das die gesellschaftlichen Maßstäbe seiner Umwelt radikal infrage stellt, nicht schämen.
In einer vorgreifenden phänomenologischen Skizze lässt sich Scham so beschreiben: Scham ist immer sozial gefasst, gleichgültig, ob es als soziales oder religiöses Gefühl thematisiert wird. Es geht um Prozesse der Selbstachtung, die im Fall der Scham einen Verlust an Respekt, eine negative Beurteilung meiner selbst und damit eine persönliche und soziale Minderung nach sich ziehen. Das eigene Öffentlichkeitsbild wird beschädigt. Scham dokumentiert die Unstimmigkeit zwischen Eigen- und Fremdbewertung. Tritt die Scham ein, dann entflammt die sprichwörtliche Schamröte (Ps 69,7f.; 2.Thess 3,14), die Stimme versagt, man wird stumm (Ez 16,61), senkt den Blick, wird vielleicht nach der Schamröte bleich, möchte am liebsten im Boden versinken und unsichtbar werden („man schämt sich zu Tode“), um den Blicken und Kommentaren der anderen nicht länger ausgesetzt zu sein. Gesichtet heißt gerichtet sein. Plötzlich bin ich in radikaler Weise mit mir selbst konfrontiert, vollständig auf mich zurückgeworfen, fühle mich nackt, frage mich, wie es zu dieser Bloßstellung in den Augen der anderen kommen konnte. Die soziale und religiöse Kommunikation ist augenblicklich ruiniert. Als religiöser Kommunikationsbegriff dokumentiert die Scham die Störung im Verhältnis von Mitmensch und Gott.
Unterschieden vom Gefühl der Reue, die sich aktiv zu einzelnen Handlungsverfehlungen verhält (man zeigt Reue), widerfährt uns Menschen die Scham und bezieht sich auf die ganze Person. Mein Selbstverständnis ist vehement gestört. Die elementare Grundstruktur lautet: Ich schäme mich für etwas oder über etwas oder über eine Person vor Dritten, die mir wichtig sind; oder wie Bernard Williams sagt: In der Scham werde ich von falschen Leuten in einer unangenehmen Lage auf unangenehme Weise gesehen.
Hier liegt auch der Unterschied zum schlechten Gewissen. Das schlechte Gewissen orientiert sich nicht primär am Öffentlichkeitsbild. So kann ich ein schlechtes Gewissen haben, wenn ich zum wiederholten Mal vergessen habe, meiner Tochter Schulbrote einzupacken. Ich schäme mich aber erst, wenn die Mutter einer Freundin meiner Tochter mir süffisant mitteilt, sie gebe ihrer Tochter vorsorglich Brote für meine Tochter mit, weil ich offenbar keine Zeit dafür fände – ich erleide also eine Selbstbeschädigung, der eine bisher nicht öffentliche Schädigung von mir vorausgeht. Mit dieser „Schande“ muss ich, wenn ich mein Verhalten nicht ändere, künftig leben.
Positiv kann die Scham deshalb in dem Versuch münden, sich nachhaltig persönlich und sozial zu bessern – die Scham steuert also prospektiv unsere Handlungen. Die Erfahrung mit Situationen der Scham (ich schäme mich in der U-Bahn in der Anwesenheit meines Kindes, Übergriffe auf einen Ausländer nicht unterbunden zu haben) kann künftig helfen, durch vorweggenommene Scham – wenn ich mich also vor dem Eintreten der Scham durch eine Handlung schütze – das reale Eintreten der Scham zu verhindern. Weil sich Scham immer schlecht anfühlt, will ich künftig dieses Gefühl möglichst vermeiden.
Negativ kann die Scham dazu führen, die peinliche Situation dadurch zu lösen, dass man die Scham verschiebt und an anderen schuldig wird. Dann lenken wir die Aufmerksamkeit von uns weg auf andere. Mit Schuld scheint es sich oft besser zu leben als mit der Scham. Erstaunlicherweise scheint Scham stärker als Schuld zu sein, sie bedrängt mehr, man flieht lieber in die Schuld, als in der Scham zu bleiben, denn in der Schuld gewinnt der Schämende die aktive Rolle zurück. In der Scham leidet er passiv, die Schuld wirkt, obwohl sie Beziehungen zerstört, attraktiver, weil sie mit Souveränitätsgefühlen lockt. Die biblischen Texte zeigen, wie schnell das biblische Personal versucht ist, aufkommende Schamsituationen dadurch zu „meistern“, dass man sie in Schuld überführt. Das prominenteste Beispiel ist Kain, der seine Situation der Scham dadurch löst, dass er seinen Bruder Abel erschlägt. Oft wird, nach meiner Einschätzung zu Unrecht, der Weg von Scham zu Schuld als Aggressionsimpuls gewertet, als seien die durch die Scham evozierten Gefühle nicht zu beherrschen. Viele der biblischen Geschichten zeigen dagegen, dass die Protagonisten der Geschichten absichtsvoll in die Schuld wechseln, um Souveränität zurückzuerlangen, notwendig ist dieser Schritt oft nicht.
Ein falscher Umgang mit der Scham ist es auch, die in der Situation der Scham erfahrene Verstummung durch eine Kultur des Ausweichens und Verschweigens zu zementieren. Dann wächst sich die erlittene Selbstabwertung sehr schnell zu einem Trauma aus, wie der Psychiater Boris Cyrulnik gezeigt hat. Die Verschiebung von Scham in Schuld oder die betonierte schweigende Beschämung sind Holzwege im Umgang mit Scham.
Schämen kann ich mich für alles, mit dem ich mich verwandt fühle: Ich kann mich schämen für die Verbrechen einer Nation oder für die gewalttätigen Fans des Fußballclubs Ajax Amsterdam, in dessen Bettwäsche ich in der Frühpubertät schlief. Schämen kann ich mich für jede Handlung einer Person oder Gruppe oder einer Gemeinschaft, der ich mich zugehörig fühle und deren Gefühle ich teile, die andere Menschen demütigt und verletzt. Das heute oft in der Alltagssprache verwendete Wort fremdschämen bezieht sich auf diesen Sachverhalt: Wenn ich mich mit einer Gruppe, streng genommen der ganzen menschlichen Spezies, einer Sache, einem Wert identifiziere, kann mich die Scham auch stellvertretend ereilen. Darin spiegelt sich die Einstellung, dass jeder Mensch für sein Umfeld Verantwortung trägt. Der Umfang des Umfeldes ist dabei variabel: Ich schäme mich für die Dummheit eines Onkels (Familie), den hölzernen Stil der Fußballnationalmannschaft (Nation), Sexaffären eines amerikanischen Präsidenten oder eines französischen Politikers (Menschheit). Oft verschiebt sich hier die Scham hin zu Peinlichkeit: Man ist dann nur noch „peinlich berührt“, die Situation ist einem aber nicht mehr „entsetzlich peinlich“, man senkt noch den Blick, will aber nicht mehr vor Scham im Erdboden versinken.
Der Begriff der Scham erlaubt, ungenaue Begriffe wie Kollektivschuld oder Erbschuld zu präzisieren: Schuld ist an persönliche Handlungen gebunden und somit unvertretbar, aber ich kann mich für Taten von Personen, denen ich mich zugehörig fühle, über Generationen hinweg schämen und entsprechend meinen Teil dazu beitragen, dass künftig diese Situationen nicht wieder eintreten.
Eine Beschämung erfolgt schließlich, wenn durch Dritte (Gott, Propheten, Richter, Freunde) jene meiner Handlungen überhaupt erst offenbar werden, für die ich mich schämen sollte und die meine Ehre oder mein Ansehen beschädigen. In Amerika gibt es den medienwirksamen shame-walk, über den Verhaftete zur Vorführung bei Gericht in Handschellen gehen müssen, und englische Zeitungen veröffentlichen gerne auf der ersten Seite Bilder von Verhafteten, name and shame, wie die Briten, phonetisch nicht unbegabt, es nennen.
Ich möchte jene prägnanten biblischen Geschichten aufsuchen, die, zum Teil unterschwellig, unser Schamverhalten bis heute bildkräftig steuern. Ich lese die biblischen Geschichten, auch wenn nicht immer der Scham-Begriff ausdrücklich fällt, als biblische Kulturgeschichte der Scham. An diesen prallen Geschichten und dem Kranz der erzählerischen Deutungen kann man bis heute den Umgang mit der Scham üben. Es sind perfekt polierte Szenen, die uns erzählend ein Leben im Horizont der Scham vorspielen. Indem ich mich in die Geschichten einlogge, kann ich stellvertretend üben, wie Leben im Horizont der Scham gelingt.
Mit der ersten Geschichte, der Geschichte vom Sündenfall, artikulieren die biblischen Erzähler bereits ein formales, nur scheinbar primitives Gefühl von Scham, das in den weiteren Geschichten führend bleibt und inhaltlich gefüllt wird: Die Ur-Eltern schämen sich für ihre Nacktheit, weil sie sich plötzlich als von Gott und voneinander getrennt und geschlechtlich different erfahren. Ein Riss geht auch durch das Genus Mensch. Wie, so die alles entscheidende Frage, lässt sich dieser horizontale und vertikale Riss kitten? Wie gelingt eine reparierte Gemeinschaft? Wie finden Menschen, die nach biblischer Anthropologie als Bild Gottes (imago Dei) zur Gemeinschaft bestimmt sind, wieder zu personalen und verantwortlichen Beziehungen?
Und: Wie verhält sich die religiöse Urszene zu inhaltlichen Füllungen, die oft von Konventionen und gesellschaftlichen Arrangements gesteuert werden?
Schämen können wir uns zudem nicht nur für Handlungen, sondern auch für Nichtkorrigierbares wie körperliche Handicaps, ästhetische Mängel oder Krankheit, weil wir Angst haben, dass Dritte ein Handicap oder die Behinderung auf die gesamte Person übertragen. Wir können uns auch falsch schämen (vgl. bereits Sir 4,24f.; Sir 41,18–29; Sir 42,1–8), wenn inhaltliche Füllungen der Scham zu Unrecht bei uns Scham aufrufen, weil sie uns etwa einem unpersönlichen Maßstab von Normalität unterwerfen, der unser personales Sein gar nicht in den Blick bringt.
Ich schlage vor, den Schambegriff zunächst als formale Struktur zu beschreiben, darin vergleichbar dem kantischen kategorischen Imperativ, die inhaltlichen Füllungen der Scham müssen dann immer auf ihre zeitspezifischen und kontextspezifischen Eigenheiten hin befragt werden. Nur so wird die Frage zu klären sein, warum wir uns manchmal für Sachen schämen, obwohl wir eigentlich keinen Grund (mehr) dazu haben. Wie kommt es zu einem falschen Selbstverständnis in unserem Alltag, das wir oft mit vielen teilen?
Einen tastenden Umgang mit der Scham dokumentieren die biblischen Geschichten. Viele Mitglieder der buckligen Verwandtschaft scheitern, weil sie Schamsituationen durch Schuld lösen wollen. Jesus von Nazaret hat im Gegenzug die Kunst der Entschämung vorgeführt, wenn er die Menschen, mit denen er Umgang hatte, von „falscher Scham“, also von inhaltlichen Füllungen, die die Grundstruktur der Scham bis zur Unkenntlichkeit überlagern, befreit hat und den fatalen Zusammenhang von Scham und Schuld löste, indem er vor allem in den Gleichnissen die zentrale Erfahrung inszeniert, von bedingungsloser Liebe ergriffen zu sein. Das Widerfahrnis der Liebe korrigiert (immer wieder) das Widerfahrnis der Scham. Gelingendes Leben als glückliche Kommunikation zwischen Gott und den Mitmenschen gibt es nur im Spielraum dieser beiden Widerfahrnisse – in der Ergriffenheit durch Scham und der Ergriffenheit durch Liebe.
Dieser Essay bietet auch eine Fußnote zum Gigantenwettstreit zwischen Norbert Elias und Hans Peter Duerr im Diskurs über die Scham. Elias hatte in seinem Werk Über den Prozess der Zivilisation die These vertreten, der Prozess der Zivilisation bestehe in einer wachsenden Triebmodellierung und Affektkontrolle, der zivilisierte Mensch sei also im Unterschied zu den Primitiven und den Bauern im Mittelalter deutlich schamhafter – die Verringerung der Aggressivität gehe mit einer Erhöhung der Schamgrenzen einher. In fünf reich bebilderten Bänden hat Hans Peter Duerr mit einer überbordenden Materialfülle gegen den „Mythos vom Zivilisationsprozess“ zu zeigen versucht, dass die geschlechtliche Scham eine anthropologische Konstante darstelle. Von einem zivilisatorischen Reifeprozess könne keine Rede sein. Wirft man heute einen Blick auf die medialen Inszenierungen, in denen Menschen am frühen Nachmittag ihr Intimstes fröhlich preisgeben, muss man konstatieren, dass zumindest in manchen Erscheinungen des „Unterschichtenfernsehens“ (Harald Schmidt) Scham und der korrespondierende Begriff der Ehre beinahe nichts mehr bedeuten.
Deutlich Stellung bezieht der Essay zu der häufig zitierten Unterscheidung zwischen Schamkultur und Schuldkultur. Populär wurde diese Unterscheidung durch die amerikanische Anthropologin Ruth Benedict, die im Auftrag der amerikanischen Regierung eine Studie erstellte, um den amerikanischen Soldaten die Handlungsmuster ihrer japanischen Feinde zu erklären, die Höflichkeit und Mitleidlosigkeit vereinigten, weil sie die Nichterfüllung einer Verpflichtung als beschämend empfanden, notfalls die verlorene Ehre durch den Selbstmord retteten, nicht aber als moralisch verantwortliche Individuen agierten.
Erinnert hat man sich in diesem Kontext an die Forschungen von Sigmund Freud, der glaubte zeigen zu können, dass in der Ontogenese eines Individuums die Entwicklung des Schamgefühls deutlich vor der Entwicklung des Schuldgefühls einsetze. Hinterrücks übertragen auf die Phylogenese hat man in der ethnografischen Forschung lange damit geliebäugelt, etwa zwischen archaischer Schamkultur und klassischer Schuldkultur zu unterscheiden. Die Pointe ist eine andere: Der Essay zeigt, wie eine ausgebildete biblische Schamkultur in einem „vormoralischen“, oft schuldfreien Sinn ideale Gemeinschaftserfahrungen einüben kann. Allerdings retten sich die Protagonisten oft in die Schuld, um der Passivität der Schamsituation zu entkommen. Die Ausbildung einer Schamkultur ist auch, wie zu zeigen, für gegenwärtige Lebenswelten hoch attraktiv.
Schließlich: Vielleicht bietet der Schambegriff die Möglichkeit, Sachverhalte zu beschreiben, die traditionell unter dem Stichwort Sünde verhandelt wurden – ein Begriff, der bei heutigen Lesern eher Fluchtverhalten auslöst. Mit dem bekannten Gefühlsphänomen der Scham will ich den ausgemusterten Begriff neu anschaulich machen.
Dieser Essay nimmt die Konstruktivität der biblischen Erzählungen ernst. In den letzten Jahrzehnten hat die Wissenschaft zum Alten Testament sich zu der Einsicht durchgerungen, dass die biblischen Geschichten wahrscheinlich zu einem großen Teil erst während des babylonischen Exils (597/586–539v.Chr.) oder sogar deutlich nach dem babylonischen Exil geschrieben wurden oder zumindest ihre gültige Form erhielten. Damit stellt sich umso schärfer die Frage, warum die Erzähler einen so riesigen Kranz von kaputten Figuren geschaffen haben? Muss man nicht dahinter die Idee vermuten, den Autoren sei es darum gegangen, die Leser mit den Geschichten zu trösten und zu entängstigen, weil Gott offenbar nichts verloren gibt?
Ich lese also die biblischen Erzählungen als prägnante Geschichte der Schamkultur. Das ist selbstredend nur ein Ausschnitt. Alle bisher bekannten Kulturen aber kennen Schamgefühle, offenbar ist die Scham universal. Damit ist noch nicht vorschnell einer „Natur“ der Scham das Wort geredet. Der Traumaforscher Boris Cyrulnik hat darauf hingewiesen, dass man im Unterschied zu Wut und Euphorie die Scham nicht durch eine chemische Substanz auslösen kann. Scham ist, wie auch die Liebe, ein eminent kulturelles Gefühl.





























