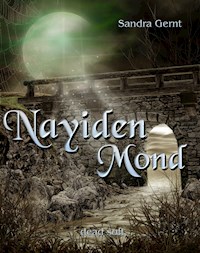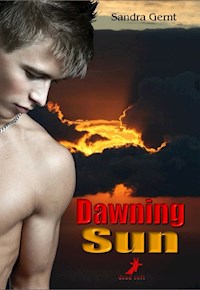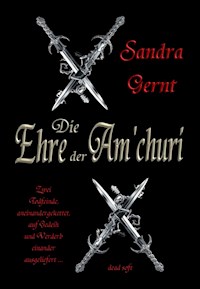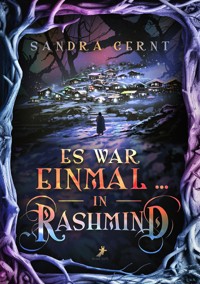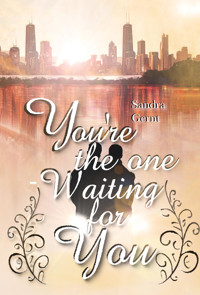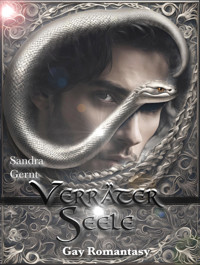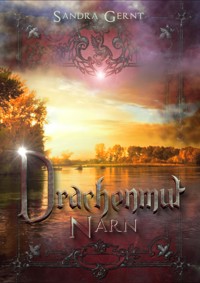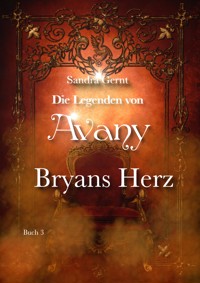7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
„Ziehe aus und kehre siegreich zurück!“ Eygard! Die große Festung schützt Ittaras Grenzen. Sollte sie fallen, geht das Königreich gemäß einer Prophezeiung unter, verloren im Krieg, der seit Jahren gegen die Thalvarer geführt wird. Um dies zu verhindern, zieht der Seelenheiler Lián von einer Vision zur nächsten, auf der Suche nach allem, was Eygards Mauern schützen könnte. Diese Suche führt ihn in das Dorf Varl, wo ein junger Krieger um sein Leben ringt. Die Zeit drängt, denn bald wird sich die Prophezeiung erfüllen. Was Lián nicht weiß: Andere Völker erheben sich, insbesondere die dreizehn Stämme Ebons, mit ganz eigenen Interessen, Intrigen und Absichten. Denn Eygards Mauern schützen insgeheim die Quelle der Magie. Um Zugriff zu erhalten, müssen Eygards Mauern fallen … Ca. 171.000 Wörter Im gewöhnlichen Taschenbuchformat hätte dieses Buch ungefähr 850 Seiten
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
„Ziehe aus und kehre siegreich zurück!“
Eygard!
Die große Festung schützt Ittaras Grenzen. Sollte sie fallen, geht das Königreich gemäß einer Prophezeiung unter, verloren im Krieg, der seit Jahren gegen die Thalvarer geführt wird.
Um dies zu verhindern, zieht der Seelenheiler Lián von einer Vision zur nächsten, auf der Suche nach allem, was Eygards Mauern schützen könnte. Diese Suche führt ihn in das Dorf Varl, wo ein junger Krieger um sein Leben ringt. Die Zeit drängt, denn bald wird sich die Prophezeiung erfüllen.
Was Lián nicht weiß: Andere Völker erheben sich, insbesondere die dreizehn Stämme Ebons, mit ganz eigenen Interessen, Intrigen und Absichten. Denn Eygards Mauern schützen insgeheim die Quelle der Magie. Um Zugriff zu erhalten, müssen Eygards Mauern fallen …
Ca. 171.000 Wörter
Im gewöhnlichen Taschenbuchformat hätte dieses Buch ungefähr 850 Seiten
von
Sandra Gernt
Wenn am Morgen des 7. Jahrestages seit Kriegsbeginn das große Horn der Thalvarer zum Sturm bläst, werden Eygards Mauern fallen. Ist die Festung dann erst einmal verloren, geht auch Ittara unter, und Dunkelheit, Tod und Stille überziehen alles Land mit einem Leichentuch. Wenn Eygards Mauern fallen, ist jede Hoffnung verloren.
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Epilog
Ein Jahr voller Fantasy …
„Es gilt das Neue zu feiern, nicht zu fürchten. Es bringt nicht den Tod für das Alte, sondern garantiert dessen Fortbestand.“
Zitat von Juvria vom Taru-Stamm, Priesterin der Karmu
ald ist es geschafft, Marna.“
Erschöpft von den anhaltenden Wehen blickte Astida zu ihrer Sklavin hoch. Es war wohl das erste Mal überhaupt, dass diese stolze Frau sie mit dem Ehrentitel Marna ansprach. Er gebührte einer Sippenführerin, der Herrin eines der dreizehn Stämme. Ihre Sklavin stammte aus den Niederungen, erkennbar an der dunkelbraunen Haut und den Tätowierungen, die sich wie blaue Blütenranken über Gesicht, Hals und Hände schlängelten.
„Wie ist dein Name?“, stieß Astida atemlos hervor. Sie hatte es noch nie wissen wollen, es war ihr gleichgültig gewesen. Jetzt, da sie mit ihrer Sklavin allein in dieser furchtbarsten Stunde ihres Lebens war … Das glühende Ziehen baute sich erneut auf, zog über Bauch, Rücken und Hüften, als wollte es sie zerbrechen und in Stücke schneiden, zerrte ihr Bewusstsein in dunkle Tiefen, beherrschte ihren Leib für eine nicht enden wollende Ewigkeit. Als würde eine Faust ohne Gnade an Ketten reißen, um die Kinder in ihr mit Gewalt ins Licht der Welt zu bringen. Astida brüllte vor Pein, nicht länger fähig, sich zurückzuhalten. Zu Beginn der Wehen hatte sie noch gelächelt und gesagt, dass sie dies mit Leichtigkeit ertragen und ihre Kinder stumm wie eine Katze bekommen würde. Was für eine Närrin sie doch war! Da hatte sie tatsächlich dem Gestammel der Karmu-Priesterin geglaubt, die ihr einreden wollte, eine Geburt sei eine feierliche, würdevolle Angelegenheit, bei der jede Frau der Göttin nah käme. Stattdessen war da nichts als Schmerz, dazu Schweiß, Tränen, Blut und noch niedrigere Körperflüssigkeiten, die aus ihr herausströmten.
„Mein Name ist Rán, Marna“, erwiderte die Sklavin. Vollkommen ruhig und gelassen blieb sie, ließ sich vom Leid ihrer Herrin nicht berühren. Sie tupfte ihr die Stirn mit einem kühlenden Tuch ab und kniete dann hinter Astida im großen Bett. Kostbare Hölzer, Gold, Edelsteine, wertvolle Stoffe. Von allem das Beste. Was Astidas Herz normalerweise mit Genugtuung und Freude erfüllte, konnte ihr im Augenblick kaum gleichgültiger sein. Sie würde auch im Schlamm vor dem Schweinestall liegen, solange diese Qual endlich vorbeiging, die ihren Körper in Stücke riss.
„Wo bleiben die anderen Frauen?“, fragte sie, nach Atem ringend, kaum noch in der Lage, die Lider offenzuhalten. „Wo sind meine Freundinnen, die Dienerinnen? Wo sind sie alle hin?“ Schon dreimal hatte sie ihre Sklavin angefleht, nach ihnen zu suchen und jedes Mal war sie allein zurückgekehrt. Warum hörte niemand ihr Schreien?
„Ich habe sie fortgeschickt, Marna.“ Rán bedachte sie mit einem schmalen Lächeln, das kaum ihre Mundwinkel hob und ihre plötzlich so kalten schwarzen Augen nicht erreichte. „Mitsamt dieser jammernden Priesterin, der Heilfrau und dem ganzen Pack. Ich habe ihnen gesagt, dass es falscher Alarm war und die fürstlichen Kinder sich noch ein wenig mehr Zeit lassen.“
Astida spürte die Angst nur aus weiter Ferne. Die nächste Wehe hatte sie fest im Griff und ließ sie schreien wie ein aufgespießtes Schwein. Würde. Es gab keine Würde, nur jämmerliche Schmerzen, die zu groß für eine einzige Frau waren.
„Warum … warum …?“, stieß sie weinend hervor, den Kopf hin und her werfend. War es ein Fehler gewesen, ihren Gatten um eine Sklavin aus den Niederungen zu bitten? Er hatte ihr diesen Wunsch gerne erfüllt und eine Frau gefangen genommen und versklavt, die in etwa genauso alt wie Astida war – Anfang zwanzig, eher ein, zwei Sonnenläufe weniger. Astidas Freundinnen hatten sie beneidet, wie gewünscht, doch einige hatten sie auch gewarnt. Es war klüger, sich seine Sklaven als Kinder zu holen, nur dann konnte man sich ihrer Treue wirklich sicher sein.
„Warum? Ach Marna …“ Rán tätschelte ihr das schweißgetränkte goldblonde Haar. Astidas größter Schmuck. Ihr Gefährte war ihr sofort verfallen gewesen, denn diese Farbe fand man selten in der Ostmark. „Du gehörst mir!“, raunte ihre Sklavin ihr mit einer Zärtlichkeit ins Ohr, die Astida erschaudern ließ. „Du wolltest eine Frau, die von den Ynsh abstammt, du hast sie bekommen. Ich habe vor dir gekniet, die Schläge ertragen, die Demütigungen, die Einsamkeit. Nun gehörst du mir. Wir sind allein.“
„Bitte …“ Astida wimmerte und begann übergangslos zu kreischen, als die nächste Wehe gemeinsam mit Panik über sie hinwegrollte. Egal wie laut sie schrie, niemand würde sie hören. Die Wände, die Tür, sie waren zu dick. Ein Fenster besaß ihr Schlafgemach nicht. Die Winter in Ebon waren hart und lang, die Angriffe verfeindeter Stämme ebenfalls. Schutz war wichtiger als Licht.
„Bitte!“, brachte sie schluchzend hervor, als der vernichtende Schmerz abklang. Rán schlang die schmalen Arme um Astidas Oberkörper und streichelte ihr sanft über das verweinte Gesicht.
„Fürchte dich nicht“, sagte sie und gab Astida einen Kuss auf die Schläfe. „Du wirst diese Nacht überleben, was nicht geschehen würde, hättest du mich nicht versklavt. Ausschließlich deshalb habe ich es zugelassen. Es sind drei Kinder, die unter deinem Herzen liegen, nicht nur zwei, wie die dumme Heilfrau behauptete. Meine Macht wird sie gesund und stark aus deinem Leib bringen und dafür sorgen, dass du zwei von ihnen eine Mutter sein darfst.“
„Zwei? Es ist mehr als zwei? Sind es etwa …“ Astida verkrampfte sich, krümmte sich in Ráns Armen, zu schwach, um noch schreien zu können. Das Winseln klang wie von einem sterbenden Tier.
„Ja, Marna. Drei Söhne sind es. Alle drei wären mit dir gestorben, hätte das Schicksal seinen ungehinderten Lauf. Deine Eitelkeit, deine Selbstsucht hat mich an deine Seite gebracht. Du weißt, keine Frau vom Volk der Ynsh würde dem ungeborenen Leben Schaden zufügen.“
Genau aus diesem Grund hatte Astida nach einer Sklavin aus den Niederungen verlangt. Die Ynsh, wie sich diese kleinwüchsigen, schmalgliedrigen Wilden nannten, die nicht zu den dreizehn Stämmen des Reiches gehörten … Sie verfügten über seltsame magische Kräfte. Als absolut friedfertig galten sie, großartige Heiler und die besten Wehenfrauen, die man sich wünschen konnte. Sobald die Heilerin Astida verkündete, dass sie mit Zwillingen schwanger war, hatte sie ihrem Gemahl in den Ohren gelegen, ihr eine dieser Frauen zu besorgen.
„Lügst du auch nicht? Ich bin ohne dich dem Tod geweiht?“, wisperte sie stöhnend. Es fühlte sich zweifellos danach an. Die Schmerzen waren mehr, als ein lebendes Wesen ohne Verlust des Verstandes ertragen sollte.
„Das erste Kind, es liegt quer in deinem Bauch und es gibt nicht genug Platz, um es zu drehen“, entgegnete Rán.
Astida begann erneut zu schluchzen. In ihrem Stamm gab es gleich mehrere machtvolle Kampfmagier, die die Elemente Wind und Feuer beherrschten. Doch niemand war da, der Erde oder Wasser zugeordnet wurde und damit Heilung schenken konnte. Sie war tatsächlich zum Tod verdammt und ihre Kinder möglicherweise mit ihr. Lediglich ihre Sklavin konnte sie retten. Nun bereute sie jedes harsche Wort, jeden Stockhieb, mit dem sie diese Frau bedacht hatte. All die Verachtung, weil ihre Sklavin anscheinend langsam und faul und widerspenstig war. Sich weigerte, ihr Respekt zu zollen und Astida damit vor ihren adligen Begleiterinnen blamiert hatte.
„Ich gebe dir, was immer du willst, aber rette meine Kinder!“, brachte sie matt über die Lippen. Die nächste Wehe. Und direkt noch eine!
„Es gibt bloß eines, was ich von dir begehre, Marna“, sagte Rán und wiegte sie sanft in den Armen, bis die zerreißende, brennende Qual überstanden war.
„Sag es. Sag es!“
„Freiheit. Ich verlange die Nachgeburt deines dritten Sohnes. Dessen Blut wird mir die Kraft geben, zu meinem Volk zurückzukehren. Überzeuge deinen Gemahl, dass er mir nicht zu folgen hat. Bitte ihn, niemals wieder in die Niederungen einzudringen, um einen von meinem Volk zu entführen. Er ist dir und deiner Schönheit verfallen und als Mutter seiner Kinder wird er dich verehren. Er wird es tun, um dich glücklich zu stimmen. Also schwöre es, und ich rette dich.“ Die schwarzen Augen loderten in einem Feuer, wie Astida es noch nicht gesehen hatte. Nicht vor Zorn, nicht im Hass. Es war die Ahnung einer Magie, die für Astida unbegreiflich war. Eine Macht, die die ihre weit überstieg. Kaum mehr als ein wenig Windmagie, über mehr verfügte sie nicht. Ihr Gemahl hatte sie aus anderen Gründen als ihre Macht gewählt …
„Du hast mein Wort“, versicherte sie winselnd.
„Vergiss es nicht.“ Rán hielt mit einem Mal ein winziges Messer in der Hand. Astida blieb keine Zeit, sich zu fürchten: Während die nächste Wehe ihr Atem und Lebenskraft raubte, ritzte die Klinge ihren aufgequollenen Bauch. Nicht tief, gerade weit genug, um die Haut zu durchdringen und Blut fließen zu lassen. Ein rankenförmiges Mal war es, das ihren Nabel umspielte und den Mustern glich, mit denen Rán und ihr Volk sich zu schmücken pflegte. Astida spürte die Schnitte nicht einmal, zu stark war der Schmerz der Wehen. Es würde sicherlich Narben hinterlassen, doch das war gleichgültig. Als Mutter dreier Söhne könnten ihr sogar Haare und Zähne ausfallen und dennoch wäre sie unangreifbar.
„Nmauruuru tsha kan yv!“, flüsterte Rán in der rauen Sprache ihres Volkes. Sie legte beide Hände auf Astidas gewölbten Leib. Die Wärme ihrer zarten Finger drang wohltuend durch. Die Schmerzen ebbten ab, wurden erträglicher … Bis sie gänzlich verschwunden waren. Astida konnte endlich Atem schöpfen und langsam zur Ruhe kommen. Ihre Augen brannten von den vielen Tränen, ihre Kehle war rau. Sie litt an Durst und Erschöpfung und seufzte erleichtert, als ihr etwas Wasser eingeflößt wurde.
„So ist es besser, hm?“, fragte Rán lächelnd. „Niemals hätten die Weiber solche wunderschöne Magie gestattet. Diese lächerlichen Frauen, die an deinem Rockzipfel hängen und beklatschen, was immer du von dir gibst. Eine jede von ihnen war überglücklich, dass sie die Nacht im eigenen Bett verbringen darf, statt um dich herumzuspringen, dir Luft zuzufächeln und bei jedem noch so kleinen Stöhnen wie eine Taube gurren zu müssen. Nicht einmal die Heilerin hat an meinem Wort gezweifelt oder auf eine eigene Untersuchung bestanden. Was sagt dir das, Astida, Herrin über die Ostmark von Ebon? Sind sie geflohen, weil das Wort einer Sklavin mehr zählt als das, was die eigenen Augen und Ohren verraten? Oder weil sie dankbar waren, eine Entschuldigung zu haben, nicht in deiner Nähe weilen zu müssen?“
„Sie sind meine Freundinnen!“, protestierte Astida schwach.
„Nein. Sie sind Speichellecker. Als du noch eine einfache Bauerstochter warst und deine Tage mit mühsamer Plackerei, Schafhüten und Mistschaufeln zugebracht hast, da hätte keine Einzige von ihnen dir auch nur einen Morgengruß entboten. Kaum hat der Parn der Ostmark dich zum Eheweib genommen, dir kostbare Stoffe und kaltes Gold um den Leib gelegt, schon küssen sie deine Füße und preisen jeden Schritt, den du zu tun gedenkst. Vergiss das niemals wieder. Wenn du als Marna überleben willst, erhebe dich nicht über diejenigen, die scheinbar schwach sind, und stütze dich niemals ausschließlich auf die Schultern derer, die behaupten stark zu sein. Sie verlassen dich bei erster Gelegenheit und lassen dich bedenkenlos abstürzen.“ Rán löste ihre Hände von Astidas Bauch und schenkte ihr das erste echte Lächeln seit der Stunde, in der sie sich zum ersten Mal begegnet waren. „Genug geplaudert. Es wird Zeit, deine Söhne zu bergen.“ Sie raunte einige weitere Worte in ihrer eigenen Sprache. Astida keuchte vor Schreck und Überraschung, als Ráns Hände durchscheinend wie Nebelschleier wurden. Solche Macht war selten!
Diese Tatsache versank zur Nebensächlichkeit, als die Nebelhände in Astidas Bauch verschwanden. Es schmerzte nicht, sie spürte nichts als ein leichtes Prickeln, wie bei einem Gewitter, kurz bevor der Blitz einschlug. Da war nicht einmal Druck, gar nichts.
Rán zog die Arme zurück, die bis zu den Ellenbogen in Astidas Leib eingedrungen waren – und brachte ein Kind einschließlich der Nachgeburt mit sich. Der kleine Junge lag für drei Herzschläge vollkommen still, ebenso durchscheinend wie die Arme der Ynshfrau. Dann nahm er Gestalt an, begann sich zu regen, tat seinen ersten Atemzug und schrie auf.
„Dein Sohn ist geboren, Marna“, sagte Rán sanft. In vollkommener Ruhe versorgte sie das Kind, nabelte es ab, wusch es, hüllte es in ein weiches Tuch. Zuletzt schlang sie ein purpurrotes Band um sein rechtes Handgelenk. Das Zeichen, dass er der erstgeborene Sohn war, dazu bestimmt, einst der neue Parn zu werden, wenn sein Vater starb oder von seiner Würde zurücktreten sollte. Sie legte ihn in Astidas Arme, die ehrfürchtig still blieb, das neue Leben bestaunte, das sie viele Monde lang in sich getragen hatte. Die überwältigende Liebe, von der die Karmu-Priesterin geredet hatte, sie wollte sich nicht wie von Zauberhand einstellen. Bislang überwogen Verblüffung und Erschöpfung. Wie klein ihr Sohn war! Kleiner als sonst bei Neugeborenen üblich, da die Wehen verfrüht eingesetzt hatten. Ihm schien nichts zu fehlen, er war rosig und bewegte sich erstaunlich kraftvoll für solch eine Handvoll neues Leben. Mehr aus den Augenwinkeln bemerkte sie, wie Rán die Nachgeburt in eine dafür bereitgestellte Schale legte.
„Hat jedes Kind eine eigene?“, fragte sie neugierig. Was war es schön, keinerlei Schmerzen mehr leiden zu müssen! Sie konnte entspannt und unbeteiligt zuschauen, als wäre dies eine Aufführung von Schaustellern.
„Das ist nicht immer so bei Mehrlingen. In diesem Fall ja, was gut ist. Sie hätten sonst nicht zu dritt in dir überlebt. Sollen wir den Nächsten holen?“ Ohne auf Astidas Antwort zu warten, griff Rán erneut zu. Diesmal hatte Astida keine Angst mehr. Gelassen wartete sie, bis ihr der zweite Sohn in die Arme gelegt wurde. Genauso winzig und vollkommen wie sein Bruder war er und schrie, oder vielmehr quäkte wie ein Mäuschen. Er trug das blaue Band des Zweitgeborenen. Während der erste Sohn auf die Würde des Parn vorbereitet wurde, um mit offizieller Politik, Klugheit und Verhandlungsgeschick seinen Stamm zu führen, wurde der zweite zum Berater. Er lenkte die Geschicke aus dem Zwielicht, achtete darauf, dass sein Bruder nicht vom Weg abkam und teilte mit ihm Macht und Verantwortung. Der Drittgeborene hingegen wurde noch am Tag seiner Geburt von der Mutter getrennt, damit er zur Schattenhand heranwachsen konnte. Spione waren sie. Attentäter. Schattenhände bekämpften Gefahren für ihren Stamm mit allen Mitteln, sammelten Wissen über Verbündete und Feinde und taten auch sonst das, wozu sie vom Stamm angehalten wurden. Sie lebten im Verborgenen, erhielten keinerlei Schutz oder Rückhalt und mussten sich den Lebensunterhalt mit der Erfüllung von Aufträgen verdienen. Aus Sorge, dass diese Attentäter bessere Entlohnung auf der falschen Seite verlangen könnten, wurden sie zum einen stets sehr gut bezahlt und zum anderen von Kindesbeinen an zu strikter Loyalität erzogen.
Alle nachgeborenen Söhne des Parn wurden nach Geburtsreihenfolge zu Stellvertretern ihrer älteren Brüder ausgebildet. Ein Parn galt als glücklicher Mann, wenn er neun Söhne besaß, die die Kontinuität seiner Herrschaft garantieren konnten, und mindestens zwölf Töchter. Die wurden nach Möglichkeit mit Söhnen der anderen Stämme verheiratet und sollten damit den Frieden des Reiches erhalten. Für diese hohe Anzahl an Nachkommen war es üblich, bis zu drei Hauptfrauen und eine beliebige Anzahl an Nebenfrauen zu besitzen. Jedes Kind war gleichwertig, gleichgültig von welcher Mutter es geboren wurde.
Astida war die Erstfrau ihres Gatten, der wie sie noch sehr jung war. Dass sie ihm gleich drei Söhne zugleich schenken konnte, würde ihr ein sorgloses Leben in hoher Achtung garantieren. Als Marna besaß sie viel Macht und nahm Einfluss auf die Geschicke des Stammes. Neugierig musterte sie den letzten der kleinen Jungen, den Rán ihr übergab. Er trug das schwarze Band, das ihn als Schattenhand kennzeichnete. Ihn würde sie nicht an ihrer Brust stillen, so wie seine Brüder. Doch ein einziges Mal wollte sie ihn halten, bevor er ihr weggenommen werden würde. Sie würde ihm seinen Namen schenken. Mehr konnte sie ihm nicht geben, abgesehen von seinem Leben.
Es war grausam. Es war Gesetz.
Traurig hob sie den winzigen Säugling hoch, nachdem sie seine Brüder für diese Tat auf die Matratze abgelegt hatte, ohne sich um ihr Quengeln zu kümmern. Die beiden würden viele Sonnenläufe lang Liebe und Fürsorge erfahren. Auf diesen kleinen Jungen hingegen wartete sehr viel Schmerz und ein hartes Leben.
„Sei gegrüßt, mein Sohn“, sagte sie zärtlich und küsste ihn. „Was bin ich froh, dass ich wenigstens deine Brüder behalten darf …“ Die Tränen, die plötzlich zu fließen begannen, überraschten sie. Astida drückte den Kleinen an ihr Herz. „Ich wünsche dir, dass du ein hohes Alter erreichst und so viel Glück, wie die Götter einer Schattenhand zugestehen. Dein Name soll Llan lauten.“
Llan musterte sie intensiv. Seine grünen Augen wirkten seltsam klar dafür, dass er erst vor wenigen Minuten geboren worden war. Ein Schauder rann über Astidas Körper. Offenbar war die Magie in diesem Kind sehr stark. Ein rotes Mal an seinem Kopf fing ihre Aufmerksamkeit. Eine Druckstelle an der linken Schädelseite.
„War er wirklich der Dritte?“, fragte sie scharf. „Oder hätte er der Erste sein sollen, der quer in mir gelegen hat?“
„Dies, verehrte Marna, bleibt mein Geheimnis“, erwiderte Rán mit einem hintergründigen Lächeln. Sie hielt die Nachgeburten in den Händen. Ein seltsamer, leicht übelkeitserregender Anblick. Noch während Astida sie anstarrte, verschwanden die blutigen Klumpen im Nichts. Rán hob die Arme, über die Blut strömte. Sie waren nicht länger durchscheinend.
„Leb wohl, Astida. Ich trage dir nichts nach, denn letztendlich habe ich an Macht gewonnen, dafür, dass ich fast fünf Monde lang deine Grausamkeit ertragen musste. Wir werden uns vielleicht eines Tages wiedersehen, so die Götter es wollen.“ Sie sprang auf und drehte sich, so abrupt, dass sich ihr graues Sklavengewand aufbauschte. Es begann sich schwarz zu färben, genau wie die blauen Tätowierungen auf Ráns Körper.
Astida schrie vor Erstaunen und Schreck. Instinktiv beugte sie sich über ihre drei Söhne. Aber Rán griff nicht an. Stattdessen verwandelte sie sich in einen Vogel, mit schwarzen Federn und schwarzem Schnabel und beachtlichen Flügeln, die den gesamten Raum einzunehmen schienen. Der Vogel kreischte grell, flog flatternd auf – und glitt wie ein Geisterhauch durch die Mauern. Welch eine Magie!
„Ihr Götter, behütet mich und meine Söhne!“, stammelte Astida verängstigt.
Sie dachte träge darüber nach, sich zu erheben und nach ihren Dienern zu rufen. Stattdessen bettete sie sich auf den Kissen zurecht und bewachte den Schlaf ihrer Kinder. Der nächste Morgen würde viel zu früh einkehren. Ein Morgen, an dem sie einen ihrer Söhne verlieren würde.
Eine Schattenhand.
„Seelen sind zu den erstaunlichsten Dingen fähig. Sie gründen im Gestern, erahnen das Morgen, durchwandern die Welt im Heute. Häufig erkranken sie an den Dingen, die damals geschahen, manchmal weil sie fürchten, was die Zukunft bringt. Das erstaunlichste ist wohl, dass wir wissen, wie eine Seele geheilt wird, ohne wirklich zu begreifen, was sie eigentlich ist. Ein Geschenk der Götter? Die gebündelte Lebenskraft eines Menschen? Ein magischer Funken? Oder doch bloß ein Traum?“
Zitat von Nishaira, Seelenheilerin aus Ittara
ein Kopf schmerzte. Der Mund war wie ausgedörrt und ihm war kalt, so bitterlich kalt …
Sie waren eng zusammen, dicht an dicht gedrängt. Der Donnervogel hielt sie alle in seinen Klauen. Beinahe achtzig Menschen. Es war viel,die Kreatur war erschöpft.Zu viel? Sie mussten doch entkommen … Er starrte in die hellbraunen Augen des Mannes mit den leicht gewellten, dunkelblonden Haaren direkt vor ihm. Ein markant geschnittenes Gesicht. Kurz gehaltener Vollbart. Vertraut war er ihm. Vertraut, als hätten sie ein ganzes Zeitalter Seite an Seite verbracht. Viel mehr als die sechsundzwanzig Winter, die Joryn erleben durfte. Vertraut, als wären ihre Seelen zu einer einzigen verschmolzen. Dennoch sah Joryn ihn gerade zum ersten Mal, soweit er wusste. Er müsste bloß die Hand ausstrecken, um ihn zu berühren. Um alles neu zu erfahren, das er längst wusste. Um ihm nah zu sein.
In diesem Moment geschah es.
Der Donnervogel schrie schrill auf, laut genug, dass sie alle zusammenbrachen. Dann begann er zu trudeln, der Erde entgegen, die eine Meile unter ihnen lag. Diesen Absturz würde keiner von ihnen überleben. Nicht aus dieser Höhe. Nicht einmal der Donnervogel selbst, obwohl er so riesig war, so unbesiegbar erschien.
Nur die Götter waren unbesiegbar. Alles, was lebte, konnte vernichtet werden.
Der Fremde streckte die Arme nach ihm aus. Joryn wollte sich an ihn klammern, während er um sein Leben schrie. Er wollte …
Joryn versuchte die Lider zu öffnen, doch diese klebten hartnäckig fest, widerstanden seinen kläglichen Bemühungen. Entsetzlich elend fühlte er sich, schwach, von Schmerzen gequält, die sich bis in seine Knochen hineingefressen hatten. Konnte Erschöpfung eigene Gestalt annehmen? Mehr Gewicht besitzen als ein Felsbrocken, mächtig genug sein, um ihr Opfer zu zerquetschen? Warum wurde er nicht wach? Und was war das für ein absonderlicher, merkwürdig lebhafter Traum gewesen?
„Er scheint munter zu werden.“
Das war die Stimme von Askala, der Heilerin seines Dorfes. Er spürte mehr, als das er hörte, wie die uralte, gebeugte Frau durch seine Kammer humpelte und sich neben ihm niederließ.
„Joryn, mein Junge. Hast du also tatsächlich die Nacht überlebt. Da draußen sind einige Leute, die bereits die Totenstatuen aus den Regalen klauben.“ Sie wischte ihm mit einem feuchten, kühlen Tuch über das Gesicht. Es schmerzte, jede Berührung tat weh. Dennoch fühlte es sich gut an, darum wandte er den Kopf in ihre Richtung und seufzte zugleich unwillig. Alles tat weh, alles war unangenehm. Sein Körper war für den Augenblick kein guter Ort, um darin zu wohnen, so viel war gewiss.
„Sinkt das Fieber?“, fragte Ingmar, Joryns Bruder. „Oder wird er uns noch mehr Geschichten aus der Anderswelt erzählen, von Riesenvögeln, die mit dutzenden Menschen in ihrem Bauch vom Himmel stürzen? Von Reisen in seltsame ferne Länder und Fremden, die ihm vertrauter als seine eigene Familie sind?“
„Ich kann weder das eine noch das andere garantieren. Aber diese Geschichten müssen dich nicht in Sorge versetzen, Ingmar, das sagte ich doch letzte Nacht bereits. Die Seele wandert gerne, besonders dann, wenn das Fieber steigt und der Körper all seine Kraft benötigt, um gegen die Erkrankung zu kämpfen. Joryn wird sich an diese Seelenwanderung kaum oder gar nicht erinnern und auch keinen Schaden davontragen. Gleichgültig was die Leichtgläubigen behaupten, es gibt keine bösen Geister, die seine Seele stehlen wollen.“
Askala klang müde. Vermutlich hatte sie die gesamte Nacht an seiner Seite gewacht, was sie sich in ihrem hohen Alter eigentlich nicht mehr zumuten sollte. Zumal ihre älteste Tochter und ihre Enkelin ebenfalls ausgebildete und sehr fähige Heilerinnen waren. Dennoch ließ sie es sich nie nehmen, bei den schwersten Fällen selbst zu wachen. Legendär war, wie sie einst bei Barlan, dem Dorfvorsteher, sieben Tage und Nächte ausgeharrt hatte und sich kaum mehr als eine Handvoll Stunden Schlaf zwischendurch zugestand. Er hatte eine Pilzvergiftung erlitten, die ihn beinahe getötet hätte. Erst hatte er über Sehstörungen geklagt, dann erbrochen. Zu dem Zeitpunkt hatten alle noch gelacht, denn sie dachten, er hätte zu sehr dem Met zugesprochen, der zur Feier der erfolgreichen Obsternte ausgeschenkt worden war. Als er jedoch keine Luft mehr bekam, die Besinnung verlor, zitterte wie ein Fieberkranker und sein Herzschlag kaum noch spürbar war, da wurde klar, was geschehen sein musste. Zum Glück hatte er wohl den einzigen Pilz erwischt, der das Gift in sich trug, denn seine gesamte Familie hatte von der frisch gesammelten Korbfüllung mitgegessen. Askala hatte ihm ein aufgelöstes Pulver eingeflößt, in dem sich unter anderem auch Tollkirsche befunden hatte, wie sie auf Nachfrage freimütig erzählte. Dennoch dauerte der Kampf lange …
Joryn grübelte. Hatte er auch etwas Seltsames gegessen? Er konnte sich nicht erinnern, wie er krank geworden war. Wenigstens versickerte allmählich die Erinnerung an diesen Traum. Er war so lebhaft gewesen, hatte sich unglaublich echt angefühlt. Anscheinend war seine Seele tatsächlich auf Wanderschaft gegangen, wie Askala sagte, damit sein Körper die notwendige Ruhe bekam, um heilen zu können.
Seine strohgefüllte Matratze bewegte sich. Joryn blinzelte und erblickte kurz das sorgenverzerrte Gesicht seines Bruders im flackernden Schein einer Laterne.
„Du hast lang genug geschlafen, Kleiner“, sagte er mit gespielter Strenge, die seine tiefe Angst um ihn nicht überdecken konnte. „Willst du nicht mal langsam munter werden?“
Eigentlich dachte er eher darüber nach, zurück ins Reich der Träume zu fliehen. Dorthin, wo weder Kälte noch die knochenzermalmenden Schmerzen im gesamten Leib ihm etwas anhaben konnten.
„Was … Was ist …?“, murmelte er mühsam. Die Worte wollten nicht gehorchen, seine Zunge schien ihm fremd.
„Ein Giftpfeil hat dich getroffen. Du hattest Wachdienst auf der Festung. Als wir dich fanden, dachten wir schon, du wärst bereits in Farjas Arme heimgekehrt. Es steckte aber noch ein wenig Leben in dir und Askala versucht seither alles, um dich durchzuhätscheln.“
Der Pfeil. Gewiss, er hatte ihn an der linken Schulter erwischt. Er erinnerte sich an den Zorn, der in diesem Moment sein Bewusstsein beherrscht hatte. Die Wut und der Hass auf die Feinde. Dann war jegliches Gefühl aus seinem Arm verschwunden, eisige Kälte hatte sich in seinen Adern ausgebreitet und er hatte den Pfeil herausgerissen. Vielleicht hatte ihn das vor dem Tod bewahrt?
„Nun rück beiseite, du großer Ochse“, knurrte Askala. „Er braucht Wasser, solange er wach genug ist, um es trinken zu können. Das Fieber dörrt ihn aus.“
Joryn keuchte gequält, als sie ihn hochstützte und ihm Wasser aufzwang. Es war kälter als Eis, jeder Schluck fühlte sich an, als würden tausende Nadeln sein Inneres durchlöchern. Dennoch schluckte er, denn sie ließ ihm keine andere Wahl. Danach ließ er sich dankbar zurück auf sein Kissen betten, froh, endlich wieder seine Ruhe zu haben.
„Schlaf, Kleiner“, sagte Ingmar und fuhr ihm durch die dunklen, rotbraunen Locken, die verschwitzt auf Joryns Haut klebten. „Werde gesund und heil, das ist das Wichtigste.“
Es hämmerte an der Tür.
„Ingmar! Du musst kommen, Angriff auf die Festung!“
„Bin schon unterwegs. Eygards Mauern dürfen nicht fallen!“
Der erste Schlachtruf aller Bewohner des Großreiches Ittara. Sechs Jahre dauerte die Belagerung durch die Thalvaren bereits an. Bis heute konnte die Festung Eygard gehalten werden, die das erste und wichtigste Bollwerk gegen den Ansturm der Feinde bildete.
Zieh aus und kehre siegreich zurück, dachte Joryn – der zweite Schlachtruf und der einzige Satz, der von sämtlichen Menschen des Reiches mindestens genauso häufig gesprochen wurde wie der innige Wunsch, dass Eygards Mauern halten mussten. Er betete zu den Göttern. Ingmar sollte heil und unversehrt zurückkehren. Sie brauchten ihn noch. Brauchten ihn so dringend …
„Geht es dir besser?“
Lián schreckte zusammen, als Bronmar ihn am Arm berührte. Erst dadurch wurde ihm bewusst, dass er die letzten Minuten zusammengekauert am Boden gehockt und ins Leere gestarrt hatte. Die Visionen hatten ihn mehr verstört und mitgenommen, als er sich selbst zugestehen wollte.
„Wir müssen einen neuen Weg einschlagen“, murmelte er. „Das alte Ziel ist bedeutungslos geworden. Das haben die Visionen klar aufgezeigt.“
Sie hatten ein Dorf im Osten angesteuert, wohin ihn keine Visionen, sondern Gerüchte über einen Krieger führten. Ein Krieger, der sich im Schwertkampf besonders hervortun sollte. Lián hatte von Anfang an keine große Hoffnung auf diese Reise gesetzt. Dafür war er schon zu vielen Gerüchten und Legenden gefolgt, die sich am Ende allesamt als große Enttäuschung herausgestellt hatten. Darum war er nicht undankbar für die kristallklaren und seltsam starken Visionen, die ihm den neuen Weg wiesen.
„Wir müssen nach Südwesten. Ein kleines Dorf namens Varl. Es liegt sehr nah an der Festung.“
„Shaia hilf.“ Drunid schlug ein frommes Götterzeichen, um den Beistand der jungen Göttin zu erflehen. Lián war gläubig, so wie jeder geistig gesunde Mensch, und vielleicht sogar mehr als die meisten. Als Seelenheiler und Prophet kam er den Göttern in seinen Visionen oft näher, als es gut für den schwachen menschlichen Verstand sein konnte. Möglicherweise glaubte er allerdings genau deswegen nicht an die Wirksamkeit von Gebeten, außer zur Selbstberuhigung. Die Götter hatten Wichtigeres zu tun, als den Sterblichen zu lauschen, die unentwegt um Hilfe und Beistand flehten.
„Wir wollten uns in diesem Jahr nicht mehr Eygard annähern“, sagte Bronmar, was einem Widerspruch so nah kam, wie es dem Krieger möglich war. Er war ein gutherziger, einfacher Mann, der sich am wohlsten fühlte, wenn er klaren Befehlen folgen durfte. Seine Aufgabe war es, Lián gemeinsam mit seinem Bruder Drunid zu beschützen, während dieser dem königlichen Befehl folgte, alles zu tun, um den Sieg der Thalvaren und damit den Untergang des Reiches zu verhindern. Seit drei Jahren mühten sie sich, diesen königlichen Auftrag zu erfüllen und bis zum heutigen Tag hatten die beiden Krieger niemals Zweifel an Liáns Entscheidungen gehegt – gleichgültig, wie viele Fehlschläge ihnen widerfahren waren, wie irrational und sprunghaft diese Entscheidungen auf der Grundlage von Visionen getroffen wurden. Auch jetzt zweifelten sie nicht. Dafür hatte Lián zu häufig bewiesen, dass seine Visionen echt waren und keine Gespinste eines kranken Geistes. Längst nicht jeder, der sich als Seelenheiler und Prophet ausgab, verfügte tatsächlich über die magische Gabe. Bronmar war lediglich besorgt, denn rund um die Festung Eygard war die Gefahr am größten, auf thalvarische Truppen zu stoßen und einen verfrühten Tod zu erleiden.
„Eygards Mauern dürfen nicht fallen“, murmelte Drunid quasi im Reflex und vollführte noch einige weitere Schutzgesten. Damit bestätigte er das eigentlich alberne Gerücht, dass Rotschopfe besonders aber- und leichtgläubig waren. Roter Zopf bringt Gold in den Topf war ein Sprichwort der turavesischen Händler, das sich so allerdings selten bewahrheitete, soweit Lián das beobachten konnte. Drunid war dennoch derjenige, der beständig um göttlichen Beistand betete, während sein älterer Bruder – hellblond, ansonsten fast das Ebenbild von Drunid mit seinem struppigen Bart und der großen, massiven Gestalt – nur an hohen Feiertagen zu den Tempeln der Götter strebte.
„Die Festung wird unter beständiger Beobachtung stehen“, sagte Bronmar. „Genau wie die Grenzen und das unmittelbar umliegende Gebiet. Die thalvarischen Hunde lauern auf ihren Sieg.“
„Um das zu verhindern, sind wir ausgeschickt worden“, entgegnete Lián streng. „Das Dorf liegt einige Meilen von der Festung entfernt, wenn meine Vision mich nicht getäuscht hat. Entfernungen sind am schwierigsten einzuschätzen, da mir oft nicht die wirkliche Welt gezeigt wird, sondern ein seltsames Trugbild.“
„Das, was dich vorhin hat in Ohnmacht fallen lassen, war aber keine richtige Vision, hattest du gesagt, oder?“ Bronmar musterte ihn aufmerksam, als würde er eine Wiederholung dieses beschämenden Anfalls befürchten. Lián hatte keine echte Erklärung für das, was dort über ihn gekommen war. Es war in der Tat keine richtige Vision gewesen. Mehr eine Art Seelentreffen. Was er dort gesehen, ja, durchlebt hatte, mussten Erinnerungen einer verstorbenen Seele gewesen sein. Ein Mensch, der an einem anderen Ort, einer anderen Zeit gelebt und Lián sein gesamtes Dasein bis zum Moment des Todes gezeigt hatte. Der Absturz des Donnervogels, in dessen Klauen sich dutzende Menschen befunden hatten, beendete diese Begegnung abrupt. Mehr als einmal schon hatte Lián solche Begegnungen mit sterbenden Seelen gehabt, die sich weit fort von ihm befanden, und sie jedes Mal als große Bürde und Ehre zugleich empfunden. Dies hier allerdings … Der Sterbende war möglicherweise selbst ein Seelenheiler gewesen und hatte deshalb die Macht besessen, Raum und Zeit zu durchqueren, um die letzten Augenblicke bis zum gewaltsamen Tod nicht allein verbringen zu müssen. Ja, das musste es gewesen sein. In diese Begegnung hatte sich die Vision hineingeschoben. Ein junger Mann mit rotbraunen Locken und kraftvoll leuchtenden blauen Augen. Er war mit ihm in den Klauen des Donnervogels gewesen und gleichzeitig der Ankerpunkt in der Vision über einen schwer Erkrankten im Dorf Varl, den Lián unbedingt erreichen musste.
Wenn er länger darüber nachdachte, konnte es gar keine andere Erklärung geben: Der Sterbende aus der anderen Zeit war auf jeden Fall ein Seelenheiler gewesen. Er hatte Lián diese Vision geschenkt, um ihn zu dem jungen Mann aus Varl zu führen.
Hoffentlich hatte er nicht zu sehr leiden müssen und befand sich nun in den Armen der Göttin, um dort Trost und Schutz zu erhalten, bis es Zeit für die Wiedergeburt wurde.
„Wir dürfen nicht länger zögern. Der Mann aus meiner Vision ist schwer erkrankt. Ich muss zu ihm, bevor er stirbt.“
Leider verrieten ihm seine Visionen äußerst selten, warum genau er an bestimmte Orte eilen, Menschen treffen oder Taten begehen sollte. Manches erklärte sich hinterher, meistens jedoch blieb nichts als Verwunderung. Lián hoffte inniglich, dass der junge Mann mit den blauen Augen nicht ein weiterer Irrweg des Schicksals war, sondern diesmal das Mittel, um den Willen des Königs zu erfüllen.
Eygards Mauern, sie durften nicht fallen.
„Nichts ist komplizierter als die Hierarchie der dreizehn Stämme –
und ihr Verständnis der Götter. Nicht einmal das Konzept der Magie.“
Einleitung aus „Hierarchien der dreizehn Stämme“, Verfasser unbekannt
lan!“
Seine Hand fuhr im Reflex zum Kampfdolch. Sofort ließ er sie sinken, als er Tadan erkannte, den Meister der Schatten. Seit er fast zum Opfer einer heimtückischen Giftattacke geworden war, hielt Tadan sich nur noch selten im Freien auf – er war nahezu erblindet und das Sonnenlicht fügte ihm starke Schmerzen zu. Man musste ihn in dieser Sache beim Wort nehmen. Er erzählte freimütig darüber, doch anzumerken waren ihm weder Schmerzen noch Schwierigkeiten beim Sehen. Llan schickte ein kurzes, hoffnungsloses Gebet an die dreifaltigen Götter, dass sein Großonkel noch lange die Führung über die Schattenhände ihres Stammes innehalten würde – Karmu, die Weiblichkeit, Foray, die Männlichkeit, Ushru, das göttliche Prinzip allen Lebens, das Pflanzen sowie sämtliches Getier bis hin zum Menschen umfasste. Sie vereinten je drei Manifestationen in sich, die auf Geburt, Reife, Verfall und Tod zurückgingen. Die drei und die neun, dazu die vier für die magischen Elemente – damit ließ sich die gesamte Welt begreifen. Wer nicht in die dreizehn Stämme hineingeboren war, tat sich oft merkwürdig schwer zu verstehen, wie die göttlichen Manifestationen zusammenhingen.
Tadan hatte offenbar auf ihn gewartet, denn er winkte ihn ungeduldig zu sich.
„Berichte!“, befahl er knapp und wies ihm zugleich den Weg in Richtung Arena statt zurück in den Schatten des Hauptgebäudes. Tadan lief gerne beim Sprechen, das war kein Geheimnis. Llans gerade abgeschlossener Auftrag beinhaltete ebenfalls keine Geheimnisse, darum war es ungefährlich, sich darüber im Freien zu unterhalten, wo jeder sie belauschen konnte. An einem solch sonnengefluteten, wolkenlosen Wintermorgen wie diesem musste es dennoch quälend für den Meister der Schatten sein, durch die sorgsam gepflegten Trainingsanlagen zu spazieren.
Da es Llan nicht anstand, die Entscheidung seines Herrn zu hinterfragen, gehorchte er und berichtete ausführlich.
„Die turavesischen Händler sind in Verbindung mit dem Stamm der Quai’n getreten, wie erwartet“, erzählte er. „Die Wüstensöhne haben Palmwein, Datteln und Kamelfleisch gebracht und von den Quai’n Salz und Räucherfleisch erhalten. Die Tauschquote war weder höher noch niedriger als bei Geschäften mit unserem Stamm. Es gibt keinen Grund, Betrug oder Unehrenhaftigkeit zu fürchten.“
In Friedenszeiten, in denen keiner der dreizehn Stämme von Ebon versuchte, das mühsam errungene Gleichgewicht zu verletzen, um sich Vorteile zu verschaffen, war auch das Leben der Schattenhände weitestgehend ruhig und angenehm. Sie überwachten sich alle gegenseitig, kontrollierten Handel und Außenbeziehungen sämtlicher Stämme mit den umliegenden Ländern und berieten ihre Parns in der Heiratspolitik für deren Kinder.
Sie erreichten die Arena, wo Tadan ihn mit einer weiteren Geste nötigte, sich auf einer der Steinstufen niederzusetzen. Diese umringten den runden Sandplatz, wo sich ein Dutzend Nachwuchs-Schattenhände im Stockfechten übten. Eine Weile lang beobachteten sie schweigend die Kämpfer. Sie waren nicht alle mit Llan blutverwandt, obwohl sein Vater seinen Samen sehr fleißig verteilt und zehn gesunde Söhne sowie acht starke Töchter gezeugt hatte. Die Kinder des Parn hatten in der Welt der Schattenhände stets eine vorrangige Stellung. Doch es kamen auch aus anderen Quellen Krieger zu ihnen. Friedenszeiten und starke Magie sorgten dafür, dass mehr Kinder geboren wurden, als erwünscht waren. Nicht jede Familie konnte solch eine Unzahl von Mäulern stopfen und gab darum freiwillig die Neugeborenen ab. Die ersten kamen zum Foray-Tempel, die zweiten zu Kamru, die letzten wurden zu Schattenhänden. Obwohl Llans Stamm, die Ianma, die über die Ostmark herrschten, mit etwa fünfzigtausend Köpfen zum unteren Mittelfeld zählten, gab es zurzeit sechsundsiebzig Schattenhände. Nicht wenige davon waren Frauen. Nur zwei der dreizehn Stämme verfügten über mehr Schattenhände als sie. Das sagte etwas über die Vielzahl gesund und stark geborener Kinder aus. Und noch mehr über die Armut, die dazu führte, dass so viele Säuglinge fortgegeben werden mussten.
Llans Eltern hatten ein verschwendungssüchtiges Leben geführt und niemand konnte sie daran hindern. Je mehr Luxus Parn und Marna eines Stammes an sich rafften und verschwendeten, umso mehr mussten die anderen leiden. Es war ihr Recht als Anführer gewesen, das Vermögen des Stammes für sich zu beanspruchen und sich nicht einen Moment lang dafür zu interessieren, ob es deswegen Leute gab, die hungern mussten. Llans Onkel und Tanten hatten sich nach Kräften bemüht, den Parn zur Mäßigung anzuhalten, ohne jeden Erfolg. Diese Tage waren vorbei …
Der Giftanschlag, der Meister Tadan fast hatte erblinden lassen, hatte auch Llans Vater getroffen; er war gestorben. Seit einem Sonnenlauf führte Llans Drillingsbruder die Geschicke des Ianma-Stammes. Bis heute versuchten die Schattenhände verschiedener Stämme vergeblich herauszufinden, wer hinter dem Anschlag gesteckt hatte – es war bei einem großen Stammestreffen geschehen und es hatte weitere Tote und Verletzte gegeben.
Briggan, Llans Bruder, lebte sehr viel bescheidener und gemäßigter als ihr Vater und ihm war es sogar gelungen, ihre Mutter Astida zu bändigen. Weitestgehend zumindest. Astida bestand nicht nur weiterhin auf ein gewisses Maß an Luxus und Wohlleben, sie war auch für ihre Intrigen und Skrupellosigkeit berüchtigt. Dennoch hegte Llan die Hoffnung, dass der Stamm sich nun endlich erholen und eine höhere Position in der Rangfolge einnehmen würde. Es würde die Flut von neuen Schattenhänden eindämmen. Diesen Winter waren bereits zwei Neuzugänge zu ihnen gekommen. Zwei kleine Mädchen. Eine davon befand sich mit ihrer Amme ebenfalls auf den Stufen der Arena und wurde gerade gestillt. Achtzehn Monde lang sorgten Frauen des Stammes, die ihre eigenen Kinder verloren hatten, für die winzigen Schattenhände. Sie stillten und umhegten sie, gaben ihnen die Zuneigung, die sie zum Überleben benötigten. Auch danach waren sie noch für weitere eineinhalb Sonnenläufe für die Kleinen da, doch bereits mit achtzehn Monden begann das harte Training, das für den Rest des Lebens den Alltag einer Schattenhand bestimmte.
Meister Tadan hatte Llans Blick auf die Amme mit dem Kind bemerkt.
„Unruhige Zeiten stehen bevor“, sagte er leise. „Seit zwanzig Sonnenläufen herrscht Frieden. Du hast nie etwas anderes als Frieden und Gleichgewicht kennengelernt. Bald wirst du erfahren, was Krieg bedeutet. Ich spüre es in meinen alten Knochen. Der Giftanschlag war der Anfang gewesen. Die Stämme werden sich neu aufstellen und nur die Götter wissen, was sonst geschehen mag.“
Llan nickte. Mit seinen siebenundzwanzig Sonnenläufen hatte er zumindest undeutliche Erinnerungen an kriegerische Zeiten. An ältere Schattenhände, die ausgezogen und nicht zurückgekehrt waren. An sorgenvollem Geflüster auf den Gängen, wenn jeder dachte, dass die Kinder längst schliefen. An die Anspannung, die beinahe ständig geherrscht und wie klebrige Spinnenfäden an jedem Wort gehangen hatte. An die vielen Wächter, die das Gelände patrouillierten. Nicht alle waren Schattenhände gewesen, die Gardisten des Parn hatten mitgeholfen, Andarn zu bewachen – die Stadt der Schattenhände. Llan hatte keine Sehnsucht danach, die Rückkehr solcher Zeiten zu erleben. Aber er verstand durchaus, dass es sich nicht verhindern ließ. Wenn neue Generationen von Parne an die Macht kamen, entstand jedes Mal auch eine neue Dynamik im Gleichgewicht zwischen den Stämmen. Die einen waren ehrgeizig und wollten ihren eigenen Stamm voranbringen. Die anderen fühlten sich durch jede noch so geringfügige Änderung bedroht und reagierten aggressiv. Manch einer verstand prinzipiell alles falsch. Am schlimmsten waren diejenigen, die eigentlich keinen besonderen Ehrgeiz hegten und sich vor den anderen Parnen fürchteten. Sie neigten am schnellsten zu vorsorglichen Anschlägen. Ihre Berater konnten das bloß bedingt auffangen – und die Schattenhände mussten tun, was ihnen befohlen wurde.
„Es gibt einen neuen Auftrag für dich“, sagte Tadan und überreichte ihm ein Pergament. „Lies die Anweisungen in deinen Räumlichkeiten und verfahre wie gewohnt.“
Llan wartete einen Moment, ob der Meister der Schatten noch etwas hinzufügen wollte. Als dies nicht geschah, erhob er sich und nahm mit einer respektvollen Verbeugung Abschied. Irgendetwas sagte ihm, dass dies das letzte Mal war, dass er seinen Meister zu Gesicht bekam. Eine Schattenhand, die zu alt, zu krank oder zu schwach wurde, um für den Stamm zu kämpfen, musste sich nicht selbst richten. Sie durften als Lehrer dienen, ihre Erfahrungen einem Schreiber erzählen oder sich gänzlich der Fürsorge der jüngeren Hände anvertrauen. Tadan gehörte zu denjenigen, die nicht für ein solches Leben geeignet waren. Etwas an der Art, wie der grauhaarige Schattenmeister in der Sonne saß und auf eine Weise friedlich und entspannt wirkte, wie es für ihn eigentlich undenkbar war …
„Lebt wohl, Meister“, sagte Llan kaum hörbar. Das Nicken, das ihm antwortete, mochte er sich vielleicht sogar einbilden, so schwach war es. Er wandte sich ab und eilte zum Hauptgebäude hinüber, wo sich seine Räumlichkeiten befanden. Die Welt war im stetigen Wandel begriffen. So war es der Wille der Götter – einatmen, ausatmen, wandeln. Kein Augenblick überdauerte mehr als drei Herzschläge. Gleichgültig wie sehr die bedauernswerten Sterblichen sich wünschen mochten, dass es anders sein könnte. Dass sich ein besonders schöner Moment festhalten ließe, für länger, für die Ewigkeit. Es geschah nicht und darüber zu klagen, war müßige Verschwendung von unwiederbringlicher Lebenszeit.
„Wie geht es dir, Mutter?“ Kharil trat zu Astida, die am äußersten Rand der Gartenanlage von Mannak stand und den Wind genoss, der durch ihre schweren weißen Trauergewänder fuhr. Die Wehrmauer der Trutzburg umschloss auch diesen Teil des Geländes und schützte vor Feinden, die es im Moment glücklicherweise nicht gab. Stets hatte sie die Sicherheit genossen, wenn sie die Hände auf die breiten, hellen Felssteine legte, aus denen die Mauer gefügt worden war.
Nun fühlte sie gar nichts mehr, außer Leere. Nie hätte sie gedacht, dass sie dieses seltsame Alter erreichen würde, in dem Frauen die Fähigkeit zur Empfängnis verloren und das Leben merkwürdig beschwerlich wurde. Im einen Moment schwitzte sie aus sämtlichen Poren, im nächsten wurde ihr kalt. Abscheulich war das. So alt zu werden, ohne einen echten Nutzen zu haben, das konnte nicht der Wille der Götter sein. Drei Kinder hatte sie geboren, wofür ihr Gatte sie angebetet hatte. Einige Zeit lang zumindest, bevor er seine Aufmerksamkeit der nächsten jugendlichen Schönheit zugewandt und diese geschwängert hatte.
Astida hatte niemals wieder empfangen. Niemand hatte es ihr vorgeworfen, immerhin hatte sie drei prachtvolle, gesunde, starke und in ihrer Magie ungewöhnlich mächtige Söhne hervorgebracht. Ihre Position als Marna, als erste Hauptfrau, hatte niemals gewankt, nicht für einen Moment. Doch sie hatte es den Göttern vorgeworfen – und Rán, ihrer einstigen Sklavin. Mit Sicherheit war deren seltsame Magie dafür verantwortlich, dass Astida kein weiteres Kind unter dem Herzen tragen konnte. Wie sehr hatte sie sich danach gesehnt, eine Tochter haben zu dürfen! Ein Mädchen, das einige Sonnenläufe länger bei ihr geblieben wäre.
Nun war ihr Gemahl tot, ihre Macht von einer Stunde auf die andere gebrochen, ihre Söhne erwachsen und jeder empfand sie als Last. Als Überbleibsel, das durchgefüttert werden musste. Astida hatte keine Aufgaben, kein Tagewerk. Ja, sie leistete ihren Anteil am Wolle spinnen, Weben und Nähen, sie knüpfte Teppiche und färbte Stoffe. Doch all das konnte auch von anderen fleißigen Händen getan werden, niemand brauchte sie wirklich. Auch nicht, um Befehle zu empfangen, denn die neue Marna leitete nun den Haushalt des Parn. Sie war hier lediglich geduldet. Niemand sagte es laut. Ein Teil von ihr wusste, dass sie sich die kritischen Blicke bloß einbildete. Das Geflüster darüber, dass man das Bauernweib allmählich zurück in den Schweinestall schicken könnte. Keiner würde es wagen, durch die Heirat war sie zur Marna aufgestiegen.
Du bist keine Marna mehr. Du bist die Mutter des Parn. Ein verbrauchtes, altes, zänkisches Weib.
Oh, was hatte sie sich Ráns Worte zu Herzen genommen! Siebenundzwanzig Sonnenläufe lang hatte sie gegen jene intrigiert, die stark waren und ihr schaden konnten, und dabei niemals die anderen unterschätzt, die scheinbar schwach waren. Hatte mit Menschen gespielt, sie benutzt wie Werkzeuge, die sie letztendlich auch gewesen waren. Sie wurde gefürchtet, gehasst, verachtet. Und der einzige Mensch, der sie tatsächlich geliebt und angebetet hatte, der ihr ein Seelengefährte gewesen war, lag nun still und kalt unter der Erde. Zu früh. Viel zu früh war er ihr genommen worden! Noch ein paar gute Jahre mehr, das hatte ihnen zugestanden. Bis ihr Körper so verfallen gewesen wäre, dass der Verlust der Macht sie nicht hätte interessieren können. Nun war sie vollkommen allein auf dieser Welt. Geblieben war ihr Vermächtnis. Sie war die Mutter des Parn! Ihre Söhne gehörten zu jenen, die sie fürchteten. Zumindest hoffte sie das.
„Mutter?“ Kharil zupfte an ihrem weißen Schultertuch. Ihr Zweitgeborener besaß den Anstand, Fürsorge zu heucheln. Es war als Berater des Stammes seine Aufgabe, genau das zu tun.
„Ich mag den Wind“, sagte Astida leise, ohne sich zu ihm umzuwenden. „Meine Magie hat nie gereicht, um ihm wahrhaftig gebieten zu können. Dennoch liebe ich ihn mehr als jedes andere Element.“
„Du bist viel zu dünn bekleidet für einen solch kalten Tag, Mutter. Trauer hin oder her, du solltest wärmere Gewänder tragen. Dein Gesicht ist ganz rot von der Kälte.“
Sie ignorierte das besorgte Geschwätz nicht, so wie sie es normalerweise tun würde, sondern wandte sich Kharil mit ungeduldiger Geste zu.
„Ich bin alt genug, um selbst über meine Garderobe zu entscheiden, und noch nicht zu alt, um diese Fähigkeit verloren zu haben. Hör auf, mich wie ein altersschwachsinniges Weib zu behandeln!“
Instinktiv hob Kharil die Hand, als wolle er einen Schlag abwehren. Die Tätowierung am Gelenk wurde sichtbar – ein gewundenes blaues Band, das unauslöschlich zeigte, wer er war. Eine zweite Tätowierung befand sich über seinem Herzen, denn Hände konnten verloren gehen, wie man in der Ostmark gerne sagte. Am siebten Lebenstag bekam ein jedes Kind des Hochadels diese Tätowierungen unter die Haut gestochen, was mehrfach aufgefrischt wurde, als Zeichen, welchem Gott sie geweiht waren. Welche Position ihnen dank ihres Geburtsrechts versprochen war.
Astida erinnerte sich an den Stolz, den sie empfunden hatte, als sie Kharil damals im Arm hielt. Er hatte jämmerlich geweint, die gesamte Prozedur hindurch. Wie die meisten Kinder es eben taten. Dennoch war sie so stolz, hatte diesen kleinen Jungen mehr geliebt als ihr eigenes Leben. Und heute? Mehr als Kälte und Ungeduld war ihr nicht geblieben. Die Liebe hatte sich verbraucht wie Salz in einem Fässchen – kostbar und kaum zu bezahlen und wie alles auf dieser Welt nicht unendlich.
Er spürte ihre Abneigung, senkte seinen hübschen Kopf. Ihre Söhne waren mehr als ansehnlich. Sie hatten das rabenschwarze Haar ihres Vaters geerbt und Astidas grüne Augen. So viel Schönheit, und das gleich dreifach …
Kharil räusperte sich.
„Mutter, wir haben einen Gast. Eine Botschafterin aus den Niederungen ist zu uns gekommen. Eine Frau der Ynch. Sie trägt den Siegelring der Unterhändler, versteht unsere Sprache und verlangt, ausschließlich mit dir zu sprechen.“
„Eine … eine Botschafterin sagst du?“ Astida musste an sich halten, um nicht ins Stammeln zu geraten. Seit dieser einen Nacht hatte sie keinen Vertreter aus dem geheimnisvollen Volk der Ynsh mehr gesehen. Ein Umstand, für den sie sehr dankbar gewesen war. Mit einem Mal erschien ihr der Wind rau und kalt. Sie hüllte sich fester in das verhasste weiße Schultertuch, drehte sich abrupt um und eilte zurück zur Trutzburg. Mannak, der Hauptsitz des Parn, der über den Stamm der Ianma regierte. Ihre Heimat. Das Gefängnis, in dem sie aus freien Stücken gefangen blieb.
Llan starrte nachdenklich auf das Pergament. Ausführliche Instruktionen waren darauf verschlüsselt, nach einem Code, für den nur er und der Schattenmeister das Referenzbuch besaßen. Siebenundzwanzig Bücher befanden sich in seinen Räumlichkeiten, kein Fremder könnte auf die Schnelle herausfinden, welches davon zum Entziffern des Codes zu verwenden war; zumal es weitere Vorsichtsmaßnahmen gab, die das Erkennen erschweren würden.
Sein Befehl lautete, Ivar zu entführen. Den Erben des Taru-Stammes, erstgeborener Sohn des derzeitigen Parn. Der Mann war in etwa so alt wie Llan, vielleicht ein Sonnenlauf älter oder jünger. Warum der Taru-Stamm? Mit ihm hatten die Ianma keine Fehde, sie standen neutral zueinander. Den Erben zu entführen war ein kriegerischer Akt, die Taru würden das niemals friedlich hinnehmen! Und dennoch waren dort die Instruktionen, an welchem Ort sich Ivar zurzeit aufhielt. Das war etwa hundert Meilen von dessen Heimat entfernt, eine Gegend, die sehr dünn besiedelt war, wenn Llan sich richtig erinnerte. Angeblich hielt sich Ivar dort allein auf, um die Heilkraft der Schwefelquellen zu genießen. Auch ihn hatte es bei dem Giftanschlag vor einem Sonnenlauf erwischt, wie schwer, das wusste Llan nicht. Gerade deshalb fand er es unglaublich, dass Ivar allein sein sollte – eine Handvoll Gardisten oder vielleicht sogar eine Schattenhand müssten ihn begleiten, um ihn zu schützen.
Es sei denn, die Beeinträchtigungen durch das Gift waren schwer genug, dass Ivar nicht mehr länger der Erbe sein konnte. In diesem Fall könnte die Entführung sogar von Ivars Stamm selbst erbeten worden sein. Vom Berater des Parn, Ivars Onkel, wäre ein solcher Akt noch am ehesten zu erwarten, wenn es starke Zweifel daran gab, dass der Erbe geeignet war. Ein geheimer Anschlag, um herauszufinden, ob er noch genug Kraft besaß, um sich gegen Gewalt zu erwehren. Die Instruktionen lauteten, ihn lebendig und unversehrt nach Andarn zu bringen. Sollte Ivar unterwegs zu Schaden kommen, würde man ihm dies nicht als Versagen auslegen. Sollte die Gegenwehr zu stark sein, durfte er das anvisierte Opfer entkommen lassen, dort unten stand es als Zusatz.
Ja, so ergab es Sinn. War der Erbe zu schwach, würde die Entführung dies deutlich zeigen und man konnte die Würde offiziell auf Ivars jüngeren Bruder übertragen. Hatte er sich hingegen weit genug erholt und zeigte sich dem Anschlag gewachsen, so musste sein Stamm sich nichts vorwerfen lassen, da die Gewalt von einer fremden Hand ausgehen würde. Gleichgültig wie es ausgehen sollte, ein Krieg zwischen den Stämmen würde daraus nicht erwachsen. Der Meister der Schatten hätte diesen Auftrag ansonsten gar nicht erst angenommen, das war gewiss.
Unterdrückt seufzend packte Llan seine Sachen. Er musste sich noch Vorräte für die lange Reise besorgen. Dieser Auftrag würde ihn mindestens einen Mond beschäftigt halten. Also auf! Hände waren dazu geschaffen, sich zu regen.
Rán blickte hoch, als Astida in den Raum stürmte. Die Jahre hatten es nicht gut mit der einstigen Marna gemeint. Ihr liebliches Gesicht wirkte verhärmt, die Lebenskraft war aus den schönen Augen versickert. Kälte und Unnahbarkeit strahlten von ihr aus, tiefe Linien hatten sich in die Mundwinkel gegraben. Selbst das Gold ihrer langen Haare schien zu Eis gefroren, so viel Weiß, wie sich daruntergemischt hatte. Das Trauergewand rundete diesen Anblick ab. Kostbare Stoffe und viel zu viel Schmuck lasteten auf ihr und raubten den letzten Anschein von Menschlichkeit. Nichts davon dürfte ihr bewusst sein. Arme kleine Astida. Sie war erbärmlich. War es immer gewesen, aber nun hatte man ihr die Macht genommen, das Einzige, was sie neben Reichtum von dieser Welt begehrt hatte.
„Bist du also tatsächlich zurückgekehrt, Sklavin?“, fragte Astida, statt Zeit mit einer Begrüßung zu verschwenden. „Was willst du?“
„Eine Warnung aussprechen“, erwiderte Rán gelassen. Sie saß still auf dem Holzschemel, den man ihr zugewiesen hatte, als wäre sie eine Bettlerin statt geehrte Botschafterin ihres Volkes. Aus diesem Grund hatte man sie auch in einen fensterlosen engen Raum geführt, statt sie in die hohe Halle zu bringen. Niemand außer Astida erkannte die einstige Sklavin, es war die generelle Ansicht der Ianma, dass das Volk der Ynch keinerlei Respekt verdiente. Diese Leute glaubten tatsächlich, ihr würde der Unterschied nicht einmal auffallen …
„Warnung? Ich höre.“ Astida blieb stehen und starrte auf sie herab, als könne sie sich nicht zwischen Hass und Verachtung entscheiden.
„Die Quelle der Magie ist erschüttert worden. Erdbeben werden folgen, zeitweise könnte die Quelle gänzlich versiegen. Dies geschieht einmal in tausend Sonnenläufen auf natürliche Weise, doch das letzte Mal ist noch keine dreihundert Sonnenläufe her. Wenn dies geschieht, folgen Zeiten des Umbruchs. Das Alte wird verfallen. Das Neue mag Bestand haben oder sofort zugrunde gehen. Einst war das Volk der Ynsh die größte Macht zwischen den Hundertbergen und dem Eismeer. Heute sind wir das Volk im Zwielicht, das kaum einer kennt. Unsere himmelsstürmenden Bauwerke sind verloren. Krieg hat uns fast ausgelöscht. Wir, die Nachgeborenen, verstecken uns in den Niederungen, um überleben zu können. Ein ähnliches Schicksal mag den dreizehn Stämmen drohen. Dies ist keine Vision, lediglich eine Warnung.“
„Und was soll der Parn der Ianma deiner Meinung nach mit dieser Warnung anfangen, Sklavin?“, erwiderte Astida, nachdem sie Ráns Worte eine Weile lang hatte wirken lassen.
„Er könnte einen Boten ausschicken. Chadron, der Krüppelfürst ist der größte Seher der Stämme, er könnte eine Vision empfangen und ein Orakel sprechen, wie mit dieser Gefahr am sinnvollsten umzugehen ist.“
„Ich werde deine Worte an meinen Sohn weitergeben“, sagte Astida. Es war keine Lüge, wie Rán erleichtert feststellte. Sie hatte Zweifel gehegt, ob diese verbitterte alte Frau so viel Klugheit aufbringen würde. Wie schön es war, sich zum Besseren zu irren.
„Damit wäre mein Werk getan. Ich verabschiede mich.“ Als sich Rán erhob, packte Astida sie unvermittelt am Arm und umklammerte ihn hart.
„Warum bist du zu mir gekommen?“, zischte sie. „Du hättest zu meinem Sohn gehen können, der Parn hätte dich empfangen. Warum warnst du uns überhaupt?“
„Warum ich diese Warnung ausspreche, bleibt mein Geheimnis, verehrte Marna“, antwortete Rán lächelnd. „Warum ich zu dir gegangen bin? Nun, du gehörst mir. Es ist mein Recht, mit dir zu sprechen, wann immer es mir gefällt. Nenne mich ruhig eine Sklavin. In Wahrheit bist du es, die an der Kette liegt. Eine Kette, die ich in der Hand halte. Der Tag mag kommen, an dem du verstehst, was ich damit meine. Bis dahin spiele ich mit dir und deinen Söhnen, wie es mir beliebt und meinem Volk dienlich ist. Du glaubst, ich wäre die vergangenen siebenundzwanzig Winter fort gewesen. Das ist ein Irrtum. Wobei ich es nicht wahr, die das Gift austeilte, das deinen Gefährten tötete. Ich weiß, wer es getan hat. Auch dieses Wissen bleibt vorerst mein Geheimnis.“
Astida starrte sie aus riesigen, erschrockenen Augen an. Ihre Finger verkrampften sich schmerzhaft um Ráns Arm. Sie begriff nicht. Sie konnte es nicht. Mitleidig tätschelte Rán die Wange ihres Besitzes, bevor sie sich mit einem Ruck befreite und ungehindert den Raum verließ. Es gab vieles zu tun. Die Erschütterung der Quellen, sie waren ein finsteres Omen. Möglichweise war die Zeit gekommen, dass Eygards Mauern fallen mussten.
„Eygard, die große Festung, liegt auf einer Anhöhe, etwa tausend Schritt über dem Tal der Andraste. Sie überblickt die Grenzen nach Thalvar, kann von bis zu tausend Kriegern geschützt werden und hat ein Netz von Dörfern im Rücken, die sie mit Mannesstärke und Vorräten versorgen. Die stolze Festung gilt als uneinnehmbar, schon weil der Aufstieg beschwerlich und die Mauern gewaltig sind. Seit achthundert Jahren beschützt sie das Reich Ittara vor dem Erzfeind aus Thalvar. Sie wird niemals untergehen, es sei denn, es ist der Wille der Götter – oder durch Verrat.“
Zitat aus „Burgen, Schlösser, Festungsmauern: Das Großreich der Ittarer“; Verfasser unbekannt
st er noch einmal zu sich gekommen?“
„Nein. Das Fieber sinkt allerdings etwas und er ist nicht mehr so unruhig. Es war ein harter Kampf, Ingmar. Schlaf ist wichtig, um zu heilen. Stör ihn mir nicht! Ich bin froh, dass er ruhig daliegt.“
„Ich schaue nur ganz kurz nach ihm, ja?“
„Wasch dich erst mal, Junge. Haben die Thalvaren mit Schlamm geworfen, statt Pfeile nach euch auf die Wehrmauer zu schießen?“
„Das Lastenpferd hat gescheut, als das Gewitter über uns kam, und ich war derjenige, der es führte. Zum Glück ist der Gaul nicht durchgegangen, aber ich bin ruhmlos gestürzt. Nichts passiert.“
Eine Tür flog auf. Schwere Schritte. Joryn war glücklich über das Geplänkel zwischen Ingmar und Askala. Der Angriff war überstanden, sein Bruder heimgekehrt. Sein Herz fühlte sich gleich leichter an.
Als vor über sechs Jahren der Krieg mit den Thalvaren begann, wurde ihr Dorf mit als eines der ersten überrannt. Joryns Eltern und seine jüngere Schwester gehörten zu den Opfern, erschlagen von feindlichen Kriegern, die jahrhundertelang zu ihren Nachbarn und engsten Verbündeten gezählt hatten. Lange hatten sich die Thalvaren nicht ausgetobt, sie waren bloß auf dem Durchmarsch gewesen und wurden rasch von den königlichen Garden vertrieben. Dennoch hinterließen sie verbrannte Erde und in nahezu jeder Familie mussten die Totenstatuen aufgestellt werden.
In den folgenden Jahren hatte Joryn noch drei weitere Geschwister verloren. Zwei seiner Brüder, Aarys und Korla, wurden beim Bau des Schutzwalls ums Dorf von Pfeilen getroffen. Seine älteste Schwester Isgaly starb im Kindbett nach der Geburt ihres Sohnes, und auch der Kleine folgte nicht lange danach. Nun gab es nur noch Ingmar und ihn.
„Hey, Kleiner! Wir hätten dich diese Nacht gebrauchen können“, sagte sein Bruder und wuschelte ihm durch das schweißverklebte Haar. „Dein gutes Auge hat gefehlt, deine Pfeile hätten reiche Ernte gehalten. War zwar nichts Besonderes, dieser Angriff, wir haben keine Leute verloren. Trotzdem, mit dir zusammen hätten wir mehr Spaß gehabt. Glaub also nicht, dass du dich noch lange im Bett rumdrücken und schlafen kannst!“
Joryn versuchte die Augen zu öffnen und ihn empört anzuzischeln. Frechheit! Er lag schließlich nicht zum Vergnügen darnieder! Leider war die Erschöpfung zu groß, für mehr als ein hauchleises Seufzen reichte es nicht aus. Und selbst das hatte er sich womöglich eingebildet. Außerdem war ihm schon wieder kalt. Kälte, die sich in die Knochen fraß und ihn von innen heraus aushöhlte. Kälte, die schmerzte wie nichts anderes, das er jemals durchleiden musste. Kälte, die er fürchtete.
„Müsste er nicht langsam mal was essen? Seit einer Woche bekommt er nichts als Wasser und Brühe. Schau dir seine Wangen an, vollkommen hohl! Er zerfällt uns vor den Augen, Askala. Ein Mann wie er braucht mehr, um seine Kräfte zusammenzuhalten.“
Ingmars Stimme schwankte unter der Last der Sorge. Das tat Joryn leid, er wollte nicht, dass sein Bruder so viel Sorgen tragen musste.
„Er hat noch genügend Vorräte, ein gesunder, starker Junge wie er verhungert nicht nach ein paar Tagen. Solange ich Wasser in ihn reinzwingen kann, ist alles gut. Ich denke, das Schlimmste ist geschafft. Der Weg zurück ins Leben ist allerdings genauso gefährlich wie das Fieber selbst, darum müssen wir weiterhin gewappnet sein. Meine Tochter übernimmt die heutige Nachtwache. Mir geht die Kraft aus, dadurch bin ich nutzlos an seiner Seite. Und nun geh dich endlich waschen, Ingmar! Zieh dich um, iss was, schlaf. Joryn braucht dich stark und ausgeruht, ansonsten bist du ebenfalls nutzlos.“
„Bin ja schon weg. Kleiner, benimm dich, verstanden? Morgen früh will ich, dass du mich wieder anschaust, wenn ich mit dir rede. So viel Höflichkeit sollte man erwarten können.“
Joryn versuchte, ihm mit einem Blinzeln zu antworten. Seine Lider reagierten nicht. Es war seltsam unheimlich, jegliche Kontrolle über den Körper verloren zu haben. Wach und aufmerksam alles mitzuerleben, ohne reagieren zu können. Was hatte das Gift bloß mit ihm angestellt? Das bildete er sich nicht ein, es war nicht lediglich tiefe Erschöpfung aufgrund des hohen Fiebers. Er war eingesperrt in seinem eigenen Kopf und niemand, nicht einmal Askala, ahnte etwas davon!
Joryn nahm die ganze Kraft zusammen, kratzte herbei, was er finden konnte, und begann zu schreien. Laut, anhaltend, ohrenbetäubend – doch nur in seinem Bewusstsein. Äußerlich blieb er stumm, atmete nicht einmal schneller.
Schritte, Stimmen, Türgeklapper, Rascheln.