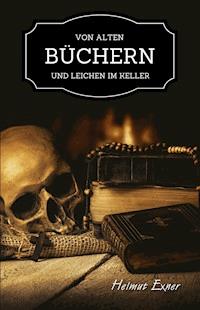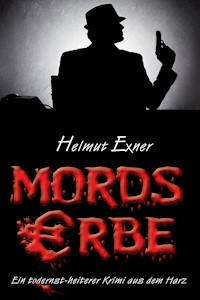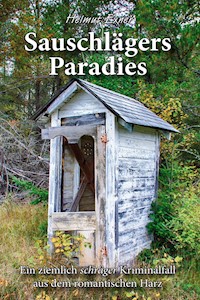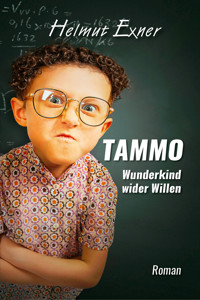Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Elektronik-Praktiker
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Der junge Lektor Waldemar Möser, der sich zeitlebens über seinen bescheuerten Namen ärgert, bekommt den Auftrag, einen prominenten Schriftsteller zu betreuen. Als dieser ihm offenbart, dass die kriminellen Machenschaften, um die es in seinem neuen Buch geht, der Realität entsprechen, geraten beide in Gefahr. Um möglichen Mordanschlägen zu entfliehen, reisen sie von München in den beschaulichen Harz. Doch in ihrer Nachbarschaft wohnt eine alte Dame namens Lilly Höschen, die dafür bekannt ist, Verbrechen magisch anzuziehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 176
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Helmut Exner
Impressum
Fahr zur Hölle, Vogelmann
ISBN 978-3-947167-70-8
ePub Edition
V1.0 (08/2019)
© 2019 by Helmut Exner
Abbildungsnachweise:
Umschlag © Bussardel
# 89002190 | depositphotos.com
Porträt des Autors © Ania Schulz
as-fotografie.com
Lektorat:
Sascha Exner
Verlag:
EPV Elektronik-Praktiker-Verlagsgesellschaft mbH
Postfach 1163 · 37104 Duderstadt · Deutschland
Fon: +49 (0)5527/8405-0 · Fax: +49 (0)5527/8405-21
E-Mail: [email protected]
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Titelseite
Impressum
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Ein paar Worte hinterher
Eine kleine Bitte
Über den Autor
Mehr von Helmut Exner
Kapitel 1
Dein Name ist Waldemar, weil es im Wald geschah. Er wusste nicht, wie oft er sich diesen blöden Spruch schon anhören musste. Und wer auch immer auf die Idee kam, ihn mit Waldi anzureden, dem hat er für den Wiederholungsfall angedroht, ihm die Zähne einzuschlagen. Welcher Teufel hatte bloß seine Eltern geritten, ihm diesen Namen zu verpassen? Als ob sein Familienname nicht schon Strafe genug wäre: Möser. Immerhin steht am Ende noch ein ›r‹. Bei seinem Glück hätte er auch Möser ohne ›r‹ heißen können. Als er sich während des Studiums mal in einem Lokal um einen Job bewarb, stellte sich der Chef, der auch mit einem außergewöhnlichen Namen gestraft war, vor: »Schwanz«. Er darauf: »Möser«. Der Chef: »Arschloch!« Er: »Was denn nun? Heißen Sie Schwanz oder Arschloch? Also mein Name ist Waldemar Möser.« Es dauerte ein paar Sekunden, bis Herr Schwanz begriffen hatte, dass er ihn nicht wegen seines Namens beleidigen wollte. Dann fing er haltlos an zu lachen – und Waldemar stimmte ein. Das war eine der seltenen Gelegenheiten, dass ihm sein Name genützt hatte. Er wurde eingestellt und hatte bis zum Abschluss des Studiums gutes Geld in einer angenehmen Atmosphäre verdient. Ansonsten war es ausgesprochen unerquicklich, mit diesem Namen aufzukreuzen. Es sei denn, man konnte selbst ordentlich austeilen. Und das hatte er im Laufe der Zeit gelernt. Sein angeborener Hang zur Albernheit und die Kultivierung seiner zynischen Ader schützten ihn vor Bemerkungen wie: Na Möser, hast du die Möse getroffen? Wovor man sich nicht schützen kann, sind die Äußerungen einer zehn Jahre jüngeren Schwester, die ihm die peinlichsten Situationen seines Lebens beschert hat. Mit siebzehn hatte er sich in ein atemberaubendes Mädchen verguckt. Er hatte nicht zu hoffen gewagt, dass sie ihn überhaupt beachtete, geschweige denn sich sogar mit ihm einlassen würde. Er war damals derart unscheinbar und schüchtern, dass er von Mädchen kaum wahrgenommen wurde – dachte er jedenfalls. Dann geschah das Wunder: Nina hatte mit ihm angebandelt. Die Initiative ging von ihr aus. Er hätte es sich nie getraut. Nach ein paar Begegnungen kam sie eines Tages mit zu ihm. Sie saßen in seinem Zimmer und – ja, es knisterte zwischen ihnen. Bis zu dem Zeitpunkt, als die Tür aufging und seine siebenjährige Schwester hereinkam. Sie ging auf Nina zu und sagte, höflich, wie sie war: »Hallo, ich bin Christine. Und wer bist du?«
»Ich bin Nina.«
»Bist du Waldemars Freundin?«
»Ja, das könnte man so sagen.«
»Das ist prima. Er hatte nämlich noch nie eine, weil er schüchtern ist.«
Er: »Es reicht. Zisch ab.«
Nina: »Lass sie doch. Sie ist so süß.«
Christine, ihren Bruder völlig ignorierend: »Er ist sogar noch Jungfrau.«
Er, Haare raufend: »Schreib es mir doch auf die Stirn, damit es jeder weiß.«
Aber es gibt natürlich Schlimmeres als bescheuerte Namen oder nervige kleine Mädchen. Zum Beispiel, wenn einem ein Personalchef nach dem Leben trachtet oder die Schwester, mittlerweile zu einer tollen jungen Dame herangewachsen, zwei Tage nacheinander in ihrem Haus überfallen wird. Doch eins nach dem anderen.
Kapitel 2
Eigentlich betrachtete er sich als freier Schriftsteller. Ein blöder Begriff. Gibt es auch unfreie Schriftsteller? Mit eigentlich ist das so eine Sache. Aber uneigentlich, ob nun frei oder unfrei, konnte er davon noch nicht besonders gut leben. Seine Herz-Schmerz-Seifenopern, die er unter dem Pseudonym Mary de Vegas veröffentliche, verkauften sich zwar leidlich, aber er wartete noch auf den großen Durchbruch. Außerdem hätte er gern ganz andere Dinge geschrieben, sah aber keine Chance, damit irgendeinen Menschen hinterm Ofen vorzulocken. Jedenfalls im Moment nicht. Insgeheim bastelte er an dem ganz großen Roman, der all seine Schreibsünden vergessen machen sollte. Aber das brauchte Zeit. Um ein geregeltes Grundeinkommen zu haben, entschloss er sich, eine Stelle als Lektor anzunehmen. Man verdient zwar trotz Studium und Aufopferung für Verlag und Autoren nicht mehr als ein Kaufmannsgehilfe, ist aber nicht angewiesen auf die meist schmalen Honorarzahlungen. Und schreiben konnte er ohnehin nur nachts. Also würde er tagsüber etwas für den Broterwerb tun. Schlafen dürfte er am Wochenende. Direkt nach dem Studium hatte er schon als Volontär in einem Lektorat gearbeitet und so wenig verdient, dass er abends noch kellnern musste. Das sollte sich nicht wiederholen. Er fuhr also nach München, um sich bei dem Programmleiter eines großen Verlagshauses vorzustellen. Das Gespräch mit dem Mann, er war so Ende vierzig, trug Jeans und offenes Hemd, verlief hervorragend. Man merkt sofort, wenn man mit einem Menschen auf einer Wellenlänge liegt. Er ging auf all seine Wünsche ein: Homeoffice in seinem Wohnort im Harz. Einmal pro Monat für zwei Tage nach München. Und er hätte absolut freie Hand im Umgang mit den Autoren. Er müsste nur die entsprechenden Terminvorgaben einhalten. Aber das ist ja überall so. Das Gehalt war höher als erhofft. Am Ende der Verhandlung kam der Programmchef dann auf die Idee, den Personalmenschen hinzuzuziehen, der den Vertrag aufsetzen sollte.
Als dieser eintrat, wusste Waldemar auch schon, was das für ein Typ war. Abo im Fitnessstudio und auf der Sonnenbank, Rhetoriklehrgang für Führungskräfte, Seminar Körpersprache für Anfänger, ein eigens für ihn kreiertes Parfüm, damit auch niemand seine Duftmarke verwechselte. Dynamischen Schrittes kam er auf ihn zugestürzt und stellte sich vor: »Michael Grothmann, Director Human Resources.«
»Waldemar Möser, Manager of Geschreibsel.«
»Hahaha. Origineller Name, originelle Vorstellung.«
Und dann fing er an zu quatschen, als ob er für jedes Wort extra bezahlt würde. Firmenphilosophie, Personalphilosophie, seine eigene Philosophie. Was noch fehlte, war Scheißhausphilosophie. Er hätte das ja alles über sich ergehen lassen, wenn da die beiden letzten Sätze nicht gewesen wären: »Sie haben sich unserem Programmdirektor sicherlich in den schillerndsten Farben dargestellt, sonst hätte er mich nicht dazugerufen, um den Vertrag zu machen. Neben all den Vorteilen, die Sie mitbringen – was ist Ihre größte Schwäche?«
Waldemar sah ihn an, als hätte er ungeniert angefangen zu popeln. Dann brachte er mit verärgerter Stimme heraus: »Sie glauben doch nicht im Ernst, dass ich Ihnen die verraten würde.«
»Das wäre aber gut und fair als Indiz für Ihre Ehrlichkeit. Sie wollen schließlich, dass wir Ihnen für gutes Geld eine wichtige Funktion in unserem Hause übertragen.«
»Wer sagt denn, dass ich das will?«
»Sie haben sich bei uns beworben.«
»Da muss ein Missverständnis vorliegen. Sie suchen einen Mitarbeiter und ich erkunde, ob ich eventuell bereit wäre, für Sie zu arbeiten. Dazu brauche ich ein paar Informationen. Zum Beispiel, was die größte Schwäche Ihres Unternehmens ist.«
Der Programmleiter, er hieß übrigens Dirk Schwalbe, grinste vor sich hin. Es war klar, dass er den Personalfutzi nicht ausstehen konnte, der nun erwiderte: »Ich werde doch unser Unternehmen nicht vor Ihnen bloßstellen.«
Waldemar redete sich allmählich warm: »Aber genau das erwarten Sie von mir. Könnte es sein, dass Sie der größte Schwachpunkt dieses Unternehmens sind? Ein Personalchef, Entschuldigung, Director Human Resources, der so blöde abgedroschene Fragen stellt, wird wohl kaum in der Lage sein, erstklassiges Personal zu rekrutieren. Sie suchen nach unterwürfigen armen Würstchen, die aufgrund ihres mangelnden Selbstbewusstseins in keinem innovativen Unternehmen eine Chance hätten.«
»Wenn Sie so über uns denken, dann suchen Sie sich doch woanders einen Job, der Ihren hohen Ansprüchen genügt.«
»Warum ich? Hängen Sie doch Ihren Job an den Nagel und gehen mit einem Bauchladen über den Markt, um Schnürsenkel zu verkaufen.«
Der kleine Disput endete durch lautstarkes Lachen von Dirk Schwalbe, der Frieden stiftend die Hände hob und sagte: »Das war jetzt eine richtig gute Vorstellung. Endlich ist mal was los hier. Also, Michael, du machst bitte den Vertrag fertig. Die Details schicke ich dir später per E-Mail.«
Der Personalheini verabschiedete sich erhobenen Hauptes von Waldemar. In seinem immerwährenden Lächeln war zu erkennen, dass er ihm die Pest an den Hals wünschte. Als er gegangen war, bot Dirk Schwalbe dem neuen Mitarbeiter das Du an und sagte: »Genau so muss man mit solchen Typen umgehen. Er denkt, er sei hier der große Entscheider. Aber wer hier eingestellt wird, bestimme ich – und in meiner Abwesenheit der Cheflektor.«
Kapitel 3
Quietschvergnügt verließ er das Verlagsgebäude und machte sich auf den Weg zum Löwenbräu, um sich mit einer Schweinshaxe für sein Verhandlungsglück zu belohnen. Zufrieden fuhr er nach Hause. Den Anstellungsvertrag würde man ihm umgehend zuschicken, die für die Arbeit nötigen Programme übermitteln, und dann konnte er loslegen. Und siehe da: Es machte Spaß. Wieder zu Hause in seinem beschaulichen Ort im Oberharz lektorierte er den Schmachtfetzen einer hoffnungsvollen jungen Autorin, die wirklich schreiben konnte. Die Zusammenarbeit funktionierte auf Anhieb. Er lag gut im Zeitplan. Da kam der Anruf von Programmdirektor Dirk Schwalbe: »Du musst nach München kommen.«
»Wann?«
»Sofort.«
Einer der wenigen Star-Autoren, von denen jeder große Verlag lebt, in diesem Fall Reginald Schulze, hatte sich mit seinem langjährigen Lektor in die Wolle gekriegt. Das ist zwar nichts Besonderes in dem Gewerbe. Aber hier war es anscheinend wirklich ernst. Der Lektor hatte dem Autor an den Kopf geworfen, er hätte sein Sprachgefühl verloren und würde nur noch im Dreck herumwühlen. Statt Romane solle er doch lieber vulgäre Texte für Pornofilme schreiben, falls es da überhaupt welche gab. Der Autor hatte daraufhin verlangt, einen jungen unverbrauchten Lektor zu bekommen, der ein Gefühl für die Sprache der Gegenwart hätte.
»Und warum nimmst du nicht einen der erfahrenen Lektoren aus dem Verlag?«, fragte Waldemar.
»Weil niemand mit Schulze zusammenarbeiten will. Ich denke, du bist genau der, den der Mann jetzt braucht. Wenn es zwischen euch funktioniert, ist das ein Riesensprung für dich. Jeder Lektor, außer denen, die ihn kennen, reißt sich darum, einen solchen Erfolgsautor zu betreuen.«
»Wie kommst du darauf, dass ausgerechnet ich Neuling mit dem Kerl zurechtkomme? Ich hab schon mal was von ihm gelesen. Das hat mich aber nicht vom Stuhl gerissen.«
»Das ist doch eine gute Voraussetzung. Motiviere ihn, so zu schreiben, dass es dich vom Stuhl reißt. Ihr seid seelenverwandt. So, wie du mit unserem Personalchef umgegangen bist, so pflegt dieser Autor mit Lektoren umzugehen. Ihr liegt auf derselben Frequenz.«
»Und du meinst nicht, dass es Mord und Totschlag gibt, wenn ich mit ihm arbeite?«
»Das werden wir sehen. Wenn du tot bist, schicke ich dir einen Kranz.«
Er machte sich also am übernächsten Tag auf den Weg nach München. Im Zug las er die letzten Kapitel des neuen Manuskripts von Reginald Schulze. Er hatte sich schon einen Tag und eine Nacht damit um die Ohren gehauen und war entsetzt. Er wusste nicht, wie oft er dabei mit dem Kopf geschüttelt oder sich die Haare gerauft hatte. Bestimmt trieb es ihm zwischendurch auch die Schamesröte ins Gesicht. Wie konnte ein Schriftsteller, der im Prinzip sehr gut mit der deutschen Sprache umzugehen imstande war, nur derart obszönes Zeug zu Papier bringen? Die Handlung war gar nicht schlecht. Jedenfalls würde seine Lesergemeinde auf ihre Kosten kommen. Es ging um das Thema Missbrauch und die Verstrickungen hochgestellter Persönlichkeiten darin, unter anderem von Polizei und Staatsanwaltschaft. Aber musste man das derart drastisch ausbreiten?
Am Ziel angekommen, fuhr er in das Hotel, das der Verlag für ihn gebucht hatte. Gehobene Mittelklasse zu einem Schweinepreis. Das ist halt München. Er bekam einen Anruf von der Assistentin des Programmleiters, die ihm mitteilte, dass Dirk Schwalbe nicht im Hause sei. Er solle am nächsten Morgen direkt zu Reginald Schulze gehen, um sich bei ihm vorzustellen.
»Kennen Sie den Mann?«, fragte er sie.
»Natürlich.«
»Und wie ist er so?«
»Er ist ein hervorragender und äußerst erfolgreicher Schriftsteller. Sozusagen eines unserer besten Pferde im Stall.«
»Das weiß ich selber.«
»Also, Sie wollen wissen, was für ein Typ er ist? Na gut. Schulze ist ein absonderlicher alter Kauz, den manche Leute nicht mal grüßen würden, wenn man sie dafür bezahlt. Man stellt ihm Fragen, und er antwortet nicht. Er kann einen stundenlang anschweigen. Dann redet er plötzlich wie ein Wasserfall. Er beleidigt seine Mitmenschen und zieht Grimassen. Seinen letzten Lektor hat er zum Schluss nur noch mit Arschgesicht angeredet. Zum Glück geht er nicht auf Lesungen. Und er gibt auch keine Interviews. Kaum jemand weiß, welche Person sich hinter dem Namen des Schriftstellers verbirgt. Ich kann Ihnen garantieren, dass Sie Ihre Freude an ihm haben werden.«
»Das hört sich ja echt spannend an. Und so ermutigend.«
»Viel Erfolg!«, kicherte sie ins Telefon und beendete das Gespräch.
Nachdem er abends in einem Restaurant gegenüber dem Hotel gegessen hatte, zog er sich auf sein Zimmer zurück, um sich noch etwas mit dem Machwerk des Reginald Schulze zu beschäftigen. Irgendwann läutete sein Smartphone. Es war seine Schwester Christine.
»Hallo, großer Bruder.«
»Hallo, Schwesterchen.«
»Wo steckst du denn, Waldemar?«
»In München. Ich habe hier beruflich zu tun.«
»Das gibt es doch nicht. Ich komme morgen auch nach München. Ich habe da ein Bewerbungsgespräch. Vielleicht sehen wir uns ja noch.«
»Melde dich einfach, wenn du da bist. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich hier brauche.«
Er hatte ganz vergessen, Christine zu fragen, wo sie sich vorstellen wollte. Studiert hatte sie Amerikanistik, Schwerpunkt Literaturwissenschaften. Zusätzlich hatte sie noch ein Dolmetscher-Diplom in Englisch erworben. Sie hatte ein Schuljahr in den USA verbracht und zwei Semester in New York studiert. Christine, mittlerweile eine gut aussehende Frau von fünfundzwanzig, hatte in den letzten Jahren einen enormen Verbrauch an Männern gehabt. Zurzeit wohnte sie in Hamburg. Da ihr letzter Freund ausgezogen war, konnte sie die Wohnung nicht länger halten. Sie brauchte entweder einen wesentlich besser bezahlten Job oder sie müsste in eine andere Gegend ziehen. Dann rief er Reginald Schulze an, der sich mit einem knappen Ja meldete.
»Waldemar Möser. Guten Abend, Herr Schulze. Ich bin Ihr neuer Lektor und wollte für morgen früh einen Termin mit Ihnen ausmachen.«
Die kurze Antwort war: »Elf Uhr hier bei mir.« Dann legte er auf.
Waldemar war einigermaßen perplex. Übermäßige Geschwätzigkeit konnte man dem Mann wirklich nicht vorwerfen.
Fünf vor elf hielt das Taxi vor dem Haus des Schriftstellers in der Widenmayerstraße. Welch noble Adresse. Eine echte Prachtstraße an der Isar. Fast jedes Haus ein Baudenkmal. Der Mann musste entweder von Haus aus reich sein oder ein Schweinegeld verdienen mit seiner Schreiberei, um hier zu wohnen. Er betrat das Haus und benutzte den altertümlichen Aufzug. Im 3. Stockwerk angekommen, klingelte er. In der Wohnung gegenüber öffnete sich eine Tür und eine sehr alte Dame mit Rollator trat auf den Flur. Eine Sekunde später machte dann auch Reginald Schulze seine Tür auf. Die alte Dame, die schwerfällig zum Aufzug taperte, wurde von ihm gegrüßt: »Guten Tag, meine Gnädigste.« Als Erwiderung kam mit einer altersdünnen Stimme: »Halt die Fresse, du Schwuchtel.« Waldemar bekam vor Staunen den Mund nicht zu. Als er sich zu der alten Dame umwandte, erhob sie gerade eine Hand und streckte den Mittelfinger aus. Schulze sah ihn grinsend an und reichte ihm die Hand.
»Du bist dieser komische Waldemar?«
»Ob ich komisch bin, weiß ich nicht. Auf jeden Fall bin ich Ihr neuer Lektor.«
»Gut, komm rein. Vorsicht, am Anfang des Salons ist ein Loch im Fußboden.«
Er folgte ihm über einen langen Flur und betrat dann das, was Schulze als Salon bezeichnet hatte. Sekundenbruchteile später fand er sich auf dem Boden wieder.
»Ich hab doch gesagt, da ist ein Loch im Fußboden«, sagte der Mann genervt.
Das Loch war mit einem Teppich bedeckt. Waldemar fragte sich, warum man den Fußboden nicht einfach reparierte, während er seine Aktentasche aufhob. Der Salon war ein Zimmer von vielleicht fünfzig Quadratmetern Fläche, vollgestopft mit Möbeln verschiedener Epochen – Barock, Rokoko, Jugendstil. Die diversen Tische und Anrichten waren überhäuft mit Geschirr, benutzt und unbenutzt, Blumenvasen, Porzellanfiguren, Büchern, Bergen von Papier. Die Wände beherbergten Bücherregale vom Fußboden bis zur Decke. Die Vorhänge an den großen Fenstern waren wahrscheinlich vor dem Zweiten Weltkrieg zum letzten Mal gewaschen worden. Aber man hatte einen traumhaften Ausblick auf die Isar, da die gegenüberliegende Straßenseite nicht bebaut war. Direkt vor dem Fenster gab es einen zierlichen barocken Schreibtisch, an dem Schulze sich nun niederließ. Er fragte sich, wie ein Schriftsteller mit solch einem kleinen Tischchen auskam, zumal es haufenweise Platz gab in diesem riesigen Raum. Er bot Waldemar den Hocker an, der danebenstand. Die diversen plüschigen Sessel und Sofas waren allesamt mit Papierkram bedeckt.
Offenbar erriet er Waldemars Gedanken und sagte: »Meine Putzfrau ist eine Schlampe.«
»Ach, Sie haben eine Putzfrau?«
Ohne auf diese blöde Bemerkung einzugehen, sagte er: »Übrigens, wer meine Bücher lektoriert, hat nicht das Privileg, mich zu siezen. Ich heiße Reginald, falls dir das noch nicht bekannt sein sollte.«
Reginald war Anfang siebzig, von mittelgroßer Statur und schlank. Er trug eine schmuddelig wirkende beige Hose, ein ebensolches Jackett und ein grasgrünes T-Shirt darunter. Mit seinem Dreitagebart und dem schütteren grauen Haar wirkte er eher ungepflegt. Als beide saßen, stand er wieder auf und sagte: »Ich habe den Kaffee vergessen. Komm mit in die Küche.«
Er folgte ihm durch das Chaos des Salons in den Nebenraum. Es handelte sich um ein riesengroßes dunkles Zimmer mit einem uralten Küchenbuffet und diversen Schränken. In der Mitte des Raumes stand ein großer Tisch, auf dem offenbar wahllos alles abgestellt wurde. Tüten mit Zucker, Mehl, Nudeln und Reis, dazwischen Geschirr, halb volle Marmeladengläser, Batterien, ein Brotkorb, eine edle Silberschale mit halb vergammeltem Obst. In dem uralten Spülstein aus Keramik türmte sich schmutziges Geschirr. Reginald stellte einen vorsintflutlichen Heißwasser-Boiler an und holte zwei Tassen aus einem der Schränke. Von dem Tisch angelte er zielsicher ein Glas Instantkaffee und kippte in jede Tasse eine große Portion.
»Nimmst du Zucker? Milch gibt es nicht.«
»Nein, danke.«
Dann füllte er die Tassen mit dem heißen Wasser aus dem Boiler auf, reichte ihm eine, und sie gingen zurück in den Salon. Wieder am Schreibtisch, sagte er: »So, nun erzähle, wie du dir unsere Zusammenarbeit vorstellst.«
Waldemar legte ihm seine Arbeitsweise dar und war darauf gefasst, dass er alles rundherum ablehnen würde.
Stattdessen sagte er knapp: »So machen wir es. Und wie ist dein erster Eindruck von meinem Buch?«
»Tja, Spannung und Erzählkunst sind typisch Reginald Schulze. Allerdings gibt es da etwas, was mich stört. Ich halte eine derartige Ansammlung von Obszönitäten nicht für angebracht.«
»Das ist dein Problem. Ich halte das sehr wohl für angebracht.«
Entschuldige, Reginald, aber wenn auf einer Seite fünf Mal das große F-Wort steht und drei Mal das kleine F-Wort, dann ist das für mein Gemüt zu viel. Zum Beispiel das große F-Wort auf Seite 116, also zumindest am Schluss kannst du darauf wirklich verzichten.«
Reginald sah ihn an, als hätte er ihm eine geknallt und entgegnete ganz souverän: »Die Fotze bleibt drin.«
»Sie muss raus.«
»Sie bleibt da stehen, wo ich sie hingesetzt habe.«
»Das ist starrsinnig von dir, aber nicht logisch begründet.«
»Es geht nicht um Logik, sondern um Sprache. Meine Romanfigur ist eine Drecksau, sie benimmt sich wie eine Drecksau und sie spricht wie eine Drecksau.«
»Aber Reginald, auch Drecksäue müssen nicht fünf Mal hintereinander dieses Wort benutzen.«
»Meine Romanfigur schon.«
»Gut, das klären wir später im Gesamtkontext. Das war ja nur ein Beispiel.«
Dann klingelte es an der Tür. Reginald stand auf, um zu öffnen. Kurz danach kam er wieder in den Salon, hinter ihm die Nachbarin mit dem Rollator.
»Vorsicht, gnädige Frau«, sagte er. »Sie wissen doch – das Loch. Nicht, dass Sie sich noch auf die Schnauze legen.«
Reginald ging weiter in die Küche und kam zurück mit einer angebrochenen Tüte Zucker, die er der Dame in die Ablage des Rollators stellte.
»Ach, das ist nett. Ich habe vergessen, welchen zu kaufen.«
»Dafür sind Nachbarn da«, sagte er.
Jetzt erblickte die Frau Waldemar und nickte ihm freundlich zu: »Grüß Gott, junger Mann.«
Er grüßte höflich zurück: »Guten Tag, gnädige Frau.« Warum er sie so anredete, wusste er auch nicht. Das war ihm in seinem ganzen Leben noch nicht über die Lippen gekommen.
Jedenfalls entgegnete sie: »Machen Sie mich ja nicht an. Ich bin keins von diesen leichten Mädchen.«
Dann machte sie kehrt, Reginald hinter ihr, um sie hinauszugeleiten. Waldemar kam sich vor wie aus der Zeit gefallen. Diese großzügige heruntergekommene Wohnung in einer der teuersten Gegenden Münchens, die Nachbarin, die Reginald erst sagt, er soll die Fresse halten, dann vor der Tür steht, um sich Zucker zu leihen und ihn ermahnt, er solle sie nicht anmachen. Dazu noch eine Putzfrau, die eine Schlampe ist, was er nur bestätigen konnte. Offenbar gab es hier eine größere Ansammlung von Verrückten. Als Reginald zurückkam, war sein Lektor in Gedanken versunken.