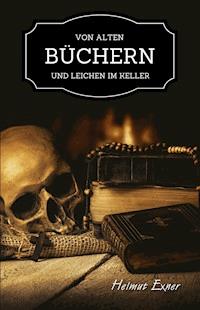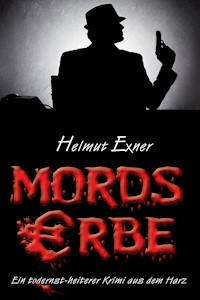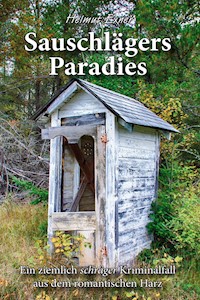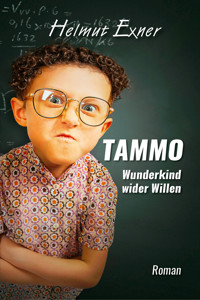Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Elektronik-Praktiker
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Eine Künstlerin malt eine Serie von Bildern, auf denen Menschen ermordet werden. Die Werke verkaufen sich gut. Dann werden nach und nach die Eigentümer dieser Gemälde umgebracht, und zwar in der Weise, wie auf den Bildern dargestellt. Das letzte Motiv befindet sich bei Lilly Höschen. Ihr Großneffe Amadeus und zwei ehemalige Schüler, darunter auch Rio, helfen der Miss Marple des Harzes, die Todesfälle aufzuklären. In der Parallelhandlung erzählt Rio seine persönliche Geschichte, die in Brasilien beginnt und dann über Hamburg in den Harz führt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 227
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Helmut Exner
RIO und die mörderischen Bilder
HARZKRIMI
Impressum
Rio und die mörderischen Bilder
ISBN 978-3-96901-063-1
Kindle Edition
V1.0 (07/2023)
© 2023 by Helmut Exner
Abbildungsnachweise:
Umschlag © iconogenic | #65076419 | depositphotos.com
Porträt des Autors © Ania Schulz | as-fotografie.com
Lektorat:
Sascha Exner
Verlag:
EPV Elektronik-Praktiker-Verlagsgesellschaft mbH
Obertorstr. 33 · 37115 Duderstadt · Deutschland
Fon: +49 (0)5527/8405-0 · Fax: +49 (0)5527/8405-21
Web: harzkrimis.de · E-Mail: [email protected]
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Die Schauplätze dieses Romans sind bis auf Kleinbötelkamp reale Orte. Die Handlung und die Charaktere hingegen sind frei erfunden. Eine Ausnahme bilden in diesem Buch lediglich Vera und Edy, das belgische Musikerehepaar, das seit vielen Jahren regelmäßig den Harz bereist und diverse Harzkrimi-Lesungen unter dem Namen Edy en de Veras musikalisch bereichert. Auf ihren Wanderungen treffen die beiden in der Regel aber nicht auf Leichen. Ansonsten wären etwaige Ähnlichkeiten mit lebenden und toten Personen reiner Zufall und sind nicht beabsichtigt.
Inhalt
Titelseite
Impressum
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Über den Autor
Mehr von Helmut Exner
Eine kleine Bitte
Kapitel 1
Rio erzählt
Ich heiße Rio Rakete. Meine Vorfahren mütterlicherseits stammen aus einer Hugenottenfamilie, die, aus Frankreich kommend, Schutz in Preußen gefunden hatten. Bis 1935 schrieb sich der Name Raquette, was einem deutschen Standesbeamten offenbar ein Dorn im Auge gewesen war und er die Schreibweise auf der Geburtsurkunde meines Großvaters eigenmächtig in Rakete umwandelte. Zweifellos gibt es schlimmere Namen, zum Beispiel Müller, Meier, Schulze, Höschen oder Fischmaul. Aber dazu später mehr.
Meine Mutter, Jahrgang 1951 – ja, Großvater hat früh angefangen oder er hatte keine Ahnung von Empfängnisverhütung – heißt Josefine Rakete. Als sie das Licht der Welt erblickte, waren ihre Eltern sechzehn. Sie wurde in den ersten Jahren von ihren Großeltern aufgezogen, während ihr Vater eine Ausbildung im Familienbetrieb absolvierte und ihre Mutter in ihrem eigenen Elternhaus wohnte, da sie ja nicht verheiratet waren. Mit einundzwanzig heirateten sie und führten eine prima Ehe, obwohl alles so holprig angefangen hatte. Meine Mutter Josefine entwickelte sich zu einem Späthippie und reiste 1973 nach Brasilien. Dort trat sie einer Art Kommune bei, die nördlich der Stadt Rio de Janeiro in einer fröhlichen Gemeinschaft der freien Liebe frönte. Die heitere Stimmung hielt allerdings nicht lange an. Sie waren sowohl den Einheimischen wie auch der autoritären Staatsmacht ein Dorn im Auge. Abgesehen von der miserablen wirtschaftlichen Lage war die Gefahr, in den Kerkern des Systems zu verschwinden, erheblich. Außerdem hatten die Mitglieder der Kommune nach einiger Zeit die Schnauze voll von dem armseligen Dasein. Nach und nach löste sich die Gruppe auf. Einige gingen zurück in die Heimat und wurden Lehrer, Bankdirektor, Sozialarbeiter, Sozialhilfeempfänger oder Politiker. Andere blieben in Brasilien, landeten in der Armut oder machten Karriere.
Meine Mutter ging mit ihrem Freund Maximilian Graf Fischmaul de la Rosée nach Rio de Janeiro. Maxi entstammt einer alten Hamburger Fischhändler-Dynastie. Seine Vorfahren waren reiche jüdische Händler in Spanien. Als man vor Jahrhunderten anfing, die Juden aus Spanien zu vertreiben oder zu vernichten, hatte diese wohlhabende Familie, die sich sogar einen Adelstitel erkaufen konnte, so viel Geld und Besitz im Ausland angehäuft, dass man rechtzeitig die Flucht ergreifen konnte, ohne in Armut zu geraten. In Hamburg wurden sie willkommen geheißen unter der Voraussetzung, dass man die christlich-protestantische Religion annahm, großzügige Zuwendungen an diverse Honoratioren vornahm und sich einen neuen Namen zulegte. Aus den Vorschlägen Bitter, Süß, Sauer und Fischmaul wählte man Letzteren. Ein weiterer Obolus erhielt ihnen zudem den Grafentitel de la Rosée, was auf alten spanischen Adel schließen lässt.
Dieser Maximilian Graf Fischmaul de la Rosée, kurz Maxi, ist mein Erzeuger. Ich wurde 1976 in Rio de Janeiro in einem armseligen Hospital in einer Favela geboren. Josefine ließ den Namen Rio in die Geburtsurkunde eintragen. So würde sie wenigstens nicht vergessen, wo ich das Licht der Welt erblickt hatte. Maxi nahm wieder Kontakt zu seinen Eltern auf und schilderte seine Lebenssituation. Diese waren gewillt, ihm zu helfen, wenn er denn endlich bereit wäre, Vernunft anzunehmen. Sie besorgten Flugtickets für Maxi, Josefine und mich.
Meine Mutter kam mit den großbürgerlich-hanseatischen Gepflogenheiten in Hamburg überhaupt nicht zurecht. Und Maxis Eltern konnten sich diese Emanze absolut nicht als Schwiegertochter vorstellen. Das Verhältnis zwischen Josefine und meinem Erzeuger war nicht gerade von besonderer Zuneigung durchdrungen. Folglich entschied man sich, getrennt voneinander zu leben. Maxi nahm in Hamburg ein Studium der Betriebswirtschaft auf, nachdem ihn meine Großeltern erst zum Friseur und dann zum Herrenausstatter geschickt hatten. Er sollte später in das Familiengeschäft einsteigen und hatte sich den Sitten und Gebräuchen der Gesellschaft anzupassen. Meine Mutter ging mit mir in den Harz, wo sie mich bei den Großeltern parkte, um in Göttingen Sozialwissenschaften zu studieren.
Kapitel 2
Rio erzählt
Meine Mutter, die es sich verbat, mit Mama oder Mutti angeredet zu werden, für mich also schlichtweg Josefine, fand das Studium ermüdend. Alles viel zu wissenschaftlich und fernab vom praktischen Leben. Aber sie hielt durch. Da meine Großeltern nicht auf Rosen gebettet waren, konnten sie ihr keine großen Zuwendungen machen. Josefine arbeitete abends in einer Studentenkneipe, um Geld zu verdienen. Sonst hätte sie sich das Zimmer in ihrer WG nicht leisten können. Nach fünf Jahren hatte sie ihren Abschluss mit einem mäßigen Ergebnis geschafft und nahm eine miserabel bezahlte Stelle als Beraterin für Migranten in Brüssel an. Ihre Sprachkenntnisse in Portugiesisch, Französisch und Englisch waren dabei von Vorteil. Mit ihrem mäßigen Abschluss hatte sie Glück, diesen obendrein befristeten Job überhaupt zu bekommen. Als sonderlich befriedigend empfand sie diese Arbeit nicht. Sie sollte noch lange eine Suchende bleiben, bis sie ihren Platz gefunden hatte.
Ich war inzwischen in dem Städtchen Clausthal-Zellerfeld im Oberharz eingeschult worden. Meine Großeltern Hertha und Gotthilf waren glücklich, dass es mich gab. So empfand ich es zumindest. Da sie ihre Tochter im Teenageralter bekommen hatten, waren sie relativ jung, als sie mich in ihre Obhut nahmen. Die Eltern vieler anderer Kinder waren kaum jünger als meine Großeltern. Goddi, wie Opa von allen genannt wurde, war selbstständiger Glasermeister. Den Betrieb hatte er von seinem Vater übernommen. Mehr als einen Gesellen und einen Lehrling konnte er sich nicht leisten. Oma kümmerte sich um den Bürokram. Trotz der vielen Arbeit hatten Goddi und Oma immer Zeit für mich. Von Maxis Familie kamen monatliche Zuwendungen, wovon Oma einen Teil an Josefine überwies und einen weiteren Teil für meine Zukunft anlegte.
Ich war ein ebenso fröhliches wie nachdenkliches Kind. Die Grundschule bereicherte mein Leben. Trotzdem genehmigte ich mir den einen oder anderen freien Tag. Es reichte, Oma zu sagen, ich hätte Kopfschmerzen, und schon konnte ich einen Tag auf dem Sofa verbringen. Dann erfand ich Geschichten, die ich manchmal auch aufschrieb. Als ich meiner geliebten Lehrerin in der vierten Klasse, einer sehr jungen Frau, einmal eine dieser Geschichten zu lesen gab, war sie zutiefst beeindruckt und sagte, ich solle unbedingt weitermachen mit dem Schreiben.
Dann kam ich aufs Gymnasium. Meine Großeltern waren stolz auf mich. Ihre Tochter hatte es zwar auch geschafft, Abitur zu machen. Aber bei mir nahmen sie offenbar mehr Anteil. Für Josefine war mein Wechsel aufs Gymnasium nichts Besonderes. Sie sagte nur, dass ich mich von den bekloppten Lehrern an dieser Schule, die sie ja auch besucht hatte, nicht verrückt machen lassen sollte. Sie meinte, diese Schule sei ein Sammelsurium von Möchtegernen und gescheiterten Existenzen. Die meisten Lehrer dort hätten diesen Beruf ergriffen, weil sie sonst nichts im Leben bewerkstelligen könnten. Mit dieser Motivation ausgestattet, musste ich feststellen, dass es da durchaus einige Lehrkräfte gab, die in anderen Berufen besser aufgehoben gewesen wären. Vielleicht als Zahnärzte, Verwaltungsangestellte, Gefängniswärter oder Busfahrer. Am dritten Tag betrat unsere Deutschlehrerin das Klassenzimmer. Sie stellte sich vor als Fräulein Lilly Höschen. Ich war fasziniert. Sie war etwa im Alter meiner Großeltern. Eine kleine dünne Frau mit einer schicken Frisur, einer lauten Stimme und einem freundlichen Lächeln, das nicht darüber hinwegzutäuschen vermochte, dass sie der Boss war.
Kapitel 3
Die drei Männer saßen brav an Lilly Höschens Esstisch im Wohnzimmer und warteten. Ihre Freundin Gretel, die wieder einmal für einige Tage zu Besuch in Lautenthal war, hatte sie hereingelassen und vertröstet, dass das Fräulein noch einen Moment brauche. Bei den Männern handelte es sich um Lillys Großneffen Amadeus und die ehemaligen Schüler Antek Spielmann und Rio Rakete. Die drei hatten das Gymnasium in unterschiedlichen Jahrgängen besucht. Amadeus war 44, Rio 46 und Antek 48 Jahre alt. Amadeus und Antek kannten sich gut, da beide in Lautenthal aufgewachsen waren. Rio kannte die beiden anderen nur oberflächlich, da er als Kind in Clausthal-Zellerfeld gewohnt hatte.
Lilly hatte die drei für heute Nachmittag eingeladen, weil sie sich von ihnen in einer prekären Angelegenheit ihre Hilfe erhoffte. Antek Spielmann lief ihr gelegentlich über den Weg, weil er abwechselnd in Polen und in Lautenthal wohnte. Wenn er ihr auf der Straße oder bei sonstigen Gelegenheiten begegnete, hatte er immer ein flaues Gefühl im Magen. Denn meistens passierte es, dass sie ihn mit der einen oder anderen tadelnden Bemerkung traktierte. Es war ihm klar, dass er nicht ganz unschuldig daran war. Er hatte einen unbändigen Drang zur Albernheit und erzählte die tollsten Lügengeschichten. Ihr Großneffe Amadeus schaute fast jede Woche bei ihr vorbei, mal mit und mal ohne Frau und Kinder. Seit dem Alter von zwölf Jahren war Lilly für ihn Elternersatz. Zu Rio hatte sie lange keinen Kontakt mehr gehabt.
Als Lilly das Zimmer betrat, standen die drei Männer auf wie Musterschüler. Das Fräulein strahlte sie an. Antek und Rio überreichten ihr brav ihre Blumensträuße. Man setzte sich, und Gretel brachte Kaffee und Kuchen, um dann in der Küche zu verschwinden. Sie war zwar neugierig, wollte aber im Moment lieber nicht wissen, was Lilly schon wieder im Schilde führte. Zunächst fragte Lilly Antek, ob ihm während der Corona-Zeit nicht langweilig gewesen wäre, da er ja nicht, wie sonst gewohnt, in aller Welt herumreiste, um seine Kunden zu besuchen.
»Nein, Fräulein Höschen, ich war auf allen Kontinenten, habe so viel gesehen, ich bin froh, wenn ich von zu Hause aus arbeiten kann oder in meinem Büro in Krakau.«
»Und was ist mit dir, Rio? Von dir weiß ich am wenigsten. Was hast du in all den Jahren getrieben? Ich hatte ja gehofft, dass aus dir ein Schriftsteller wird.«
»Oh, das kann ja noch werden. Aber ich habe meine Liebe zur Architektur entdeckt. Ich habe Projekte in aller Welt realisiert. Aber damit ist jetzt erst mal Schluss.«
»Warum das denn?«
»Das Unternehmen, für das ich lange gearbeitet habe, hat Pleite gemacht.«
»Oh, ich hoffe, du bist nicht schuld daran.«
»Nein, meinen Teil der Arbeit habe ich bestens erfüllt. Das Problem ist, dass meine Kollegen vergessen haben, Aufzüge einzuplanen. Und nun ist das Gebäude, das übrigens in Südamerika steht, fertig, und niemand weiß, wie man da hoch kommen soll. Es sei denn, man ist sportlich und benutzt die Treppen, die ich selbstverständlich eingebaut habe.«
»Wieviele Stockwerke hat denn das Gebäude?«
»Dreiundfünfzig.«
Alle brachen in schallendes Gelächter aus. Nachdem man sich wieder beruhigt hatte, fragte Lilly: »Aber du suchst dir bestimmt eine neue Stelle?«
Amadeus warf ein: »Am besten im Flachbau-Bereich.«
»Lacht nur. Wenn ich mich irgendwo bewerbe und man sieht, wo ich vorher gearbeitet habe, werden sich die Leute auch totlachen. Ich denke, ich steige jetzt doch bei meinem Vater ein.«
»Was macht denn dein Vater?«, wollte Antek wissen.
»Er ist Deutschlands größter Fischhändler.«
»Das passt«, sagte Amadeus. »Fische brauchen keine Aufzüge.«
Man alberte noch eine Zeitlang drauflos, und Lilly fragte: »Bist du verheiratet, Rio?«
»Ja, seit einem Jahr.« »Kinder?«
»Wir üben noch.«
»Na, dann viel Spaß und guten Erfolg!«
»Danke.«
Jetzt erhob sich Lilly, wandelte gemächlich um den Tisch herum und dozierte: »Ihr werdet euch sicherlich fragen, warum ich euch hierher gebeten habe. Zunächst einmal herzlichen Dank, dass ihr meiner Einladung gefolgt seid. Drei so bedeutende, vielbeschäftigte Männer an den Kaffeetisch einer alten Frau zu kriegen, ist schon etwas Besonderes. Nun gut, ich habe euch hierher gebeten, weil ihr die albernsten Menschen seid, die ich in meinem langen Leben kennengelernt habe.«
Während Antek und Rio in sich hinein lachten, sagte Amadeus: »Tante Lilly, was redest du denn da für einen Unfug?«
»Unterbrich mich nicht, sonst verliere ich den Faden. Also, bei Amadeus verhält es sich so, dass er unfreiwillig komisch ist. Irgendeine missgünstige Fee muss ihm wohl bei der Geburt etwas mitgegeben haben, dass ihm jedes Missgeschick passiert, das man sich nur vorstellen kann. Er kippt mit dem Stuhl um, setzt sich auf Torten, fällt nackt vom Dach mitten in eine Cafeteria, verklemmt den Rock einer fremden Frau in seinem Hosenschlitz, fällt mit einer besoffenen Psychologin in mein Rosenbeet, lässt sich bei einer amourösen Begebenheit im Wald die Kleidung klauen, sodass er nackt nach Hause kommt ...«
Jetzt sprang Amadeus auf und sagte aufgeregt: »Tante Lilly, hörst du wohl auf, mich derart ...«
»Ach Amadeus«, unterbrach sie ihn, »mehr sage ich gar nicht. Es ist, wie es ist. Und ich liebe dich trotzdem von Herzen. Ohne deine Eskapaden wäre mein Leben ärmer. Im Gegensatz zu ihm bist du, Antek Spielmann, ganz bewusst ein alberner Kerl. Du wirfst in einem Kaufhaus Hunderte von Bällen von der Empore in die Lebensmittelabteilung, bringst einem chinesischen Geschäftsmann bei, er solle seine Gesprächspartner mit dem Satz ›Ich habe keine Unterwäsche an‹ begrüßen oder beleidigst deinen Chef derart, dass er Gegenstände nach dir wirft. In der Schule hast du eine Karikatur des Direktors an die Tafel gemalt und ihm einen Mini-Penis verpasst ...«
Jetzt sagte Antek: »Das wussten Sie?«
»Natürlich, und ich habe es sehr genossen, da ich diesen Kerl auch nicht ausstehen konnte. Ich habe dich nicht verraten und hoffe, du weißt das zu schätzen.«
»Oh, dafür bin ich Ihnen wirklich sehr dankbar.«
»Und nun zu dir, Rio Rakete: Du bist so eine Art Mischung aus gewollt und unfreiwillig komischem Heini. Der Grund, warum ich euch nicht pünktlich empfangen habe, war, dass ich dein Heft mit Klassenarbeiten in Deutsch herausgekramt habe. Normalerweise werden alle Klassenarbeiten für zehn Jahre in der Schule archiviert und dann vernichtet. Dein Heft habe ich damals gestohlen beziehungsweise unterschlagen, weil es einfach zu schade gewesen wäre, es zu vernichten.« Jetzt holte sie ein DIN-A-5-Heft vom Sideboard, setzte sich und betrachtete es. Auf dem Etikett war eine Rakete aufgemalt, in die das Wort RIO geschrieben war. Daneben stand Deutsch Klassenarbeiten, Klasse 5b. »Am Ende der fünften Klasse hast du folgenden Aufsatz geschrieben:
Ein Urlaubserlebnis
Endlich waren Ferien. Meine Großeltern fuhren mit mir an die Nordsee. Opa Goddi und Oma waren im Strandkorb eingeschlafen. Es war Flut und ich ging mit der Luftmatratze ins Wasser. Eigentlich darf man nicht mit einer Luftmatratze ins Meer gehen, weil man leicht abgetrieben werden kann. Aber das nahm ich nicht so ernst. Und dann passierte es. Ich wurde immer weiter hinaus getrieben. Die Ebbe setzte ein und das Wasser floss vom Ufer weg. Nach einiger Zeit war der Strand außer Sichtweite. Ich hatte Angst. Da sah ich einen riesigen Fisch. Nein, das war kein Fisch, sondern ein Wal. Er kam auf mich zu geschwommen und sagte: »Du bist ziemlich leichtsinnig. Wie willst du denn jetzt zurück an Land kommen?« Ich antwortete: »Wale können nicht sprechen.« Aber der Wal sagte: »Ich schon. Ich kann dir auch helfen, zurück an den Strand zu kommen. Übrigens, mein Name ist Lilly.« Ich sagte: »Lilly, bitte hilf mir.« »Na gut. Aber du musst genau das tun, was ich dir sage.« »Das mache ich«, antwortete ich. »Also«, sagte Lilly, »ich öffne jetzt mein Maul und du paddelst mit deiner Luftmatratze hinein.« Gesagt, getan. Ich hatte zwar Angst. Aber ich vertraute Lilly, dem Wal. Es war dunkel im Bauch des Wals, aber ich fühlte mich sicher, weil ich Lilly vertraute. Nach einiger Zeit öffnete sich das Maul des Wals und ich paddelte hinaus. Nach ein paar Metern konnte ich im Watt stehen. Jetzt sah ich wieder den Strand. Ich drehte mich um zu Lilly und sagte: »Vielen Dank. Du hast mich gerettet.« Der Wal rief mir zu: »Gern geschehen« und schwamm zurück ins tiefe Wasser. Als ich wieder am Strandkorb meiner Großeltern war, fragte Opa Goddi: »Warst du etwa allein im Wasser?« Ich antwortete: »Ja. Ich wäre fast ertrunken, aber ein Wal hat mich geretet.« »Na, das ist ja prima«, sagte Goddi. »Der Wal hieß Lilly«, sagte ich noch. Aber da schlummerte Goddi schon wieder ein.
Amadeus fing an zu lachen und prustete: »Lilly, der Wal.«
»Lach nur, Amadeus. Ich habe nie wieder erlebt, dass ein Fünftklässler einen solchen Aufsatz geschrieben hat.« Und an Rio gewandt: »Ich habe dir natürlich eine Eins gegeben. Und ich hatte die Hoffnung, dass aus dir ein Schriftsteller wird. Deine enorme Fantasie ist wohl auch der Grund, dass du so ein begnadeter Lügner bist. Außerdem hast du immer wieder die absurdesten Sachen gemacht. Warum hieß der Wal eigentlich Lilly?«
Rio war verlegen und antwortete: »Sie waren für mich eine Art Offenbarung. Ich habe Sie vom ersten Moment an geliebt. Und das ist nicht gelogen. Und da Wale für mich als Kind schon meine Lieblingswesen waren, musste er einfach Lilly heißen.«
Lilly war gerührt. Dann sagte sie: »Der Grund, warum ich euch herbestellt habe, ist, weil ich eure Hilfe brauche. Das heißt, nicht ich selbst brauche eure Hilfe, sondern eine ehemalige Schülerin: Susanne Hermanns.«
Kapitel 4
Rio erzählt
In meiner Kindheit kam mein Vater einmal im Jahr für ein paar Tage in den Harz, um mich zu besuchen. Der erste Tag war immer aufregend, weil es Geschenke gab. Ansonsten vermochte ich nicht viel mit ihm anzufangen – und er auch nicht mit mir. Ich wäre lieber mit den Nachbarskindern baden gegangen. Maxi kam mir vor wie ein dressierter Affe. Heute weiß ich, warum er so ist, wie er ist. Er hatte eine freudlose Kindheit, in der er auf seine Rolle des künftigen Firmenchefs vorbereitet wurde. Da er ein Einzelkind war, setzten seine Eltern ihre ganze Hoffnung auf ihn. Nachdem er endlich sein Abitur mit Ach und Krach geschafft hatte, zog es ihn, zum Entsetzen seiner Eltern, hinaus in die Welt. Sie genehmigten ihm ein Jahr Auszeit, die sie Bildungsreise nannten. Zuerst flog er nach Kalifornien. Als sein Visum dort sechs Monate später abgelaufen war, zog es ihn nach Brasilien, wo er Josefine kennenlernte. Drei Jahre vergingen, und er musste sich eingestehen, dass er nicht bereit war, die Welt weiterhin durch seine Lebensweise zu verbessern. Er war im Elend gelandet und sich zugleich seiner Verantwortung bewusst, seinem Sohn ein solches Leben zu ersparen. Maxis Eltern fielen diverse Steine vom Herzen, als sie seinen Hilferuf erhielten. Als sie ihn sowie Josefine und mich, ich war damals knapp ein Jahr alt, vom Flughafen abholten, erkannten sie ihren Sohn kaum wieder, so heruntergekommen, wie er war. In ihrer pragmatischen Art hatten sie längst einen Plan geschmiedet, ihren Sohn auf Linie zu bringen. Wie schon gesagt, fing es an mit dem Frisör, der ihn wieder vorzeigbar machte, setzte sich fort mit einem Besuch beim Herrenausstatter und endete mit der Immatrikulation an der Universität. Josefine ließ das selbstverständlich nicht mit sich machen. Sie wollte keine Vorzeige-Schwiegertochter sein, die ein Dasein als Anhängsel ihres Mannes fristen würde. Nach ein paar Wochen packte sie ihre Sachen und mich und fuhr in den Harz. Maxis Eltern bestanden darauf, dass ein Chauffeur uns dorthin brachte. Ich glaube, sie hat meine Hamburger Großeltern nie wiedergesehen. Ich hingegen hatte einmal in jedem Jahr das Vergnügen, für zwei Wochen in dem großen Haus im Hamburger Treppenviertel zu verweilen. Ich hatte mein geräumiges Kinderzimmer, das in jedem Jahr altersgemäß mit allem Schnickschnack ausgestattet war, damit es mir an nichts fehlte. Großmutter Luise kümmerte sich rührend um mich, derweil Großvater Maximilian kaum wahrzunehmen war. Entweder er war in der Firma oder in seinem Arbeitszimmer. Mit Kindern etwas anzufangen, war seine Sache nicht.
Erst als ich zwölf war, fing Maximilian Heinrich Graf Fischmaul de la Rosée an, sich gelegentlich mit mir zu unterhalten. Diese Gespräche fanden meist in seinem altmodisch eingerichteten Arbeitszimmer statt. Ich hatte ihm mein Zeugnis zu zeigen. Es war außerordentlich gut. Ich war richtig stolz. Drei Einser und nur ein einziges Befriedigend, und zwar in Mathematik. Ich erwartete zwar keine Begeisterung, aber zumindest ein ordentliches Lob. Seine Reaktion: »Mathematik ist eminent wichtig für ein erfolgreiches Leben. Was nutzt dir die Eins in Kunst? Oder in Religion? Willst du später mal Bilder malen, die keiner kauft? Oder Pastor werden? Wenigstens hast du eine Eins in Deutsch. Wer sich gut ausdrücken kann, ist immer im Vorteil.« Dieses Gespräch hat mich schockiert. Ich war ein Kind und wurde abgeschätzt und eingestuft wie ein Bewerber bei einem Vorstellungsgespräch. Am Ende sagte er, er würde mir hundert Mark auf mein Sparkonto überweisen, das er für mich angelegt hatte. Heute ist mir klar, warum Maxi so ist, wie er ist.
Maxi wurde von seiner Mutter dazu verdonnert, mit mir etwas zu unternehmen. Er ging mit mir in den Zoo, wir spielten Federball im Garten oder wir fuhren sogar für einen Tag an die Ostsee. Aber so richtig warm wurden wir nicht miteinander.
Als ich vierzehn war, wiederholte sich das Ritual mit der Begutachtung meines Zeugnisses. Es war wieder äußerst passabel ausgefallen. Reaktion: »Das ist ganz ordentlich. Allmählich solltest du dir Gedanken über deine Zukunft machen. So, wie ich deinen Vater einschätze, wird er wohl keine weiteren Kinder in die Welt setzen. Das bedeutet, dass die Last, irgendwann unserem Unternehmen vorzustehen und unseren Namen samt Titel zu bewahren, auf dir liegen wird. Mach dir mal Gedanken darüber. Du hättest viele Privilegien, wenn du Namen und Titel deines Vaters annimmst. Allerdings würde auch ein hohes Maß an Verantwortung auf dich zukommen. Für dein Zeugnis überweise ich dir angesichts der Kontinuität deiner Leistungen fünfhundert Mark.«
In der Art setzte es sich fort. Jedes Jahr zwei Wochen Hamburg. Mit sechzehn hatte ich einen pubertären Schub. Ich hatte mich verändert, stellte alles in Frage. Während die Großeltern im Harz, bei denen ich lebte, ganz gut damit zurechtkamen, war es für meine Hamburger Familie eine Herausforderung. Zu Oma Luise war ich nett und freundlich, weil sie einfach ein lieber Mensch war. Sie betüddelte mich von hinten bis vorne und steckte mir Geld zu, um mir damit den einen oder anderen Wunsch zu erfüllen. So langsam wurde sie aber ein wenig dement, obwohl sie erst Ende sechzig war. Maxi hatte neben seinem mittlerweile fünfundsiebzigjährigen Vater die Geschäftsführung übernommen. Er war zu einem konservativen Hanseaten mutiert. Nach einem Besuch in einem Varieté gingen wir in eine Kneipe, wo ich zum ersten Mal wirklich mit ihm ins Gespräch kam. Nachdem er versuchte, mich zum Thema Liebe und Sex auszufragen, erfand ich eine haarsträubende Geschichte. Ich hätte mit meiner Mathe-Lehrerin ein amouröses Verhältnis, wovon jedoch meine Freundin nichts wissen dürfe. Außerdem würde ich es gelegentlich mit einem Ehepaar treiben, dem es zu langweilig geworden sei. Das Verrückte: Er kaufte mir das ab und erzählte, dass sein Sexualleben auch mal so frei gewesen war. Aber das sei nicht in Ordnung. Ich solle mich doch auf eine Partnerin konzentrieren. »Na ja, wenn man so alt ist wie du, immerhin neununddreißg, dann ist es klar, dass man so denkt. Was ist eigentlich mit dir? Bist du mittlerweile zum Mönch mutiert?« »Nein, ich hatte verschiedene Beziehungen, aber keine war so, dass ich sie auf Dauer fortsetzen wollte. Vielleicht kommt noch mal eine Frau, mit der ich mir ein gemeinsames Leben vorstellen kann.« »Mein Gott«, sagte ich, »bist du langweilig. Hast du in deinem Alter eigentlich noch Sex?« Er fing an zu lachen und entgegnete: »Du bist ein toller Junge. Ich war auch mal so wie du. Und ich hoffe, dass du noch möglichst lange so bleibst. Aber irgendwann wirst du dich umorientieren.« Über Josefine sprachen wir fast nie.
Über mein wahres Liebesleben, das praktisch nicht existierte, redete ich nicht. Das wäre zu frustrierend gewesen. Ich hatte ein ›Verhältnis‹ in Anführungszeichen zu einem fünfzehnjährigen Mädchen. Da war nichts mit Sex, sondern wir kamen zusammen und unterhielten uns. Es war aufregend, mit diesem wunderbaren Wesen ganz allein viel Zeit zu verbringen. Irgendwie funkte es zwischen uns, aber ich war zu zaghaft oder verklemmt für irgendwelche Annäherungsversuche. Irgendwann war dann abrupt Schluss. Wie die meisten Mädchen an meiner Schule himmelte sie ältere Jungen an oder einen knackigen jungen Lehrer namens Michael Prackel.
Als ich Großvater Maximilian Heinrich, wie üblich, mein Zeugnis vorlegte, sagte er: »Ich überweise dir tausend Mark. Hast du inzwischen darüber nachgedacht, ob du unseren Namen und Titel annehmen und die Familientradition fortsetzen willst?« »Ich denke an nichts anderes. Deshalb habe ich mich entschlossen, Architektur zu studieren.« »Was willst mit Architektur? Wir beliefern halb Europa mit Fisch. Und mittlerweile sind wir auch im Japan- und Chinageschäft.« »Das ist ja schön für die Schlitzaugen. Aber ich will Häuser bauen, imposante Häuser.« »Du wirst schon noch zur Vernunft kommen, genau wie dein Vater auch zur Vernunft gekommen ist. Manchmal muss man erst tief fallen, um den richtigen Weg einzuschlagen.« »Na, dann hoffe ich mal, dass ich nicht von einem Hochhaus falle.« Da rang sich Graf Maximilian Heinrich doch tatsächlich ein Lächeln ab. Offenbar gefiel ihm meine Schlagfertigkeit.
Kapitel 5
Die drei Männer waren gespannt, was Lilly von ihnen wollte.
»Nun, meine Lieben, es geht, wie gesagt, um meine alte Schülerin Susanne Hermanns. Sie ist Mitte fünfzig, hat nach dem Studium der Kunstwissenschaft noch Betriebswirtschaft studiert und in verschiedenen bedeutenden Galerien in aller Welt gearbeitet, bis sie sich ihren Lebenstraum erfüllen konnte: eine eigene Galerie in Hamburg zu eröffnen.«
»Die kenne ich«, schoss es aus Rio heraus, »Maxi, also mein alter Herr, hat dort verschiedene Bilder gekauft.«
»Sehr schön«, sagte Lilly. »Und nun zu dem Problem: Um mit den ganz bedeutenden Kunsthändlern mithalten zu können, ist Susanne eine Kooperation eingegangen mit einem reichen Kunstsammler. Er hat kräftig in ihre Galerie investiert und dafür eine Beteiligung von fünfundvierzig Prozent an ihrem Unternehmen erhalten. Susanne ist die alleinige Geschäftsführerin geblieben und ihr Partner, Gerald Jenssen, hat sie beraten und unterstützt, wenn es darum ging, potenzielle Kunden an Land zu ziehen. Das ist ein paar Jahre lang wunderbar gelaufen. Dabei sind sich die beiden auch menschlich näher gekommen. Nun hatte Gerald Jenssen vor, Susanne im Falle seines Todes seinen Anteil am Unternehmen zu vermachen. Es sollte eine entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrags erfolgen. Aber einen Tag vor dem Notartermin kam Gerald auf mysteriöse Weise ums Leben. Und nun macht sich die Erbin, nämlich die Witwe des Herrn Jenssen, in Susannes Galerie breit, zusammen mit ihrem Liebhaber. Die beiden machen alles kaputt, was Susanne in vielen Jahren aufgebaut hat.«
»Na, so ein Miststück,« sagte Rio. »Und was erwartest du von uns?«, fragte Amadeus.