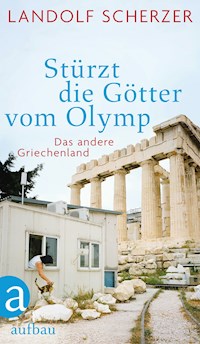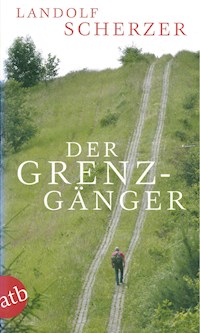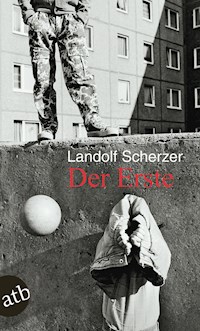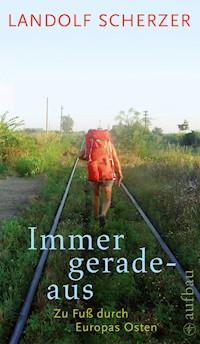11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
100 Tage zwischen Rostock und Labrador
Bis Labrador ging die Fahrt mit einem Fischfangschiff, auf dem Landolf Scherzer anheuerte, um herauszufinden, was hinter der sagenumwobenen Seefahrt steckt. In der Coffeetime und am Feierabend ließ er sich Seemannsgarn und Lebensgeschichten erzählen. Hundert Tage beobachte er das Leben an Bord, das zugleich die DDR-Gesellschaft wie in einer Nussschale zeigte. Und er testete, wie er selbst in Extremsituationen reagiert, und dies erwies sich als das größte Abenteuer. Zwanzig Jahre später geht er den Spuren der Fischer und der Fischfangflotte nach, und er lässt sich vom Schiffskoch die beliebtesten Rezepte aus der Bordküche aufschreiben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 408
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über Landolf Scherzer
Landolf Scherzer, 1941 in Dresden geboren, lebt als freier Schriftsteller in Thüringen. Er wurde durch Reportagen wie »Der Erste«, »Der Zweite« und »Der Letzte« bekannt.
Im Aufbau Taschenbuch sind ebenfalls seine Bücher »Der Grenzgänger«, »Immer geradeaus. Zu Fuß durch Europas Osten«, »Urlaub für rote Engel. Reportagen«, »Fänger & Gefangene. 2386 Stunden vor Labrador und anderswo«, »Madame Zhou und der Fahrradfriseur. Auf den Spuren des chinesischen Wunders«, »Stürzt die Götter vom Olymp. Das andere Griechenland«, »Der Rote. Macht und Ohnmacht des Regierens« und »Buenos días, Kuba. Reise durch ein Land im Umbruch« lieferbar.
Informationen zum Buch
100 Tage zwischen Rostock und Labrador.
Bis Labrador ging die Fahrt mit einem Fischfangschiff, auf dem Landolf Scherzer anheuerte, um herauszufinden, was hinter der sagenumwobenen Seefahrt steckt. In der Coffeetime und am Feierabend ließ er sich Seemannsgarn und Lebensgeschichten erzählen. Hundert Tage beobachte er das Leben an Bord, das zugleich die DDR-Gesellschaft wie in einer Nußschale zeigte. Und er testete, wie er selbst in Extremsituationen reagiert, und dies erwies sich als das größte Abenteuer. Zwanzig Jahre später geht er den Spuren der Fischer und der Fischfangflotte nach, und er lässt sich vom Schiffskoch die beliebtesten Rezepte aus der Bordküche aufschreiben.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Landolf Scherzer
Fänger & Gefangene
2386 Stunden vor Labrador und anderswo
Mit einem Nachwort und Rezepten der Hochseefischer
Inhaltsübersicht
Über Landolf Scherzer
Informationen zum Buch
Newsletter
Angelesenes zählt nicht mehr
Wir machen die Leinen los
Über Coffeetime-Gespräche
Coffeetime 1 – Moor erzählt von seiner Bekanntschaft mit der Liebe auf Grönland
Zwischenbericht 1 – Die Fischdampfer
Unheldischer Kampf gegen die Seekrankheit
Coffeetime 2 – Dombrowski erzählt von einem Staatsbesuch im Fischkombinat
Zwischenbericht 2 – Aus medizinischen Gutachten
Coffeetime 3 – James Watt erzählt von einem Bestmann
2 000 Seemeilen bis Labrador
Siegfried Dombrowski, LOP – Leitender Offizier der Produktion, genannt »Produktenboß«
Coffeetime 4 – Schiffsarzt Hermann Wendt erzählt vom »großen Schweiger«
Neue Rituale vor dem ersten Hol
Coffeetime 5 – Meister Teichmüller erzählt von seinem Gespräch auf dem Transportschiff »Kosmonaut Gagarin«
Zwischenbericht 3 – Von der Doryfischerei
Der Fisch ist über uns gekommen
Coffeetime 6 – Maschinenassistent Bernd Schmied erzählt von seinem Dauerparktrabant
3. Technischer Offizier Werner Just, genannt Moor
Coffeetime 7 – Schiffsarzt Hermann Wendt erzählt von seinem Fernsehinterview
Fänger, im Eis gefangen
Kapitän Knut Olsen
Im Sommer nach meiner Reise wird mir die Frau des Kapitäns erzählen:
Coffeetime 8 – Odysseus erzählt von den Brieftauben
Zwischenbericht 4 – Vom Verschwinden der Fische und Vögel
Auch Wale schwimmen ins Netz
Coffeetime 9 – Meister Schulz erzählt, wie sie vor Afrika mit Hefeklößen Haifische angelten
Frühlingsträume im Fischschlachthaus
Zwischenbericht 5 – Die modernen Cuxhavener Fabrikschiffe
WOP (Wachoffizier der Produktion) Bernd Teichmüller
Landgang in Saint-John’s
Coffeetime 10 – James Watt, der E-Meister, erzählt von einer »Alkoholverlobung«
Coffeetime 11 – Edgar, der Funker, erzählt, wie der Chefkoch der »Gotha« in Murmansk die deutsch-sowjetische Freundschaft vertiefen wollte
Tage ohne Fisch
Coffeetime 12 – Karl Wilhelm erzählt, wie ihm in Harstad vier Leute abhauten
Zwischenbericht 6 – Die Fischkriege
E-Meister Gerd Häfner, genannt James Watt
Im Sommer nach meiner Reise wird mir Ursula Häfner, die Ehefrau von James Watt, erzählen:
Ostern vor Labrador
Produktionsarbeiter Uwe Gessler, genannt Jumbo
Coffeetime 13 – Epi, der E-Assi, erzählt, wie sie einen Toten an Land brachten
Zwischenbericht 7 – Die Tat des Klaus D.
Abschied von Labrador
Zwischenbericht 8 – Über Fischmehl und Eiweißmangel
Schiffsarzt Hermann Wendt
Die Engländer verkaufen uns Makrelen
Zwischen(abschluß)bericht 9 Über die Jahre seit unserer Rückkehr
Notwendige Berichtigungen zu diesem Buch und einige Rezepte, wie die Hochseefischer Kabeljau, Garnelen, Heilbutt und andere Fische an Bord zubereiteten
Anmerkungen
Impressum
Angelesenes zählt nicht mehr
Die Schiffe im Hafen sind größer, rostiger und verbeulter, als ich dachte.
Die Männer darauf lächeln nicht stolz und optimistisch wie in den Werbeprospekten der Kaderabteilung. Sie sprechen auch eine andere Sprache als ihre Betriebszeitung, die sich »Der Hochseefischer« nennt.
Zum ersten Mal balanciere ich über eine schwankende Gangway, stolpere über gespannte Stahltrossen, stoße mir den Kopf an der niedrigen Tür zum Schiffsbauch, hangele steile, enge Treppen hinunter und verlaufe mich hilflos in den winkligen Gängen. Ich bin unsicher und neugierig: ein 36jähriger Schulanfänger. Außer mir werden im Januar 1978 noch zweiundzwanzig neueingestellte Landratten (keine von ihnen ist älter als dreiundzwanzig) in einem fünftägigen Schnellkurs von nicht mehr fahrenden alten Hochseefischern und jüngeren Theoretikern seeklar gemacht.
Während des Einführungsvortrages in der Bildungsbaracke des Fischkombinates mühe ich mich, Steuerbord und Backbord auseinanderzuhalten. Steuerbord ist dort, wo das Lenkrad vom Auto nicht ist – also rechts. Dann erklären uns die Lektoren, was wir tun müssen, wenn unser Schiff sinkt, brennt, wir über Bord gehen, seekrank werden . . .
»Früher gehörte zum Inventar der Rettungsboote auch ein Kartenspiel. Wir lassen es neuerdings weg, damit die Schiffbrüchigen nicht mehr um das Trinkwasser und den Notproviant skaten.«
Das stimmt mich optimistisch, denn ich bin ein schlechter Spieler.
»Falls jemand Heimweh bekommt und außenbords springen will oder sich bei Sturm nicht ordentlich festhält, sollte er sich bitte vorher überlegen, daß ein Fang- und Verarbeitungsschiff – angenommen, es fährt mit zwölf Knoten – schon rund 300 Meter entfernt ist, bevor er unten ankommt, wieder auftaucht, Luft holen und um Hilfe rufen kann.«
Gott sei Dank, ich werde unter Deck arbeiten.
»Gegen die Seekrankheit gibt es ein bewährtes Mittel: trockenes Brot, immerzu trockenes Brot kauen! Sonst kotzt man sich nur die grüne Galle aus dem Leib und macht nicht einmal den Möwen eine Freude.«
Mit einem flauen Gefühl im Magen denke ich daran, daß mir schon auf dem Riesenrad speiübel wird.
Nach dem Vortrag über das Verhalten bei Schiffsuntergängen packen ein Eisenwarenverkäufer und ein Bibliothekar ihre Siebensachen und fahren wieder nach Hause. Wir übrigen erhalten am Ende des Lehrganges den »Sicherheitsqualifikationsnachweis« für künftige Fahrensleute. Schlafen dürfen wir im Rostocker Haus der Hochseefischer. An der Tür steht: »Keine öffentliche Gaststätte! Nur für Betriebsangehörige des Fischkombinates!«
Seeleute sind hier unter sich. In der Gaststätte säuft, qualmt und lärmt man wie in einer Mitropa-Bahnhofskneipe. Nach zehn Minuten tränen die Augen. Meine zwei Tischnachbarn sind um die fünfundzwanzig, bartlos, bleichgesichtig und ziemlich dickbäuchig.
Ich frage, wie lange sie schon zur See fahren.
Fünf Jahre der eine.
Sieben Jahre der andere.
Als Fischmehler der eine.
Als Produktionsarbeiter der andere.
Und wieviel Jahre wollt ihr noch auf dem Schiff bleiben?
»Ich habe meiner Frau gesagt: ›Laß mich noch zwei Jährchen, dann können wir uns einen Dacia kaufen.‹ Seitdem ist sie friedlich«, grient der Fischmehler.
Der andere zuckt mit den Schultern. »Weiß nicht, solange ich es durchhalte.« Er hat an Land als Beifahrer gearbeitet. »Was soll ich machen, wenn ich den Job hier aufgebe? Hab mich daran gewöhnt, im Monat an die 2 000 Eier auf die Hand zu kriegen . . .«
Als ich sage, daß es meine erste Seereise wird, tröstet mich der Fischmehler. »Wenn du das erste, zweite oder dritte Mal fährst, stehst du beim Auslaufen noch neugierig an der Reling, aber danach wird es von Reise zu Reise schlimmer, dann hilft nur noch eins: Du mußt dich derart besaufen, daß du erst in der Nordsee wieder aufwachst.«
Ich frage sie, was ich für die 100-Tage-Fahrt mitnehmen muß. (Darüber hatte man uns weder in der Kaderabteilung noch während des Kurzlehrganges informiert.)
Die zwei zählen auf: Teppichknüpfwolle. Ein gutes Dutzend Flaschen Schnaps. Hausschlachtene Wurst. Formalin zum Präparieren von Seespinnen. Ein paar Lederhandschuhe.
»Wozu Lederhandschuhe?« frage ich.
»Damit dich das Kielschwein auf dem Dampfer beim Füttern nicht beißt«, sagt der Fischmehler.
Ich nicke mutig.
Einen Blumentopf mit Grünzeug. Rasierwasser und Spray gegen den Fischgestank. Einen guten Zollstock.
»Wozu einen Zollstock?« frage ich.
»Damit du nachmessen kannst, wenn du die Poller auf Deck mit dem Vorschlaghammer richten mußt«, sagt der Fischmehler.
Ich nicke ehrfurchtsvoll.
Magazine mit nackten Mädchen für die Kammerverschönerung. Buchenholzscheite zum Heilbutträuchern.
»Hausschuhe?« frage ich.
Nein, das sei überflüssig, die würde man sich auf dem Dampfer aus Ochsenfell basteln. Dagegen sei es lebenswichtig, einen Recorder mitzunehmen und mindestens dreißig bespielte Kassetten, denn mit der Musik des Kombinates könne man sogar die gefräßigsten Möwen von Deck jagen. Dann einen dicken Pullover. Kalender oder Metermaß zum Tageabstreichen. Briefmarken.
»Wozu Briefmarken?« frage ich.
»Wenn ihr auf dem Atlantik an einer Postboje vorbeikommt und du Briefe einwerfen willst«, sagt der Fischmehler.
Ich nicke verstehend.
Sie bestellen drei Flaschen Sekt. Schwärmen von den letzten zehn Freizeittagen, da hätte jeder von ihnen in der Rostocker »Storchenbar« fast einen Tausender auf den Kopf gehauen.
Das Wort »Storchenbar« wirkt auf meine Tischnachbarn alarmierend. Sie trinken nicht aus, zahlen, fragen, ob ich mitkäme. Nein, ich bin müde und will schlafen gehen.
Der Fischmehler spottet: »Aus dir Thüringer Löffelschnitzer wird nie ein Hochseefischer!«
Beim Portier bestellen sie telefonisch eine Taxe, finden keine zwanzig Pfennige und legen ein Fünfmarkstück hin. »Stimmt so!«
Im Zimmer oben brennt Licht. Ein junger Kerl in Jeans, Hemd und Sakko liegt auf dem Bett. Er hat die Schuhe zwar aufgebunden, aber nicht ausgezogen. Schläft auf dem Rücken und hält sich mit beiden Händen an den Seitenbrettern der Koje fest.
Hat er Angst aus der Koje zu fallen?
Auf dem Tisch liegen Wurstschalen, Brötchen, Zigarettenkippen, zwei leere Scotch-Whisky-Flaschen, Basarscheine für den Seemanns-Shop und – zwischen alldem verstreut – Fotos von einer jungen Frau mit Baby. Im Garten. Vor dem Einfamilienhaus. Am Fenster. In der Wohnstube . . .
Nach einer halben Stunde kommt der dritte Zimmergenosse. Er ist nüchtern. Den Halbtoten auf dem Bett würdigt er mit keinem Blick. Schweigend zieht er sich aus. Eine Seejungfrau. Hammer und Sichel. Leuchtturm. Pralle Brüste. I like Eva. Palmen. Die USA-Flagge. Auf der linken Brustseite eine Narbe.
Ich frage ihn, wo er sich die geholt hat.
Er winkt ab. »Ein Filetiermesser vor zehn Jahren.«
»Wieso ein Filetiermesser?« frage ich.
Ich solle nicht so blöd quatschen, knurrt er. Oder wäre ich etwa (hier höre ich das Wort zum ersten Mal als Schimpfwort) eine Neueinstellung?
»Ja«, sage ich, »bin noch nie gefahren.«
»Dann sieh dich vor, mein Junge«, warnt er. »So ab dem 80. Tag behalte deine Hände immer schön in den Hosentaschen und verschlucke dich lieber an einem Wort, als daß du eins zuviel sagst. Nach 80 Tagen sind die Massen abgefischt. Da ist es an Bord, als hätte das Schiff nicht Fisch, sondern Dynamit geladen . . .«
»Und das Filetiermesser?«
»Bekam ich seinerzeit in die Rippen, als ich zu einem Kumpel sage: ›Na, was wird deine Alte jetzt zu Hause machen?‹ Damals waren wir 83 Tage auf See.«
Er legt sich in Turnhose und Unterhemd auf die Koje, stemmt die angezogenen Knie gegen die Seitenwand, so, als könne er jeden Moment herausfallen.
Drei Tage später laufe ich – als Produktionsarbeiter angemustert – mit dem Fang- und Verarbeitungsschiff ROS 703 »Hans Fallada« nach Labrador aus.
Wir machen die Leinen los
Die Wehen hatten schon probeweise eingesetzt. Der Schiffskörper vibrierte von der Anstrengung der Maschine.
Aber noch liegt die »Hans Fallada« fest vertäut an der Pier im Rostocker Hafenbecken. Noch kommen Lastkraftwagen mit Lenzpumpen, Plastesäcken, Waschpulver, Putzlappen, Kartonagen und Netzen längsseits, um das Schiff für Monate lebensfähig zu machen. Es wird beladen mit Mehl, Zucker, Eiern, Hefe, Kartoffeln, Kraut, getrockneten Bananen, Sauerkraut (das hätte Barents, der an Skorbut starb, das Leben gerettet), Knoblauchsalz, Rosenkohl, halben Rehen, Früchte-C-Kindersäften, Schokolade, Zigaretten, Meerrettich, gefrostetem Fischfilet (dabei muß ich an den Jäger denken, der zur Treibjagd einen gekauften Hasen im Rucksack mitnimmt), Mandarinen, Quark, Bratheringen, Rollmöpsen . . .
Noch pumpt man Wasser in die Reservoirs. Und noch rennen die Schauerleute befehlend auf dem Deck umher; das Schiffsgehirn – Kapitän, 1. Technischer Offizier (Chief genannt) und Steuermann – läßt sie widerspruchslos schalten und walten.
Als der Kai dunkel und menschenleer wird, zittert das Schiff unter den 2 100 Pferdestärken der Hauptmaschine. Und nun ist es kein blinder Alarm, dieses Mal wird das Schiff abgenabelt, die Lebensstränge zum Mutterland werden unterbrochen, das Telefonkabel und die Stromleitung zerschnitten, die Gangway eingeholt.
Die »Hans Fallada« geht zum 45. Mal auf große Fahrt.
Vergessenes kann man jetzt nicht mehr nachholen, spätestens vor Labrador werden es der Koch, der Chief, der Arzt oder der Steuermann merken.
Das Schiffsgehirn arbeitet. Es weist durch den Bordfunk an: »Die noch nicht eingesammelten Seefahrtsbücher sind sofort beim 1. Steuermann abzugeben!« Bis zur Heimkehr in Rostock wird jedes amtlich in mehreren Sprachen bescheinigte Seemanns-Ich im Kapitänspanzerschrank verwahrt. Die Zollbeamten kontrollieren inzwischen Laderäume, Kammern, Stores, Personen und Papiere. Der Bordlautsprecher bittet die Offiziere zum Paßvergleich in die O-Messe, alle übrigen sollen sich sofort in der Mannschaftsmesse versammeln.
In dem engen Labyrinth von Gängen, Treppen und verschiedenen Decks hatte ich meine Kammer erst nach vielem Fragen gefunden. Auch den Weg zur Messe kenne ich nicht, denn während der drei Tage, an denen wir das Schiff mit Proviant und Ausrüstungen beluden, aßen wir im Speisesaal an Land. Suchend steige ich die Treppen zum zweiten Deck hinauf, und hier, wo es sonst nur nach Diesel stank, schnuppere ich jetzt den Duft von Braten. Ich tippe auf Gulasch oder Rostbrätl, gehe dem sympathischen Geruch nach und fühle mich, obwohl immer noch unwissend, wohin all diese Gänge, Treppen und Türen führen, plötzlich heimisch auf dem Schiff. Denn als erstes nach dem Ablegen hat man anscheinend zu kochen, zu backen und zu braten begonnen.
Neben der Kombüse, dem Ursprung des Duftes, finde ich die Mannschaftsmesse. Alle Drehstühle an den Tischen sind schon besetzt, und die restlichen dreißig Mann lehnen an der Wand oder sitzen auf dem Fußboden. Niemand spricht, jeder stiert wie abwesend auf seine Schuhspitzen oder irgendeinen Punkt in der Messe. Sie ist schmucklos, lediglich die Bullaugen sind von bunten Gardinen verdeckt.
Wir warten schweigend wie im Vorraum einer Behörde. Der Zeiger der Schiffsuhr ruckt laut knackend zehnmal weiter. Dann beginnt einer zu erzählen, wie sie – von Halifax kommend – den Zoll ausgetrickst hätten. Endlich wird gelacht in der Messe. Und plötzlich reden fast alle, berichten von Schallplatten und Taschenrechnern, die sie aus Kanada mitgebracht haben, preisen ihre todsicheren Verstecke für Schnaps, Pornos und Transitzigaretten: unter den Transportbändern, hinter den Fischkartons im Frostladeraum, in Plastetüten gewickelt und dann in Farbfässern versenkt, unter der Verschalung in der Toilette . . . Obwohl ich die aufgezählten Räume noch nicht kenne, begreife ich die Grundregel: Nie in der eigenen Kammer! Die Matrosen und Arbeiter reden sich bei diesem Thema derart in Rage, daß die Zollbeamten erst laut husten müssen, damit wir merken, daß sie schon an der Tür der Messe stehen.
Die Zöllner – früher fuhren viele von ihnen selbst zur See – grienen gemütlich, für sie sind die heißen Verstecktips längst kalter Kaffee. Dann rufen die Grenzbeamten jeden einzelnen auf.
Die »Hier«- oder »Ja, hier«-Antworten sollen gelangweilt klingen. Müde erhebt man sich, und manche haben, wenn sie an den Zollbeamten vorbeigehen, die Daumen in die Hosentaschen gesteckt. Aber das sieht eckig aus wie bei schlechten Schauspielern.
Einer schauspielert garantiert nicht.
»Wales, Alfred!«
Nichts.
»Wales, Alfred!«
Wieder nichts.
Noch einmal: »Wales!«
Er hebt den Kopf. Aufstehen kann er nicht. Da hieven zwei Kumpels den Wales wie eine Schaufensterpuppe in die Höhe, halten ihn senkrecht, bis die Beamten das Paßbild verglichen haben, und bringen ihn hinaus. Nachdem ich entlassen bin, steige ich eine Treppe höher zum dritten Deck. An der Reling stehend, schaue ich zurück. Rostocks Lichter sind schon so klein wie Zündholzflämmchen.
Rechts und links von der Fahrrinne leuchten Bojen. Sie leiten das Schiff in der Enge der Warnow. Aber sie führen uns nur so lange, wie es unbedingt nötig ist; sobald wir die offene See erreicht haben, dürfen – nein, müssen – wir unseren Weg allein suchen.
Sechzehn Lehrlinge (künftige Matrosen und Fischverarbeiter) fahren wie ich zum ersten Mal. Sie stehen mit drei oder vier »Alten« auf dem Brückendeck. Der Lichtstrahl eines Richtscheinwerfers an Land zerschneidet die Finsternis und schwenkt zu unserem Schiff herüber.
Suchend tastet er über die Aufbauten, verweilt bei Namen und Rufzeichen an Bug und Schornstein, mitleidlos bringt er Rost, Beulen und Schrammen der Bordwände zum Vorschein. Wo mag sich die alte »Fallada« ihre Beulen geholt haben? Ist sie vor Labrador mit Eisbergen zusammengestoßen? Oder haben den Schiffskörper mächtige Schollen umklammert, bis sein Stahlgerippe krachte?
Wie groß werden die Eisberge vor Labrador sein und wie dick die Eisschollen?
Und wie hoch die Wellen des Atlantiks?
Noch spiegelt sich das Feuer des Warnemünder Leuchtturms im Wasser. Es kann einladen oder verabschieden, froh oder traurig machen, warm oder kalt sein. Die meisten auf unserem Schiff schauen dem Leuchtturm beim Auslaufen nicht mehr in seine Leuchtaugen. Sie arbeiten seit vielen Jahren in der schwimmenden stählernen Fischfabrik. Ich dagegen werde nach 100 Tagen wieder aufhören und weiß nicht, ob mir die Einmaligkeit Vorteile oder Nachteile bringen wird. Ich bin neugierig auf die Leute, die mit mir fahren, auf die prophezeiten Strapazen der Arbeit, die Seekrankheit, die Einsamkeit im Eis, ich habe angemustert, um das Unbekannte kennenzulernen und darüber schreiben zu können . . . Und ich bin neugierig auf mich.
Der kleinste und schmächtigste Lehrling erzählt die Reisegeschichte seines Großvaters, eines weitgereisten Seemanns. Im marokkanischen Tanger hätte er sein Schiff verlassen, weil er alle Meere, aber die Wüste noch nicht kannte. Bei einem Stoffhändler verdingte er sich als LKW-Fahrer, transportierte Waren durch die Sahara und wäre fast in einem Sandsturm umgekommen. 1918 ging er nach Rußland, neugierig auf die Revolution. Die letzten Nachrichten von ihm kamen aus Turkmenien.
»Wenn ich heute abgerissen von einer Tramptour aus Ungarn oder Bulgarien zurückkomme, schimpft mein Alter, ich sei nicht besser als der Großvater und würde schon sehen, was mir die Rumtreiberei noch einbrächte . . .«
Das Licht des Leuchtturms versinkt. Unser Dampfer macht volle Fahrt. Die Wellen brechen sich krachend am Bug und tosen an den Bordwänden entlang. Der Fahrtwind wird kälter und bissiger, mich friert, und ich steige wieder hinunter in den warmen Bauch des Schiffes.
Meine Kammer liegt auf der Backbordseite, es ist die zweite von vorn. Roland, ein Lehrling mit einer schwarzen Löwenmähne, aber noch flaumig ums Kinn, wohnt mit mir in der Kammer. Sie nennt sich wegen der zwei übereinanderstehenden Kojen Zwei-Mann-Kammer, ist aber so klein, daß zwei dort nicht gleichzeitig ihre Sachen verstauen können. Nachdem ich mich mit dem Lehrling geeinigt habe, daß ich oben schlafen werde – ich kann kein Brett vor dem Kopf und keinen Schnarchenden über mir ertragen –, schicke ich ihn auf den Gang und packe in Ruhe meine Wäsche aus. In Hotels schmeiße ich Hemden und Hosen gewöhnlich in das erstbeste leere Schrankfach, aber das hier ist kein Hotelzimmer; die kaum zweimal zwei Meter große Kammer soll für 100 Tage mein Zuhause werden. Links neben der Tür stehen die Kojen, an deren Kopfenden im Bullauge ein Stück Himmel schaukelt.
Rechts von der Tür haben die Werfttischler einen schmalen, bis zur Decke reichenden Spind eingebaut. Ohne Stuhl bin ich zu klein für sein oberstes Fach, doch der Stuhl ist genau wie Tisch, Schrank und Koje am Fußboden festgeschraubt. Unter den Kojen entdecke ich drei ungefähr 25 Zentimeter hohe Schubladen, seemännisch Backskisten genannt. Zieht man die vordere Backskiste heraus, geht die Kammertür – seemännisch Schott genannt – nicht mehr auf, also verstaue ich meine Wäsche in der mittleren. In der dritten liegen vom Vorgänger noch Gummistiefel, Schlachthandschuhe, ein mit Schimmel überwachsenes Glas Pflaumen, Reste von braun-weiß geflecktem Ochsenfell, eine 10-kg-Hantel, schmutzige dickrandige Tassen – seemännisch Mucken genannt –, leere Wodkaflaschen und Gelenkbinden. Ich schmeiße wütend meine Gummistiefel und Fischmesser dazu, mehr ist dort nicht unterzubringen. Dann zwänge ich den Koffer in den Spind und hänge die Landhose und die Landjacke auf. Mottenpulver hätte man mitnehmen sollen.
Unter dem Tisch – seemännisch Back genannt – befinden sich noch zwei Schubladen. Als ich Bücher von Ovid und Mercier, Hemingways »Der alte Mann und das Meer«, die Bibel (ich hoffe sie hier noch einmal in Ruhe lesen zu können), meine Aufzeichnungen über Seefahrt und Fischfang im Nordatlantik und leeres Schreibpapier darin verstaue, klopft einer. Das Schott rammt meinen Kopf, ich will den Lehrling anbrüllen, doch da steht ein junger Kerl vor mir, und über mir schwebt ein Plastekasten mit Tütenmilch. Er steht und grinst, hat große braune Augen, rote Apfelbäckchen machen ihn freundlich, obwohl unter seinem mit Hawaipalmen bemalten T-Shirt ansehnliche Muskelpakete spielen. Etwas verlegen schaut er, wo er seine Kiste Milch abstellen könnte, findet nichts und hält sie weiter vor dem Bauch.
»Hab während der letzten Reise hier gewohnt«, beginnt er das Gespräch. Dann stellt er sich vor: Volker Sturm, genannt »Baby«. Ich hoffe, er wird die dritte Backskiste ausräumen. Nein, sagt er, nur die Hantel wolle er mitnehmen, das andere Gerümpel sei schon von seinem Vorgänger. Dann stellt er mir den Kasten mit den fünfzig Tüten Milch fast auf die Füße. Die möchte er gern in der Backskiste verstauen.
Ich staune, daß sich Seemänner Milchvorräte mit auf die Reise nehmen, und frage, weshalb er die Tetraeder nicht in seiner Kammer unterbringt. »Weil eure Kammer eine der kältesten auf dem Dampfer ist.«
Darunter liegt der Frostraum. Baby hat sich auf der letzten Reise Eisbeine geholt und ist in eine wärmere Kammer gezogen. Allerdings wird die Milch dort schneller sauer, und solange er Milch hat, braucht er keinen Schnaps . . .
Die Wände der Kammer sind mit nackten Frauen tapeziert. Ich frage Baby, wie ich sie entfernen könne, ohne die Brüste oder Schenkel zu verunstalten.
»Gefallen sie dir nicht?«
Ich schüttle den Kopf: »Es sind nur zu viele!«
Da polkt er sie selbst von den Wänden. Es geht leichter, als ich dachte, denn an Bord verwendet man, um die Nackedeis beim Austauschen nicht zu verletzen, Zahnpasta statt Leim. (Chlorodont klebt am besten.)
Bevor er mit den Papierschönen und dem leeren Kasten verschwindet, will Baby wissen, ob ich unten oder oben schlafe, denn die Kammer sei eine Pilotenkammer.
Ich frage, was eine Pilotenkammer ist, aber Baby sagt nur: »Das wirst du früh genug merken!«
Nachdem ich alle meine Utensilien seefest verstaut habe – zumindest denke ich das –, will ich meine Kammernachbarn auf der Backbordseite begrüßen. Nebenan wohnen der Bootsmann und ein Fischereibiologe, dort klopfe ich nicht, denn als ich den Bootsmann nach dem Auslaufen gefragt hatte, wo hier unten eine Toilette sei, schrie er: »Wenn du noch einmal so blöd quatschst, verpasse ich dir eine Woche Scheißhausdienst!«
Am nächsten Schott steht mit grüner Schrift: Klaus Schöller und Uwe Gessler. (Damit die Arbeiter der zwei Produktionsbrigaden von den Wachhabenden beim Wecken nicht verwechselt werden, sind die Namensschilder unserer Brigademitglieder grün und die von der Brigade II rot geschrieben.) Ich klopfe, bis einer »Herein!« ruft.
Auf der Back der Kammer hat nur noch ein Aquarium Platz, die restliche Fläche beansprucht ein Gestell, auf dem mindestens drei Quadratmeter Teppichstoff befestigt sind. Schöller sitzt davor, blickt kurz auf, mustert mich, beugt sich dann wieder über die Back und knotet flink und geschickt wie eine turkmenische Spezialistin grüne, gelbe, blaue und rote Fäden in den Stoff. Allerdings sieht Schöller – auf dem Schiff ruft man ihn »Widder« – nicht wie ein Teppichknüpfer, sondern wie ein gut trainierter Mittelgewichtsboxer aus. Ich stehe verlassen in der Kammer herum und beobachte die Fische. Auf dem Aquarium liegt eine Glasscheibe – sollte das Schiff manchmal so sehr schaukeln, daß sogar die Fische herausfallen? Mit einer kurzen Kopfbewegung deutet Widder zur Ecke zwischen Schott und Koje. Dort sitzt sein Kammerkumpel auf einem Stuhl und schläft. Er sieht dabei so friedlich aus, so rund und gesund, daß es mich nicht wundern würde, wenn er am Daumen nuckelte.
»Betrunken?« frage ich.
»Ach wo, der ist stocknüchtern«, sagt Widder und brüllt: »He, Jumbo! Aufstehn! Heiraten!«
Der Dicke blinzelt, ohne den Kopf zu heben, sagt maulend: »Ich schlaf doch gar nicht, du Idiot!« und klappt die Augen zu. Widder brüllt noch einmal: »He, Jumbo! Dir will einer Guten Tag sagen.«
Jumbo schaut mich an, murmelt »Tag« und beginnt zu schnarchen.
Auch die zwei Ältesten unserer Brigade wohnen auf der Backbordseite. Sie sind über dreißig, der eine, Henry Wischinsky, knochig und sehnig, immer in Trab und laut schreiend, der andere, Gerd Häfner (die Kumpels nennen ihn Opa), ruhig und dickfellig. Trotzdem schreit Opa sehr oft, das heißt, Opa schreit, wenn Wischinsky schreit. Als ich vor ihrem Schott stehe, schreien beide, und ich klopfe nicht.
Neben Opa und Henry Wischinsky wohnen die drei Fischmehler, die nächste Kammer gehört den zwei einzigen weiblichen Wesen auf dem Dampfer, den Stewardessen. Ich habe sie nur flüchtig angeschaut. Kriemhild, die Offiziersstewardeß, ist korpulent, ihr Alter schwer zu schätzen, vielleicht dreißig. Evi, die jüngere, Mannschaftsstewardeß, hat eine scharfgeschnittene große Nase und einen verführerisch geformten Körper. Ob sie nach 70 Tagen mit einem von uns schläft? Und mit wem? Die meisten an Bord sind jünger als ich . . .
Die zwei Meister der Produktion – laut Dienstordnung heißen sie »Wachoffizier der Produktion« – wohnen auf der Steuerbordseite. Ich konnte sie beim Aufrüsten zuerst nicht unterscheiden, denn beide sind etwa 25 und tragen rot-weiß gemusterte Hemden und graue Latzhosen. Später sah ich, daß Teichmüller, der Meister unserer Brigade, gepflegte Hände, gelocktes Haar und unter dem derben Arbeitszeug eine schlanke Figur hat. Er spricht in wohlgeformten Sätzen. Schulz, der andere Meister, stottert, wenn er aufgeregt ist, seine Hände ähneln Baggereimern, er soll schon einige Jahre als Produktionsarbeiter gefahren sein.
Inzwischen schwankt der Dampfer merklich, die Schaumspritzer lecken bis zu unserem Bullauge hinauf – ich möchte nicht mehr allein in der Kammer sitzen. Weil meine nachbarliche Begrüßung aber weder bei Widder und Jumbo noch bei Opa und Henry Wischinsky auf Begeisterung stieß, klettere ich hinauf zum Offiziersdeck und klopfe an das Schott von Dombrowski.
Dombrowski ist LOP – Leitender Offizier der Produktion – und hatte mich, während wir das Schiff in Rostock mit Proviant beluden, in seine Kammer holen lassen.
»Du kannst doch mit einer Schreibmaschine umgehen.« Ohne eine Antwort abzuwarten – jeder Schriftsteller kann Schreibmaschine schreiben, das liest man schließlich überall –, kramte er einen Stapel Unterlagen aus der Backskiste unter der Sitzbank – seemännisch Ducht genannt – hervor.
Ich tippte mit einem Finger Lohnlisten, Materialbestellungen und die Jahresendprämie für den Produktionsbereich. Dombrowski verteilte die Prämie diskussionslos in Sekundenschnelle, gewährte fast jedem Arbeiter einhundert Prozent, nur zweien kürzte er die Zusatzvergütung auf siebzig Prozent. (Sie hätten sich bei der letzten Reise Brotwein angesetzt, also gegen die strenge Rationierung von Alkohol auf Fischereifahrzeugen der DDR verstoßen, und, wie der Produktionsleiter sagte, »Orgien mit den verheirateten Stewardessen« gefeiert.) Die eingesparten sechzig Prozent Prämie vergab Dombrowski zu gleichen Teilen an einen Fischmehler, an Opa aus unserer Brigade und an Joachim Michel, einen Arbeiter der zweiten Brigade, den man – ich weiß noch nicht weshalb – auf dem Schiff Odysseus nennt.
Ich schrieb fast zehn Stunden bei Dombrowski, die anderen, die Kartonagen verladen hatten, saßen schon in den Rostocker Kneipen. Bevor mich der »Produktenboß« entließ, sagte er: »Wenn du Langeweile oder Sorgen hast – und du wirst garantiert Sorgen bekommen – dann schau mal hoch zu mir, ein Schnaps steht immer im Spind.« Dombrowski ist fast fünfzig, aber er sieht jünger aus, lächelt geschmeichelt, wenn man es ihm sagt, trägt moderne Hemden, manchmal auch Jeans. Er spricht leise, plappert nicht, überlegt, was er redet.
Heute lärmt es in seiner Kammer. Dicker Zigarettenrauch vernebelt die Gesichter der zehn Mann, die auf der Ducht sitzen. Die meisten von ihnen kenne ich nicht, nur Wales, den Schlosser, der hockt still in einer Ecke und nuckelt am leeren Glas. Schulz im rot-weiß karierten Hemd lächelt freundlich, und Dombrowski schiebt mir, so, als würde ich schon jahrelang auf diesem Dampfer fahren und zur traditionellen Auslauf-Wodkarunde gehören, ein volles Glas über die Back. Die Unterhaltung stockt nicht, der Produktionsleiter erzählt, daß er, vier Tage vor dem Auslaufen von früh bis Mittag Holz und Kohlen aus dem Keller geholt und auf dem Balkon gestapelt hat. Einen guten Monat würde seine Frau – sie ist herzkrank – damit auskommen . . .
Schulz stößt mit mir an. Vier leere Lunikoff-Flaschen stehen schon auf der Back.
Während ich bei Dombrowski geschrieben hatte, war Schulz hereingestiefelt und hatte aufgeregt, also stotternd gemeldet, daß er den von Dombrowski bestellten Lunikoff-Wodka nicht von zu Hause habe mitbringen können. Dann hatte Meister Schulz mich zu überreden versucht, fünf Flaschen Adlershofer in der Stadt zu kaufen. Jedoch müßte ich an der Wache gut aufpassen, es wäre verboten, Schnaps auf den Dampfer zu schmuggeln. Mir war die Mutprobe erspart geblieben, das Schiff war schon am Abend ausgelaufen . . .
Schulz schenkt laufend nach, immer randvoll, russische Trinksitten, nur was zum Beißen fehlt. Er freut sich, daß die Reise endlich begonnen hat, jeden Tag in dem Laden der Schwiegereltern – Kolonialwaren stände noch dran! – wie ein Affe an den Regalen herumklettern, die Marmeladengläser blankputzen, und dafür nicht mal genug Lunikoff bekommen, das sei die schlimmste Art von Ausbeutung. »Bloß« – er beginnt zu stottern – »meine Frau ist im achten Monat. Aber beim zweiten Kind soll’s ja halb so schlimm sein . . .«
Wir trinken darauf, daß seine Theorie stimmt.
»Wäre ich wegen ihr zu Hause geblieben, müßte ich im März auf einem anderen Dampfer anfangen, und ich fahre schon eine Ewigkeit mit Dombrowski zusammen.«
Teichmüller, mein Meister, sitzt nicht in der Runde. Wenn die Rede auf ihn kommt, winkt Schulz ab. Und der Fischmehler sagt abfällig: »Ein Studierter!«
Dombrowski meint: »Falls der Teichmüller auf dieser Reise mit seiner Brigade wieder weniger Fisch als Schulz verarbeitet, kann er sich ein neues Schiff suchen.«
Nach diesem Satz jubelt die Runde, und Dombrowski muß – weil er von der Arbeit gesprochen hat – eine neue Flasche ausgeben. Das ist Sitte.
Als auch diese Flasche zur Neige geht, stimmt Wales »La Paloma« an, aber keiner singt mit. Die weiße Taube fliegt nicht. Der Fischmehler probiert es mit »Rolling home«, doch wir fahren erst in 100 Tagen wieder nach Hause . . .
»Ich hole James Watt«, sagt der Fischmehler.
Zwei Minuten später steckt einer seinen Kopf zum Schott herein. Und was für einen Kopf: Er besteht fast nur aus Bart. Feuerrot und dicht wie eine Krause Glucke.
»James, wir brauchen Musik«, sagt Dombrowski. Der Rotbart – Elektromeister auf dem Schiff – setzt sich, trinkt ein Glas Wodka auf ex und stimmt das Lied vom faulenden Wasser in den Kesseln vor Madagaskar an.
Und die Wodkarunde stimmt lautstark ein.
Dann singt der Elektromeister ein Solo auf platt, die Moritat von »Herrn Pasturn sien Kauh«. Ich frage ihn, ob er aus Mecklenburg stammt. »Nein, ich bin aus Leipzig«, sagt James Watt.
Der Rundgesang lockt immer mehr Leute an, man rückt zusammen, holt neue Gläser.
Die Gemütlichkeit wird unterbrochen, als ein bartstoppliger Mann im Schott steht und der Raum plötzlich nach Arbeit, nach Diesel und Schweiß riecht. Der vielleicht Fünfzigjährige hat ein ölverschmiertes Netzhemd an, dazu eine grüne Turnhose, die ihm unterhalb des Bauches baumelt, denn um die Hüften ist er so rund, als hätte er einen Rettungsring verschluckt. Verlegen entschuldigt er sich, er suche den Funker, müsse sofort ein Telegramm aufgeben, er würde das Futter für den Wellensittich nicht finden, wahrscheinlich hätte seine Frau vergessen, es einzupacken.
Die Runde überredet ihn, noch einmal zu suchen, bevor er ein Telegramm aufgibt. Schulz drückt ihn auf die Ducht, aber keiner schenkt Wodka ein. Dombrowski holt ein Glas Juice. Schulz, den ich fragend anschaue, sagt, daß der 3. Maschinist Werner Just – mit Spitznamen »Moor« genannt – auf dem Dampfer noch nie einen Schluck Schnaps getrunken hat.
Als Moor bemerkt, daß er und sein Vogel im Mittelpunkt der Wodkarunde stehen, wird er geschwätzig, beteuert, daß er es nicht länger als vier Wochen an Land aushalten könnte. Da würden sich die Nachbarsweiber die Mäuler zerreißen, ob er seiner Frau auch Blumen zum Geburtstag schenkt, aber als Mann mit Blumen in der Hand durch die Stadt, das sei schlimmer als nackt Spießruten laufen. Also bestellt er die Blumen schon Monate vorher auf dem Dampfer und wartet dann zu Hause, im Sessel sitzend, bis der Fleurop-Boy klingelt und seiner Frau die Geburtstagsblumen überreicht.
In der vorletzten Freizeit gab es Krach wegen des Eheringes, er trägt ihn nie, und als die Hochzeit des Ältesten bevorstand, kündigte ihm die Frau an: »Wenn du auf dem Standesamt ohne Ring erscheinst, lasse ich mich scheiden!« Da ging Moor in den Keller, bastelte in seiner Werkstatt, riß sich an einem Nagel den Ringfinger auf und mußte mit dickem Verband, bedauert von den Verwandten, und ohne Ring zum Standesamt gehen.
Als sich die Nachbarn aufregten, daß er den Garten nicht jäte, legte Moor im Garten Betonplatten. Nun wächst kein Gras und kein Unkraut mehr. Nur zwei Kirschbäume hat der Seemann gepflanzt, die Ernte besorgen während seiner Abwesenheit die Stare.
Das Schlimmste, lamentiert der Maschinist, sei ihm jedoch in diesem Urlaub passiert. Weil er nie weiß, was er den lieben langen Tag anstellen soll, legt er sich ein Kissen auf das Fensterbrett und beobachtet am Vormittag die Leute auf der Straße. Nachmittags geht er einkaufen und kommt immer mit einem prallgefüllten Netz zurück. In der dritten Woche meldete sich der ABV bei Moor. Der wachsame Rentner, der ständig auf der anderen Straßenseite aus dem Fenster schaute, hatte den Hüter des Gesetzes geholt, weil ihm sein Gegenüber, der nicht arbeitete und trotzdem jeden Tag für mindestens 50 Mark einkaufte, verdächtig vorkam.
Während Moors Geschichten haben wir auf den Geburtstag seiner Frau, auf die Hochzeit seines Ältesten und auf das Gedeihen der Kirschbäume getrunken. Nun stoßen wir noch auf Moor, das verdächtige Element, an. Danach stellt Dombrowski die restlichen vollen Flaschen in den Spind. Für heute würde es reichen. Die Runde mault, und Wales versucht die leeren Flaschen artistisch durch das Bullauge über Deck und Reling ins Wasser zu schmeißen, doch schon die erste zersplittert an der Rehling. Ein Wachhabender von der Brücke, der draußen vorbeigeht, knurrt bedrohlich, und Dombrowski bugsiert uns einzeln aus der Kammer . . .
Ich will den Niedergang zum dritten Deck hinuntersteigen, aber wahrscheinlich schaukelt der Dampfer in entgegengesetzter Richtung zu meinem Körper, denn jedesmal, wenn ich meinen Fuß auf eine Stufe stelle, versinkt sie, und mich hebt es in die Höhe.
Ein Matrose kommt von unten. Ich erinnere mich, daß an steilen Engstellen die Autos, die sich die Steigung hinaufmühen, Vorfahrt haben, und mache ihm Platz. Doch hier gilt wohl die umgekehrte Regel, denn er fragt mich lächelnd: »Was machst du besoffene Landratte auf dem Dampfer?«
»Ich bin Produktionsarbeiter«, sage ich.
»Dann streng dich an«, sagt der auf dem zweiten Deck Wohnende, »daß du gut hinunterkommst zum Portugiesendeck und die Koje findest, du Stinker.«
Ich finde meine Kammer und frage Baby, der sich Milch holt, weshalb mich der Matrose »Stinker« und unser drittes Deck »Portugiesendeck« genannt hat.
»Weil jeder, der wochenlang Fische schlachtet, auch nach Fisch stinkt, und weil westdeutsche Reeder für diese mistige Arbeit im untersten Deck meist nur Portugiesen oder andere Gastarbeiter anheuern«, sagt Baby.
Über Coffeetime-Gespräche
Die Kaffeezeit-Gespräche ändern sich mit der Dauer der Reise.
Während der Fahrt zum Fangplatz spricht man von den Erlebnissen in der zurückliegenden Freizeit, von den Leuten der Stammbesatzung, die diesmal nicht mitgefahren sind, von den Eigenheiten der Offiziere an Bord . . . und von den Frauen.
Später, wenn der Fisch tonnenweise ins Netz geht, die Arbeiter fast ersticken unter der Masse des zu schlachtenden Kabeljaus und bei der Coffeetime Luft holen wie in der Halbzeit eines Fußballspiels, erzählen sie vom Landgang in Kuba, von den Wäldern zu Hause . . . und von den Frauen.
Nach 60 Tagen der Reise, wenn die Steuerleute den Fisch suchen und nichts mehr finden, wenn die Langeweile beginnt und die Coffeetime zur lebensnotwendigen Medizin wird, hat man als Gesprächsstoff meist nur noch Witze . . . und die Frauen. (Allerdings nie die eigenen, über sie spricht man in der großen Kaffeerunde nicht.)
Wenn jeder auch die Witze auswendig kennt, beginnt bei der Coffeetime alles noch einmal von vorn.
Die Coffeetime ist eine wichtige Medizin gegen die Monotonie des Hochsee-Alltags. Beim Kaffeegespräch kann man sich ablenken, bekommt neue Informationen, fühlt sich nicht allein, sondern zugehörig zu seiner Truppe. Zur Kaffeezeit versammelt man sich regelmäßig und ohne Aufforderung. Sie wird brigadeweise, streng getrennt nach Produktions-, Decksund Maschinenabteilungen und immer in den gleichen Kammern zelebriert . . .
Coffeetime 1Moor erzählt von seiner Bekanntschaft mit der Liebe auf Grönland
Was ein richtiger Frauenkenner ist, der läßt für ein Eskimomädchen jede Französin sausen, und wenn der Käptn nicht so ein Moralstiesel gewesen wäre, hätte sich der eine oder andere unserer Mannschaft vielleicht eine Grönländerin aus Godthåb mit nach Hause genommen.
Die Grönländerinnen sind so anhänglich und so liebevoll. Wie sie einen anschauen mit zärtlichen, großen Augen!
Also, wir fuhren nach Godthåb, was Gute Hoffnung heißt, nein, wir fuhren nicht, wir wurden reingeschleppt, denn das Netz hatte sich in der Schraube verwurstelt, und Taucher sollten uns wieder klarreißen. So was dauert höchstens vier Stunden – nichts mit Landgang, dachte ich mir. Trotzdem hielt der Doktor vor dem Einlaufen einen Kurzvortrag (mit Lichtbildern) über die verschiedenen Stadien der Syphilis. Er war neu auf dem Dampfer und ein sehr ordentlicher Mensch. Wenn man beispielsweise mit einem vereiterten Finger zu ihm kam, belehrte er einen stundenlang über die Bordhygiene im allgemeinen und das Händewaschen im besonderen. Von seinen Medizinkollegen hatte er wohl auch gehört, daß Grönländerinnen sehr liebebedürftig sind und außerdem für jedes von einem Ausländer gemachte Kind eine Prämie wegen guter Bevölkerungspolitik erhalten sollen . . .
Also, die Taucher fummelten an der Schraube, und wir schielten sehnsüchtig zum Land. Vorsichtshalber hatte der Kapitän zwei Matrosen zur Wache an die Luke gestellt, damit keine fremden Wesen, vor allem keine weiblichen, den Dampfer entern könnten. Als wir kaum zwei Stunden in der Bucht lagen, tuckerte ein Kahn, gefährlich tief im Wasser liegend und mit Grönländerinnen beladen, zu uns herüber. Vier Mädchen nahmen die zwei Wachmatrosen an die Hand – so wie das Mütter mit ihren Kindern tun, und lächelten sie aus braunen, warmen Augen an (solche sehnsuchtsvollen Augen, sag ich, sieht man sonst nirgends in der Welt). Dann stiegen sie mit ihren zwei Gefangenen zum Wohndeck hoch, so sicher, als würden sie auf dem Dampfer zu Hause sein. Die Mädchen lachten, gurrten, zierten sich nicht, sie verlangten nichts, nur Liebe – Sonne, wie sie dazu sagten, wollten sie haben. Mir strich eine kleine Zierliche über den gelichteten Schädel, daß ich vor Aufregung nicht wußte, wohin in der Schnelle; ich wollte mit ihr in die Netzlast, stolperte aber wie eine Neueinstellung über die Seile, schlug lang hin.
Die Grönländerin half mir hoch, und so sah mich der Kapitän. Er schrie: »Just, scheren sie sich verdammt noch mal in ihre Maschine, die Taucher sind fertig.«
Ich habe immer solch ein Pech, kein Glück bei den Frauen, es war zum Heulen . . . Die Kleine bekam Angst vor dem Krach im Maschinenraum, ich zerrte und zerrte, doch sie stieg nicht hinunter, machte sich los und umarmte den Kälteassi. Kaum war ich jedoch in der Maschine, schepperte die Alarmglocke. »Feuer im Schiff!«
Ich dachte, ich spinne, doch da bestellte die Brücke schon Wasser.
»Und ’n bißchen dalli!« fauchte der Alte. Ich schmiß die Löschpumpe an, dann kletterte ich hoch. Über dem Dampfer hingen Rauchwolken wie über dem Ätna.
Die Matrosen – manche nur in Unterhosen – rannten mit der Feuerspritze zum Achterdeck, und die Eskimomädchen flüchteten in ihren Kahn und fuhren zum rettenden Ufer, wo die Godthåber Feuerwehr bereitstand. Ich raste also wie alle anderen – ja, damals bin ich trotz meines Bauches wie ein Hase gelaufen – zum Achterdeck. Und dort sah ich den Beschiß: Der Kapitän hatte Putzwolle und Rauchbomben anzünden lassen.
Dann befahl er: »Volle Kraft voraus«, und unser qualmendes Schiff dampfte aus dem Hafen. Einige Lords brüllten, man müsse den Kapitän dafür nackt auf einem Eisberg aussetzen, aber die meisten Leute von uns waren noch frohgestimmt und glückselig, als wir auf dem Fangplatz ankamen. Einen anderen Rostocker Fischereidampfer, auf dem der Kapitän zu jung war, um standhaft zu bleiben, hielten die grönländischen Mädchen in Godthåb zwei Tage und zwei Nächte lang besetzt.
Unser Rendezvous dagegen hatte nur ein Nachspiel. Am nächsten Morgen vermißten wir den Doktor. Er war bei dem Feueralarm halb nackt in den Kahn der Grönländerinnen gesprungen. Ein Lotsenboot brachte das verlorene Schaf zu uns zurück. Er hat danach auf dem Dampfer nie mehr einen Vortrag gehalten, weder über die verschiedenen Stadien der Syphilis noch über Bordhygiene im allgemeinen und das Händewaschen im besonderen.
Zwischenbericht 1 Die Fischdampfer
Auch wenn ich ROS 703 »Hans Fallada« in diesem Buch manchmal »Dampfer« nenne, ist das Schiff natürlich kein Dampfer, denn es wird nicht von einer schnaufenden Dampfmaschine, sondern von dröhnenden Dieselmotoren angetrieben. Aber immer noch (inzwischen existieren FischDAMPFER in der DDR lediglich als Museumsmodelle) sagen die Hochseefischer mit liebevollem Unterton »unser Dampfer« und »wir dampfen«. »Motorschiff« ist nur eine technische Bezeichnung, »Dampfer« dagegen ein Synonym für etwas Lebendiges und Vertrautes. (Zusatzerklärung für Autobesitzer: Man könnte es mit dem Unterschied zwischen »Zweitaktfahrzeug Trabant 601 Standard« und »Trabi« vergleichen.)
Mit Dampfmaschinen, Eisenbahnen und künstlicher Eiserzeugung begann im vorigen Jahrhundert eine neue Epoche der Hochseefischerei. Zweitausend Jahre hatten die Fischer ihren Fang nur eingesalzen oder auf Klippen und Holzgestellen zu Stock- und Klippfischen getrocknet. Als der Bedarf nach frischen Seefischen immer größer wurde, holten die deutschen Fischfangschiffe – schwerfällige, dickbäuchige Segler – vor Norwegen Eis und konnten damit ihren Dorsch und Rotbarsch fast drei Wochen haltbar lagern. 1835 wurde das erste Kunsteis hergestellt, bald gab es in allen großen Fischereihäfen Eisfabriken, und ständig tropfende Fischkühlwaggons ratterten, von Dampflokomotiven gezogen, ins Landesinnere.
1882 dampfte die englische »Prince Consort« mit einer Ladung Fische in die Wesermündung zum Geestemünder Markt, wodurch die deutschen Reeder sehr beunruhigt wurden. Drei Jahre danach stach auch der erste deutsche 146-BRT-Fischdampfer, die auf der Bremerhavener Werft gebaute 33 Meter lange, sechs Meter breite und von einer 270 PS starken Dampfmaschine angetriebene »Sagitta« (Pfeil) in See. Sie sank 1901 – wie viele deutsche Fischdampfer – spurlos vor Island. Damals zählte die deutsche Fischereiflottille 130 Dampfer und 428 Segler. Bis 1914 vergrößerte sie sich auf 263 Fischdampfer. Davon waren nach dem ersten Weltkrieg noch 82 übrig . . .
In den dreißiger Jahren wurden die ersten Fangschiffe mit Echolot ausgerüstet und Frachtdampfer zu schwimmenden Fischfabriken umgebaut. Die Firma C. Andersen (unterstützt durch den Zigarettenfabrikanten Reemtsma) erhielt vom »Reichswirtschaftsführer« den Auftrag, in Deutschland eine Kühlkette zum Vertrieb gefrosteter Lebensmittel, eine »Eisvorratswirtschaft«, aufzubauen. (Einen ähnlichen Auftrag zur Haltbarmachung von Proviant hatte Napoleon vor seinem Rußlandfeldzug vergeben – da erfand ihm 1810 der Koch François Appert die Dosenkonserve.) Andersen und Reemtsma organisierten bis zum Kriegsbeginn eine gut funktionierende Kühlkette für Lebensmittel und ließen, um Fischfilet auf Vorrat produzieren zu können, 1938 den 127 Meter langen Frachter »Ilmar« (5 500 BRT) zu einem Verarbeitungsmutterschiff umbauen. Im Herbst 1940 lief es mit Geleitschutz und einer Armada von Fangschiffen nach Hammerfest aus. Täglich produzierten achtzig deutsche und vierzig norwegische Arbeiter auf dem Fabrikschiff bis zu sechzig Tonnen Filet. Als es englische Kriegsschiffe am 4. März 1941 bei den Lofoten beschossen, sank es mit 22 000 Zentner Fischfilet an Bord.
Nach dem Krieg entwickelte die englische Firma »Fresh Frozen Food Ltd.« eine neue Generation von Fang- und Verarbeitungsschiffen. Bis dahin zogen die Fischer die vollen Netze backbord oder steuerbord mit der Hand oder der Winde über die Seitenwände. Deshalb mußten die Seitenwände auf den Fischdampfern niedrig bleiben, und es war nicht möglich, die Verarbeitung unter Deck einzurichten. Die Engländer versuchten als erste, das Netz achtern über eine Schleppe einzuholen, und benutzten dazu das Minenräumboot »Fair free«. Die Heckaufschleppe bewährte sich, die Seitenaufbauten konnten erhöht und auch Fischdampfer mit mehreren Decks gebaut werden. Die Sowjetunion übernahm die Idee der Heckfänger von den Engländern und bestellte 1955 bei der Kieler Howaldtwerft vierundzwanzig Fang- und Verarbeitungsschiffe, die berühmte »Puschkin«-Serie. Wir bauten nach dem gleichen Prinzip die »Brecht«-Schiffe: Filetverarbeitung, Frostanlagen, Fischmehlproduktion, Tranerzeugung und moderne Fanggeräte alles auf einem Schiff.
Die »Hans Fallada« ist einer unserer ältesten Heckfänger, sie hat drei Wohndecks, eine Länge von 86 Metern, ist 14 Meter breit, liegt vier Meter tief im Wasser und gehört mit ihren 3 000 Bruttoregistertonnen nicht mehr zu den größten Schiffen des Rostocker Fischkombinates. (Die »Junge Welt« beispielsweise – kein Fänger, nur ein Transporter und Verarbeiter – ist 141 Meter lang, 21 Meter breit, hat über 10 000 BRT und einen Tiefgang von 7,80 Metern.)
Unheldischer Kampf gegen die Seekrankheit
Seekrankheit ist keine Krankheit, sondern ein vorübergehender Zustand, der bei besonders hohem Wellengang vereinzelt auftreten kann. So hatten es uns die Lehrgangs-Lektoren in Rostock erklärt. In der zweiten Nacht, wir schaukeln bei Windstärke 7 über die Nordsee, schlafe ich sehr schlecht wegen der ungewohnten Geräusche auf dem Dampfer – Stampfen der Maschine, Schlangenzischen des Lüfters über dem Schott, Klappern der nicht verschlossenen Schränke und Türen. Und als ich am Morgen müde und zerschlagen den Kopf in der Koje drehe und nach dem Wetter schaue, rast der graue Himmel in atemberaubendem Zeitraffertempo am Bullauge vorbei.
Fährt unser Dampfer dem Himmel entgegen? Es kracht ohrenbetäubend, die Mucken in der Backskiste scheppern, und das Schiff schüttelt sich wie ein nasser Hund. Ich schließe die Augen, glaube zu träumen, doch als ich sie wieder aufmache, jagen die Wolkenfetzen in umgekehrter Richtung am Bullauge vorbei. Dann stürzen draußen die Niagarafälle in die Tiefe, Schaum wütet am Fenster, und schließlich rast graugrünes Wasser vor dem Bullauge in die Höhe. Nach Schrecksekunden – oder sind es nur Hundertstelsekunden? –, in denen alles zu verharren scheint, wechselt auch das vorbeischießende Wasser die Richtung, dann wieder der Schaum, der Himmel . . .
Ich kann nicht mehr hinschauen, ich drehe mich weg, um das Schauspiel, das vor dem Bullauge aufgeführt wird, nicht sehen zu müssen. Doch wahrscheinlich geschieht das alles nicht nur draußen, sondern auch hier in der Kammer, denn ein unsichtbarer Riese aus den Märchenängsten meiner Kindheit steht neben der Koje, reißt meine Füße mit Urgewalt in die Höhe und zieht meinen Kopf in die Tiefe.
Als die Beine so steil nach oben ragen, daß ich glaube, aus der Koje zu fallen, und mich ängstlich an den Seitenbrettern festklammere, hält der Riese inne, holt Luft. Dann drückt er das Fußende in die Tiefe und stemmt das Kopfende der Koje so hoch, daß ich Angst habe, an die Kammerdecke zu stoßen. Doch auch sie bewegt sich nach oben.
Das Auf und Ab wiederholt sich in einer Minute zweimal, und jedesmal kracht und zittert das Schiff wie bei einem kleinen Weltuntergang.
Allmählich begreife ich, daß sich unser Dampfer unter gewaltigen Wasserbergen, die donnernd auf ihm zusammenstürzen, schüttelt und wir bestimmt zehn Meter hohe Wellen hinauf- und hinuntergeschaukelt werden. Nachdem mein Kleinhirn diese furchtbare Tatsache verarbeitet hat, wird mir kotzübel. Ich beginne zu schlucken und wische mir die schweißnassen Hände am Bettuch ab.
Die mit Sprelacart verkleideten Wände der Kammer knarren wie alte Bäume, die zu fallen beginnen. Über der Decke der Kammer poltern Fässer, die nicht fest verzurrt wurden, und irgendwo im Vorschiff klirrt eine schwere Eisenkette im Schaukeltakt gegen die Bordwand. Meine Schreiblampe rutscht, soweit es die Schnur erlaubt, auf dem Tisch hin und her, die aufgehängten Bilder baumeln wie das Pendel einer Standuhr.
Alles bewegt sich in dieser verdammten Behausung. »Pilotenkammer« hatte Baby unsere Kammer genannt. Aber Piloten können das Auf und Ab von Sturzflug und Steigen regulieren, sie bewegen nur den Steuerknüppel, um wieder ruhig zu fliegen. Im Steuerhaus eines Schiffes hingegen kann der Kapitän noch so eifrig am Ruder kurbeln, das Schiff schießt in die Höhe und stürzt in die Tiefe, wie das Meer es will. Die Amplitude der Schaukelbewegung ist dabei am Vordersteven oder Hintersteven drei- bis viermal so groß wie in den mittschiffs liegenden Kammern. Unsere Pilotenkammer ist die zweite von vorn.
Ich will vorsichtshalber aus der Koje klettern, doch in dem Augenblick, da ich mich nach unten hangele, versinkt das Schiff im Wellental, fällt wohl schneller als ich, das Gesetz der Schwerkraft funktioniert nicht mehr, ich hänge hilflos in der Luft, und erst als das Schiff wieder nach oben rast, staucht es mich auf den Fußboden.
Ich sitze zwischen meinen Unterhemden, Büchern, Papieren und den herausgeschleuderten Schubladen. Beim Versuch, sie wieder hineinzuschieben und mit Papier festzuklemmen, kracht mir die Spindtür gegen den Kopf. Auch sie öffnet und schließt sich im Rhythmus der Himmel- und Höllenfahrt. Im gleichen Rhythmus bewegt sich mein Mageninhalt.
Ich schlucke und schlucke . . .
Ähnlich erging es mir, als ich zwölfjährig Vaters Pfeife mit seinem Nachkriegskraut (im Garten angebauten Tabak gemischt mit Buchenblättern) stopfte und sie bis zum bitteren Ende rauchte. Auch damals bekam ich weiche Knie und versuchte mühsam, mein Innenleben innen zu behalten.
Doch während ich vor 26 Jahren nur Angst hatte, von Vater erwischt zu werden, habe ich nun im gleichen Trancezustand Bange, mein Herz könnte streiken, der Kreislauf versagen . . . Dabei hatte man mich vor der Ausreise in der Rostocker Betriebspoliklinik untersucht, zwar festgestellt, daß ich verschnörkelte Farblinien nicht entziffern kann – deshalb darf ich nur unter Deck arbeiten –, aber bestätigt, daß ich gesund und – was das wichtigste war – seetauglich sei