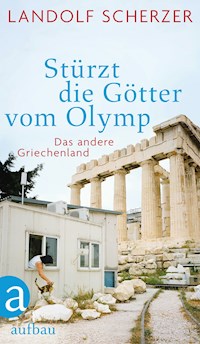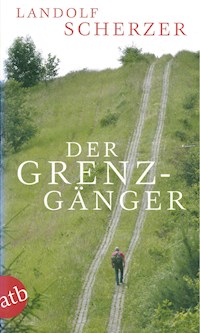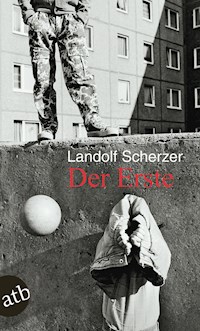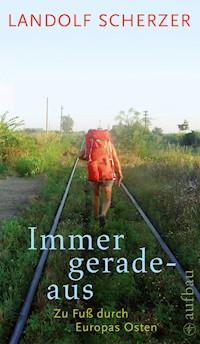16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Krim – eine Region, die ein Paradies sein könnte, aber zum Spielball zerstrittener Länder wurde Landolf Scherzer, der „Spezialist für Recherchen vor Ort“, fuhr 2019 auf die Krim. Er ahnte nicht, dass es der Vorabend eines Krieges zwischen Russland und der Ukraine war. Aber aus seinen Beobachtungen und Begegnungen wird die historische Dimension der Konflikte deutlich. Das Porträt einer Krisenregion entsteht, das weder vereinfacht noch verurteilt und dadurch umso wahrhaftiger und lebendiger ist. „Die meisten hier haben Leidensgeschichten. Russen, Polen, Deutsche, Ukrainer … Nicht nur bei den Tataren blieb die Angst wie ein Geschwür im Kopf. Auf der Krim ist sie jetzt als Angst vor dem Krieg wieder lebendig. “
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 322
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über das Buch
Die Krim – der Name erinnert an üppige Vegetation, südliches Leben und Sommerfrische, aber auch an Gewalt, Vertreibung, Krieg. Nicht erst seit der Krimkrise von 2014 ist ihr Status umstritten. Landolf Scherzer ignorierte die Warnungen des Auswärtigen Amtes und reiste 2019 privat und eigentlich illegal zu einer krimtatarischen Familie. Wie lebt es sich in dieser gezeichneten Region? Was erhoffen sich Russen oder Ukrainer? Welche düsteren Erfahrungen belasten die zurückgekehrten Krimtataren, die Stalin 1944 deportieren ließ? Scherzer sammelt berührende Lebensgeschichten und kommt Legenden auf die Spur wie der vom Absturz des Fliegers Joseph Beuys. Im Puzzle der Begegnungen scheint die historische Dimension heutiger Konflikte auf, und das Porträt einer Region entsteht, das weder vereinfacht noch verurteilt und dadurch umso wahrhaftiger und lebendiger ist.
Über Landolf Scherzer
Landolf Scherzer, 1941 in Dresden geboren, lebt in Thüringen. In seinen großen Langzeitreportagen wie „Der Erste“, „Der Zweite“ und „Der Letzte“ hat er seinen besonderen Blick für brisante Themen bewiesen. Ob nach China, Griechenland oder Kuba, immer wieder bricht er auf, um sich auf faszinierende Begegnungen und Alltagsabenteuer einzulassen, die der Zufall und seine Neugier ihm zuspielen. Zuletzt erschien „Buenos Días, Kuba. Reise durch ein Land im Umbruch“. 2021 stellte Hans-Dieter Schütt ihn und seine Bücher im Gespräch vor: „Weltraum der Provinzen. Ein Reporterleben“.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Landolf Scherzer
Leben im Schatten der Stürme – Erkundungen auf der Krim
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Motto
Motto
Von einer Plüschente, die die Überwachungskamera in der Meldebehörde von Saki bewacht, einer Krimtatarin, die blau gesäumte gelbe Umhänge für Putin häkelt, und Timur-Leng, dem hinkenden Welteroberer
Vom Lenindenkmal, das in der »verbotenen Zone« der eingestürzten Krimsanatorien steht, von einem Rubel‑U-Boot, das im Schmuckgeschäft auf- und abtaucht, und der ewigen Flamme
Von Bauern, die auf der Krim tiefe Brunnen bohren, dem Geschichtsbruder, der nach 2014 den Fehler gemacht hat, so viel Knoblauch wie zuvor anzubauen, und dem Zaren, der 1867 Alaska an die USA verkaufen musste
Vom Geologen Valeri, der Pilot werden wollte, aber nun den Heilschlamm analysiert, von einem Baustellenbewacher, dessen Vorfahre den Moskauer Zirkus gegründet hat, und dem Unterschied zwischen einem klaren und einem trüben »Wässerchen«
Von meiner Schafsbruderschaft mit dem Kuhbruder, dem zweiten Autokennzeichen des Busfahrers für die Stationen nach der neuen russisch-ukrainischen Grenze und einer Dreieinigkeit von Moschee, Synagoge und russisch-orthodoxer Kirche in Jewpatorija
Vom Fluch des sowjetischen Afghanistansoldaten Igor auf die verdammten Mudschaheddin, von der Kaffeesatzprognose des lustigen Bruders für meine künftigen Krimgespräche und der tatarischen Weisheit, dass Bucklige erst im Grab gerade werden
Von Boleslaw, der so alt wie ich ist, aber behauptet, dass sein Leben schon länger währt als meines, dem Kauf eines nach dem Truppenabzug in Deutschland zurückgelassenen russischen T‑34‑Panzers und Reschit, der als Busfahrer einmal ein galstuk umbinden musste
Von »Putingeldern«, die auf der Krim spurlos verschwinden können, dem Chefredakteur Leonid, der in seinem Büro verzweifelt ein Gastgeschenk sucht, und dem kofferlosen Ende meiner ersten Krimreise
Von der »Neu-Erfurterin« Olga, deren Eltern auf der Krim in der Stadt des großen Chemieunfalls leben, dem Schriftsteller Sergej Lochthofen, der den Absturzort des deutschen Kampffliegers und späteren Künstlers Joseph Beuys im Norden der Krim gesucht hat, und dem Beginn meines zweiten Versuchs, das »Paradies am Schwarzen Meer« zu erkunden
Von Stalins Angst, dass ihn jüdische Ärzte vergiften, Gulnadas Erzählung, wie sie als Kind trotz blutiger Hände schneeweiße Baumwolle pflücken musste, und der Liebe meines guten Bekannten Leonid zu »Rammstein« und »Kreuzberger Nächten«
Von philosophischen Theorien bei Gerds Stoffpräsentation in Jalta, dem Preisnachlass, den die Malerin Vika im Restaurant »Orchidee« erhält, und dem Rat, bei der Fahrt nach Armjansk die sumpfige Landenge von Perekop zu meiden
Von der Suche nach der Familie Rypnerski, einem auf dem Acker des adligen Großvaters gelandeten polnischen Flugzeug und den »Hängt die Russen an die Bäume«-Sprechchören in ukrainischen Schulen
Von einem Erlebnis auf dem Friedhof von Nowaja Derewnja, das ich mir eigentlich für einen Roman aufheben wollte, dem bereits dritten strahlengeschädigten Direktor des Tschernobyl-Museums in Jewpatorija und Worten und Fakten, die nicht miteinander verheiratet sind
Erläuterungen
Impressum
Wer von diesem Buch begeistert ist, liest auch ...
Aus aktuellem Anlass widme ich dieses Buch den Ukrainern und Russen, die sich gegen jeden hasserfüllten Nationalismus und für ein friedliches Zusammenleben ihrer Völker einsetzen.
L. S., Dietzhausen, 10. März 2022
Wenn du die Erinnerung tötest, tötest du dich.
Tatarische Weisheit
Ein Volk, welches seine Vergangenheit nicht kennt, hat keine Zukunft.
Russische Weisheit nach Michail Lomonossow
Ohne Kenntnis der Vergangenheit gibt es keinen Weg in die Zukunft.
Ukrainische Weisheit nach Isaak Babel
Ich stehe am Fenster.
Der Sturm, ein gewalttätiger Bruder des gewöhnlich friedlichen Schwarzen Meeres, reißt die Folien von den alten Gewächshäusern und wirbelt sie wie Segelfetzen in der kalten Winterluft himmelwärts. Schließlich landen sie doch vor Gartenzäunen, Hundehütten, Schutthaufen, Weinstöcken und Mauerresten zwischen löchrigen Eimern, gerodeten Sträuchern, Pappkartons, Zeitungsseiten, Plastekanistern und verschlissenen Tatarenmützen. Strandgut der Krimstürme der letzten Jahre …
Seit gestern wohne ich bei Babuschka Gulnada und ihrer vierköpfigen Familie in Nowaja Derewnja. Das aus Muschelkalksteinen gebaute kleine Haus steht an der Sowjetskaja, der wegen tiefer Schlaglöcher nur noch sehr langsam und in engen Schlangenlinien zu befahrenden Dorfstraße. Nowaja Derewnja gehört zur Stadt Saki, in der ich mich mit meinem russischen Visum als ausländischer Tourist auf der – sowohl von der Ukraine als auch von Russland beanspruchten – Halbinsel Krim innerhalb von drei Tagen behördlich anmelden muss.1
Als es dunkel wird, legt sich der Sturm. Die schwarzen Krähen und die grau gefiederten wilden Tauben setzen sich scharenweise auf die Gasleitungen, die wie Triumphbögen in drei Meter Höhe die Straßen queren und die Häuser miteinander verbinden. Zwar meiden die vorsichtigen Vögel die dünnen Stromkabel, mit denen die Holzmasten an den Häusern oder die Häuser an den Holzmasten festgebunden sind, doch plötzlich erlischt die an einem Kabel baumelnde Glühbirne in meinem Zimmer. Auch in den gegenüberliegenden Häusern wird es dunkel. Vor einem Gebäude wirft ein Mann den Motor seines Notstromaggregats an. Ich will das Fenster öffnen und fragen, ob eine Leitung gerissen oder der Strom abgeschaltet worden ist. Doch ich kann das Fenster ebenso wenig öffnen wie das im Nachbarzimmer. Oder das auf der Toilette. An allen Fenstern sind die Griffe abgeschraubt. Von wem? Und weshalb? Ich habe keine Ahnung und finde auch keinen Vierkantschlüssel zum Öffnen.
Die Fenster bleiben mir – was ich erst später merken werde – nicht nur in dem kleinen Haus auf der Krim vorerst verschlossen.
Trotzdem hoffe ich, dass ich die Bitten, die mir mein Freund Wassja in seinem Abschiedsbrief geschrieben hatte, erfüllen kann.
Seit dem Abflug in Berlin am 3. Februar 2019 steckt dieser Brief wie ein kostenloses Eintrittsbillett ordentlich gefaltet in meiner Hosentasche.
Leipzig, den 1. Dezember 2018
Lieber Landolf, ich schreibe eilig und kurz. Wir werden uns vielleicht eine lange Zeit nicht mehr sehen. Nach 25 Jahren Deutschland wandere ich aus. Ich fühle mich hier nicht mehr gut. Für die deutsche Politik und ihre Medien ist mein Russland nur noch ein alter neuer Feind. Schon in zwei Tagen werden meine Frau Sieglinde und ich nach Australien fliegen. Wir wollen dort in der kleinen Stadt Albany leben. Bestimmt wirst Du fragen: Weshalb Australien und nicht zurück nach Russland? Weil meine Frau dort nicht leben will. Sie ist ängstlich, dass unsere Kinder sie in Russland nicht mehr besuchen können und wir wegen der EU‑Embargopolitik nicht nach Deutschland fahren dürfen …
Mein Freund, ich muss Dir jetzt noch sagen, dass ich Dir nie die Wahrheit über mich und meine Vergangenheit gesagt habe. Ich bin nicht, wie Du denkst, ein Russe. Ich bin ein Krimtatar! Aber ich wurde auch nicht auf der Krim, sondern 1981 in Usbekistan geboren. In der Verbannung!
Im Mai 1944, zwei Wochen nachdem die Rote Armee die Krim endlich von den deutschen Faschisten befreit hatte, ließ Stalin alle auf der Krim lebenden Tataren nach Sibirien und Mittelasien verbannen. Insgesamt mehr als 200 000. Auch meine späteren Eltern. In den 70 fest verschlossenen und überfüllten Güterzügen mit Viehwaggons starben während der wochenlangen Transporte Zehntausende. In Deutschland ist dieses Leiden der Krimtataren nur wenigen Menschen bekannt. 1948 hatte Moskau die Krimtataren zu »Umsiedlern auf Lebenszeit« erklärt. Erst 1989 durften sie wieder in ihre alte Heimat. Auch mein Vater Suleman und meine Mutter Akscheschek – »weiße Blüte« – gingen mit mir zurück. Damals war ich sieben Jahre und die Krim für mich ein fremdes Land. Dort habe ich später meine Mutter und meinen Vater begraben. Danach arbeitete ich als Ingenieur in Deutschland und heiratete Sieglinde.
Viele Bekannte von mir leben noch auf Krim. Auch meine besten Freunde, die sechs Brüder Baraschew2, von denen drei im kleinen Dorf Nowaja Derewnja bei Saki zu Hause sind: Alexander der Große, der jüngste und einzige rothaarige Baraschew. Wait, der Geschichtsbruder, der sich in jeder freien Minute mit der russischen und tatarischen Krimhistorie beschäftigt. Jussuf, der Kuhbruder, der Biokäse verkauft. Hussein, der Autobruder, der einen Oldtimer fährt. Ibrahim, der lustige Bruder, der die Regeln des Islam streng befolgt, und Kerim, der Hauptstadtbruder, der in Simferopol wohnt. Ich versprach schon vor einigen Monaten, zu ihnen zu kommen und die letzte Bitte meines Vaters zu erfüllen: das vergangene Leiden der Krimtataren und das Leben der Menschen auf der Krim überhaupt zu beschreiben und es ins Deutsche übersetzen zu lassen. Ich schaffe es nun nicht mehr. Vielleicht kannst Du für mich auf die Krim fliegen? Und alles aufschreiben. Damit niemand die Vergangenheit vergisst. Und auch die Deutschen besser verstehen, was heute auf der Krim geschieht. Ein Schlafbett hast Du bei Reschit – tatarisch »der Mann, der den Weg kennt« – und der Babuschka Gulnada – gul ist »schön« und nada »weise«. Fahre irgendwann! Und atme die Krim. Ein Paradies. Das Schwarze Meer ist blau und warm und weich. Die Berge schützen das Ufer vor den kalten Stürmen des Nordens. Dort wachsen Steppengras und duftende Kräuter. Gastfreundliche Menschen leben seit Tausenden Jahren auf der Krim. Griechen, Türken, Russen, Tataren … Obst und Wein gedeihen. Paradies Krim. Küsse die Erde von mir. Und lebe weiter nützlich.
Dein Wassja
Vor seinem Abflug nach Sydney hatte ich ihm nur noch eine SMS schreiben können:
Mein Freund Wassja! Ja, wenn ich ein Visum erhalte, werde ich irgendwann auf der Krim sein, Deine Freunde grüßen und versuchen, über ihr Leben früher und den Alltag heute zu schreiben. Gute Reise Dir und Deiner Frau
Von einer Plüschente, die die Überwachungskamera in der Meldebehörde von Saki bewacht, einer Krimtatarin, die blau gesäumte gelbe Umhänge für Putin häkelt, und Timur-Leng, dem hinkenden Welteroberer
Nach einigen Minuten flackert die Glühbirne auf. Kurz darauf erlischt sie wieder. Ich könnte zur Babuschka hinuntergehen und sie nach dem Grund für den Stromausfall fragen. Doch ich bleibe vor dem Fenster stehen und schlucke die Dunkelheit. Erinnere mich, was mir Bekannte, selbst ernannte »Russlandexperten«, und das deutsche Auswärtige Amt vor meiner Reise privat und offiziell geraten oder verboten hatten. Unter anderem sollte ich niemand fragen, ob er lieber auf einer ukrainischen oder der russischen Krim leben möchte … Als Tourist dürfte ich keine Interviews führen … Und ich sollte einem Krimtataren um Allahs willen keinen Schnaps anbieten, denn die würden, anders als wodkaliebende Russen, niemals Alkohol trinken … Am kompliziertesten sei jedoch die Einreise auf die Krim: Ausländische Touristen dürften nicht von der Ukraine aus auf die »russische Krim«. Und wer, wie ich, mit einem russischen Visum über Moskau auf die Krim fliegt, macht sich nach ukrainischem Gesetz des illegalen Grenzübertritts in die Ukraine schuldig. Mindestens zwei Jahre dürften diese »Grenzverletzer« keinen ukrainischen Boden betreten, und sie könnten dort verurteilt werden.
Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, hatte 2018 gefordert, dass deutsche Personen des öffentlichen Lebens, die mit einem russischen Visum von Moskau auf die »ukrainische Krim« fliegen, bei ihrer Rückkehr auch in Deutschland vor Gericht gestellt werden. Was nicht geschieht. Doch das Auswärtige Amt in Berlin warnt alle Bundesbürger offiziell vor einer Reise auf die Krim. Man sei dort, weil illegal in die Ukraine eingereist, ohne deutschen diplomatischen, medizinischen und rechtlichen Schutz.
Ich bin ein Illegaler!
Aber in meiner Hosentasche steckt Wassjas Brief als ordentlich gefaltetes Eintrittsbillett. Eintritt wofür? Es gibt Billetts, um Theater, Museen und Stadien zu besuchen … Aber wahrscheinlich keine Eintrittskarten in fremdes Leben.
Das Licht brennt wieder. Ich ziehe den Vorhang vor das nicht zu öffnende Fenster und gehe hinunter zu Gulnada. Sie sitzt mit ihrer Tochter Sera, deren Mann Reschit und den zwei Enkeln in der Küche. Ohne zu fragen, ob ich hungrig bin, bringt sie mir sofort usbekischen Plow: Reis mit Möhren, Zwiebeln, Rosinen, Lammfleisch. Dazu tatarisches Fladenbrot. Danach usbekischen grünen Tee. Und zum Schluss noch russische Mischka-Pralinen.
Ich frage, ob sie Ukrainerin, Tatarin, Usbekin oder Russin ist.
Statt ihrer antwortet Reschit: »Wir sind Usbeken und Russen und Ukrainer. Aber zuerst Tataren! Krimtataren! Muslime!«
Die zwei Frauen wiederholen ständig: »Kuschai! Kuschai! – Iss! Iss!« Also noch einmal Kekse und noch einmal Konfekt. Und noch einmal Tee und noch einmal Plow. Dann in Scheiben geschnittene Äpfel.
Wenn ich wenig esse, beleidige ich sie, sagt die wohlbeleibte Babuschka. Das will ich nicht. Auch nicht, als sie noch einmal Tee nachgießt und Eierkuchen und Feigenkonfitüre auf den Tisch stellt. Danach holt sie eine Flasche aus dem Vorratsraum.
»Wein von den eigenen Weinstöcken vor unserem Haus. Und aus von eigenen Händen geernteten Weintrauben. Und mit eigenen Händen gekeltert«, sagt sie beim Einschenken.
Süßer roter Krimwein! Für alle!
Das erste Glas auf den Gast.
Nachdem ich ihnen von der Reisewarnung des Auswärtigen Amtes für die Krim erzählt habe, stoßen wir mit dem zweiten Glas auf meine Illegalität an.
Ich erinnere mich an die Ratschläge deutscher Experten und frage unsicher: »Muslimische Krimtataren trinken Alkohol?«
Die Babuschka: »Selbst gemachter Wein ist kein Alkohol.«
Ich: »Aber auch kein Traubensaft.«
Sie: »Erst im Geschäft verkauft, wird er zu Alkohol.«
Und Reschit ergänzt: »Nur dem Mann, der zu oft und zu viel trinkt, zürnt Allah.«
Als die Babuschka die leere Flasche zur Seite stellt, holt sie keine neue. Aber sie schneidet Salami in dünne Scheiben und brüht noch einmal Tee.
Die Teekrümel quellen im heißen Wasser zu großen Blättern.
Es ist inzwischen halb zehn. Das Licht brennt ruhig. Die Kinder toben nicht mehr. Das zierliche siebenjährige Mädchen sitzt mit ordentlich geflochtenen Zöpfen in einem blumengemusterten Kleid auf dem Schoß der Mutter und schreibt geduldig die Zukunftsformen des russischen Verbs »leben« in ihr Aufgabenheft.
Ihr zwei Jahre jüngerer Bruder ist genauso groß wie sie. Doch sein weites gelbes T‑Shirt spannt über dem Bauch. Wenn die Großmutter ihn nicht beobachtet, stibitzt er unentwegt Salamischeiben und Konfekt. Er kniet auf der Sitzbank vor dem Fensterbrett. Darauf liegt ein Computerspiel.
»Er beschäftigt sich vom Aufstehen bis zum Schlafengehen nur noch damit«, schimpft Gulnada. »Sogar wenn der Strom weg ist. Das Ding läuft auch mit Batterien.«
Auf dem Bildschirm schießen gelb gekleidete kleine Monstersoldaten auf Bäumen (!) wachsende rote Rüben und grüne Melonen ab, und Frauen sammeln das Gemüse in Körbe. Danach marschieren die gelben Monstersoldaten übers Feld zum Waldrand. Dort stehen Soldaten in blauen Uniformen. Minuten später liegen Tote und Verwundete zwischen den Bäumen. Der Junge strahlt. Die Babuschka schimpft …
Um zehn hat das Mädchen die Hausaufgaben erledigt. »Rechnen und Schreiben mag ich nicht. Aber Zeichnen und Sprachen.«
»Fremdsprachen?«
»Ja. Wir lernen in der Schule Russisch. Und Ukrainisch. Und Tatarisch.«
Ich verkneife mir die Frage: Nicht nur Russisch?, wie man mir in Deutschland erzählt hatte, denn Reschit ergänzt, dass es zu ukrainischen Zeiten keinen Tatarischunterricht gegeben habe. Den hätten erst 2015 die Russen eingeführt.
Ich sage dem Mädchen auf Deutsch: »Guten Tag! Danke! Bitte! Auf Wiedersehen!«
Sie wiederholt es dreimal und sagt stolz: »Nun spreche ich schon vier Sprachen. Ich werde später in Russland, der Ukraine, Tatarstan oder Deutschland leben können.«
Russisch: »Dobroho dnja! Spassibo! Pashalujstwo! Do swidania!«
Ukrainisch: »Choroschy den! Djakuju! Laskawo prossymo! Pobatschennja!«
Tatarisch: »Chercher! Rachmat! Sau bul! Kureschkendje!«
Und Deutsch: »Gutted Ach! Tanke! Bjitte! Auf Widdersän!«
Sera bringt die Kinder ins Bett.
Gulnada streut Salz in die Gemüsesuppe, die in einem sehr großen – Thüringer würden sagen – Kloßtopf auf dem Herd köchelt.
»Für morgen. Ich koche jeden Tag für alle.«
Sie klopft auf ihren Bauch und meint lachend: »Man sieht es doch.«
Ich frage, weshalb sie heftig genickt hatte, als Reschit behauptete, dass sie sowohl Usbeken als auch Ukrainer, Russen und Tataren wären.
Sie fischt für mich ein Fleischstückchen als Kostprobe aus dem Topf und pustet vorsorglich. »Verbrenn dir nicht den Mund!«
Während ich kaue, klärt sie mich auf, dass sie nach der Deportation ihrer Eltern in der Usbekischen Sowjetrepublik geboren wurde. »Wir hatten dort einen usbekischen Sowjetpass. Als wir 2008 auf die Krim kamen, lebten wir mit einem ukrainischen Pass in der Ukraine. Inzwischen mit einem russischen Pass in Russland. Aber immer sind wir Tataren, Krimtataren, geblieben. Und werden es bleiben.«
Reschit erinnert mich, dass ich unbedingt morgen in der Meldebehörde von Saki die Aufenthaltsgenehmigung für Ausländer beantragen muss. »Nur damit kannst du deine Euro hier gegen Rubel eintauschen und später ohne Probleme zurückfliegen.« Die Behörden auf der Krim würden die neuen russischen Vorschriften peinlich genau befolgen. Bei der Ein- und Ausreise und auch beim Umtausch des Geldes wären sie kleinlicher als die Russen in Russland. Bis 2014 hätte jeder auf der Krim Euros oder Dollars in ukrainische Griwni tauschen und die westlichen Touristen dabei auch mal übers Ohr hauen können. »Doch jetzt dürfen Ausländer ihr Geld nur noch in der Bank zum staatlichen Kurs in Rubel wechseln.«
Ob er mich morgen früh nach Saki fahren und mit mir zur Meldebehörde gehen kann, weiß er noch nicht. »Ich muss zuerst die Tochter zur Schule und die Frau zur Arbeit bringen. Sera ist Verkäuferin.«
»Und du?«
»Ich fahre manchmal Touristenbusse und repariere Autos für die Urlauber. Aber leider nur im Sommer.« Dann würden sich Hunderttausende auf der Krim erholen. Nach dem EU‑Verbot von organisierten Touristenreisen kämen jetzt vor allem Russen. »Ihre Autos sind oft schon sehr alt. Aber unsere Straßen immer noch sehr schlecht. Und unsere Berge auf der Krim sehr hoch. Also kann ich im Sommer sehr viel reparieren.«
Reschit telefoniert nach einem Ersatzfahrer für mich und sagt danach erleichtert: »Alexander der Große, der jüngste der Baraschew-Brüder, wird dich morgen um 9 Uhr hier abholen.«
Wieder in meinem Zimmer mit dem nicht zu öffnenden Fenster, packe ich meinen Rucksack aus, lege den bunt bebilderten Krimreiseführer von 2012 und meine noch leeren Hefte (eines für meine Recherchen, das andere für kurze Tagebuchnotizen, die ich Wassja schicken will) in das Nachtschränkchen neben meinem Bett. Danach stapele ich etliche Kataloge, in denen Designerstoffe angeboten werden, in den Kleiderschrank. Die Kataloge und Adressen seiner früheren Kunden auf der Krim hatte mir mein Freund Gerd auf dem Flugplatz in Berlin in die Hand gedrückt. Mit seiner russischen Frau Lidia verkauft er seit der Wende exquisite Stoffe nach Osteuropa. Ich solle das Geschäft auf der Krim wiederbeleben. Mehr sagte er nicht.
Am Ende meiner nächtlichen Einräumaktion steckt nur noch ein dickes ungeöffnetes graues Kuvert im Rucksack. Ich lege es auf das Kopfkissen. Absender: Nasur Yurushbaev. Ein tatarischer Filmemacher und Poet, der über 30 Jahre in Deutschland (zuerst in der DDR) arbeitete. Ich hatte ihn in Leipzig kennengelernt. Seit einigen Wochen lebt er wieder in Kasan, der Hauptstadt des autonomen tatarischen Gebietes der Russischen Föderation. Seine deutschen Kinder leben heute in Rostock, Potsdam und Düsseldorf. In Kasan schreibt er jetzt ein Theaterstück und einen Roman über sein Leben. Er wird aus einer ungewöhnlichen Perspektive erzählen: aus einem beim Abzug der russischen Truppen in Stendal gekauften T‑34‑Panzer, in dem er nach der Trennung, ohne Wohnung und »krank mit den Nerven«, einen Monat lang campiert habe …
Vor meiner Reise bat ich ihn um Informationen zu Geschichte, Traditionen und dem Alltag der Tataren, damit ich seine Landsleute nicht missverstehe. Die Bräuche und die Geschichte der Tataren und seine persönlichen Erfahrungen könne er mir gern beschreiben. Doch ich sollte mir davon für meinen Aufenthalt nicht zu viel versprechen. Auf der Krim gebe es 60 Prozent Russen, 25 Prozent Ukrainer und 12 Prozent Tataren und viele andere Nationalitäten. »Und jeder, gleich wo er früher in der Sowjetunion gelebt hat, wird dir eine andere Geschichte erzählen. Oder schweigen. Ich schreibe dir meine kurz auf. Aber was auch immer du auf der Krim bei deinen Erkundungen erfahren oder nicht erfahren wirst, tröste dich mit einer Weisheit der Tataren: ›Auch ein Pferd kann trotz vier Beinen einmal stolpern.‹«
Heute bin ich zu müde, um das Kuvert zu öffnen. Ich stecke es in den Rucksack zurück.
Am Morgen steht 5 Minuten vor 9 Uhr ein junger Mann mit roten Haaren am Hoftor. Groß gewachsen und dünn wie eine Bohnenstange.
»Du bist fünf Minuten zu früh«, begrüße ich ihn.
Er lacht. »Alle Freunde, die Deutsche kennen, sagen: Die Nemzis sind ein überpünktliches Volk. Du bist der erste Deutsche, mit dem ich mich treffe, und ich wollte nicht schon beim ersten Mal zu spät kommen.«
Auch als er eine Verbeugung andeutet, muss ich noch zu ihm hochschauen. »Ich heiße Mansur. Mansur ist der ›Sieger‹.«
»Reschit nennt dich aber Alexander der Große.«
»Der spottet, weil ich 2 Meter und 3 Zentimeter groß bin. Aber alle Freunde nennen mich Alexander. Sag du das bitte auch.«
Wir hätten noch Zeit, um nach Saki zu fahren, meint er und schlägt vor, seinen Bruder Wait zu besuchen.
Wir benutzen die hintere, nur mit Draht zugebundene Gartentür. Reschits angeketteter Hund, der wegen des besseren Überblicks zur Verteidigung seines Territoriums gegen Nachbarsköter auf dem Dach seiner Hütte sitzt, bellt nicht. Neben dem Haus sind umgebogene Bäumchen wie Mumien in Stoff eingerollt. »Das sind wärmeliebende Feigen. Unser Vater Achtem Baraschew hat sie aus Usbekistan mitgebracht. Seitdem schützen wir sie vor den eisigen Krimstürmen«, sagt Alexander.
Wir stolpern querfeldein über mit braunem Steppengras bewachsene Flächen. An einer Stelle liegen Mauerreste zwischen dornigen Büschen.
»Das war die Station, in der die beladenen Erntewagen der Kolchosen gewogen wurden.«
Ich zeige fragend auf die kilometerweite Brache. »Viel gab es hier wohl nicht zu wiegen?«
»Doch! Tausende Zentner Weintrauben.«
»Weintrauben?«
»Ja! Hier wuchsen überall sehr süße Weintrauben.«
Lange Pause.
Dann erklärt Alexander: »Zwischen 1984 und 1988 haben die Russen die Weinstöcke herausgerissen.«
»Die Russen?«
»Ja, Gorbatschow! Bei seiner Anti-Alkohol-Kampagne wurden die Weinanbauflächen auf der Krim von fast 90 000 auf etwa 70 000 Hektar reduziert. Jahrhundertealte Weinstöcke sind damals mit Baggern herausgerissen worden. Und Gorbatschow konnte deren Vernichtung auf der Krim persönlich kontrollieren, denn an der Südküste hatte er sich zuvor seine Regierungsdatscha bauen lassen.«
Bei Wait steht die Tür zwar weit offen, aber niemand ist zu Hause. Auf dem Rückweg zum Auto laufen wir auf der Sowjetskaja-Schlaglochstraße.
Während der Fahrt schweigt Alexander. Nur als wir am Stadteingang von Weitem vier hohe rot-weiße Schornsteine sehen, sagt er, dass die Russen dort zur Stromerzeugung ein Siemens-Gasturbinenwerk aufbauen. Wegen der Handelsblockade der EU gegen die Krim sei es von der deutschen Firma zuerst nach Russland geliefert worden. Von dort wohl illegal hierher. Man erzähle, dass auf der Baustelle keine Krimtataren und keine Einheimischen arbeiten dürfen, sondern nur Spezialisten aus Russland.
Mehr sagt er nicht.
Ich schaue unruhig auf die Uhr. Wir sind nun doch spät dran.
Alexander beruhigt mich. »Du musst bei uns nicht hasten, sondern warten können. Das Leben auf der Krim bedeutet auch: geduldig auf etwas warten.«
Wir halten vor der schmucklosen grauen Fassade eines langen dreistöckigen Gebäudes mit vielleicht hundert Fenstern.
Lenin im Zentrum
»Ein sowjetischer Bürobau«, sagt Alexander.
150 Meter daneben steht ein mit Sockel ungefähr 9 Meter großer Lenin. Er schaut geradeaus auf die goldglänzenden Kuppeln einer russisch-orthodoxen Kirche. Dem sowjetischen Verwaltungsgebäude zeigt er seine februarkalte rechte Schulter. Den Rücken hat er einem kolossartigen sozialistischen Kulturhaus zugewandt, und zu seiner Linken verkündet ein Transparent an einer Bank: »Gemeinsam mit Russland«.
Wir steigen die schon nicht mehr kantigen, sondern abgetretenen Betonstufen hinauf. An den zementgrauen Wänden hängen Hinweis- und Reklamezettel. Vor der Tür zur Meldebehörde stehen drei Wartende. Als nach einer Viertelstunde ein Mann herauskommt, gehen wir fünf gleichzeitig in die Amtsstube. In dem vielleicht 4 Quadratmeter großen Wartebereich drängeln, schubsen und stützen sich ein gutes Dutzend Bürger.
Im doppelt so großen Arbeitsbereich sitzen zwei junge Frauen hinter einer thekenähnlichen Barriere. Die Wände über ihren Schreibtischen sind mit Reklamebildern von Traumlandschaften der Krim tapeziert. Nackte Bergkuppen. Palmen. Zypressen. Sandstrände. Sonnenaufgänge und azurblaues Meer. Nach einer gefühlten halben Stunde schaut mich die jüngere schwarzhaarige Frau fragend an. Sie trägt eine sehr weite, in den ukrainischen Farben Blau und Gelb gemusterte Folklorebluse, verlangt herrisch meinen Pass und kontrolliert das russische Visum. Um Vertrautheit zwischen ihr und mir herzustellen, will ich sie nach den traumhaften Krimlandschaften fragen. Aber ich frage nicht.
Auch nach langem Suchen findet sie im Computer keinen Hausbesitzer für meine Unterkunft in Nowaja Derewnja und erklärt kategorisch, dass ich morgen noch einmal vorsprechen muss. Ich probiere die Mitleidstour. »Ohne Aufenthaltsgenehmigung kein Geldumtausch. Und ohne Rubel kann ich weder Brot noch Wodka kaufen.«
Die ältere Frau in einem schwarzen Kostüm mit weißer Bluse schaut noch einmal in den Computer und findet den Namenseintrag. Entschuldigend sagt sie: »Bei der Umstellung der Computer auf die neuen russischen Formulare sind einige Daten verwechselt worden.« Als ich mich bedanke und zum Gehen wende, scheint es, als ob die mit allerlei Firlefanz dekorierte Plüschente, die auf der Überwachungskamera in der Ecke hockt, hämisch grinst.
Ich bezahle 150 Rubel (2 Euro) für ein Formular zur Erlangung eines Antragsformulars und laufe, nach Anweisung der älteren Frau, zwecks Erteilung einer behördlichen Aufenthaltsgenehmigung durch einen langen Gang am Redaktionszimmer der »Sakier Zeitung« vorbei bis zu einem sehr großen Raum. Er ähnelt einem Wartesaal der Deutschen Reichsbahn aus DDR-Zeiten. Allerdings ohne Sitzbänke. Die Bürger stehen und warten, bis sie aufgerufen werden und durch eine Tür, die sich nur selten öffnet, eintreten dürfen. Zuerst muss man im Wartesaal an einem Automaten den konkreten Grund des Kommens per Knopfdruck mitteilen. Weil ich nichts Zutreffendes finde, wähle ich: »Andere Fragen«. Danach erfahre ich auf einer Anzeigetafel, dass für mich im Büro die Zeit von 10.30 bis 10.45 Uhr reserviert ist. Ich warte geduldig bis 10.35 Uhr. Doch immer noch stehen die Termine für die Bürger, die um 9.45 Uhr, 10.00 Uhr und 10.15 Uhr eintreten dürfen, an der Tafel.
Nervös falte ich mein Antragsformular. Das ist, wie ich später bemerke, falsch. Der Beamte wird mein Papier vor dem Vervielfältigen wieder glätten müssen.
Um mich abzulenken, studiere ich die vielen »Achtung! Achtung!«-Zettel an der Wand neben der Behördentür. Außer allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen stehen dort Hinweise, wie die Bürger die Abfertigung beschleunigen und Fehler vermeiden können: »Nur auf konkrete Fragen der Angestellten konkret antworten! Nichts sagen, was nicht gefragt wird!«
Unter den teilweise schon vergilbten Zetteln ist eine Verlängerungsschnur mit fünf Steckdosen angebracht. Die an der Decke hängende Klimaanlage ist dagegen fest installiert. Die Gardinen vor den Fenstern sind zerknüllt.
10.50 Uhr … Ich müsste seit 5 Minuten abgefertigt sein. Doch auch die drei vor mir warten noch …
Der Fußboden ist zur Hälfte mit Linoleum und an manchen Stellen mit Laminat belegt. Es wellt sich schon. Das alles kenne ich noch aus DDR-Büros. Damals hatten wir als Lehrlinge auch die Bürokratie vom großen sozialistischen Bruderland übernehmen müssen. Inzwischen ist das vereinigte Deutschland ein Meister im Anwenden der sowjetisch-russischen DDR-Bürokratie …
Alexander schaut seit einer halben Stunde wortlos aus dem Fenster. Um 10.55 Uhr klopft er an die Tür, öffnet sie und sagt, auf der Schwelle stehenbleibend, dass ein Ausländer auf seine Aufenthaltsgenehmigung wartet. Dieser Ausländer – also ich – würde Russland und die nun wieder russische Krim schätzen. Ob die neuen Behörden es verantworten könnten, dass der Ausländer diesen guten Eindruck ausgerechnet in Saki verliert.
Er winkt mir. Im Büro sitzen zwei Angestellte. Sie fragen mich nichts. Der eine, schlipslos, kopiert, mich strafend anschauend, mein geglättetes Antragsformular. Der andere, mit Schlips und Anzugjacke, tippt Zahlen in den Computer. Hinter ihren Schreibtischen steht ein langes Regal. Darauf liegen Akten. Die werden durch eine kleine künstliche, vom Fest übrig gebliebene russische Jolka-Weihnachtstanne und einen Gummibaum geschmückt. Zwischen Weihnachtstanne und Gummibaum steht ein gerahmtes Porträt von Putin. Ein zweites Foto des streng blickenden Präsidenten befindet sich auf dem Tisch des Schlipsträgers. Der unterschreibt und stempelt wortlos zuerst mein Anmeldeformular und dann die Aufenthaltsgenehmigung.
Als ich in den Wartesaal zurückkomme, murrt niemand über meine Bevorzugung, also die eines Ausländers. Selbst die nicht, die eigentlich vor mir dran gewesen wären.
In Deutschland dagegen wäre …
»Hier noch nicht!«, denke ich laut. »Hier beschimpft man keine Ausländer.«
Statt eines Kommentars beginnt Alexander, die verschiedenen Nationalitäten aufzuzählen, die seit Jahrhunderten auf der Krim leben: »Litauer, Ukrainer, Russen, Türken, Griechen, Deutsche, Tataren, Polen …« Bei 15 hört er auf und lacht.
Wieder auf der Straße, bringt er mich zu dem kleinen Lebensmittelgeschäft, in dem Reschits Frau Sera arbeitet.
Ich frage, wie viel sie verdient.
»In der Woche 8000 Rubel.« (Gut 100 Euro.) Das sei viel. In der Ukraine würde sie – ich rechne im Kopf (!) ihre Rubel in Euros um – wahrscheinlich nur 70 Euro erhalten.
Aber dort koste das Kilo Butter fast 5 Euro. »Einen Euro mehr als hier.« Ein Kilo Brot (auf der Krim 0,60 Euro) sei 0,30 Euro und ein Liter Benzin (auf der Krim 0,70 Euro) 0,20 Euro teurer …
Sie spendiert mir einen Kaffee und ein Wurstbrot.
Mit Alexander vereinbaren wir, dass er mich um 16 Uhr abholt. In der Zwischenzeit könne ich Saki erkunden.
»Wie weit ist es zum Meer?«, frage ich.
»Vielleicht zwei Kilometer bis zur sumpfigen Bucht.« Die würde ich schon von Weitem riechen. »Saki bedeutet auf Tatarisch ›heilender schwarzer Schlamm‹.«
Alexander warnt mich vor Gesprächen in der Stadt. »Wer nach dem EU‑Reiseembargo als deutscher Tourist hier herumläuft, fällt auf und ist inzwischen ein Exot. Also sei lieber still!«
Doch schon vor der Tür spricht mich ein junger Mann an, der seine Fellmütze tief ins gerötete Gesicht gezogen hat. Als er mir wie anderen Vorübergehenden eine weiß-blau-rote russische Papierfahne in die Hand drückt, sage ich: »Spassibo – Danke!« Aber was machen mit der russischen Fahne? Ich bin noch nie, selbst nicht in der DDR, als Fahnenträger umhergelaufen. Einfach wegwerfen? Wahrscheinlich wäre das eine antirussische Provokation. Ich gehe also hinter die – von Lenin beäugte – russisch-orthodoxe Kirche des heiligen Ilja, stecke die Fahne dort dekorativ in die Umzäunung und hoffe, dass mich niemand beobachtet hat!
Man hat. Neben dem Zaun sitzt eine in Decken gehüllte alte Frau auf einem Kissen. Vor ihr liegen auf einem Brett silberfarbige Amulette und stehen bunte Matroschkas, die mit ihren Bäuchen protzen. Sie gleichen sich wie ein Ei dem anderen. Alle sehen aus wie Wladimir Iljitsch … Nein, nicht wie Wladimir Iljitsch Lenin, sondern wie Wladimir Wladimirowitsch Putin.
Putin auseinandernehmbar! Im großen Putin steckt ein kleiner. Im kleinen Putin steckt ein noch kleinerer. In dem kleineren Putin ein sehr, sehr kleiner. Und in dem sehr, sehr kleinen Putin ein winziger Putin. Die Frau hat allerdings nur den großen Putin aufgestellt. Und für den häkelt die frierende Frau einen schmückenden gelben Wollumhang. Ich habe schon viele Matroschkas in der Hand gehalten: Lenin, Stalin, Mao Tse-tung, Karl Marx, Che Guevara, Gorbatschow, Jelzin. Aber zum ersten Mal sehe ich, dass eine Frau mit klammen Händen wärmende Umhänge für die Holzfiguren häkelt.
Statt einen Putin zu kaufen, bitte ich die Frau um ein Amulett. Nachdem sie mich neugierig gemustert hat, sagt sie, dass sie Aigü – die Blüte des Mohns – Abduschewa heißt. Auf den Amuletten sei der berühmte tatarische Heerführer Timur-Leng abgebildet. Er würde – was ich bestimmt in der Schule gelernt hätte – direkt von Dschingis Khan abstammen.
»Als dessen Reich zerfiel, raubte Timur mit seinen Kriegern zuerst Schafherden und später Städte und Länder.« Mit Allahs Hilfe sei er bald Herrscher der halben Welt geworden, erzählt sie, während sie für mich sein Porträt blitzblank putzt.
Ich hatte gelesen, dass er mit 28 Jahren in einer Schlacht am Bein verletzt wurde, an Knochentuberkulose erkrankte und danach lahmte. Timur-Leng – Timur der Lahme. Nach dem Sieg bei Delhi hätte er 100 000 Gefangene erschlagen und bei Isfahan 56 Pyramiden aus je 1500 Schädeln der Besiegten errichten lassen. Für den Bau seiner Festungen wären an Pfosten gebundene Soldaten mit Lehm und Mörtel übergossen worden. Auf seiner Gruft im Mausoleum von Samarkand stehe: »Glücklich ist, wer die Welt verlässt, ehe sie auf ihn verzichtet!« Mit 68 Jahren sei Timur auf dem Feldzug gegen China getötet worden. Allerdings nicht vom Schwert, sondern vom Suff.
»Timur war ein Moslem?«
Sie nickt.
Näher als Timur-Leng erschien mir zur Schulzeit der Held des sowjetischen Jugendbuches »Timur und sein Trupp« von Arkadi Gaidar. Der Namensbruder des Welteroberers, ein sowjetischer Pionier, vollbrachte mit seinem Trupp gute Taten. Nach seinem Vorbild wurde in der DDR die »Timur-Hilfe« organisiert. Auch ich war als Pionier ein Timur-Helfer. Ich schippte für gebrechliche Menschen den Schnee vor ihrem Haus, ging für Kranke einkaufen, half Rentnerinnen, den Müll wegzubringen, und jätete für Schwerbeschädigte Unkraut in ihren Gärten …
Ehrenamt heißt das heute und wird staatlich gefördert.
Ich kaufe zwar auch kein Amulett von Timur-Leng, hole aber Aigü Abduschewa am Kiosk einen heißen Kaffee und mit Quark gefüllte Piroggen. Die Frau trinkt so hastig, dass sie sich den Mund verbrennt, über ihre Gier lachen muss und mich mit vollem Mund fragt, weshalb ich kein Timur-Amulett möchte. Es würde mir wieder jugendliche Kraft schenken und mich vor Gefahren schützen.
Ich sage, ich hätte gelesen, dass Timur ein Massenmörder war.
Leise, als spräche sie mit sich selbst, antwortet sie: »Ich habe über 40 Jahre in der Nähe von Timurs Grabstätte, dem Gur-Emir-Mausoleum, in einem Dorf bei Samarkand gelebt.«
»Und weshalb sind Sie von Usbekistan auf die Krim gegangen?«
»Meine Mutter ist eine Krimtatarin. Sie lebte bis zur Verbannung hier in Saki.«
»Mohnblüte« wühlt lange in der Kiste, bis sie unter den Timur-Amuletten eine Muschel findet, auf die ein Marienbild gemalt ist, drückt sie mir in die Hand und sagt: »An irgendetwas muss jeder Mensch glauben. Sonst ist er wie ein Schiff ohne Hafen. Oder wie eine Pflanze ohne Licht. Niemand kann ohne Glauben leben. Nicht die Russen und nicht wir Tataren.«
Ich erinnere mich an meine Reise in die untergehende Sowjetunion im Jahr 1991. Zwei Priester hatten mich damals in der Stadt Kaluga nach meinem Glauben gefragt. Ich sagte ihnen, dass ich meinen alten Glauben seit dem Ende der DDR verloren und noch keinen neuen gefunden hätte.
Da begannen ihre Augen missionarisch zu flackern. Einer hielt mir das Bild der Muttergottes vor das Gesicht und forderte mich auf, zu ihr zu beten. Jetzt und auf der Stelle. Dafür würden sie mir einen neuen Glauben schenken. »Wir haben heute schon ein Dutzend Kommunisten bekehrt.«
Ich vertröstete die Priester mit dem Versprechen, dass wir unser Gespräch in zwei Tagen vor der Kirche fortsetzen könnten. Und sündigte dabei bereits mit einer Lüge. Denn am nächsten Tag, das wusste ich, würde ich von Kaluga nach Moskau zurückfahren.
Mit dem Marienbild in der Hand verabschiede ich mich von Aigü Abduschewa. Als ich mich noch einmal umdrehe, sehe ich, dass sie keinen der Vorüberlaufenden anspricht. Sie häkelt mit blauem Garn den Saum des gelben Umhangs für die Putin-Matroschka.
Den Weg zum Meer suchend, ärgere ich mich, dass ich mit Aigü Abduschewa zwar über Timur, Putin und den Glauben gesprochen habe, nicht aber den Mut hatte, sie nach ihrer Verbannungszeit in Usbekistan zu fragen.
Weshalb?
Weil vielleicht ein ängstliches Schweigen ihre Antwort gewesen wäre?
Vom Lenindenkmal, das in der »verbotenen Zone« der eingestürzten Krimsanatorien steht, von einem Rubel‑U-Boot, das im Schmuckgeschäft auf- und abtaucht, und der ewigen Flamme
Das Meer ist noch nicht zu riechen. Auch nicht das sumpfige. Lenin, der neben der Kirche steht, weist mir keine Richtung. Seine Arme hängen kraftlos am Körper herunter.
Neben Lenin steht ein vielleicht 13‑jähriger Junge. Ich frage ihn nach dem Meer. Er zeigt mit einer Hand – die andere behält er in der Tasche seiner Jeans – in die Richtung, der Lenin den Rücken zugewandt hat, und sagt: »Ever long the street.«
Die street ist eine schmale Einkaufsstraße. An ihrem Anfang wird sie von einem rechteckigen Tor überspannt, auf dessen Querbalken in lichter Höhe kunstvoll verschnörkelte Buchstaben für den »KURORT SAKI« werben. Rechts und links Foto-, Elektro-, Schmuck-, Bekleidungs- und Möbelläden. Dazwischen steht eine offene zweispännige Pferdedroschke vor einem tatarischen Restaurant. Es ist geschlossen. Gegenüber befindet sich eine Weinstube. »Krimweine zum Kaufen und Probieren« werden angeboten.
Krimweine?
Zum Glück sind trotz Gorbatschows Kontrolle damals doch nicht alle Weinstöcke vernichtet worden! Oder wurden sogar neue gepflanzt? Ich kann weder fragen noch probieren. Auch die Weinstube ist geschlossen.
Die Gold- und Schmuckgeschäfte auf der street sind geöffnet. Vor dem ersten wechsle ich die Straßenseite. Denn neben der Tür steht der Mann, der die russischen Fähnchen verteilt. Am zweiten Geschäft (»Sonderangebot: 1 Gramm Gold nur 1600 Rubel«) beobachte ich, ob jemand hineingeht oder interessiert vor dem Schaufenster stehenbleibt. Fünf Minuten warte ich vergeblich. Die Frauen, die hier noch wie zu Sowjetzeiten sehr mondän mit Pelzmantel, Nerzschal, Lackstiefeln, Samtröcken und Seidenblusen, deren Bündchen unter dem Pelzärmel hervorschauen, bekleidet sind, laufen am Gold vorbei.
Kurort Saki
Ich gehe hinein. Die Verkäuferin, eine junge blonde Frau mit Stupsnase und Grübchen, trägt weder goldene Ringe noch goldene Armbänder oder eine goldene Halskette. Ihr wertvollster, für die meisten russischen Verkäuferinnen untypischer Schmuck ist ein neugieriges, freundliches Lächeln. Und ein kleiner Bernstein an einem dünnen ledernen Halsband.
Trotz meiner abgetragenen grünen Kutte, der schlampigen braunen Cordhose und einem mit Ankern gemusterten Seemannstuch fragt sie: »Solotije saponki?« – Ob ich goldene Manschettenknöpfe kaufen möchte.
Ich lache. Und sie auch.
»Ich bin von Lenin bis hierher an drei Schmuckläden vorbeigekommen. Kauft man auf der Krim so viel Gold, Silber und Edelsteine?«
»Heute nicht mehr. Doch früher …«
»Früher?«
»Ja, gleich nachdem wir russisch geworden sind.«
Damals hätten vor allem die reicheren Bewohner der Krim die Schmuckläden gestürmt und Unmengen goldene Ringe, Ketten, Krawattennadeln und – sie lacht wieder – goldene Manschettenknöpfe gekauft. »Gold war Sicherheit für die ungewisse Zukunft.«
Die ukrainische Währung, die Griwna, sei von einem Tag zum anderen zwar gegen Rubel tauschbar, aber nicht mehr sicher gewesen.
»Und der Rubel?«
»Der war ein U‑Boot!«
Weil ich das nicht verstehe, legt sie eine Hand auf den Tisch, steckt sie dann unter den Ladentisch und hebt sie wieder hoch. »Auftauchen und abtauchen und wieder auftauchen.«
»Und heute?«
»Das U‑Boot ist inzwischen eine seetüchtige Fähre. Sie bringt die Menschen jetzt vom alten Ufer zu einem neuen.«