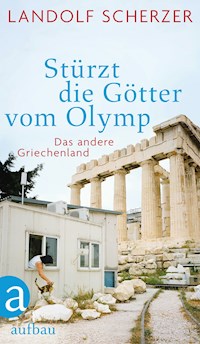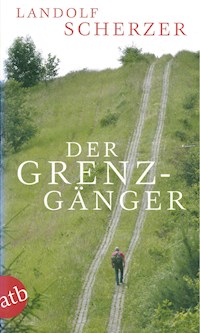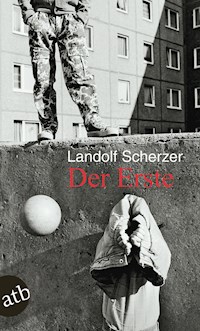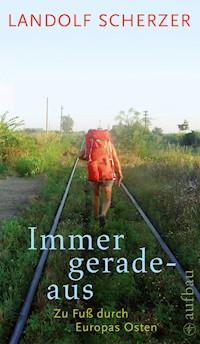
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Geplant war eine Fahrt per Traktor und Wohnwagen durch sieben osteuropäische Länder, aber bereits vor Ungarn gab der Trecker auf. So musste Landolf Scherzer mit seiner alten Kraxe loslaufen, immer geradeaus, von Grenze zu Grenze. Was enttäuschend begann, erwies sich als Glücksfall, denn wie hätte er sonst so viele Begegnungen am Wegrand haben können: ungarische Flurwächter, kroatische Friedhofspfleger, rumänische Fußballtrainer, gastfreundliche Roma und all die Grenzgänger aus dem Heer derer, die der Arbeit hinterherziehen. Ihn erwarteten merkwürdige Beispiele der Globalisierung, osteuropäisches Improvisationstalent, absurde EU-Projekte, neueste Technik neben primitivsten Bedingungen. Hass auf den Nachbarn lernte er kennen, Geschäftstüchtigkeit wie Großherzigkeit - und nicht zuletzt seine eigenen Grenzen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 404
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Landolf Scherzer
Immer geradeaus
Zu Fuß durch Europas Osten
Impressum
Mit 50 Fotos des Autors
ISBN 978-3-8412-0050-1
Aufbau Digital,veröffentlicht im Aufbau Verlag, Berlin, 2010© Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, Berlin 2010
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung und Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlages zulässig. Das gilt insbesondere für Übersetzungen, die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen sowie für das öffentliche Zugänglichmachen z.B. über das Internet.
Umschlaggestaltung heilmann/hißmann, Hamburg unter Verwendung eines Fotos, das Landolf Scherzer in Rumänien bei einer riskanten Abkürzung auf den Gleisen zeigt
E-Book Konvertierung: le-tex publishing services GmbH, www.le-tex.de
www.aufbau-verlag.de
Menü
Buch lesen
Innentitel
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Impressum
Inhaltsübersicht
Ein Dank und eine notwendige Vorbemerkung
Von einer 5000 Kilometer langen Traktorfahrt, die endete, bevor sie begonnen hatte, einem transportablen Antizecken-WC und einer Béla-Bartók-Wette um zehn Flaschen »Egri Bikavér«
Von ungarischen Frauen, die »Peter-seine« heißen, Hakenkreuzen an einem verlassenen Stellwerk und einer Nacht auf dem Fußboden der katholischen Kirche in Beremend
Vom Sheriff Nr. 0037, der an der kroatischen Grenze Maisdiebe verfolgt, der Spur der toten Hunde und einem Vulkanisierer, der hofft, dass die EU in Kroatien keine besseren Straßen bauen lässt
Von meiner Flucht vor den Ratten im Weinkeller, einem arbeitslosen Kroaten, der in seiner Wohnstube auf Ferrari Rennen in São Paulo fährt, und einer alten Serbin, die mich vor einer »betrügerischen, schlechten Frau« bewahrt
Von einem Zimmer mit Blick auf freischaffende Prostituierte, von Serben, die Kroaten vor Serben beschützen , und genetisch veränderten Sonnenblumen, deren Köpfe zu groß geraten sind
Von einem deutschen »O Tannenbaum …«-Gesang im serbischen Sommer, einem Überfall vor dem Friedhof in Oreškovica und einem Glückskauf in einer kleinen Apotheke von Backa Topola
Von einem Tag, als keine Regentropfen, sondern Bomben vom Himmel fielen, meiner Fahrt mit einem schwarzen Schwein durch Tornjoš und einem serbischen Schachgroßmeister, der für Bayern spielt
Von serbischen Eltern, die zwei ungarische Kinder vor dem Waisenhaus bewahrten, einer großflächigen Vojvodina-Wahlwerbung im Maisfeld und einem Donauschwaben, der Reifen verbrennt und das Eis vom Himmel schießt
Von einer Dame, die ich besser mit Handkuss begrüßt hätte, einer Schauspielerin, die Liebeslieder sang, als die NATO-Bomben in Kikinda detonierten, und einem Protokoll über die Leiden von Unschuldigen
Hildas Aufzeichnungen
Von meinem Versuch, illegal über die serbisch-rumänische Grenze zu laufen, einem Zigeuner in Srpska Crnja, der sich über Pornografie in Deutschland empört, und einer schweißnassen roten Abschiedsfahne
Von einem Kleintransporter aus Gera, der ohne Kennzeichen in Jimbolia verrostet, einem rumänischen König, der wegen seiner Mätresse ins Exil ging, und dem Großvater von »Lady Di«, der Adventist ist
Von der Versuchung, in einem alten Renault bis nach Timişoara zu fahren, einer Frau, die in achtundzwanzig Jahren dreizehn Kinder geboren hat, und meiner »Aufnahme« in das Kloster der Salvatorianer
Von einem General, der erst die Erschießung der Demonstranten in Timişoara und danach die des Ehepaares Ceauşescu vorbereitet hat, einem künftigen Patre, der meint, dass der liebe Gott die schönen Mädchen für alle geschaffen hat, und einem rumänischen Geheimdienstler, der nur für Geld erzählt
Von der Museumsleiterin in Lenaus Geburtshaus, die Nikolaus Lenau nicht mag, einem banatschwäbischen Rumänen, der seinem Bruder Speck und Tomaten nach Deutschland bringt, und einem neuen Bürgermeister in Grabaţ, der auch mit Hilfe eines Fußballtrainers die »Altkommunisten« besiegt hat
Von einem Gedenkstein für die 52 HELDEN auf dem Friedhof von Gottlob, dem Apfelpflücker Pavel Konstantin Kolling, der nicht begreifen will, dass kleine Äpfel in der EU keine Äpfel mehr sind, und meiner ersten Fahrt mit einer Draisine
Von einem Monteur aus Sânnicolau Mare, der 1991 die »Erfurter Brauerei abgebaut und nach Timişoara gebracht hat«, meinem verzweifelten Versuch, die Béla-Bartók- Wein-Wette zu gewinnen, und »Herzi«, der 1982 als Hundezüchter nach Deutschland floh und heute wieder in Rumänien leben will
Ein Dank und eine notwendige Vorbemerkung
Bei der Robert Bosch Stiftung in Stuttgart bedanke ich mich für die Förderung meiner Osteuropatour.
Bei den Gesprächspartnern, die ich in Ungarn, Kroatien, Serbien und Rumänien traf – unter anderem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Deutschen humanitären Vereins »St. Gerhard« in Sombor, des Deutschen Vereins in Kikinda und des Deutschen Kulturzentrums in Timişoara (Temeswar) –, bedanke ich mich für die Informationen.
Bei Hilda Banski bedanke ich mich für die Erlaubnis, ihre Erinnerungen aufnehmen zu dürfen.
Bei den Bauern, Patres, Winzern und Roma bedanke ich mich für die Nachtlager in Getreidekammern, Kirchen, Weinkellern, alten stabilen Banater Gehöften oder fast schon eingefallenen Hütten.
Bei Anton Enderle aus Regensburg bedanke ich mich für die Hilfe beim Übertragen der donauschwäbischen Mundart.
Eine notwendige Vorbemerkung: In den Ländern, durch die ich gelaufen bin, ist es im alltäglichen Sprachgebrauch nicht üblich, von Minderheiten der Roma und Sinti zu sprechen. Die Angehörigen dieser Bevölkerungsgruppen bezeichnen sich dort selbst, und zwar mit Stolz, als cigányok, Ciganini oder ţigani.
Um einen ständigen Wechsel zwischen der Autorensprache und der Landessprache zu vermeiden, habe ich im Buch immer die Bezeichnung »Zigeuner« verwendet, auch wenn dies selbstverständlich keine adäquate Übersetzung ist.
Von einer 5000 Kilometer langen Traktorfahrt, die endete, bevor sie begonnen hatte, einem transportablen Antizecken-WC und einer Béla-Bartók-Wette um zehn Flaschen »Egri Bikavér«
Das Abenteuer Traktorreise sollte in dem 1100 Kilometer von Thüringen entfernten südungarischen Kurort Harkány beginnen. Als ich dort nach einer zweitägigen Fahrt mit Badetouristen aus dem klimatisierten Touristenbus steige, ducke ich mich unter der Hitze. Vierzig Grad im Schatten. Die neuen Kurgäste rollen ihre Koffer zu den Pensionen und werden von den Wirtsleuten mit kühlem Sekt begrüßt.
Ich hucke meine zwanzig Kilo schwere Kraxe auf. Aber ich weiß nicht, wozu. Ich sage zu meinem Sitznachbarn: »Tschüss! Ich lauf dann mal los.« Und ich weiß nicht, wohin, denn meine Landkarten, Wörterbücher, Wäsche und Schuhe liegen in Willis Wohnwagen.
Willi war vor zwei Wochen mit seinem fünfzig Jahre alten Deutz-Traktor und einem Bastei-Wohnwagen allein vorausgefahren. Heute wollten wir uns hier in Südungarn treffen und gemeinsam zu einer Tour durch sieben osteuropäische Länder aufbrechen. Kurz vor meiner Abfahrt hatte ich eine SMS bekommen: »Ich fahre wieder nach Hause. Die Tour mit dem Traktor ist zu gefährlich.«
Bis zu meiner Ankunft in Harkány habe ich gehofft, dass Willi mich nur an der Nase herumführen wollte und schon in Ungarn auf mich warten würde …
Wir hatten 1975 in einer Solidaritätsbrigade am Sambesi gemeinsam Häuser für moçambiquanische Bergleute gebaut. Als wir uns im vergangenen Jahr wiedersahen, erzählte Willi von seiner Liebe zu alten Traktoren und sagte, dass er sich im Sommer einen großen Traum erfüllen würde: mit Traktor und Wohnwagen durch Nordafrika zu fahren. Und er fragte, ob ich mitkommen wolle. Ich könnte doch über die Reise schreiben.
»Nein«, sagte ich, »nach Afrika nicht, aber wenn du stattdessen durch Osteuropa fährst, bin ich dabei.«
Noch am selben Tag legten wir die Route fest: von Thüringen durch Österreich, Ungarn, Kroatien, Serbien, Rumänien, Moldawien, die Ukraine, Polen und zurück nach Thüringen – 5000 Kilometer in vier bis fünf Monaten.
Schon bei unserem nächsten Treffen hatte Willi eine lange Liste, was wir organisieren und mitnehmen müssten: einen gebrauchten zweiten Traktorsitz, den er anschweißen lassen wollte, Ohropax gegen Schnarch- und Traktorlärm, Pfefferspray gegen Überfälle, Fahnen aller Länder, durch die wir fahren würden, einen Benzinkocher, viele Fünfeuroscheine, falls man große Scheine nicht wechseln konnte, eine aufklebbare Picasso-Friedenstaube, einen handbetriebenen Dynamo zum Aufladen des Handys, Warnwesten, Zollgenehmigungen für den Transport des Traktors über die Grenzen der nicht zur EU gehörenden Länder, Luftballons, Stifte und Kugelschreiber für die Kinder in den Dörfern, Magnesium-Tabletten zur besseren Durchblutung, eine Waschschüssel, ein Behelfsklo, auf das wir uns, um uns keine Zecken einzufangen, in der freien Natur setzen könnten …
Willi dachte an jede Kleinigkeit.
Bis zu seiner Abfahrt hatten wir alles organisiert und zusammengetragen. Sogar das Antizeckenklo: ein Plastehocker, aus dessen Sitzfläche Willi ein Loch herausgesägt hatte.
Zur Abschiedsparty war der alte Deutz frisch lackiert, die Picasso-Friedenstaube auf die Motorhaube geklebt, und Willi erläuterte den Freunden die seiner Meinung nach wichtigsten Sicherheitsregeln für unsere Fahrt:
»Die Bären in Rumänien reagieren nicht auf Pfefferspray, also Vorsicht in Wäldern! Damit der Traktor und der Wohnwagen nicht von Zigeunern oder Kriminellen geklaut werden können, müssen sie nachts immer in einem Gehöft stehen! Luke und Fenster des Wohnwagens bleiben selbst bei größter Hitze geschlossen, denn es gab Fälle, in denen mit einem Schlauch Betäubungsgas eingefüllt wurde und die bewusstlosen Leute ausgeraubt worden sind! Vielleicht können wir Serbien auch umfahren, der Krieg dort soll zwar beendet sein, aber …«
Vor der Tour mit dem Traktor: Alles ist vorbereitet
Ich lächelte damals noch über Willis Ängstlichkeit.
Am übernächsten Morgen war er planmäßig allein gestartet. Kurz vor Ungarn fuhr er in ein Schlagloch, und ein Achsschenkel des Traktors brach. Der Achsschenkel wurde erneuert. Doch danach tuckerte Traktor-Willi nicht weiter Richtung Ungarn. Nachdem er die SMS geschickt hatte, sagte er mir nur kurz und knapp am Telefon, dass auf den Straßen mehr Autos fahren würden, als er gedacht hatte, und der Traktor viele Staus verursachte. Außerdem würde der westdeutsche Deutz-Traktor den ostdeutschen Bastei-Anhänger bergauf nur mühsam hinterherziehen. Und bergabwärts könnte der Traktor den schiebenden Anhänger nicht in der Spur halten. Deshalb werde er umkehren.
Wie gesagt, ich glaubte nicht, was er erklärte, packte die nötigsten Dinge in meine Kraxe, fuhr wie vereinbart nach Harkány und hoffte, dass er dort sein würde.
Aber ich habe, wie ich jetzt weiß, vergebens gehofft.
Der rüstige Rentner, der im Bus neben mir gesessen hat, versucht mich zu trösten. Ich soll mich im Thermalbad von Harkány erholen und in zwei Wochen mit ihnen wieder nach Hause fahren.
Doch ich schüttele trotzig den Kopf. »Wenn ich schon nicht durch sieben Länder fahren kann, dann will ich wenigstens durch drei Länder bis nach Rumänien laufen!«
»Zu Fuß? Bei vierzig Grad im Schatten?«
Ich nicke.
Im Restaurant frage ich den weißhaarigen Kellner, der mir den Pálinka – einen doppelt gebrannten feinen Obstschnaps – lächelnd mit »Bittscheen, der Herr« auf einem goldenen Tablett serviert, nach einer Landkarte.
»Ich suche den günstigsten, von Autos wenig befahrenen Weg nach Rumänien.«
Der Kellner, er trägt zum rostbraunen Hemd eine an beiden Enden abgegriffene blaue Fliege, schaut erst auf meine leichten Sandalen, dann auf meine unbequeme schwere Kraxe und sagt nun fürsorglich lächelnd: »Mein Herr, das sind durch Kroatien und Serbien mehr als vierhundert Kilometer. Pardon, der Herr, mit dieser Ausrüstung. Und, Verzeihung, der Herr, in Ihrem Alter.«
Als ich widerspreche, bietet er eine Wette an. Sein Einsatz: zehn Flaschen alter ungarischer »Egri Bikavér«-Rotwein. Wenn ich in fünf Wochen bis nach Rumänien gelaufen bin, zahlt er. Wenn nicht, zahle ich. Als Beweis, dass ich es geschafft habe, soll ich ihm, weil er ein Béla-Bartók-Verehrer ist, aus Sânnicolau Mare, der früher ungarischen und heute rumänischen Geburtsstadt des Komponisten, eine CD mitbringen. Sie wird, sagt der weißhaarige Kellner, dort im Museum verkauft, und auf ihr spielt das Schülerorchester von Bukarest Bartóks »Tanzsuite«.
Ich schlage ein. Dann laufe ich, die Kraxe auf dem Rücken, sehr gerade und lächelnd aus dem Gastraum. Vor dem Eingang zum Thermalbad stehen schon einige der Reisegäste aus dem Bus. Sie schwitzen und stöhnen und freuen sich auf die Abkühlung im Bad. Das schwefelhaltige Heilwasser ist nur sechsunddreißig Grad warm.
Sobald ich allein bin, setze ich die Kraxe ab. Ich war sehr glücklich, als ich sie vor vierzig Jahren in Bulgarien erstanden hatte. Aber heute drückt ihr Aluminiumgestell auf Schultern und Steiß, denn die Halteriemchen sind mit der Zeit porös geworden und einige sofort unter der ungewohnten Last gerissen. Ich wollte den Rucksack während der Traktorfahrt nur für kurze Ausflüge nutzen. Nun wird er mein Begleiter auf 400 Kilometern. Um sein Gewicht zu reduzieren, packe ich die Wasserflasche und meine Notizbücher in die Umhängetasche und esse fünf Äpfel. Dann schlage ich mich neben der Hauptstraße von Harkány in die dichten Büsche und mache etwas, wofür ich mich im Nachhinein noch schäme. Die Frau unseres Reiseunternehmers war 1972 mit anderen Ungarinnen 18-jährig als Auszubildende und Arbeitskraft in die DDR gekommen. Sie heiratete und blieb. Seit zwölf Jahren fährt sie im Sommer als Busbegleiterin in die ungarische Heimat. Als ich ihr erzählte, dass ich nun allein durch Kroatien und Serbien laufen werde, hatte sie die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, »Jesses Maria« gerufen und mich gewarnt: »Alleinwanderer werden in Kroatien und Serbien ausgeraubt, die Männer beenden jeden Streit mit dem Messer, und die Zigeuner stehlen, was nicht niet- und nagelfest ist. Auch Ihr umgehängter Brustbeutel ist kein sicheres Geldversteck. Ein Schnitt und …«
Im Brustbeutel stecken 1000 Euro, die EC-Karte und der Pass. Ich ziehe also hinter den Büschen die Hose herunter, knüpfe die Schnur des Brustbeutels auf, verlängere sie auf meinen Bauchumfang und binde den Lederbeutel wie einen Lendenschurz vor mein bestes Stück, das nun mindestens 1000 Euro wert ist.
Am Ortsausgang laufe ich über eine kleine Brücke. Neben der Hauptstraße beginnt ein Radweg. Die Sonne brennt mir auf den mützenlosen Kopf, dass er schmerzt. Als erste Marscherleichterung setze ich meine Brille ab. Ein kleines Lieferauto steht mitten auf dem Radweg. Zwei Zigeuner laden abgehackte Weiden- und Erlenstangen auf. Im Auto sitzt ein dicker Ungar und raucht. Ich probiere, wie die Verständigung klappt, grüße ihn in der Landessprache und frage mit Zeichensprache, was er mit den Ästen macht. Er formt mit den Fingern eine Viehkoppel.
Ich frage: »Mäh?«
Und er sagt: »Igen. Mäh.« Dann zeigt er lachend auf meinen Rucksack und sagt: »Iaah?«
Und ich antworte: »Igen. Iaah.« Die Verständigung klappt.
Auf einer Tafel am Straßenrand wirbt der Besitzer eines kleinen Hotels sogar auf Deutsch: »Billig! Billig! Hier können Sie nicht nur übernachten, sondern erhalten auch eine preiswerte Zahnbehandlung, Implantate und neue Kronen von einem geprüften Dentisten. Billig! Billig!« Ähnliche Reklameschilder habe ich in Harkány an vielen Straßenkreuzungen gesehen. Doch ich will jetzt nicht an Zähne denken, denn mein vor der Reise aufgebohrter Zahn pocht inzwischen im Schritttakt der hin und her schaukelnden Kraxe.
Ein Jogger rennt, nur mit Mütze, Badehose und Turnschuhen bekleidet, an mir vorbei. Ich ziehe weder mein Hemd noch meine Hose aus. Vor vielen Jahren hatten mir usbekische Baumwollpflückerinnen, die bei brütender Hitze in Leinen gemummelt waren, gesagt: »Was gegen die Kälte gut ist, schützt auch gegen die Sonne.«
Zwar habe ich von dem weißhaarigen Kellner eine alte Landkarte mitbekommen, aber ich möchte mich nicht schon jetzt verlaufen und frage einen alten Mann, ob der nächste Ort, wie auf der Karte steht, Siklós ist. Er nickt und will zuerst auf Ungarisch, dann auf Rumänisch und schließlich auf Russisch wissen, woher ich komme.
»Nicht aus Russland, sondern aus Deutschland, das ist gut«, sagt er. Aber weshalb ich laufen würde. »Als Rentner kann man in Ungarn kostenlos mit allen Bussen fahren. Sogar bis Budapest.«
Ich sage, dass ich nicht nach Budapest will. »Ich möchte heute über Siklós nach Máriagyűd.« Dort hatte Willi die erste und einzige Übernachtung unserer 5000-Kilometer-Tour bestellt.
»Máriagyűd?«, fragt der Mann. Ich nicke, und er bekreuzigt sich.
Die Kirche des Ortes sei eine der berühmtesten Wallfahrtskirchen in Südungarn. Hunderttausende Gläubige würden, um ein Wunder oder die Vergebung ihrer Sünden zu erbitten, jedes Jahr nach Máriagyűd pilgern.
Kurz vor Siklós steht links neben der Straße zwischen großen Erlen und kleinen wilden Pflaumenbäumen ein mächtiger unvollendeter Holzbau. Auf groben Felssteinen sind dicke Rundstämme zu einem zeltförmigen Dach an- und übereinandergefügt. Zwei kleine, wahrscheinlich als WC gedachte, aber auch noch nicht fertige Häuschen stehen wie Zwerge rechts und links neben dem riesigen Bauwerk, die Wasserleitungen ohne Wasser und Waschbecken, die Stromleitungen ohne Strom und Steckdosen. Auf einer Tafel lese ich, dass es eine etwa 200 Quadratmeter große und fünf Meter hohe touristische Schutzhütte für Wanderer wird. Die Europäische Union fördert den Bau mit 162443713 Forint (rund 800000 Euro).
Auf der gegenüberliegenden Straßenseite montieren Bauarbeiter die genau wie in Deutschland aussehenden flachen Hallen für einen Aldi-Supermarkt. Nur die Parkfläche wird in Ungarn sehr viel größer. Ein Bauarbeiter wässert den frisch gegossenen, in der Hitze sonst reißenden Beton. Zum Pinkeln kommt er über die Straße und stellt sich unter das gewaltige Holzdach. Als er mich sieht, pflückt er verlegen ein paar wilde gelbe Pflaumen. Er hat, sagt er, ein halbes Jahr in Frankfurt gearbeitet. Ich zeige achselzuckend auf den von der EU geförderten »touristischen Schutzpalast«, und er macht mir verständlich, dass er leider nur drei, vier deutsche Worte sprechen kann. Aber dann sagt er, mit dem Fuß gegen einen der Rundbalken stoßend, sehr deutlich und sehr deutsch: »Eine große Scheiße ist.«
Zwar erblicke ich weit entfernt am Berghang die zwei Türme der Kirche von Máriagyűd, doch ich finde die aus Siklós hinaus- und nach Máriagyűd hineinführende Hauptstraße nicht. Also laufe ich auf gut Glück in Richtung der Türme durch die kleine Stadt. In einer Gartenanlage sehe ich die Kirche nicht mehr und verliere zwischen hässlichen Hochhäusern endgültig die Richtung.
Erst in einer engen staubigen Gasse, in der es stark nach vergorenen Pflaumen riecht, die zertreten unter den Bäumen liegen, sehe ich die Kirche wieder. Doch ich bin ihr keinen Meter näher gekommen. Also versuche ich das, was ich während meiner Tour noch oft machen werde: Ich gehe in ein Haus, zeige meine inzwischen leere Trinkflasche und bitte um Wasser. Die Frau holt mir Mineralwasser aus dem Kühlschrank, bringt mich auf die Straße und weist mir, wohl in dem Glauben, ich wäre ein Pilger, den Weg nach Máriagyűd.
Ich laufe durch Weinfelder. Die Trauben sind noch sauer.
Das Dorf Máriagyűd liegt der am Hang gebauten Kirche zu Füßen. Statt zuerst nach dem Haus zu suchen, in dem ich heute vielleicht übernachten kann, gehe ich unbewusst den Weg hinauf. Langsam und schwitzend schaffe ich die letzten Meter. Vor der Kirche spenden alte Kastanienbäume Schatten. Ein Eisengitter umzäunt die Marienfigur. Auf dem Fundament und den stachligen Spitzen des handgeschmiedeten, einer Dornenkrone ähnelnden Gitters haben schon viele Pilger rote und weiße Kerzen angezündet. Aber wahrscheinlich wurden die Flammen schnell wieder vom Wind gelöscht. Das erstarrte, bunt verlaufene Wachs ist mit Streichhölzern, Blättern, Kronkorken, Papierschnipseln, Kastanienblüten und Zigarettenkippen verunreinigt. Auf den Dornen hängen angesengte Maria-Hilf-Wunschzettel.
Im Innenraum der Kirche laufe ich nicht in die Seitenschiffe und zum Altar, um Figuren und Wandbilder, sakrale Kunst und vergoldeten Kitsch zu bestaunen. Ich setze meine Kraxe ab, hocke mich schweißnass und mit schmerzenden Schultern auf eine der niedrigen Bänke und denke, dass ich, wenn wir mit dem Traktor gefahren wären, diese Wallfahrtskirche nur aus der Entfernung gesehen hätte.
Doch weshalb bin ich zuerst in die Kirche gegangen?
Ich glaube nicht an Wunder.
Ich zünde vor der Marienfigur keine Kerze an.
Ich lege am Altar keine frischen Blumen zu den verwelkten.
Ich bete auch nicht.
Und für heute Nacht habe ich schon die Adresse des Hauses, in dem ich schlafen kann.
Aber morgen? Wo werde ich morgen schlafen?
Und die übrigen vier oder fünf Wochen?
Der weißhaarige Kellner hatte mir gesagt, dass ich in den kroatischen, serbischen und rumänischen Dörfern keine touristischen Unterkünfte finden würde.
»Vielleicht bieten Ihnen gastfreundliche Bauern oder Priester, Bettler oder Winzer ein Nachtlager an. Aber nehmen Sie sich vor den Zigeunern in Acht! Schlafen sie lieber in einem Maisfeld als in einer Zigeunerhütte!«
Ich bin mutterseelenallein in der Kirche. Als ich die Kraxe aufgehuckt habe und hinausgehe, laufe ich nicht wie sonst am »Klingelbeutel« vorbei. Ich werfe langsam meine restlichen Eineuromünzen hinein. Achtmal klingelt es im blechernen Kasten. Ein Mönch kommt aus einer Seitentür. Mit seinen weißen Haaren und seinem jovialen Lächeln ähnelt er dem »Wettkellner« in Harkány. Er segnet mich.
Am Ausgang liegt ein in ungarischer, englischer und deutscher Sprache verfasstes Faltblatt: »Die Zigeuner im Schoß der katholischen Kirche. Erfolgreiche Arbeit mit Zigeunerkindern in Siklós und Umgebung.«
Der Zusammenbruch des Ostblocks hat, so lese ich, das Leben der Zigeuner völlig verändert. »In Osteuropa und Ungarn – dort leben nach Schätzungen rund 800000 Zigeuner (also 8 % der Bevölkerung) – wurden nach 1989 die meisten Zigeuner an den Rand der Gesellschaft getrieben. Sie leben heute ausgegrenzt in verfallenen Hütten, verachtet, in unmenschlichem Elend, oft in ghettoähnlichen Situationen. Ihre traditionellen Berufe und ihre unausgebildete Arbeitskraft werden von der Gesellschaft nicht mehr gebraucht. Viele Zigeuner flüchten vor dieser Aussichtslosigkeit in den Alkoholismus. Einige versuchen, ihren Lebensunterhalt durch Geschäfte, die sich an der Grenze der Legalität bewegen, zu sichern (Devisentransaktionen, Alkohol- und Zigarettenhandel). Andere werden kriminell. Das dient dann einigen politischen Gruppierungen als Vorwand, von aktuellen Problemen der Gesellschaft abzulenken und die Zigeuner als Sündenbock zu benutzen. So fallen sie oft dem neuerwachten Rassismus und Nationalismus zum Opfer… Die katholische Kirche versucht die Zigeuner zu integrieren. Beispielsweise finanziert sie die Fahrt, das Essen und die Unterbringung von Zigeunerkindern aus der Umgebung, welche die Grundschule in Siklós besuchen …«
In Máriagyűd wohnen wahrscheinlich keine Zigeuner, denn auch am Ortsein- und -ausgang stehen nirgendwo zerfallene Häuser. Ich laufe vom Berg hinunter in das Dorf und sehe weder Bauerngehöfte noch Handwerkerbuden, sondern nur villenähnliche, bunt gestrichene, von hohen Zäunen umgrenzte Häuschen. In den Gärten blühen Rosen auf unkrautlosen Rabatten, und auf dem sorgfältig gemähten Rasen sind Stellflächen für die Autos betoniert. Kleine Mädchen in schicken Kleidern und Teenies in Jeans und bauchfreien Shirts führen kläffende Pinscher oder große Rassehunde Gassi. Auf den Briefkästen an den geschlossenen Toren lese ich oft deutsche Familiennamen.
Das Haus, in dem ich hoffentlich heute Nacht schlafen werde, hat zwar eine Nummer, aber kein Namensschild. Es gehört einem Deutschen aus Willis Dorf und wird von einer ungarischen Haushälterin verwaltet. Ich klingele sehr lange, doch niemand öffnet.
Ich habe keine Lust, schon am ersten Tag von Tür zu Tür zu laufen und um ein Nachtlager zu bitten, und weil ich seit Mittag nur Äpfel und Pflaumen gegessen habe, werde ich mir zuerst im Dorfladen Brot und Käse kaufen und mich danach vor das Haus setzen und auf die Verwalterin warten. Doch der kleine ABC-Laden ist verriegelt und verrammelt, die staubigen Fenster sind vergittert, und die Öffnungszeiten auf dem vergilbten Papier sind unleserlich.
In der Nähe des Ladens steht auf der linken Straßenseite ein weißes Haus mit der Hausnummer 1.
Das erste Haus links!
Während meiner Grenzgänger-Wanderung an der ehemaligen innerdeutschen Grenze hatte ich in den bayerischen, hessischen und thüringischen Dörfern immer am ersten Haus links geklingelt und die Bewohner gefragt, wie es ihnen fünfzehn Jahre nach der deutschen Einheit geht.
Ich weiß nicht, weshalb ich wie unter einer Eingebung plötzlich auch hier am ersten Haus links stehenbleibe und läute. Ich weiß nicht einmal, was ich fragen will.
»Urban«. Das kann ein deutscher, aber auch ein ungarischer Name sein. Im Hof bellt ein Hund. Ich sehe ihn durch den Spalt des Tores. Er ist schwarz-braun-weiß gefleckt und so groß und so dick, dass er sich nur mühsam auf den Beinen hält. Ein alter Mann mit nacktem, sehr massigem Oberkörper beugt sich im ersten Stock aus dem Fenster. Ich grüße ungarisch, und er erklärt mir auf Deutsch, dass Maria, die Verwalterin des Nachbarhauses, spät zurückkommt. Sie arbeitet in einem Hotel in Harkány. Aber ich müsste nicht an der Straße auf sie warten. Er zieht sich ein Hemd an und kommt mit dem Hund zum Hoftor. Sie gehen beide sehr langsam.
Herr Urban, kurzgeschorene weiße Haare, ein rundes Gesicht mit Brille, trägt eine Bermudahose, in die er das Hemd wegen des schon im letzten Loch festgemachten Gürtels mühevoll hineingesteckt hat. Wir setzen uns in einen großen, kalten Raum, dessen Wände wie in einem Schlachthaus oder einer Klinik weiß gefliest sind. Ein kleiner Plastetisch, die Plastestühle, Kisten und Gerätschaften stehen verloren herum.
»Das war früher der ABC-Laden von Máriagyűd«, sagt Peter Urban. Als er das Haus vor zwölf Jahren gekauft hat, wurde der neue Laden nebenan eröffnet. »Doch der ist pleite gegangen und hat seit zwei Jahren geschlossen. Das Haus wird niemand mehr kaufen, denn die Zeit, als man nach der Wende in Máriagyűd Häuser sehr billig erwerben konnte, war schnell vorbei. Damals haben die Deutschen hier viele Villen gekauft oder gebaut. Das sieht man jetzt noch, alle sind ordentlich gepflegt.«
Ich schenke ihm eine dicke deutsche Salami, das heißt keine gewöhnliche deutsche, sondern eine Thüringer. Bevor ich morgen weiterlaufe, möchte ich so viel Ballast als möglich loswerden.
Er holt eine Flasche Pflaumenschnaps aus der Küche. Nach dem ersten Glas frage ich, weshalb er sich ein Haus in Ungarn gekauft hat.
»Wo hätte ich in Europa solch ein schönes Haus für billig Geld bekommen? Ich arbeitete damals als Unterwasserschleifer bei der Firma Elektro-Fein in Stuttgart und war sechzig. Es wurde Zeit, sich langsam zur Ruhe zu setzen. Und hier leben Verwandte von mir.«
Er sei zwar deutscher Abstammung, aber in dieser Gegend wäre alles bunt durcheinandergemischt.
»Reinrassig ist selten!«
Sein Hund Alfi, er ruft ihn auf Ungarisch Alfikar, ist eine Mischung aus Dobermann und Deutschem Schäferhund.
Peter Urbans Großeltern waren Donauschwaben. Sie wohnten in Neusatz an der Donau, wie Novi Sad hieß, als es noch nicht zu Jugoslawien, sondern zu Österreich-Ungarn gehörte.
»Ich bin 1939 in Novi Sad geboren. Mein Vater hatte als Deutscher eine Ungarin geheiratet. Reinrassig war, wie gesagt, selten. Man sprach oft drei Sprachen, denn die deutschen, ungarischen, serbischen, kroatischen und rumänischen Kinder gingen gemeinsam in eine Schule. Bis zum Krieg, als die deutschen Soldaten Jugoslawien besetzten und Tito mit seinen Partisanen gegen sie kämpfte, lebte man ziemlich friedlich zusammen. Doch als die Tito-Kommunisten mit Hilfe der Russen den Hitler besiegt hatten, rächten die sich an allen Deutschen. Sie wurden, gleich ob sie gegen die Partisanen gekämpft hatten oder nicht, zeitweise enteignet, manche getötet und viele, wie mein Vater, in Lager gesteckt. Der Vater kam bald wieder nach Hause. 1960 – wir waren ja deutscher Abstammung – sind wir als Spätaussiedler nach Deutschland gezogen. Ich habe dort gelernt, gearbeitet und eine Familie gegründet. Wir lebten gut. Trotzdem sind der Vater und die Mutter nach der Wende freiwillig wieder nach Novi Sad – was dann Serbien war! – zurückgegangen und bis zum Tod dort geblieben. Sie wollten auf dem alten katholischen Friedhof, auf dem ihre Eltern lagen, begraben werden.«
Er dagegen hätte sich nie zurückgesehnt.
»Arm und schmutzig. Eben Serbien. Einmal im Jahr fahre ich nach Novi Sad und lege Blumen auf das Grab der Eltern. Das reicht.« Allerdings sei das Leben in Serbien jetzt billiger als in Ungarn. »In den zwölf Jahren, in denen ich in Máriagyűd wohne, sind die Steuern um einhundert Prozent gestiegen. Der Eintritt in das Bad von Harkány kostet zehn Euro. An meinem Wohnsitz im Schwarzwald bezahle ich dafür zwei Euro weniger. Der ungarische Staat will immer mehr. Es ist schon wieder wie seinerzeit bei den Kommunisten.«
Er fragt, ob ich morgen mit ihm bis zur kroatischen Grenze fahren möchte, und erzählt, dass in der Grenzregion viele Kroaten, Serben und Rumänen leben, die in Ungarn arbeiten.
»Reinrassig ist hier nichts.« Seinem deutschen Hund, der ständig versucht, mir die Hände zu lecken, befiehlt er auf Ungarisch: »Hely, hogy a béke végre! – Platz, und gib endlich Ruhe!«
Dann hört er, dass Maria auf ihrem Moped von der Arbeit kommt.
»Die Maria hat auch ein bisschen was Deutsches abbekommen.«
Als ich mich verabschiede, fragt er noch einmal, ob ich morgen mitfahren möchte.
»Nein«, sage ich, »ich schaff das schon.«
Maria spricht sehr schnell und sehr laut deutsch. Ihre Worte rennen um die Wette. Sie müssen sich verbinden, wo sie gar nicht verbunden werden wollen, und die zu langsam sind, verschluckt sie einfach.
So wie Maria spricht, bewegt sie sich auch. Sie wieselt von einem Zimmer in das andere. Ihre langen Arme kommen nicht nach, sie baumeln schlaksig an ihrem sehr mageren Körper. Und ihre Haare sind windschlüpfig kurz. Keine heilige Maria, eher ein Kasper, der, »Kinder, seid ihr alle da?« rufend, schnell auf der Bühne hin und her rennt.
Nach der Begrüßung erklärt sie, dass sie mir zuerst »das Wichtigste von Máriagyűd, das nirgendwo sonst zu sehen ist«, zeigen wird. Und sie öffnet mir die Tür nach draußen.
Ich will sie aufhalten, ziehe sie am Arm zurück und sage, dass ich die Wallfahrtskirche schon besucht habe. Doch sie schüttelt den Kopf. »Nicht die Kirche! Ich gehe selten in die Kirche, unser Prediger predigt schlecht.« Nein, sie will mir die größte Sehenswürdigkeit von Máriagyűd zeigen: zwei Tiger im Garten eines schönen Hauses.
»In einem Zoologischen Garten?«
»Nein, Privattiger.«
Maria schließt das Haus sorgfältig ab, läuft im Eilmarschtempo bis zum letzten Haus, einer Villa mit gepflegtem Garten, und führt mich zwischen den Weinfeldern und einem Maschendrahtzaun hinter das Haus. Zwischen den Obstbäumen liegen nicht zwei, sondern nur eine Raubkatze. Und die ist kein Tiger, sondern ein Löwe.
»Der andere schläft«, sagt sie. »Beide sind zahm, weil der Hausherr sie als Babys von irgendwoher mitgebracht hat.«
Der Mann, erzählt sie, besitzt nicht nur diese Villa und den Garten mit den zwei »Tigern«, sondern auch ein vornehmes Restaurant in Harkány. »Er ist ein reicher Mann.«
Ich sage lachend: »Du bist auch reich, Maria. Du wohnst allein in einem großen Haus.«
»Ja, als Hausmeisterin«, sagt sie. »Doch es ist gut so. Ich spare die Miete, und der deutsche Besitzer weiß, dass Maria alles reinlich und ordentlich hält.«
Maria arbeitete früher als Zugschaffnerin und danach als Köchin in einem Hotel. Dort hat sie immer gut zu essen bekommen. Inzwischen rackert sie wochentags wie feiertags als Zimmermädchen für rund vierhundert Euro. Das reicht, rechnet sie mir vor, um dreißigmal in der Gaststätte ihres Hotels essen zu gehen und ein Glas Wein zu trinken.
»Aber wer will schon jeden Tag im Restaurant essen und trinken?« Sie lacht wie der Kasper, wenn er mit seiner Klatsche den Teufel totgeschlagen hat.
Ich frage, ob es stimmt, dass die Preise und Steuern in Ungarn dramatisch gestiegen sind. Sie nickt.
Aber dafür könnte man nicht die Kommunisten verantwortlich machen. »Wir haben jetzt Kapitalismus. Und das müsste er wissen, der Herr Urban. Er kommt doch aus Kapitalismus-Deutschland!«
Wieder im Haus angekommen, setzen wir uns in die Küche. Als sie, Erstaunen spielend, in den fast leeren Kühlschrank schaut, sagt Maria lachend, sie hätte nicht gewusst, dass heute noch ein Gast kommt. Im Kühlschrank findet sie nur eine Büchse mit Bratenfett aus dem Supermarkt und drei spitze weiße Paprika. Aber Toastbrot – »das ist billiger als frisches« – hat sie noch reichlich. Ich lege meinen Reiseproviant dazu.
Während wir essen, fragt Maria, weshalb ich nicht mit Willi und dessen Traktor gekommen bin.
Das sei eine zu lange und schwerverständliche Geschichte, sage ich, versuche es trotzdem zu erklären und ende mit dem Stoßseufzer: »Ich hatte noch auf ein Wunder in Máriagyűd gehofft.«
»In Máriagyűd geschehen keine Wunder mehr«, erklärt sie und fragt: »Wollen wir Wein trinken?«
Sie holt eine angebrochene Flasche weißen Hauswein. Er ist süß, aber heute ist es mir egal, womit ich anstoße.
Nach dem Wein geht Maria in ihr kleines Zimmer, in dem sie schlafen und fernsehen kann. Ich soll mich in das ansonsten unbenutzte große Wohnzimmer legen.
Bevor ich die Doppelbettcouch aufklappe, packe ich meine Kraxe und meine Umhängetasche aus. Und packe sie wieder ein. Und wieder aus … Um nicht zu schwer tragen zu müssen, werde ich mich in den nächsten Wochen einschränken. Anstelle von drei Handtüchern nur eins. Anstelle von sieben Shirts nur drei. Die schwere Windjacke bleibt hier. Keine Sonnencreme, kein Buch, keine Pfeife und keinen Tabak. Anstelle von sechs Paar Strümpfen nur drei Paar. Kein Rasierzeug, kein Shampoo, keinen Flachmann mit Rostocker Kümmel, keinen Teller und kein Besteck. Die Geschenke zähle ich ab. Sieben Kugelschreiber, sieben Päckchen Buntstifte und zweihundert Luftballons. Am nächsten Morgen stelle ich den Beutel mit den ausgesonderten Sachen in die Schrankwand. In fünf oder sechs Wochen will ich alles wieder abholen. Ich hucke die Kraxe auf und bilde mir ein, dass sie nun sehr leicht ist.
Maria rennt in den Garten, liest heruntergefallene Pflaumen auf, stopft sie mir in die Umhängetasche, zeigt lachend auf das Haus und die Obstbäume und fragt: »Wissen Sie, dass ich sehr, sehr glücklich bin?« Ohne meine Antwort abzuwarten, verkündet sie im gleichen Atemzug: »Ja, ich bin’s!« und sagt zum Abschied: »Reichtum und Besitz machen nicht glücklich.«
Ich weiß nicht, ob sie mich damit trösten möchte, weil ich nun zu Fuß gehen muss.
Ich laufe schnell aus Máriagyűd hinaus, ohne mich noch einmal zur Wallfahrtskirche umzudrehen.
Von ungarischen Frauen, die »Peter-seine« heißen, Hakenkreuzen an einem verlassenen Stellwerk und einer Nacht auf dem Fußboden der katholischen Kirche in Beremend
Die »Tiger« liegen am Morgen nicht im Garten, denn über Nacht ist es in Máriagyűd kalt geworden. Gestern waren es vierzig Grad und Sonnenschein, heute sind es zwanzig Grad und Wolkenhimmel.
Ich friere.
Bevor ich losgelaufen war, hatte ich noch einmal den Beutel mit den zurückgelassenen Sachen ausgepackt und zuerst den Flachmann und schließlich auch das Rasierzeug in den Rucksack gesteckt. Ich weiß nicht, wie ich, ohne mich zu rasieren, in fünf oder sechs Wochen aussehen würde. Und ich bin auch nicht neugierig darauf.
Es wäre sinnvoller gewesen, denke ich, statt des Flachmanns die wärmende Windjacke mitzunehmen. Doch ich will nicht umkehren. Jetzt noch nicht! Bestimmt wird es morgen wieder heiß, und wenn nicht, werde ich mir in Kroatien eine sehr leichte und sehr dünne Windjacke kaufen.
Am Ortsausgang blättert die Farbe vom Kreuz, an das Jesus genagelt ist. Zwischen den Stiefmütterchen, die als kreisförmige Rabatte um den Gekreuzigten gepflanzt worden sind, wuchert Vogelmiere.
Links von der Hauptstraße wächst an der Südseite einer langgezogenen Hügelkette Wein, so weit ich schauen kann. Rechts biegt die Nebenstraße nach Siklós ab. Von Siklós, das hatte ich gestern gelesen, sind es zwanzig Kilometer bis nach Beremend, dem letzten ungarischen Ort vor dem Grenzübergang nach Kroatien.
Doch Maria hatte mir geraten, nicht durch Siklós zu gehen, sondern die Umgehungsstraße unterhalb der Weinberge zu nutzen. Ich sehe auf der Umgehungsstraße aber keine Wegweiser nach Beremend, sondern nur Schilder an den Lichtmasten. Nach achthundert Metern müsse man rechts abbiegen, hundert Meter zurückfahren und sei bei Lidl. Zu Spar sind es 1200 Meter vorwärts, abbiegen und dreihundert Meter zurück. Ich bin nicht nach Osteuropa gefahren, um Lidl oder Spar zu finden.
Weil ich nicht schon zu Beginn einen Umweg laufen will, schaue ich auf die Karte, die mir der Wettkellner in Harkány geschenkt hat. Trotz Brille entdecke ich die Umgehungsstraße nicht. Und die Straße zur Grenze nach Kroatien endet in Beremend, das auf dieser Karte sehr weit von der Grenze entfernt ist. Es ist auch keine Straße nach Kroatien eingezeichnet. Schließlich sehe ich, dass es auf dieser Karte weder Serbien noch Kroatien, sondern nur »Jugoslawien« gibt.
Eine Karte aus Zeiten des Sozialismus!
Ein alter Mann, der mit Spaten, Harke und Schubkarre in die Weinberge fährt, fragt mich: »Wohin?«
Ich sage: »Kroatien.«
Er nickt und zeigt auf der Umgehungsstraße geradeaus, dreht sich dann um und sagt eindringlich, so als ob ich zurückgehen müsste: »Máriagyűd.« Der Berg, an dem die Wallfahrtskirche steht, sei der Tenkesberg.
Ich erinnere mich an eine DDR-Fernsehserie über einen ungarischen Robin Hood, der heldenhaft gegen die Österreicher kämpfte, die Ungarn besetzt hatten.
»Der Kapitän vom Tenkesberg?«
»Igen. Kapitän Tenkes. Máté Eke.«
Dann zeigt der Mann auf ein aus der Entfernung einer Burg oder Festung ähnelndes Gebäude, das auf einem Hügel über Siklós thront. »Schabranzen! Schabranzen!« Und ballt die Faust.
Ich verstehe ihn nicht.
Er hält einen Trabant an. Der Fahrer hat in der Grundschule Deutsch gelernt.
Schabranzen, das sind die Österreicher, die habsburgischen Unterdrücker, gewesen. Von 1703 bis 1711 haben die Ungarn unter Franz II. Rákóczi um ihre Freiheit gekämpft. Im Schloss von Siklós saßen die Schabranzen: Baron Eckbert von Eberstein mit seinen Soldaten. Aber Máté Eke, der Kapitän vom Tenkesberg, hat sie vertrieben …
Ich habe diese Fernsehserie gesehen. Der Kapitän vom Tenkesberg ritt auf einem braunen Puszta-Hengst und trug einen feschen Schnauzbart, genau wie ich mir damals einen feurigen Ungarn vorgestellt habe.
Zwar besiegten die Österreicher nach acht Jahren die um ihre Freiheit kämpfenden Ungarn, aber sie mussten den Magyaren in der Habsburger Monarchie die Autonomie gewähren.
Ich breche den Geschichtsunterricht ab und sage, dass ich heute noch bis in das zwanzig Kilometer entfernte Beremend laufen muss.
Der Trabi-Fahrer öffnet mit einer einladenden Handbewegung die Beifahrertür.
Ich schüttele den Kopf und warte, bis er den Trabant angelassen, den ersten Gang eingelegt hat und knatternd gestartet ist. Vertraute Geräusche!
Ich erinnere mich nicht, dass ich schon durch ähnliche Landschaften marschiert bin. Die Weinstöcke haben sich an die Berghänge zurückgezogen, und neben der Hauptstraße wachsen auf hundert Meter breiten Feldern Mais, Sojabohnen, Weizen und Sonnenblumen. Das letzte Unwetter hat den Weizen zu Kreisen und Schneisen niedergedrückt. Der Mais steht noch. Aber die schweren gelbbraunen Blütenköpfe der Sonnenblumen liegen verschmutzt auf dem Acker. Nirgendwo habe ich zuvor solch ein trauriges Blumenbild gesehen: meterhohe Sonnenblumen, die sich nicht mehr aufrichten können. Die Mäuse müssen nicht klettern.
Der Wind ist kalt. Ich gehe sehr schnell. Trotzdem komme ich nur langsam voran, denn wenn mir einer der vielen Trucks entgegendonnert, trete ich ängstlich zur Seite. Die Fahrer sind wahrscheinlich schon lange unterwegs und zu müde, um für einen einsamen Fußgänger Extrakurven zu fahren.
Nach einer halben Stunde sehe ich auf der Umgehungsstraße an einer rechts abbiegenden Straße den ersten Wegweiser: »Siklós 2 km«. Missmutig denke ich, dass ich Marias Rat besser nicht gefolgt wäre und statt der Umgehungsstraße den Weg durch Siklós genommen hätte. Vielleicht habe ich in Siklós aufschreibenswerte Begebenheiten verpasst, denn in den ersten Stunden einer Reise saugt man in der Fremde alle Einzelheiten noch ungefiltert und neugierig auf. Da wird jeder alte Stein zu einem Stück Geschichte und jeder Kneipenbesuch ein gesellschaftliches Abenteuer. Jeder Bettler ist eine soziale Studie und jedes Gespräch eine kleine Lebensgeschichte. Alles erscheint noch bedeutend und einmalig. Ein sowjetischer Autor hat mir einmal gesagt: Fährst du eine Woche durch Sibirien, kannst du einen Roman über Sibirien schreiben. Wohnst du ein Jahr in Sibirien, verfasst du eine Kurzgeschichte. Und lebst du ein Leben lang in Sibirien, wirst du vielleicht noch einen Vers über Sibirien dichten.
Viele Getreidefelder sind schon abgeerntet. Nicht einmal mehr in Ungarn sehe ich die aus der Kindheit vertrauten Kornpuppen. Stattdessen stehen zu Würfeln gepresste Strohballen ordentlich in Reih und Glied auf den Feldern.
Der Wind hat die Wolken zur Seite geschoben und sich dann zur Ruhe gelegt. Es wird sehr schnell heiß, und ich trinke meine Wasserflasche aus. Proviant habe ich keinen mitgenommen, denn nach meiner Karte sind es nur noch sechs Kilometer bis Nagyharsány.
An der Abzweigung nach Kisharsány stehen zwei Polizeiautos. In einem läuft der Motor. Ein Uniformierter sitzt dort am Lenkrad und döst. Die übrigen fünf Polizisten halten die Trucks an, winken sie zur Seite und kontrollieren Fahrzeugpapiere und Fahrtenschreiber. Manche Laster, ich merke später, dass es die ungarischen sind, winken sie durch. Die Fahrer, die angehalten werden, kurbeln nicht nur die Fenster herunter, sondern steigen freundlich lächelnd aus. Manche begrüßen die Polizisten sogar mit Handschlag. Solch höfliche LKW-Fahrer habe ich noch nicht gesehen, und einen Augenblick träume ich, dass sie rücksichtsvoll zur Seite fahren werden, wenn ich ihnen unterwegs begegne. Doch das bleibt ein Traum, und ich bin froh, als ich gegen Mittag in der Ferne das Ortseingangsschild von Nagyharsány sehe. Auf dem Friedhof setze ich meine Kraxe zwischen den Grabsteinen ab.
Weder dicke Mauern noch Eisengitter schützen den Friedhof vor ungebetenen Gästen. Ein Auto fährt über die angrenzende Wiese bis zum Gräberfeld. Nur auf wenigen Gräbern wachsen Blumen oder rankt Efeu. Schwere Steinplatten verschließen die aus Beton gegossenen dicken Grabumrandungen, die nur von Kränen angehoben werden können.
Aus dem Auto steigt eine Frau. Der Mann bleibt sitzen und raucht. Sie holt einen Karton mit künstlichen Rosen, Lilien, Efeuzweigen und Nelken aus dem Kofferraum, legt sie auf das Grab und versucht das Unkraut, das um das Betongrab wuchert, herauszuziehen. Doch weil es zu fest verwurzelt ist, gibt sie es auf. Noch bevor der Mann seine Zigarette zu Ende geraucht hat, sitzt die Frau wieder im Auto. Sie fahren zwischen den Gräbern über die Wiese zurück auf die Straße.
Ein vielleicht vierzehn Jahre alter Junge mit sehr kurz geschorenen Haaren, der ein rotes »I am happy«-Shirt und grüne Turnhosen trägt, fährt mit dem Rad bis zur Wiese, legt es in das Gras und läuft zu einem Grab, hinter dem ein verwittertes schmales Holzkreuz steht. Ein Porzellan-Medaillon in der Mitte zeigt das Porträt einer jungen rotwangigen Frau. Als er merkt, dass ich kein Ungar bin, sagt der Junge auf Englisch: »The mother of my daddy.« Ich versuche, Geburtsjahr, Todesdatum und Namen auf dem Kreuz zu lesen, doch die Schrift ist kaum noch zu entziffern. Als ich endlich Janoszné und den männlichen ungarischen Vornamen Janosz lese, glaube ich an einen Irrtum. Doch auch die in Stein gemeißelten Vornamen der anderen Frauen klingen männlich. Der Mann heißt Lajos, die dazugehörige Frau Lajosné. Mihaly und Mihályné. Karol und Karolné. Ich finde keine Anna, keine Maria, keine Elisabeth. Aber Peter und Peterné.
Der Junge gießt einen Topf mit Studentenblumen. Küsst das Bild. Kniet nieder. Bekreuzigt sich. Und geht zum nächsten Grab. Küsst das Porträt eines jungen Mannes. Bekreuzigt sich. »The daddy of my mother.«
Daneben steht der Grabstein des nur 41 Jahre alt gewordenen Mihaly Müller. Gestorben 1946.
Der Junge sagt: »It is a German.« Und hält sich dann den Zeigefinger an die Schläfe. »Many Germans kaputt!«
Meine Frage, weshalb die Frauen den Vornamen der Männer erhalten haben, versteht er nicht. Ich denke, dass mit dem Namenswechsel nach der Hochzeit die Eigentumsverhältnisse klargestellt werden: Peter-né bedeutet »Peter seine«.
Ein Mann wartet, so ist es auf dem Grabstein zu lesen, schon seit dem letzten Jahrhundert vergeblich auf seine Frau. »Csima József, 1915–1978.« Darunter steht: »Csima Józsefné, 1918–19…«
Sie hat das ihr zugedachte Jahrhundert überlebt.
Der Junge füllt meine Wasserflasche. Als ich frage, ob man das Wasser vom Friedhof trinken kann, antwortet er in Zeichensprache: Was den Toten nützt, ist auch gut für die Lebenden.
Er bekreuzigt sich noch einmal, holt sein Fahrrad und ruft: »I wish a good way.«
Der gute Weg führt mich zuerst an Warnkreuzen vorbei, die nicht mehr warnen müssen, und dann unter rot-weiß gestrichenen Eisenbahnschranken hindurch, die sich nicht mehr öffnen und schließen. Die Schienen sind, nachdem sie den Asphalt der Hauptstraße zerschnitten haben, zwischen Gras und Unkraut nicht mehr zu finden.
Dem Stellwerk neben den Schienen fehlen Fenster und Türen. Die elektrischen Verteilerkästen sind zerschlagen, der kleine Raum, in dem der Bahnwärter früher mit den rotgestrichenen Hebeln und Rädern die Weichen verstellt hat, ist vollgeschissen. An die Außenwände des Häuschens sind Hakenkreuze geschmiert.
Auf der langen geraden Straße in den Ort hinein suche ich vergeblich nach einem kleinen Laden. Erst als kurz vor der Ortsmitte der Weg zur Grenze rechts abbiegt, finde ich neben der Bushaltestelle ein Geschäft. Aber das ist geschlossen. Der Sturm hat Pappkartons und Zeitungspapier an die angrenzenden Zäune geweht, und an den Sträuchern und Zaunlatten hängen zerrissene Plastetüten.
Im Stellwerk
Ich stolpere über eine der Eisenstangen, die beim Bau der Straße mit einbetoniert worden sind und nun zentimeterlang herausragen. Die Schnüre meiner Kraxe reißen. Ich will sie aufknoten, aber ich hatte mir gestern, weil ich auch keine Nagelschere mitnehmen wollte, vorsorglich die Fingernägel sehr kurz geschnitten und bekomme die Knoten nicht auf.
Ich bin froh, als ich Nagyharsány hinter mir habe.
Anstelle der Wallfahrtskirche, die inzwischen aus meinem Blickfeld entschwunden ist, sehe ich seit zwei Stunden die Silhouette einer großen Fabrikanlage vor mir. Ihre dicken, hohen Türme und mehrstöckigen offenen Gebäude sind durch schiefe Ebenen, von Geländern gerahmte Transportbänder und dickbäuchige Rohrsysteme miteinander verbunden: ein riesiger Oktopus mit Tentakeln und Saugnäpfen. Als ich etwa die Mitte der sich auf vielen Quadratkilometern ausbreitenden Betonfabrik erreicht habe, bemerke ich vor einem der mächtigen Zementsilos ein blaues Dixi-Klo für die Arbeiter.
Groß und klein
Eine blaue Laus am Bein eines Riesen.
Ein Ausstellungsfoto, denke ich belustigt und fotografiere Siloturm und Klo. Ein Mann in dunkelblauer Arbeitsmontur kommt sehr schnell aus dem Werk und will mir sehr laut und energisch etwas erklären. Mein Schulterzucken ärgert ihn. Er beginnt zu schreien. Ich versuche es mit einigen ungarischen Worten. Da zeigt er auf ein Schild, das über dem Werktor hängt: ein Fotoapparat, dick mit roter Farbe durchgestrichen. Ich will ihm durch eine unmissverständliche Geste klarmachen, dass mich nicht das Duna-Betonwerk, sondern die kleine Toilette davor interessiert. Er versteht mich falsch und schüttelt den Kopf. Nein, ich könne das Dixi-Klo im Werk nicht benutzen. Ich solle auf die Straße pinkeln. Er droht noch einmal mit dem Finger, zeigt auf das Verbotsschild und geht.
Versuchsfelder so weit das Auge reicht
Weil mir die Füße vom ungewohnten Marsch schon schmerzen, laufe ich nicht mehr auf der Betonstraße, sondern am abgemähten Straßenrand. Die Nüsse der am Straßenrand wild wachsenden Walnussbäume hängen so tief, dass ich oft mit dem Kopf daran stoße. Weil ich Hunger habe, schäle ich eine Nuss aus ihrer grünen Hülle. Der gekräuselte Kern ist noch weiß und weich und von einer feinen Haut geschützt. Er sieht aus wie Gehirn und schmeckt süß. Satt kann man davon nicht werden. Ich versuche es mit Sonnenblumen und puhle die Körner aus ihren Blütenkissen. Doch die sind noch nicht schwarz und lassen sich weder mit den Zähnen noch mit den Fingern aufbrechen. Vielleicht junge Maiskolben? Am Rande des Maisfeldes stehen im Zwei-Meter-Abstand dreißig oder vierzig sechseckige rot-weiße Schilder auf giftgrünen Pfählen. »Pioneer N43« und »Pioneer 1823«. Vermutlich genveränderten Versuchsmais werde ich nicht essen. Aber als auch das nächste Feld mit »Pioneer«-Schildern bestückt ist und am Wegrand schon abgenagte Kolben liegen, breche ich mir drei ab. Ich häute die Kolben, indem ich sie fast andächtig Blatt für Blatt aus ihrer grünen Hülle schäle.
Ich scheiß auf die Gene, ich habe Hunger! Die Maiskörner schmecken süß und sind sehr zart.
Vielleicht fünf Kilometer vor Beremend mähen sieben Männer das Gras am Straßenrand. Sechs arbeiten mit Motorsensen, einer mäht noch auf die alte Art. Der hölzerne Stiel seiner Sense ist glatt und abgegriffen, das Sensenblatt schon schmal gewetzt. »Arkadi«, stellt er sich auf Russisch vor und zeigt mir, wie man mäht. Er stellt ein Bein vor das andere, greift den Sensenwurf am Ende und den Handgriff in der Mitte. Dann schwingt er das Sensenblatt in einem Halbkreis.
»Chleb – Brot. So als ob du ein Brot schneidest.«
Ich kann mähen. Ich mache zu Hause Heu für die Schafe. Und als ich die Sense auf die Erde stelle und das Blatt mit dem Wetzstein schärfe, nicken die Männer anerkennend und setzen sich auf die Erde. Sie sagen, dass selten Fußgänger vorbeilaufen. Und kaum welche mit Rucksack. Und gar keine, die mit der Sense mähen können.
Arkadi breitet eine Zeitung aus, reißt ein Loch in die Mitte. Eine niedrige Margerite, die den Motorsensen entgangen ist, kann als Tischschmuck hindurchschauen. Die übrigen legen Brot und Wurst und Tomaten dazu. Einer holt einen Kanister. Er gießt acht Blechbecher randvoll.
»Moldawischer Wein aus der Heimat«, sagt er. Nur zweimal im Jahr fahren sie nach Hause, erklärt Arkadi. Er ist kein Moldawier, sondern ein Russe.
»Doch wenn man aus der Heimat wegmuss, macht es keinen Unterschied, ob man in der Fremde ein armer Russe oder ein armer Moldawier ist. Wer arm ist, muss überall nach Arbeit und Brot suchen – nicht nur die Afrikaner, die nach Europa kommen.«
Arkadi ist als Russe aus Moldawien geflohen, denn er lebte in Transnistrien, dem abtrünnigen, von Russen bewohnten Teil Moldawiens. »Und weil mein Bruder als Offizier in der moldawischen Armee gegen die abtrünnigen Russen in Transnistrien kämpfte, hätten wir aufeinander schießen müssen.«
Einer der Männer fragt, bevor er mir zum zweiten Mal den Becher füllt: »Weshalb läufst du so ganz ohne Not in der Fremde umher?«
Um die Welt zu sehen, sage ich.
Dazu müsste man nicht mehr laufen, berichtigt Arkadi. Er verschwindet im Wohnwagen und kommt mit einem Laptop zurück.
»Du kannst Beremend schon von hier aus sehen.«
Wir finden sogar die Straße zwischen Beremend und Nagyharsány.
»Hier steht unser Wohnwagen«, sagt Arkadi. Sie haben drei Monate gespart, um den an ein Handy anschließbaren Laptop kaufen zu können, einen Laptop für alle sieben.
»Nun können wir unseren Frauen, Kindern und Eltern in der Heimat immer schreiben, wie es uns geht.«
Als ich weitergehe, kenne ich die Straße nach Beremend schon und weiß, dass ich unterwegs nur durch Felder laufen werde. Zwei alte Flursteine rechts und links der Straße habe ich auf dem Bildschirm nicht gesehen. Auf Verbotsschildern, die danebenstehen, sind ein Bagger und ein Spaten mit roter Farbe durchkreuzt: Im Umkreis von drei Metern ist es verboten, zu baggern oder zu graben!
So schützen die Ungarn ihre Geschichte.
Am späten Nachmittag erreiche ich Beremend. Am ersten Haus rechts sitzt ein Mann auf der Bank. Sein Hund liegt neben ihm. Ich frage, ob ich mich ausruhen darf.
Johann Leiszon
Er schubst den Hund von der Bank und sagt im schwäbischen Dialekt: »Nehm’ Se Ploatz.«
Der Mann ist klein und schmächtig. Seine weite, lange grüne Hose hat er, damit sie nicht herunterrutscht, so eng gegürtet, dass sie wie ein Kleid Falten schlägt. Er trägt ein kurzärmeliges Hemd. Die nackten Füße stecken in Ledersandalen. Am rechten Fuß hat er den großen Zeh mit einer sauberen Mullbinde umwickelt. Ich will ihn, um ein Gespräch zu beginnen, nach der Verletzung fragen, doch er kommt mir zuvor, lacht mich an und sagt:«Schaut mich an und schätzt, wie alt ich sin.«