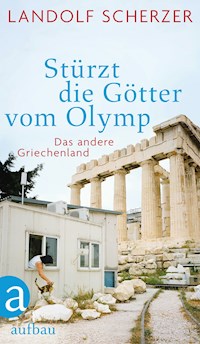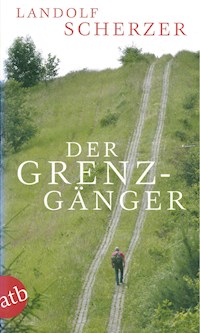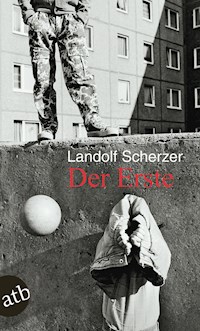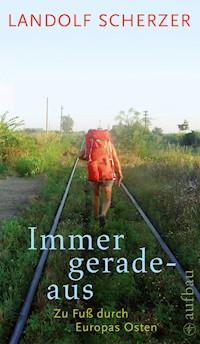16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Landolf Scherzer hat bei Reisen den Zufall auf seiner Seite. Kaum ist er auf Kuba, stirbt Fidel Castro, und er erlebt er ein Land im Ausnahmezustand. Um so drängender wird die Frage, wie die Ideale der Revolution in der Gegenwart bestehen. Wer in Kuba viel fragt, dem wird wenig erlaubt, lernt Scherzer schon am ersten Tag in Havanna. Also macht er es bei seinen Recherchen wie die Kubaner, er geht Umwege und improvisiert. Jede Busfahrt, jeder Einkauf, jeder Spaziergang beschert ihm überraschende Begegnungen und Lebensberichte. Er bewundert, wie unkonventionell die Kubaner den problematischen Alltag meistern und wie ungebrochen der Stolz auf die Revolution und ihre Errungenschaften ist. Aber mit Schlitzohrigkeit und Optimismus allein lassen sich die Konflikte, die die Öffnung Kubas mit sich bringt, nicht lösen. Was also muss bewahrt, was soll verändert werden?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 379
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Über Landolf Scherzer
Landolf Scherzer, 1941 in Dresden geboren, lebt als freier Schriftsteller in Thüringen. Er wurde durch Reportagen wie »Der Erste«, »Der Zweite« und »Der Letzte« bekannt. Nach »Der Grenzgänger« und »Immer geradeaus. Zu Fuß durch Europas Osten« erschienen zuletzt vielbeachtete Reportagen über China »Madame Zhou und der Fahrradfriseur« und über die aktuelle Situation in Griechenland »Stürzt die Götter vom Olymp«. 2015 erschien »Der Rote. Macht und Ohnmacht des Regierens.«
Informationen zum Buch
Salsa, Santeria und Sozialismus
Landolf Scherzer hat auf Reisen den Zufall auf seiner Seite. Kaum ist er in Kuba, stirbt Fidel Castro, und er erlebt er ein Land im Ausnahmezustand. Umso drängender wird die Frage, wie die Ideale der Revolution in der Gegenwart bestehen.
»Der gefährlichste Feind für den kubanischen Sozialismus ist der kubanische Alltag. Der beste Freund ist der Stolz der Kubaner auf ihr Land.«
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Landolf Scherzer
Buenos Días, Kuba
Reise durch ein Land im Umbruch
Inhaltsübersicht
Über Landolf Scherzer
Informationen zum Buch
Newsletter
Von meinem Flug als Briefträger nach Havanna, einer kubanischen Methode, Autos zu reparieren, und gesparten 5 Euro beim Besuch des zweitgrößten Friedhofs von Amerika
Von Joaquín, der einen Koch des Papstes massierte, einem Nacht-Privatquartier für jüngere und ältere Liebende und den »Fidel ist tot!«-Freudentänzen der Exilkubaner in Miami
Von Francisco, dem früheren Nationaltrainer der kubanischen Fußballer, der als 12-Jähriger in die Berge gegangen war und den Bauern dort das Schreiben und Lesen beibrachte, dem missglückten Ausflug ins Ferienparadies Varadero und meinem ersten Pakt mit Gott Orula
Von der Großmutter Maria, für die Trump ein »schlimmer Hallodri« ist, einem in Kuba nicht einlösbaren 30000-Euro-Scheck und den Skeletten der Tieropfer am Malecón
Von Leonardo und anderen kubanischen Helden in Angola, der sichersten Methode, die »Drei-Schritt-Schlange« zu töten, und dem erfahrenen Chirurgen, der am Wochenende auf dem freien Bauernmarkt Malangas verkauft
Von Jorge Luis’ Geburtstagsfeier, bei der weder gesungen noch getanzt werden darf, ermordeten Kubanern an der mexikanisch-amerikanischen Grenze und einem Rückschritt, mit dem uns die Kubaner vielleicht schon weit voraus sind
Von dem »Jugendstilmuseum«, in dem Olimpia und Carlos wohnen, der nötigen inneren revolutionären Disziplin, um als Kubaner in der DDR Tatar herunterzuschlucken, und einem Friseur, der 9 Monate lang das Zigarrenrollen lernte, aber trotzdem zu langsam war
Von der Urnenbeisetzung Fidels im Familienkreis, an der auch Maradona teilnahm, einem Eichsfelder, der in Havanna das Capitolio restauriert, und seiner Maxime »Kuba kann man nur lieben oder hassen«
Von der kriminalistischen Suche nach dem Solardorf La Guinea, der Behauptung, »wenn wir Kubaner nicht mehr kämpfen können, sind wir keine Kubaner mehr«, und Danyens Lehrvorführung zum Gebrauch einer Machete
Von der verbotenen Viehhaltung auf Havannas Dachterrassen und Balkonen, dem Wunder, dass in Marquitos Hütte seit einem Jahr eine Lampe brennt, und dem Tabak, den man nicht pflanzen, sondern heiraten muss
Von meinem Versuch, Briefe mit deutschen Investitionsvorhaben in Millionenhöhe bei kubanischen Ministerien abzugeben, der für 40 Dollar gehandelten »Cohiba«-Zigarre und einem sehr traurigen Trompeter
Von Hilda, die nach der US-Invasion in der Schweinebucht mit einem Gewehr im Bett schlief, einer Demonstration der aufgehuckten Toilettenbecken und einem Blogger, der in Kuba gegen die Ausgrenzung von Homosexuellen kämpft
Von Bordsteinkanten, die vor dem Staatsbesuch weiß gestrichen werden, dem Troubadour Reinier Valdés, der das Lied »Vom Nichttod Fidels« sang, und meinem ungelösten Geheimnis »um den kubanischen Baum mit den Traumluftwurzeln«
Nachtrag
Impressum
Von meinem Flug als Briefträger nach Havanna, einer kubanischen Methode, Autos zu reparieren, und gesparten 5 Euro beim Besuch des zweitgrößten Friedhofs von Amerika
Am Morgen nach meiner nächtlichen Ankunft in Havanna stehe ich auf Migdalias schmalem Balkon.
Ich blicke ungläubig in den von keinem Wölkchen getrübten azurblauen Novemberhimmel, blinzele in die schon heiße Sonne und sage laut und glücklich: »Buenos días, Havanna!«
Dann schaue ich von dem Balkon im dritten Stock hinunter auf eine von schwarzen Auspuffwolken der Autoschlangen vernebelte vierspurige Hauptstraße und, nur durch eine gelbe Mauer abgegrenzt, ein Meer von sarkophagähnlichen Grabstätten, gewaltigen Marmorplatten, Mausoleen, Denkmälern und sich auf Säulen zum Himmel reckenden Engeln. Ich wohne neben dem Friedhof.
Migdalia erklärt mir stolz, dass der Cementerio Cristóbal Colón, der Friedhof Christoph Kolumbus, der zweitgrößte Friedhof Amerikas ist.
»Über 50 Hektar. Fast 1 Million Tote liegen hier. Auch mein geschiedener Mann. Wir haben es nicht weit«, sagt sie.
Ich weiß nicht, ob ich darüber froh sein soll. Und vielleicht hätte ich an meinem ersten Tag auf Kuba, am 25. November 2016, alles andere machen sollen, als nach dem Frühstück in der ungewohnten Hitze stundenlang den zweitgrößten Friedhof Amerikas zu erkunden. Ich hätte zum Beispiel meine Arbeit als Postbote beginnen können, denn ich bin nicht nur als Tourist, sondern auch als ehrenamtlicher Eilbriefträger (ansonsten ist ein Brief 2 bis 3 Monate unterwegs) nach Kuba geflogen.
Der erste Blick vom Balkon: der Cementerio Cristóbal Colón
In meinem Handgepäck, einem roten Rucksack, lag bis zur Ankunft zuoberst ein unterschriebener Scheck über 30000 Euro. Das Geld hatten Mitglieder und Freunde des deutschen Solidaritätsvereins KarEn gespendet, damit im Osten von Kuba Wohnhäuser, Fabriken und Ställe, die der Hurrikan »Matthew« vor 3 Monaten zerstört hat, wieder aufgebaut werden können. Den Scheck sollte ich, falls der sozialistische Zoll ihn nicht beschlagnahmen würde, Hilda, der kubanischen Kontaktperson von KarEn, bei der Ankunft auf dem Flughafen aushändigen.
Im dicksten Kuvert schickte ein Kubaner, der in Berlin lebt, an Carlos Manuel Menéndez, einen ehemaligen Mitarbeiter des kubanischen Außenhandelsministeriums, ein Manuskript und Fotos vom gemeinsamen Ökonomiestudium in der DDR.
Egon Hammerschmied hat mich beauftragt, dem früheren Reiseleiter Alberto Suzarte, dessen Auto nicht mehr anspringt, eine neue Batterie zu kaufen oder ihm 100 Euro dafür zu übergeben.
In zwei kleinen Frachtbriefen habe ich für meine Ansprechpartner in Havanna, den Korrespondenten Andreas Knobloch und die seit über einem Jahr hier unter anderem Marxismus studierende Julie, fleischlose Wurst eingepackt.
Der 91-jährige Erfurter Rentner Karl-Heinz Voigt hatte 2015 seinen Garten verkauft und den Erlös KarEn gespendet. Davon sollten für kubanische Bauern, die in den Bergen von Candelaria noch ohne Elektrizität leben mussten, Solaranlagen errichtet werden. Eine Lageskizze habe ich nicht, nur den Namen eines der Dörfer: La Guinea, westlich von Havanna gelegen. Ich werde also suchen müssen.
Die Thüringer Parlamentsabgeordnete Ina Leukefeld hat mir die Telefonnummer von Anna-Maria geschickt und gebeten, der Frau, die sie 2004 bei einem Besuch in Havanna kennengelernt und danach nie wieder gesehen hat, ihre Mailadresse und 50 Euro zu geben.
Die beiden politisch gewichtigsten Briefe erhielt ich vom Vorstand der VR-Bank Bad Salzungen/Schmalkalden. Adressiert sind sie an die kubanischen Ministerien für Wirtschaft und Tourismus. Die Thüringer Genossenschaftsbank schlägt darin vor, Windräder und Ferienhäuser zu finanzieren. Was nicht einfach ist, denn die schon vor 56 Jahren von den USA erlassene Wirtschaftsblockade verbietet Banken, in Kuba zu investieren. (Im vergangenen Jahr musste die Commerzbank wegen Zuwiderhandlung 1,7 Milliarden Dollar Strafe zahlen.) Ich soll diese Briefe in den Ministerien persönlich abgeben und mir die Aushändigung bestätigen lassen. Doch ich habe nur ein Touristenvisum …
Von Gitarrensaiten und Kabelbindern, die Claudia Fenske aus Berlin ihrem Salsa-Tanzlehrer Miguel schenken will, konnte ich in der Hektik vor dem Abflug nur noch einen Beutel Kabelbinder besorgen.
Für den »Chef der kubanischen Vegetarier« Tito Núñez nahm ich im Auftrag der deutschen Gruppe »Gesünder leben« ein Dutzend Wiesenkräuterrezepte mit, und schließlich hatte mir Maikel, ein ehemaliger Mitarbeiter von ICAP, dem kubanischen Institut für Völkerfreundschaft, versprochen, nach den ersten Tagen ein preiswertes Quartier zu besorgen. Er bat dafür lediglich um ein Sitzkeilkissen gegen seine Rückenschmerzen.
Diese ganze »Post« sollte ich in Havanna zustellen. Ich dachte, dass es schnell gehen würde. Das war falsch. Genauso falsch wie die Ratschläge von Kuba-Experten in verschiedenen Reiseführern. Sie schrieben, dass sich die Kubaner trotz des Mangels im Land immer akkurat kleiden. Bei privaten Verabredungen und offiziellen Begegnungen würden sie nur lange Hosen und Hemden tragen. Ich hatte also 2 lange Hosen und 3 Hemden mitgenommen. Nicht eine kurze Hose. Außerdem wird in einem aktuellen Reiseführer behauptet, dass Männer in Kuba keine Sandalen anziehen. Sandalen wären ein Zeichen für Homosexualität, und Homosexuelle würden nach wie vor ausgegrenzt. Ich packte anstelle der bequemen Sandalen Turnschuhe und ein Paar glänzende Lederhalbschuhe ein. Ich wollte alles richtig machen.
Am schwierigsten war es, das sperrige Kissen für Maikel, für das der Rucksack zu klein war, nicht irgendwo liegenzulassen. Zuerst im Zug nach Berlin. Danach im Treptower Nachtquartier. Oder im Taxi, in dem mich ein Türke in aller Herrgottsfrühe zum Flughafen Tegel fuhr. Im Check-in-Wartesaal. Bei der Gepäckaufgabe, der Personenkontrolle, im Abflugraum. Jedes Mal schaute ich auf meine Hände und zählte eins und zwei: Rucksack und Kissen. Nur einmal habe ich das Zählen vergessen: in unserer Zubringermaschine von Berlin nach Düsseldorf.
Wir saßen schon angeschnallt im Flugzeug. Doch bevor die Stewardess ihre Sicherheitsgymnastik absolvierte, teilte sie mit, dass die Funkanlage wahrscheinlich falsch geschaltet sei. Man werde den Fehler sehr schnell finden. Eine Viertelstunde später informierte sie die »verehrten Fluggäste«, dass die Anlage defekt sei. Sie würde sofort repariert. Nach 10 Minuten schlurften zwei Handwerker mit Werkzeugkoffern ins Cockpit. Unruhige Blicke auf die Uhren. Bereits 25 Minuten Verspätung. Wenn der Flieger nach Havanna pünktlich in Düsseldorf startete …
Als die Stewardess sich im Namen des Kapitäns erst auf Deutsch, dann auf Englisch entschuldigte, dass die Reparatur länger als erwartet dauern könnte, aber kein Wort über den Weiterflug nach Havanna verlor, begannen die ersten Fluggäste zu murren und endlich laut zu schimpfen. Der Kubaner neben mir, dessen sonst kahlgeschorenen dunklen Kopf ein glänzender schwarzer Irokesenkamm zierte, blieb dagegen seelenruhig. Ich nahm an, dass er weder des Deutschen noch des Englischen mächtig war und die Situation deshalb nicht einschätzen konnte. Ich irrte mich. Er legte seine Hand auf mein Bein und sagte auf Spanisch: »Vamos a ver« und wiederholte auf Deutsch: »Wir werden sehen.« Es sei doch alles gut, es werde schon repariert. Und wie um mich zu trösten, stellte er sein abgeschaltetes Smartphone noch einmal an, wischte sehr lange und zeigte mir ein Video von der Reparatur seines 40 Jahre alten Autos in Havanna.
Sich gegenseitig anschreiende Männer zogen das Hinterteil des Transporters auf einen Mauervorsprung. Deutlich war zu erkennen, dass der Auspuff an mehreren Stellen gerissen war und nur noch von blanken Elektrokabeln gehalten wurde. Durch die Bodenplatte konnte man das Innere des Autos und durch das Dach sogar den blauen Himmel sehen. Um das Loch zu flicken, schlugen die Männer einen defekten Toilettenspülkasten platt, und weil auch Schrauben fehlten, befestigten sie die Ersatzplatte mit krummen Nägeln, die mein Nachbar mit einer Zange zusammenrödelte. Den Auspuff ersetzten sie durch ein dickes Rohr, das sie wahrscheinlich von einer alten Belüftungsanlage abmontiert hatten. Die Erneuerung der Kabel war in dem 3-Minuten-Video nicht mehr zu sehen.
Der Kubaner versicherte lachend: »Alles wird gut. Man muss nur Geduld haben.«
Die Monteure der Funkanlage hatten keine Geduld. Als sie ausgestiegen waren, bat die Stewardess auch die »verehrten Fluggäste«, das Flugzeug zu verlassen. Ich vergaß dabei, bis zwei zu zählen, und musste mich gegen den Strom der Aussteigenden bis zu meinem Platz zurückdrängeln. Das Keilkissen lag noch auf dem Sitz.
Eine halbe Stunde später stand ein Ersatzflugzeug bereit, und der Jumbojet nach Havanna wartete in Düsseldorf. Nach dem Start klopfte mir der Kubaner, der nun hinter mir saß, auf die Schulter. Er strich sein T-Shirt, auf dem sich die USA-Flagge über Brust und Rücken spannte, glatt, bestellte bei der Stewardess einen Cuba Libre, den er nicht bekam, schaltete den Rücksitzbildschirm an, wählte nicht den Tarzan-Dschungelkrimi, sondern eine englische Serie über superreiche Villenbesitzer und sagte wieder lachend: »Siehst du, alles wird immer gut!« Ich hätte ihm am liebsten die für Miguel bestimmten 100 Kabelbinder geschenkt. Doch die lagen im Koffer. Das bewahrte mich davor, meine Vertrauensstellung als Briefträger schon auf dem Hinflug in Frage zu stellen.
Für den 12-stündigen Flug konnte man vor dem Start für 95 Euro Aufschlag noch XL-Plätze mit mehr Beinfreiheit buchen. Die 5 Kubaner in der Reihe vor mir brauchten keine Beinfreiheit. Sie verknoteten die Füße kreuz und quer mit denen des Nachbarn, zogen sich eine Decke übers Gesicht und versäumten den ersten Snack. Als ich sie weckte, holte einer von ihnen die Stewardess samt Imbisswagen zurück. Die auf Englisch und Spanisch ausgedruckten und gewissenhaft auszufüllenden Zollformulare, die die Deutschen einander erklärten (keine Drogen, keine Waffen, keine Pornographie, keine Handelsware), blieben bis zur Landung neben den schlafenden Kubanern liegen.
In der Annahme, dass der Zoll zuerst den Rucksack kontrolliert, faltete ich das Scheckkuvert zusammen und steckte es in meine Hosentasche. Das war unnötig. Alle Ankommenden wurden vom Zoll durchgewinkt, und ich hatte schon vor der Passkontrolle und am Durchleuchtungsband meine Vorsicht vergessen, denn dort saßen junge Kubanerinnen in Netzstrümpfen und kurzen nur bis zum Saum der Strümpfe reichenden Röcken. Dazu trugen sie eng anliegende Uniformjacken, hatten ihre schwarzen Haare zu Pferdeschwänzen gebunden, schwarzen Kajal um die dunklen Augen aufgetragen und die Lippen grellrot geschminkt.
Mit diesen Bemerkungen breche ich bereits einen meiner zwei Schreibvorsätze. Ich wollte erstens nicht zum tausendsten Mal die Schönheit der Kubanerinnen preisen. Und mich zweitens in diesem Text weder enthusiastisch noch abfällig, sondern überhaupt nicht über die in jedem Kuba-Bericht erwähnten Oldtimer äußern. Doch nachdem Hilda, eine schlanke Frau in einem langen farbenfrohen Kleid, die schon 74 ist, aber wie 60 aussieht, mich begrüßt und den 30000-Euro-Scheck in ihrer Handtasche verstaut hatte, gingen wir zum Auto eines ihrer Bekannten. Der Fahrer wusste nicht, wie alt sein Lada ist. Er hatte ihn, wie er sagte, erst vor 20 Jahren durch eine gebrauchte Karosserie entscheidend verjüngt! Die Abgase des Motors verflüchtigten sich auch nicht, als Hilda unterwegs alle Fenster öffnete
Der Chauffeur, ein älterer Kubaner, der vor den Zebrastreifen wie alle anderen Fahrer Gas gab und unentwegt hupend die Fußgänger auf den Bürgersteig zurücktrieb, schaltete das Radio ein. Aber das Dröhnen des Motors übertönte die kubanischen Rhythmen. Eine Unterhaltung war nicht möglich. Nur an den Kreuzungen, an denen die Ampeln die verbleibenden Wartesekunden über LED-Zahlen anzeigen, konnte mir Hilda den Fahrer – den gegen alle Verkehrsregeln verstoßenden Fußgängerschreck – vorstellen.
»Er war früher Oberstleutnant.« Noch 47 Sekunden. »Gearbeitet hat er im kubanischen Innenministerium.« Noch 32 Sekunden. »Er hielt sogar Referate im Innenministerium der DDR in Berlin.« Noch 20 Sekunden. »Und kannte Spionagechef Markus Wolf persönlich.« Noch 12 Sekunden. »Leider ist seine Rente mit 600 Peso nacional« – umgerechnet etwas mehr als 20 Euro – »so knapp, dass er« – Grün! Aufheulen der alten Motoren wie bei einem Formel-1-Rennen. An der nächsten roten Ampel ergänzte Hilda, dass der ehemalige Oberstleutnant sich mit gelegentlichen Taxifahrten zusätzlich Geld für seinen Lebensunterhalt verdienen muss.
»Für die Fahrt zum Flughafen bekommt er 20 konvertierbare Peso-CUC. Das sind umgerechnet 500 Peso nacional, fast so viel wie seine Rente für einen ganzen Monat.« Bevor ich etwas fragen konnte, schaltete die Ampel auf Grün.
Erst als wir vor einem ordentlich verputzten, gelb gestrichenen dreistöckigen alten Haus an der calle – Straße – 18 in der Nähe der calle 23 hielten, erklärte mir Hilda die beiden Währungen. »Der Peso nacional ist die Grundwährung für alle Kubaner. Private Händler, Quartiervermieter wie Migdalia, Restaurantbesitzer und andere Dienstleister verlangen inzwischen oft (von Ausländern immer!) die Bezahlung in CUC, der 2004 eingeführten zweiten offiziellen kubanischen Währung, die konvertierbar, also gegen Euro und Dollar umtauschbar, ist.«
Angekommen in der calle 18
Ich gab mir keine besondere Mühe, die kubanische Währungspolitik und den Wechselkurs – ein CUC entspricht etwa einem Euro – sofort zu begreifen. Ich hatte noch 6 Wochen Zeit.
Hilda klingelte bei Migdalia in der calle 18. Vom obersten Balkon warf eine ältere Frau einen Schlüsselbund herunter. Doch bevor wir den passenden Schlüssel zur Haustür gefunden hatten, öffnete von innen eine schnaufende, vielleicht 50-jährige Frau.
Migdalia entschuldigte die ungewöhnliche Begrüßung. Großmutter Maria würde von oben nicht mehr genau erkennen, wer unten stände. Ich schleppte mein 30 Kilo schweres Gepäck – Hilda trug das Keilkissen – mühsam 3 Stockwerke hinauf. An den 6 Wohnungstüren standen statt Namensschildern sehr große Symbole, die wie Anker aussahen. 5 blaue Anker und ein roter.
Während Migdalia vor ihrer Tür ein nach außen gewölbtes und mit Riegeln mehrfach verschlossenes Eisengitter öffnete, das in jedem Hochsicherheitstrakt eines Gefängnisses hätte eingebaut sein können, erläuterte mir Hilda die Bedeutung der Anker. Wohnungsbesitzer, an deren Tür ein blauer Anker angebracht ist, dürfen mit staatlicher Lizenz privat Zimmer an Ausländer vermieten. Die mit dem roten Anker dagegen nur für Peso nacional an Kubaner.
In diesem Haus steht es 5 : 1 gegen Peso nacional und Kubaner oder 1 : 5 für CUC und Ausländer.
Großmutter Maria lachte mit den Augen, fasste mich an der Hand und wollte mir sofort mein Zimmer zeigen. Doch ich blieb staunend in dem schmalen Flur stehen. Er glich einer Gemäldegalerie. Dicht an dicht hingen Ölbilder, Grafiken, Kohlezeichnungen und Aquarelle: Blumen, Landschaften, Liebespaare, Porträts, Stadtansichten, Tiere, unterbrochen nur durch 4 Türen zu 4 Zimmern. Ein Zimmer mit Doppelbett, Toilette und Dusche für mich. Ein Zimmer mit Doppelbett für Migdalia. Ein Zimmer mit Doppelbett für die Großmutter. Ein Zimmer mit Doppelbett für die Tochter Elia, die, während Maria uns Kaffee kochte, sofort die Finanzen regelte. 35 CUC pro Nacht. Ich könnte natürlich länger als 3 Nächte bleiben. Falls mein Zimmer für diese Zeit schon reserviert wäre, müsste die Großmutter bei Migdalia übernachten, und ich würde im Bett der Großmutter schlafen. Dann verbilligt für 30 CUC.
An den wenigen bilderfreien Stellen des langen Flurs standen eine Westministeruhr, Nippfiguren, Vitrinen mit ineinandergestapelten Tassen, Kannen und Vasen, goldverziertes Porzellan und bunt bemalte Skulpturen aus Gips und Ton.
»Mein Erbe«, sagte die 86-jährige Großmutter.
An einem Ende des Flures die Tür zum Balkon. Am anderen die Küche, in der Maria aus der einfachen Espressomaschine, wie sie in Italien aus Aluminium und in Kuba aus Eisen hergestellt werden, würzigen kubanischen Kaffee in kleine Tassen goss. Ich legte eine Tafel Schokolade dazu, brach sie in mundgerechte Stücke, und Maria sagte: »Usted pertenece a la familia aquí.«
»Du gehörst jetzt hier zur Familie«, bestätigte Hilda.
Als neues Familienmitglied erhielt ich sofort gute Ratschläge für meinen Aufenthalt in Havanna. Den ersten müsste ich nur vor Weihnachten beachten. Havanna sei zwar die sicherste Hauptstadt der Welt, aber vor Weihnachten solle man sein Portemonnaie nicht sichtbar in der Hosentasche tragen. In dieser Zeit würden junge Kubaner, um Geschenke und ein gutes Essen kaufen zu können, manchmal ausländische Touristen bestehlen.
Der zweite Ratschlag würde immer gelten: In Havanna kein Wasser aus der Leitung trinken! Man kocht es ab und füllt es in Flaschen.
Migdalia vor ihrer Galerie
Der dritte Ratschlag klang wie ein Befehl: Niemals ein kubanisches Mädchen mit auf das Zimmer nehmen! Zwar sei die berufsmäßige Prostitution seit der Revolution verboten, aber etliche Mädchen, sogenannte jineteras – wörtlich übersetzt Reiterinnen –, würden sich inzwischen Ausländern zuerst als Begleiterinnen und danach fürs Bett anbieten.
Nach diesen Ratschlägen begann ein fröhlicher Kaffeeplausch der Frauen. Ich erfuhr, dass für Maria, »weil Jesus schon tot ist«, nur noch Fidel den Armen und den Gerechten der Welt eine Hoffnung gibt. Außerdem, dass Migdalia viele Jahre im Kulturministerium gearbeitet hat. Als ich von Hilda den mir bekannten Namen Siegfried Schnabel hörte, fragte ich, ob sie den Sexualpapst der DDR meinte. Er hatte das Aufklärungsbuch »Mann und Frau intim« geschrieben, das ich seinerzeit für meine sexuelle Weiterbildung an einem Messestand stehlen musste, weil es nur unter dem Ladentisch verkauft wurde.
Hilda hatte seine Aufklärungsbücher ins Spanische übersetzt. »Sie waren im revolutionären Kuba sehr begehrt.«
Ich würde 6 Wochen Zeit haben, um Hilda ausführlich danach zu fragen. Dachte ich.
Sehr schnell dagegen wollte ich meine Aufträge als Briefträger erledigen. Zuerst rief ich Maikel wegen des Keilkissens an, danach die Vegetarier Andreas Knobloch und Julie.
Maikel fragte am Telefon sofort eilfertig, ob er mir ein preiswerteres Quartier besorgen solle. Als ich antwortete, dass ich wahrscheinlich hier in der Familie wohnen bliebe, entgegnete er unwirsch, dass er jetzt keine Zeit hätte, mich zu begrüßen, und das Kissen irgendwann abholen würde.
Als Erster kam Andreas Knobloch. Er sah nicht so aus, wie ich mir einen Korrespondenten vom »Neuen Deutschland« vorstellte. An allen sichtbaren (und, wie er mir später sagte, auch an den meisten vom T-Shirt und von der Hose bedeckten) Stellen war er tätowiert. Allerdings nicht mit Blumen, Herzen, Schwertern, Flammen und Namen, sondern mit ineinanderverschlungenen Linien, Kreisen, Symbolen und Zeichen. Große Kunst.
»Du gehst zu einem kubanischen Meister?«
»Nein, ich fliege zum Tätowieren seit Jahren regelmäßig nach Mexiko.«
Andreas Knobloch lebt an die 18 Jahre auf Kuba. Was sich in dieser Zeit verändert habe? Er schaute auf die Uhr und fragte grienend, ob ich heute noch einen nachtfüllenden Vortrag hören wollte. Natürlich nicht. Ich war hundemüde.
»In aller Kürze: Die Maschinen haben sich, wie du es nennst, wirklich ›verändert‹. Weil durch die Blockade der USA seit 1960 weder neue Maschinen noch Ersatzteile eingeführt werden konnten, sind sie inzwischen hoffnungslos veraltet. Eigentlich schrottreif, müssen sie immer noch funktionieren.«
Auch die Menschen – »nicht unbedingt die älteren, aber viele der jüngeren« – hätten sich verändert. »Von meinen besten kubanischen Freunden, gut ausgebildeten Ingenieuren, Wissenschaftlern und Künstlern, die ich vor 18 Jahren kennengelernt habe, lebt nur noch einer auf Kuba. Alle anderen …«
Er imitierte mit den Armen einen Vogel. »Ein Vogelzug, und niemand weiß, wie viele Vögel irgendwann auf die Insel zurückkehren.«
Er dagegen wolle auf Kuba bleiben. »Hier bekomme ich jeden Tag Leben pur. Ich muss mir beim Schreiben nichts aus den Fingern saugen. Außerdem, die Liebe …« Er lebt mit einer kubanischen Schauspielerin zusammen. Als er ihren Namen nannte, wusste sogar Großmutter Maria, von wem er sprach. Edenis Sánchez Gey spielt in einer kubanischen Serie eine Kriminalkommissarin. Zurzeit drehte sie in Berlin. In dem ZDF-Zweiteiler »Landgericht« war sie die Geliebte des jüdischen Richters im kubanischen Exil.
Ich kannte sie nicht. Aber ich hatte noch 6 Wochen Zeit …
Eine halbe Stunde nachdem er gegangen war, kam die Studentin Julie. Sie ist schlank, blond, trotz einem Jahr auf Kuba noch sehr hellhäutig und auf den ersten Blick vertrauenerweckend. Weil sie kein kubanisches Mädchen war, durfte sie in mein Zimmer mitkommen.
Die 30-Jährige hat in Heidelberg Psychologie und Geographie studiert. Sie gehört zur deutschen Studentengruppe des Projektes »Tamara Bunke«. Die Deutschargentinierin Tamara Bunke war in Kuba zur Partisanin ausgebildet worden, kämpfte mit Che Guevara in Bolivien und wurde dort, noch nicht 30, in einem Hinterhalt erschossen. Ihr Leichnam trieb 7 Tage im Fluss, bevor man ihn fand. Den Studenten ermöglicht das Projekt, Kuba zu entdecken, seine Entwicklung zu beobachten und zu analysieren. Außerdem studieren sie Spanisch, Sozialwissenschaften, Marx und Martí …
Julie, die mich einige Wochen als Dolmetscherin begleiten wird, ist, wie sie mir sofort offenbarte, trotz des chronischen Warenmangels und der alltäglichen Misere, die ich noch kennenlernen würde, begeistert von Fidels revolutionären Ideen, von dem Mut, mit dem die Kubaner ihre Ideale gegen alle Widerstände verteidigen.
»Das Menschenbild des kubanischen Sozialismus ist für mich die Alternative zur westlichen Profitgesellschaft«, erklärte sie sehr bestimmt und erzählte dann zögerlicher von ihrem ersten Tag in Havanna. Damals sei ihr Jorge Luis an der Bushaltestelle vor der Eisdiele »Coppelia« sozusagen wie vom Schicksal vorausbestimmt in die Arme gelaufen.
Seitdem hat sie ihn festgehalten, ihren Afro-Kubaner. Er hat Restaurator gelernt, arbeitet aber auch als Industriekletterer. Ohne Gerüst, nur an einem Seil hängend. Jorge Luis ist einer von inzwischen Zehntausenden Kubanern, die nicht mehr in staatlichen Betrieben, sondern privat »trabajo por cuenta propia« – auf eigene Rechnung – arbeiten.
»Er will nicht um jeden Preis in Kuba bleiben. Sozialismus, wie er hier läuft, ist nicht seins. Bei der deutschen Botschaft hat er – weil Deutschland die Kubaner nur nach langwierigen Überprüfungen hereinlässt – ein Besuchsvisum für 90 Tage beantragt.«
Julie wird in reichlich 2 Monaten ihren Einsatz für und in Kuba beenden und nach Deutschland zurückfliegen. »Ob Jorge Luis ein Besuchsvisum für Deutschland erhält, ist sehr, sehr fraglich. Viele Kubaner haben es schon mehrmals erfolglos beantragt«, sagte sie.
Ich hatte noch 6 Wochen Zeit, um beide, Julie, die den Sozialismus in Kuba verteidigt, und Jorge Luis, den »cuentapropista«, der wegwill, zu verstehen. Dachte ich.
Gegen 23 Uhr, 8 Stunden nach der Landung in Havanna – in Deutschland war es inzwischen 5 Uhr früh –, war ich endlich allein in meinem Zimmer. Eine Rumba-Band spielte in einem nahegelegenen Restaurant so laut, dass ich das Dröhnen der Automotoren nicht mehr hörte und sofort einschlief. Weil mich der Wind von Ventilatoren immer krank macht, hatte ich allerdings das Ungetüm mit geiergroßen Flügeln über meinem Bett nicht eingeschaltet und wurde früh von der morgendlichen Hitze geweckt.
Ich stehe auf dem Balkon, erblicke den Friedhof, und wie von einer magischen Kraft angezogen, möchte ich an meinem ersten Tag auf Kuba nicht das Capitolio und auch nicht den Platz der Revolution, sondern diese Totenstadt erkunden.
Migdalia hat für mein Frühstück schon Papayas, Ananas und Mangos kleingeschnitten, ein Ei gebraten, ein Brötchen aufgebacken, Kaffee gekocht und das, wie sie es nennt, »Gute-Laune«-Radio angeschaltet. Ich esse sehr hastig – meine Mutter würde sagen: »Junge, schling nicht so!« –, stecke eine Flasche abgekochtes Wasser ein und sage, dass ich zum Cementerio de Colón gehe. Die Treppe laufe ich so schnell hinunter, als wäre das Meer der Gräber nur eine von oben zu erblickende Fata Morgana.
Es ist keine Fata Morgana. Das bestimmt 10 Meter hohe Marmorportal, über dessen mittlerem Rundbogen 3 Frauenfiguren thronen, ist so breit, dass zwei Totenwagen nebeneinander hineinfahren könnten. Flankiert wird es von niedrigen Gebäuden. Links die administración, rechts die información, daneben hängt ein kleines Schild: »5 CUC« (rund 5 Euro). Ich müsste erst Geld tauschen.
Weil ich nirgends ein Kassenhäuschen entdecke und mich unsicher nach Kontrolleuren umschaue, fragt ein bärtiger Mann auf Englisch, ob er mir die Geschichte des Friedhofes erklären und die berühmtesten Grabstätten zeigen soll. Als ich entgegne, dass ich kaum Englisch spreche, wiederholt eine deutsch sprechende Frau das Angebot. Mit der goldfarbenen Kette, der ordentlichen Dauerwelle und dem besorgten mütterlichen Gesicht ähnelt sie Migdalia, ist aber sehr viel jünger und trägt eine mit dem roten Revolutionsstern geschmückte Baskenmütze. Eine Mütze, wie sie Che Guevara trug und Fidel vielleicht immer noch trägt.
Ich brauche keine Führung und frage nur, ob es zur Totenstadt noch einen anderen Eingang gibt. Sie nickt. »Ja, den Ausgang!« Ich solle 10 Minuten an der gelben Mauer entlanglaufen. Sie übersetzt mir noch den Spruch am Tor: »Ich bin das Tor des Friedens«, und erklärt die Bedeutung der 3 steinernen Figuren auf dem Portal. »Sie verkünden den immerwährenden Glauben, die barmherzige Liebe und die bleibende Hoffnung.«
Die gelbe Mauer ist zwar einen Meter höher als ich, aber nicht hoch genug, um einen breiten Schatten auf den Gehweg zu werfen. Über der Mauer erblicke ich an manchen Stellen die Köpfe von lächelnden Engeln oder Jesusfiguren, die mir mit einer ausgestreckten Hand drohen oder den Weg weisen. Schließlich wird sie von einer Straße durchschnitten.
Neben dieser Straße stehen ein Tisch und zwei Stühle, auf denen sonst bestimmt die beiden uniformierten Männer sitzen, die gerade auf einem LKW verwitterte Grabsteine kontrollieren. In der Hoffnung, dass sie mich übersehen, verschwinde ich schnell zwischen den Grabstätten, kompakten Sarkophagen aus Marmor, Zement oder Granit. Sie unterscheiden sich nur durch die Namen der Toten, die Medaillons und die rechteckigen Vasen aus Beton, in denen selten frische Blumen stehen. An den mächtigen Deckplatten sind dicke Eisenringe befestigt. Damit kann man sie wahrscheinlich anheben. Aber die Gänge zwischen den Gräbern sind so eng, dass weder ein kleiner Bagger noch ein Gabelstapler hindurchfahren kann.
Links von der Hauptstraße stehen prunkvolle Mausoleen, die von Jesus, Maria, schwertschwingenden Helden und Engeln bewacht werden.
Ein Künstler hat das faltige Gesicht eines alten Mannes nach der Vorlage auf dem Medaillon mindestens dreimal überlebensgroß aus Stein gehauen. In einem aufgeschlagenen Marmorbuch stehen die Wünsche der Familie García für die Lebenden und die Toten: Liebe und Treue. Neben den individuellen Lebensgeschichten finde ich auch verewigte kollektive Zeitgeschichte in Inschriften wie »die Freunde Francos 19.2.1940«, »die Vereinigung der Zuckerproduzenten 1950«, »Mitglieder vom Autoclub Havanna 1955«, »Freimaurer«, »die Betriebsangehörigen der kubanischen Eisenbahn« …
Diese Grabstätten werden von Heiligen gekrönt. Nur die Königspalmen, deren Stämme so glatt wie Marmorsäulen sind, überragen sie.
Friedhofsarbeiter auf Fahrrädern pfeifen und zeigen, sobald sie in eine Grabgasse abbiegen, mit der Hand die neue Richtung an.
Nachdem ich 3 Stunden umhergelaufen bin und schon hinke, hält ein Multicarfahrer neben mir und bedeutet mir mit einer Geste, dass ich mich neben ihn setzen soll. Er würde mich bis zum Nord- oder Südportal (es gibt also zwei Eingänge) mitnehmen. Ich sage, dass ich zum ersten Mal in Havanna und zum ersten Mal auf diesem Friedhof bin. Da fährt Osvaldo für mich ein paar Ehrenrunden durch die breiteren Gassen der Totenhäuser. 20 Kilometer umfasst das Straßennetz des Friedhofs. Als ich wissen will, wie die zentnerschweren Grabplatten angehoben werden, stoppt er vor einem Sarkophag. Der kaffeebraune Kubaner zündet sich eine Zigarette aus sehr schwarzem Tabak an, holt ein Radio aus der Werkzeugkiste, sucht, bis er Salsa-Musik findet, und erklärt mir, dass er die Grabplatten mit 3 Kollegen öffnet. Nur 3 Brechstangen und Kraft. Aber jetzt ist Siesta. Er reicht mir eine kleine Flasche mit Rum.
Aus überbelegten Grüften müssen sie die sterblichen Überreste nach zwei Jahren wieder herausholen, in Zementkisten packen und, mit Namen und Datum versehen, in ein Lagerhaus bringen, wo sie bis zum Jüngsten Gericht aufbewahrt werden. Er zeigt mir löchrige Gummihandschuhe. Die zieht er an, wenn sie die großen Knochen herausholen. Knöchelchen würde er mit der bloßen Hand einsammeln. Jeden Monat bekommen sie vorsorglich eine Injektion.
Zwar kühlt mich der Fahrtwind, aber mein Gesicht brennt. Osvaldo hält an der Friedhofskapelle. Drinnen ist Schatten. Doch ich bleibe ehrfürchtig vor der offenen Tür stehen. Gott, der an der hinteren Wand als Fresko zu sehen ist, winkt mir hier nicht wie ein gütiger Vater zu, sondern droht als bärtiger junger Mann mit nacktem Oberkörper und zum Schlag ausholender Hand schon jetzt das Jüngste Gericht an. Unter ihm steht ein ganz in Weiß gekleideter schwarzer Priester. Er predigt, ohne seine Stimme zu heben. Ein monotoner Singsang. Vor ihm ist ein kleiner Sarg aufgebahrt, hinter dem vielleicht 30 sehr junge Frauen und Männer sitzen und stehen. Einige Frauen haben ihren Kopf schutzsuchend an die Schulter eines Mannes gelegt. Erst am Ende der Predigt schluchzen sie laut. Der kleine Sarg ist so leicht, dass ihn zwei Männer mühelos tragen können. Sie stellen ihn in eine Umrandung, die auf dem Dach eines silbergrauen PKW angebracht ist. Die Trauernden streuen Blumen auf das Dach des Totenautos, und die bestimmt noch keine 25 Jahre alte Mutter des Kindes küsst, weil sie nicht groß genug ist, immer nur die Seitenfenster.
Noch bevor die Trauergäste in einen Bus und die Mutter in das silbergraue Auto gestiegen sind, kurven 4 Oldtimer mit Touristen um die Kapelle und biegen in die Straße der Mausoleen ein. Zuerst ein zitronengelber offener Chevrolet, gefolgt von einem olivblauen Buick, einem grasgrünen Ford und zum Schluss einem kackbraunen Chevy. Obwohl die kubanischen Chauffeure sehr zügig fahren, schaffen es einige der strohhutbedeckten Touristen, aufzustehen, fröhlich zu winken, die Hüte zu schwenken und zu fotografieren.
Auf der linken Seite des Friedhofes laufe ich zwischen flachen schmucklosen Familiengräbern gedankenlos einem Mann in einem roten T-Shirt hinterher, der einen Strauß Blumen trägt.
Er bleibt vor einem einfachen halbmeterhohen Familiengrab stehen, wischt mit seinem Ärmel das vertrocknete Laub von der Grabplatte, steckt die Blumen – sie ähneln Astern – in eine Betonvase und schüttet Wasser aus seiner Trinkflasche hinein.
Ich gehe langsam näher, verhalte vor dem Grab, habe Hemmungen, ihn anzusprechen. Nicke ihm nur zu. Er richtet sich auf, schaut mich verwundert an und grüßt dann freundlich: »¡Hola!«
Als ich wissen will, wer hier begraben worden ist, zeigt er auf die Grabplatte. Sein Vater ist schon 1996 mit 70 Jahren gestorben. Er war gleich alt mit Fidel. Seine Mutter haben sie 2004 begraben.
Er würde nur ein- oder zweimal im Jahr hierherkommen, weil er oft im Ausland unterwegs ist. Als Masseur hätte er kubanische Judoka und Boxer betreut, in Spanien konnte nach seiner Behandlung der gehbehinderte Cousin von Francos Sohn wieder laufen, und in Italien hätte er sich mit einem Koch des Papstes angefreundet …
Ich nehme an, dass er mir etwas vorflunkert, doch er schreibt seinen Namen und die Telefonnummer in mein Notizbuch. Ich gebe ihm meine Adresse. Wenn er nach Deutschland kommt und Hilfe braucht, solle er mich anrufen. Schließlich bitte ich darum, ihn an seinem Familiengrab fotografieren zu dürfen. Er stellt sich in Pose und lächelt sogar.
Bevor ich gehe, möchte ich wissen, was er, ein so weit gereister Kubaner, über die Zukunft seines Landes denkt.
Sein Vater habe mit der Waffe für die Revolution gekämpft. Er sei den Ideen von Fidel – beispielsweise, dass im von Ausbeutung befreiten Kuba alle Menschen gleich gut leben müssen – immer treu geblieben.
Joaquín bemerkt, dass ich seine Worte aufschreibe, doch er fragt nicht, weshalb, und fügt ohne Pause hinzu, dass er unter dieser Sargplatte auch die Ideale seines Vaters begraben habe. Mit den Vätern würde die sozialistische Ideologie langsam sterben und die sich täglich verändernde kubanische Wirklichkeit lebendiger werden.
Joaquín: »Unter der Sargplatte sind auch die Ideale des Vaters begraben.«
Ich frage ihn nach den cambios, den Veränderungen, in Kuba. Doch Joaquín bleibt vage. Er hat im Ausland gesehen, dass für seine und die Arbeit der neuen cuentapropistas, also Selbständigen, der Kapitalismus einträglicher als der Staatssozialismus sein kann. Doch ob der Kapitalismus auch für die Armen und für die Bedürftigen in Kuba gut sein würde, weiß er nicht.
Vor der Revolution hätte man die Ärmsten, beispielsweise die Tagelöhner bei der Zuckerrohr- und Tabakernte, namenlos in einem Erdloch verscharrt. Die Besitzer der Plantagen dagegen hätten sich schon zu Lebzeiten auf dem Friedhof, der damals der katholischen Kirche gehörte, die prunkvollsten Mausoleen bauen lassen. 1963 verstaatlichte Fidel den Friedhof und nahm den Reichen die Freiheit der Luxusgrabstätten. Die Armen allerdings konnten würdiger begraben werden, je in einer mit ihren Namen versehenen Gruft. Die Angehörigen zahlen dafür jährlich etwa 90 Peso, also nicht einmal 4 Dollar. Mit dem Tod darf man keine Geschäfte machen. Die Kosten für die Beerdigung, von der Leichenwäsche bis zur Bestattung, übernimmt der Staat, in Havanna allein in einem Monat für rund 1000 Tote.
Auf dem Kindergeburtstag: Susette und Julie, die Dolmetscherin
Als ich gehe und mich noch einmal umdrehe, beugt Joaquín andächtig seinen Kopf wie zu einem Kuss zur mächtigen Grabplatte hinunter.
Ich will den Friedhof durch das nördliche Portal verlassen und bemerke vor der información die junge Frau mit der Revolutionsmütze. Nachdem ich 5 Stunden zwischen Gräbern umhergelaufen bin, erscheint sie mir nun sehr viel hübscher. Ich bedanke mich für ihren Tipp am Morgen. Marciel ist 23 und studiert im vorletzten Semester Veterinärmedizin. Weil sie sehr trocken aussehende Kekse knabbert, biete ich ihr von meinem abgekochten Wasser an. Sie polkt aus einem fast halbmeterlangen, aber hauchdünnen Plastikschlauch einen der Kekse heraus. Sie sind wirklich trocken, aber knackig und schmecken nach Knoblauch. Marciel fragt, ob ich bei meiner Exkursion die Gräber des weltberühmten Romanciers Alejo Carpentier, des Schachweltmeisters José Raúl Capablanca und das große Mausoleum für die 1890 bei einem Brand in Havanna ums Leben gekommenen Feuerwehrleute gefunden und die Statue der La Milagrosa, die 1901 an den Folgen einer Totgeburt gestorben war, bewundert habe. Bei der Beerdigung hätte man ihr das Kind zu Füßen gelegt. Doch als das Grab 13 Jahre später geöffnet wurde, hielt sie es an ihrer Brust im Arm. Seitdem wäre La Milagrosa für die kubanischen Frauen eine Heilige.
Auch zwei Deutsche – nein, nicht der Dichter Georg Weerth, der zwar in Havanna gestorben, aber dessen Grab nicht bekannt ist – wären auf dem Cementerio de Colón beerdigt worden: zwei getötete Soldaten des deutschen Kanonenbootes »Meteor«, das sich 1870 während des Deutsch-Französischen Krieges mit dem französischen Kanonenboot »Bouvet« vor dem Hafen von Havanna ein Gefecht geliefert hatte.
Ich bin zu müde für weitere Friedhofsstorys und frage nur noch, ob die Kampfgefährten von Fidel und Angehörige seiner Familie auch auf diesem Friedhof beerdigt wurden. »Nein. Bis auf die 1961 bei der erfolglosen Zwei-Tage-Aggression der USA in der Schweinebucht gefallenen Kubaner sind sie in Santiago de Cuba begraben.«
Als ich Marciel fotografieren möchte, wehrt sie heftig ab. An der Universität soll das »Komitee zur Verteidigung der Revolution« nichts über ihre Freizeitbeschäftigung erfahren. Es sei unerwünscht, vielleicht sogar verboten, dass sich Studenten, ob als jineteras der Liebe oder Friedhofsführerinnen, von ausländischen Touristen bezahlen lassen.
Sie würden im Studium alles umsonst erhalten: den Unterricht, die meisten Lehrbücher, die Unterkunft im Internat und das Mensaessen. All das hätten ihre Eltern – Arbeiter in einem staatlichen Tabakbetrieb in Pinar del Rio – niemals bezahlen können. Sie ist der Revolution deshalb dankbar, aber – sie nimmt die klobige goldfarbene Kette in die Hand – Schmuck zum Beispiel gäbe es nicht umsonst. Doch wir könnten zusammen im staatlichen Restaurant gegenüber noch einen Kaffee trinken.
»Heute nicht«, sage ich, und sie wünscht mir gute Tage auf Kuba. Wenn ich sie treffen möchte, sie warte an jedem vorlesungsfreien Freitag am Nordportal auf Touristen.
Wenige Schritte neben dem Friedhof steht in einem Park ein Riesen-, besser Zwergenrad. Die Gondeln aus zusammengeschweißten Eisenteilen sind blau, grün und gelb gestrichen. Daneben krümmen sich die dünnen Schienen einer bescheidenen Achterbahn. Außerdem wartet ein aus alten Achsen, einer leeren Kabeltrommel und Brettern gebautes Karussell. Und ein Kiosk. Über dem Eingang zum Park hängt ein Schild: Jalisco – ein Vergnügungsplatz für die Kinder. Doch das Karussell mit den im Sprung verharrenden Holzpferden dreht sich nicht, das Riesenrad und die Achterbahn stehen still, und der Kiosk ist geschlossen.
Kein Kindergeschrei. Keine quietschenden Räder. Keine Musik. Ich hätte mir all das nach der Friedhofsruhe sehnlichst gewünscht. Der Wärter (!) am Tor zum leeren Kindervergnügungspark erklärt mir, dass hier meist nur am Wochenende Kinder lärmen. Ich solle morgen, am Sonnabend, vorbeischauen.
Ein paar Straßen weiter entdecke ich zuerst Julie, die mich sucht, und höre dann schon aus großer Entfernung Musik, Gesang und lärmende Kinder. In einem von Maschendraht umzäunten, mit schattenspendenden Bäumen bewachsenen und bunten Luftballons geschmückten Hof toben zwei Clowns mit einem Dutzend Mädchen und Jungen. Frauen verteilen nach Wettspielen Süßigkeiten, und ein Kofferradio beschallt die Szene mit lauter kubanischer Musik. Am Zaun steht eine vielleicht 30-jährige Frau. Sie trägt eine schlichte weiße Baumwollbluse und schwarze, mit großen weißen Punkten gemusterte Hosen. Die Sonnenbrille hat sie auf ihr schwarzes glattes Haar geschoben. Manchmal bringt ihr ein kleiner Junge seine gewonnenen Bonbons, die er durch die Maschen des Zaunes steckt. Die Waffeln isst er lachend selber. Alle Kinder tragen Schuluniform: weiße Hemden zu weinroten Röcken oder Hosen.
Sie feiern hier einen Kindergeburtstag, sagt die Frau. Die 5- oder 6-Jährigen besuchen zwar noch den Kindergarten, lernen aber dort schon im ersten Vorschuljahr. Schuluniformen sind ein Ergebnis der Revolution, Gleichheit für alle. Die Frau findet dieses Prinzip gut. Auch wenn sie es könnte, würde sie ihrem Sohn Randall keine teuren Sachen kaufen. Er solle sich wegen seiner Hosen und Hemden weder unter anderen Schülern ducken müssen noch erheben dürfen.
Als ich sie für ihre klugen Worte lobe, lacht sie und meint, an ihr wäre nur der Name bemerkenswert. Sie heißt Susette.
Die Geschichte ihres Namens ähnelt einem Märchen. Ihre Großmutter war in der Jugend eine besonders schöne Frau. Sie durfte als Model Schmuck präsentieren. In ihrer Nachbarschaft lebte ein behindertes Kind. Es konnte sich kaum bewegen, aber wenn ihre Großmutter dem kleinen Mädchen Ringe und Ketten zeigte, glänzten seine Augen. Es hieß Susette. Der Vater war reich an Geld, aber geizig mit Liebe. Die Liebe erhielt das Mädchen viele Jahre von der Großmutter. Auf ihren Wunsch wurde die Enkelin nach dem Mädchen Susette genannt.
Das wäre die einfache Geschichte, wie sie zu ihrem Namen gekommen ist. Die zweite, weshalb ihr Sohn heute hier einen Geburtstag feiern könne, sei komplizierter. Sie hatte Kuba verlassen, um besser leben zu können, und ging nach Mexiko. Dort wurde Randall geboren. Als er 4 Jahre alt war, kehrte sie mit ihm, aber ohne den Vater, nach Kuba zurück.
Sie zeigt auf die tobenden Kinder, die Clowns, den Kindergarten. »Randall soll hier in Sicherheit aufwachsen. Ohne Angst, dass er überfallen wird. Er wird in Kuba eine kostenlose Bildung erhalten. Und er wird nie wie manche mexikanische Kinder auf Müllhalden nach essbaren Abfällen suchen müssen. Und nie Geld für Drogen stehlen.«
Als Randall eine Handvoll Bonbons bringt und stolz seine preisgekrönte Zeichnung, einen Löwen mit grüner Mähne, blauem Fell und roten Pfoten, zeigt, steckt mir Susette einige Bonbons in meine Hosentasche. »Sie sind aus kubanischem braunem Rohrzucker und Ananas!«
Der Junge winkt, als ich gehe. Er rennt mir bis zum Ende des Zauns hinterher. Der Vater, hatte Susette gesagt, schicke aus Mexiko weder Geld, noch melde er sich. Aber Randall fragt jeden Tag nach ihm.
Der Abend bleibt laut. Direkt vor Migdalias Haus steht ein Bus ohne Türen und Fenster. Drinnen improvisieren mehrere junge Männer mit Trompeten, Gitarren und Rasseln kubanische Rumba und amerikanischen Rock. Und schließlich dudelt bei Migdalia immer noch das Gute-Laune-Radio.
Die beiden Frauen sitzen im Korridor vor dem Fernseher. Ein Dokumentarfilm läuft: Kubanische Krankenschwestern impfen auf Haiti Dorfbewohner gegen Cholera und versprühen Desinfektionsmittel in den Hütten.
Ich bin zu müde, um es mir anzuschauen, gehe ins Bett und schlafe trotz der 5 Stunden auf dem Friedhof traumlos.
Früh am Morgen will ich mein Begrüßungsritual auf dem Balkon wiederholen. Doch der Fernseher läuft schon. Auf dem Bildschirm sind die bärtigen Männer um Fidel und Che beim Marsch durch die Sierra Maestra und bei Kämpfen gegen Batistas Soldaten zu sehen. Gewehrschüsse und »¡Viva Cuba!«- und »¡Nosotros somos Fidel! – Wir sind Fidel«-Rufe.
Auf dem Tisch steht noch kein Frühstück. Und das Gute-Laune-Radio ist stumm. Und Maria und Migdalia stehen wie gebannt vor dem Fernseher, ohne mich zu beachten. Und als die Großmutter sich umdreht, sehe ich ihre verweinten roten Augen. Und als sie mich erkennt, schluchzt sie laut. Und umarmt mich. Und legt ihren Kopf schutzsuchend an meine Schulter. Und murmelt immer wieder: »¡Jesús Maria, Jesús Maria – Fidel muerto!«
Fidel Castro ist gestorben.
Gestern Abend um 22:35 Uhr.
10 Stunden zuvor hatte ich noch den Friedhof erkundet. »Ich bin das Tor des Friedens!«
Ich will diesen idiotischen Gedanken nicht zu Ende denken und stütze die schwankende Maria. Wir verharren, gefühlt eine halbe Stunde, in schweigender Umarmung. Ich wische mir ab und an mit dem Hemdsärmel die Augen und streichele die immer noch dunklen Haare der 86-Jährigen.
Migdalia schneidet mittlerweile wie am Tag zuvor Papayas, Ananas und Mangos klein, brät ein Ei, backt ein Brötchen auf und kocht Kaffee. Nur das Gute-Laune-Radio bleibt stumm.
Neun Tage würde ich in Kuba keine Musik hören. Nicht in den Restaurants, nicht in den Wohnungen, nicht in den Discos und nicht in den Konzertsälen. Morgen sollte der lang erwartete Plácido Domingo in Havanna singen. Das Konzert ist abgesagt. Kuba trauert.
Ich nippe nur am Kaffee, dann gehe ich auf die Straße und suche das Meer.
Von Joaquín, der einen Koch des Papstes massierte, einem Nacht-Privatquartier für jüngere und ältere Liebende und den »Fidel ist tot!«-Freudentänzen der Exilkubaner in Miami
Auf »meiner« calle 18 treffe ich keine Passanten, die ich nach el mar fragen könnte. An diesem Morgen laufen nur Hunde durch die von schattenspendenden Palmen gesäumte Seitenstraße. Trotz strahlender Sonne liegt eine sogar mich beunruhigende Stille über der Stadt. Ich bin froh, als ich das Scheppern von Schaufeln höre. Eine Frau und ein Mann kehren den Gehweg, kratzen das Laub aus den Schlaglöchern, fegen mit ihren Rutenbesen vertrocknete Palmwedel und Plastetüten zusammen. Ein zweiter Mann schaufelt den Unrat auf eine Schubkarre. Die vielleicht 30-jährige schlanke Müllfrau trägt einen pinkfarben leuchtenden Body, der ihre Figur wie ein Taucheranzug umschließt. Dazu im selben Farbton ein Kopftuch mit weißen Tupfen und eine feingliedrige golden glänzende Halskette. Sie würde, denke ich, bei jeder Film-Gala eingelassen. Die Männer dagegen haben verwaschene graue und blaue Arbeitsoveralls an. Ich vermeide das übliche »¿Hola, qué tal? – Hallo, wie geht es?« und frage nur: »Auch heute arbeiten?«
Die Frau schluckt mehrmals und nickt wortlos.
Der Mann in Grau: Fidel habe nicht gesagt: Wenn ich tot bin, lasst den Dreck auf der Straße.
Der Gehweg ist sauber, aber vor mancher Villa, deren kunstvoll geschnitzte Türreliefs und klassischer Zierrat an bessere Zeiten erinnern, liegen Balkonteile, umgestürzte Säulen und hinter dem Zaun Schutthaufen. Als ich die Straßenkehrer – Adis Maris in Pink, Reynaldo in Grau und Gilberto in Blau – nach dem Weg zum Meer frage, meinen sie, dass ich auf der 18 richtig bin. Ich erzähle, dass ich mit meinen Gedanken an Fidel am Meer allein sein möchte. Doch sie raten mir, lieber in die Berge zu fahren. In der Sierra Maestra würde ich dem Comandante en jefe näher sein als am Meer.
Ansonsten sollte ich die calle 18 immer geradeaus gehen. Sie münde direkt ins Meer.
Nicht direkt. Zuerst trennt eine zweispurige Autostraße die 18 vom Meer. Dann ein Grünstreifen, der mit seinem kurzgemähten, schon braunen und borstigen Gras wie ein abgetretener Teppich aussieht. Danach die zweispurige Gegenfahrbahn und schließlich eine 8 Kilometer lange Ufermauer, der Malecón. Ich klettere auf die Mauer. Der Atlantik schlägt sich an den Steinen schaumig.
Auf dem Malecón sitzt ein Mann in einem blauen T-Shirt. Er kaut an einer nicht mehr brennenden Zigarre, hat den Rücken zum Katzenbuckel gekrümmt und hält eine Angelschnur ins Wasser. Gefangen hat er noch nichts.
Kein guter Tag heute, meint er, gibt mir die Angelschnur zum Halten und zündet sich seinen Stumpen wieder an.