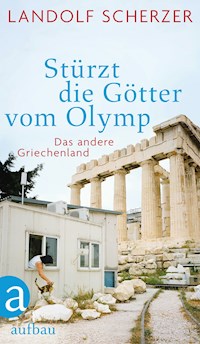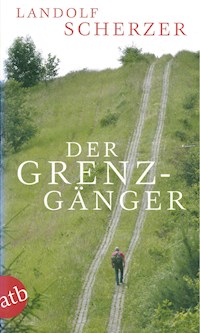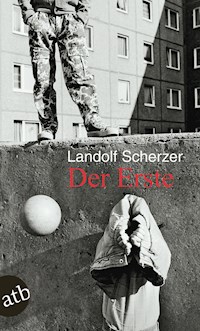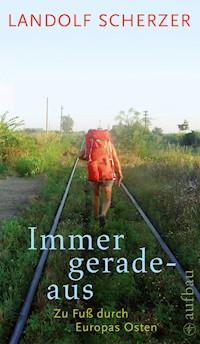8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die ungeschönte Wirklichkeit.
Für diese Reportagen hat Landolf Scherzer wieder »weiße Flecken in der Landschaft der sozialen Wirklichkeit dieses Landes« (Günter Wallraff) betreten: Er wollte von der Treuhand ein Rittergut kaufen, traf in Thüringen eine westdeutsche Puffmutter, begegnete einer lebensmüden Arbeitslosen und hat die Millionäre im »Goldstaubviertel« von Radebeul gesucht.
»Scherzer serviert Wirklichkeit in nahrhafter Form. Reportage wird in dieser Zeit sozialer Konflikte wieder zu einem wichtigen Lebensmittel.« Günter Wallraff.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 310
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Landolf Scherzer
Urlaub für rote Engel
Reportagen
Mit einem Vorwort von Günter Wallraff
Impressum
ISBN E-Pub 978-3-841-20243-7
ISBN PDF 978-3-8412-2243-5
ISBN Printausgabe 978-3-7466-2694-9
Aufbau Digital,
veröffentlicht im Aufbau Verlag, Berlin, April 2011
© Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, Berlin
Die Orginalausgabe erschien 2011 bei Aufbau Taschenbuch;
Aufbau Taschenbuch ist eine Marke der Aufbau Verlag GmbH & Co. KG
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung und Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlages zulässig. Das gilt insbesondere für Übersetzungen, die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen sowie für das öffentliche Zugänglichmachen z.B. über das Internet.
Umschlaggestaltung morgen, Kai Dieterich
unter Verwendung eines Fotos von Landolf Scherzer
Konvertierung Koch, Neff & Volckmar GmbH, KN digital – die digitale Verlagsauslieferung, Stuttgart
www.aufbau-verlag.de
Menü
Buch lesen
Innentitel
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Informationen zum Autor
Impressum
Inhaltsübersicht
Günter Wallraff, »Schreib das auf, Scherzer!«
I
Feenmärchen zu verkaufen
Die Meile der Eitelkeiten
Der sterbende Schwan in der Elsteraue
Die Kalikarawane
»Spiel mir das Lied vom Tod!« I
»Spiel mir das Lied vom Tod!« II. Vergessenes Bischofferode
Wir himmeln hier per Hand
Das Innere der Glaskugel
Sag Sascha, nicht Alexander! oder: »Die Eltern haben drei Kinderärzte totgeschlagen«
Die Erben der Öfen oder: »Das ist der Bengel von dem Kriegsverbrecher!«
Ein Gebirge wird verkauft oder: »Das Lied können Sie heute getrost wieder anstimmen«
Nach der Himmelfahrt auf Hiddensee
Straßengeschichten
Ria S. ( 43): »Ich sprang nicht … Ich heulte nur«
Urlaub für rote Engel
Anschaffen im Osten
Nebenan »Zum letzten Heller«
Die Reichen von Radebeul
Die Vermesser
II
Von Erfahrungen, die man bei serbischen Zigeunern und moçambiquanischen Maurern sammeln kann. Festrede auf der »Internationalen Studentenwoche Ilmenau – ISWI 2009« zum »Dies academicus«
Von den Unterschiedlichkeiten und Gemeinsamkeiten beim Verfassen von Reportagen. Brief an Günter Wallraff
Textnachweise
|7|»Schreib das auf, Scherzer!«
Landolf Scherzers Verdienst, die literarische Reportage zu neuem Leben erweckt zu haben, hat ganz sicher auch mit seiner gesellschaftlichen und künstlerischen Außenseiterrolle zu tun. – Da ist jemand sich und seinen Lesern treu geblieben.
Scherzer war und ist der präzise und detailgenaue Beobachter und Chronist: Jenseits der jeweils angesagten politischen Propaganda fühlt er sich den gesellschaftlich Ausgebooteten und Nichtrepräsentierten nahestehend.
Wenn Scherzer auf Reisen geht nach dem Motto »Warum in die Ferne schweifen, sieh, das Schlimme liegt so nah!«, erlebt er die Welt weder mit dem Einverständnis des Konsumenten noch als sensationslüsterner, die Erwartungen des Marktes befriedigender Klischeereporter. Scherzer nähert sich seinen Themen behutsam und diskret als Mitbetroffener, zuweilen auch als Mitleidender.
Was nicht bedeutet, dass er die Opfer verklärt, idealisiert oder ihnen nach dem Munde redet; er nimmt die Protagonisten seiner Reportagen einfach ernst, er behandelt sie liebevoll, ist oft verwundert, sogar fassungslos, nie hasserfüllt. Er menschelt nicht, er dämonisiert auch nicht, und Ostalgie ist ihm fremd. Selbst die miesesten Gestalten seiner sozialkritischen Erkundungen, politische Schaumschläger und Betrüger, windige Wendegeschäftemacher, mehrfach gewendete Wendehälse, führt er nicht als verabscheuungswürdige Schurken vor, vielmehr in ihrem Spielraum und in ihrer Rolle oft als konsequent |8|handelnde Erfüllungsgehilfen und Handlanger vorgegebener Entscheidungen.
Landolf Scherzer berichtet nie vom Standpunkt des All- und Besserwissenden. Er nähert sich als Fragender, zuweilen Staunender; statt zu belehren, wundert er sich, und so gibt er auch denen eine Chance, die es immer schon gewusst haben und meinen, nichts dazulernen zu müssen. Sogar Scherzers Selbstkritik ist wohltuend unpathetisch, lakonisch und verallgemeinerungsfähig.
Landolf Scherzer unterscheidet sich deutlich und eindeutig von den üblichen und oft üblen »Reportern« in Zeitungen, Illustrierten und Fernsehanstalten, die sich an der literarischen Form der Reportage vergriffen und sie dermaßen ausgeleiert, prostituiert und inflationär entwertet haben, dass man schon einen neuen Begriff dafür finden möchte.
Da werden die Bilder, die uns die Medien über die Wirklichkeit dieses Landes verkaufen, einerseits immer greller, unschärfer, überblendeter, verfälschter und immer schneller in ihrer Folge – kaum gezeigt und schon vergessen – und da setzt andererseits einer an seinem Schreibtisch entgegen dieser oberflächlichen Schnelligkeit und Schnelllebigkeit mühevoll und hintergründig Teil für Teil eines genauen Wirklichkeitsbildes zusammen, ein Puzzle aus gründlicher dokumentarischer Recherche und Erlebnisschilderung. Der Berichterstatter und Zeitzeuge Scherzer versucht, wie sein Vorbild Kisch, als »Schriftsteller der Wahrheit« die Vergangenheit und Zukunft in Beziehung zur Gegenwart zu setzen, und das mit Phantasie und solidem Handwerk.
Er scheut sich nicht, die traditionelle Reportage ohne |9|modernistischen Schnickschnack für seine aktuellen Themen zu verwenden, und schafft es, Wirklichkeit nicht, wie zumeist üblich, lediglich als schnell zu vermarktende Sensation zu benutzen, sondern sie im klassischen Sinn der Reportage durchschaubar, nacherlebbar zu machen. Dabei hat er sich auf ein schwieriges Unterfangen eingelassen, denn immer weniger Zeitungen und Zeitschriften veröffentlichen sie noch: die große Reportage zu sozialen, ökologischen und anderen wichtigen Themen dieser Zeit, einer Zeit übrigens, die wegen ihrer Konflikte geradezu nach Reportagen schreit, denn soziale Spannungs- und politische Umbruchzeiten waren immer auch Hoch-Zeiten der Reportage.
Als Insider, Leidtragender und Nutznießer der neuen Freiheit versucht Scherzer, diese ihm bislang fremde Wirklichkeit einer hemmungslosen »Marktwirtschaft« für sich und seine Leser transparent zu machen. Er tut das gegen Politik und Medien, die das große Geld auch damit verdienen, dass sie diese »schöne neue Welt« à la Huxley für den kleinen Mann undurchschaubar verklären und verfälschen.
Der Reporter Scherzer hat nicht spektakulär die Tresore der Treuhand geknackt, aber er hat stattdessen zum Beispiel versucht, als ehemaliger DDR-Bürger ein von der Treuhand angebotenes Schloss zu kaufen.
Er hat in Erfurt nicht nur die Erben der Topf-Firma gefunden, die die Verbrennungsöfen für Buchenwald und Auschwitz herstellte, sondern auch die moralische Anfälligkeit der »sozialistischen Arbeiter«, die 1988 mit den angolanischen Arbeitern ihres Betriebes bei Brigadefeiern auf die »ewige internationalistische Freundschaft« |10|tranken und zwei Jahre später diese angolanischen Arbeiter wie Freiwild jagten. Und er hat die Geschichte der jungen alleinstehenden, arbeitslosen Frau notiert, die mit dem kleinsten ihrer drei Kinder schon draußen auf dem Sims des Balkons ihrer Hochhausplattenwohnung in Bad Salzungen stand und nicht sprang …
Die letzten weißen Flecken auf der Landkarte der Erde sind inzwischen verschwunden. Nicht so die weißen Flecken in der Landschaft der aktuellen sozialen Wirklichkeit dieses Landes. Der Reporter betritt sie in diesem Buch nicht nur aus beruflicher Neugier, sondern auch aus einer Verantwortung für die Menschen, die er in ihren Lebensnöten beschreibt.
Scherzer serviert dem Leser nicht das schnell aufgepeppte, überall gleiche Fast-Food-Häppchen der meisten Medien, er bereitet vielmehr ein nach traditionellen Reportagerezepten ordentlich gekochtes Gericht, er serviert Wirklichkeit in nahrhafter Form. Reportage wird in dieser Zeit sozialer Konflikte wieder zu einem wichtigen Lebensmittel.
Günter Wallraff
Köln, im Februar 1997
|11|I
|13|Feenmärchen zu verkaufen
Als ich im Geraer Ortsteil Roschütz eine alte Frau nach dem Rittergut frage, mustert sie mich ungläubig und will wissen, ob ich es auch kaufen möchte. Ich nicke, und mütterlich rät sie, mich möglichst nicht bei den Bewohnern blicken zu lassen. Die würden am liebsten ihre Wohnungen verbarrikadieren, denn sie wüssten ja nicht, was der neue Gutsbesitzer dann daraus machen würde. »Vielleicht Pferdeställe.«
Nach dieser Warnung weist sie mir den Weg durch Wiesen und Äcker zum Rittergut. Es thront auf einer Anhöhe weit draußen am nördlichen Ortsrand von Gera. Der Dezemberwind bläst kalt, und ich laufe mich im Geviert von Gutshaus, Wirtschafts- und Wohngebäude und Stallungen warm. Eine Frau Eckstein, die mir im Auftrag der Liegenschaftsgesellschaft der Treuhand die Gebäude zeigen und anpreisen soll, ist auch eine Viertelstunde nach dem vereinbarten Termin noch nicht zu sehen.
Wütend klinke ich an den Türen des herrschaftlichen, mit vielen Erkern und Fachwerk geschmückten dreistöckigen Gutshauses. Die sind verschlossen. Ich versuche durch die Fenster ins Innere zu lugen, aber die sind blind oder mit rindigen Abfallbrettern vernagelt … Dabei schien mir der Schlosskauf bis zu diesem Moment sehr einfach.
Ich hatte mir in dem »Schlösser für die Zukunft. Fairytales for sale«-Hochglanzkatalog, mittels dessen die Treuhand-Liegenschaftsgesellschaft für den Richtpreis zwischen 1 DM und 3.800.000 DM 20 Burgen, Schlösser |14|und Herrenhäuser, gelegen auf dem Gebiet der alten DDR, in aller Welt anbietet, ein kleines und ein großes Anwesen ausgesucht: das Rittergut bei Gera für 2.100.000 DM und das Marienthaler Schlösschen bei Schweina (Wartburgkreis) für 430.000 DM. Rief bei den zuständigen Treuhand-Büros in Gera und Suhl an, erhielt von dort je ein dickes grünes undurchsichtiges Kuvert, in dem ich bis zum 14. Dezember 1994 um 14 Uhr einen Erwerbsantrag mit Angaben zur Schlossnutzung, zu den geplanten Investitionen, den gesicherten Arbeitsplätzen, dem Kaufangebot, meinen Referenzen, Bankverbindungen und dem Nachweis meiner Bonität abzugeben hatte. Zuvor nannte man mir einen Besichtigungstermin. Und zu diesem Termin stehe ich nun frierend vor den verschlossenen Türen des Rittergutes.
Bis 1893 war es als Herrschaftssitz in adligen Händen geblieben. Anschließend Sommerresidenz Geraer Großindustrieller. Nach deren Weltwirtschaftskrisen-Bankrott musste es 1930 schon einmal in Treuhandverwaltung. Und die ließ es zu einem Reichsarbeitsdienstlager für Mädchen umfunktionieren. Nach dem Krieg Lazarett der Roten Armee. Später Internat für die Ausbildung von Thüringer Volksrichtern, schließlich bis zur Wende Schulungsstätte für Pionierleiter und nach dem Systembankrott wieder im Besitz der Treuhand. Deutsche, für mich vorerst noch verschlossene Zeitgeschichte …
Eine Tür des flachen, lehmbraun verputzten und trotzdem ungeniert seine roten Ziegel zeigenden Wirtschafts- und Wohngebäudes öffnet sich. Drinnen wischt eine junge Frau das Treppenhaus. Nein, sagt sie, die Eckstein hätte sie heute noch nicht gesehen. Sie schaut mich |15|eher neugierig als feindselig an, erzählt, dass es hier inzwischen wie im Taubenschlag zugehen würde. Gleich nach der Wende wären Frauen aus der BRD gekommen. »Die standen im Hof und erinnerten sich andächtig der Zeit im Reichsarbeitsdienstlager.« Die ehemals verwundeten russischen Soldaten wären noch nicht wieder erschienen. »Haben jetzt wohl andere Sorgen.« Dann aber die feinen Herren Schlosskäufer aus dem Westen. »Die den Mund nicht aufkriegen, naserümpfend hier umherstolzieren und genauso wortlos wieder verschwinden. Aber noch schlimmer sind die neuen Möchtegernreichen aus dem Osten, die im alten Mercedes vorfahren. Die latschen, ohne sich die Schuhe abzutreten, in unseren Wohnungen herum, taxieren den Grundriss des Kinderzimmers und sagen grinsend: ›Das gibt ’ne schöne Bar oder so was Ähnliches.‹«
Sie schüttet das Spülwasser neben der Tür aus. Vier Familien, eine mit vier Kindern und einem Hund, würden noch in dem alten Wirtschaftsgebäude wohnen. Alle hätten bis 1990 in der Pionierleiterschule, also dem früheren herrschaftlichen Gutshaus, gearbeitet. »Die Frauen in der Küche oder im Sekretariat, die Männer als Heizer oder Hausmeister.«
Von Frau Eckstein noch immer keine Spur. Dafür gesellen sich der ehemalige Heizer und der Hausmeister zu uns. Der Heizer ist unrasiert. Seine Augen weichen aus, wenn man ihn anschaut. Seit reichlich drei Jahren würde er die Pionierleiterschule nicht mehr beheizen. »Niemand heizt dort. Im Winter sind die Wasserleitungen aufgefroren. Drei Winter ohne Heizung haben drinnen mehr kaputtgemacht als 40 Jahre DDR.« Und er rechnet |16|mir vor, wie wenig die Kohlen und seine Arbeitsstunden die Treuhand gekostet hätten: »Nicht mal einen Bruchteil von der Summe, die man nun braucht, um die Nässe wieder rauszukriegen … Aber es ist ja nicht ihrs.« Und der Hausmeister erzählt, dass er seine Wohnung, die ja auch nicht seine wäre, im letzten Jahr vom eigenen Geld renoviert, das Bad gefliest hätte. »Doch wenn jetzt einer kommt, der den Krempel kauft und uns rausschmeißt, werde ich zuvor alles eigenhändig wieder abhacken.«
Ich frage, weshalb die vier Familien das Wirtschaftshaus, das 400.000 DM kosten soll, nicht zusammen kaufen.
Die Frau, sie heißt Liebherr, lächelt böse. »Wir waren deswegen schon bei der Bank, aber in zwei der Familien hat niemand mehr Arbeit. In solch einem Fall verborgt die Bank keinen Pfennig.«
Frau Eckstein erscheint an diesem Tag nicht mehr. Die Türen vom Roschützer Rittergutshaus bleiben mir verschlossen.
Bevor ich zum Marienthaler Schlösschen fahre, erkundige ich mich in der Suhler Außenstelle nach den Besichtigungsmöglichkeiten.
Die dortige Treuhand residiert in der dickmäurigen, einer runden Trutzburg nicht unähnlichen ehemaligen Stasi-Zentrale Südthüringens. Hier drin war ich noch nie, weder vorher noch hinterher.
Ein grell bemaltes Fitnesscenter wirbt mittlerweile für Sauna, Schönheit, Kraft und Entspannung. Zwischen vielen Büros finde ich in einem langen Gang die Liegenschaftsgesellschaft. Und Frau Brandt – früher Arbeitsökonomin, dann arbeitslos, Umschulung und nun verantwortlich |17|für den Verkauf von Betriebsferienlagern, Bungalows und Schlössern – versichert mir, dass ich mich wegen der Schlossbesichtigung jederzeit beim Pförtner des nebenan stehenden Kugel- und Rollenwerkes Schweina melden könnte.
Der Betrieb, der sich mit seinen großen alten Hallen kilometerweit in der Flussaue ausbreitet, ist nicht zu verfehlen, doch das Schlösschen finde ich nicht. Und Ortsansässige, die ich nach dem Marienthaler Schlösschen frage, kratzen sich den Kopf: »Ein Schlösschen? Ham wir hier nicht.« Bis mir einer sagt: »Das ist unser Betriebskulturhaus, unten Küche und Kantine drin, das heißt, seit zwei Jahren ist die Küche dicht.«
Das Schlösschen, ein zweigeschossiger, streng symmetrischer klassizistischer Bau, sieht ein bisschen nach Kantine aus. Schmuddelig. An der Hinterseite hat man eine dicke Heizschlange wie eine Infusionsleitung in das Gemäuer gesteckt. Darunter eine hässliche Rampe, wohl zum Verladen von Rotkohl und Kartoffeln … Der Park (24.000 Quadratmeter!) ist verwildert, mittendrin ein Schießstand und Teiche, zu Tümpeln verwunschen. Der Pförtner des Betriebes hat die Schlüssel zum Schloss. Er telefoniert mit Herrn Zimmermann, der mir aufschließen soll. Das dauert. Und der Pförtner erzählt mir inzwischen vom vielleicht letzten Stündlein des 1879 gegründeten Großbetriebes. Seit einem Jahr laufe die Liquidation, wenn in den nächsten zwei, drei Monaten kein Käufer gefunden würde, sei endgültig Schluss.
Herr Zimmermann, Mittelalter und schlank, im Betrieb für Ver- und Entsorgung verantwortlich, ist freundlich, |18|aber sehr in Eile. Er probiert lange mit den Schlüsseln des dicken Bundes. Die Außentür knarrt. Drinnen ist es warm.
»Sie heizen noch?«
»Ja, ist zwar nicht mehr unser Kulturhaus, aber es war ja so lange unser.«
Im Speisesaal stehen über 200 Stühle. Die Essenausgabe. Tafeln mit Speiseplan und Essenvorauswahl an der Wand. Ein Vorwende-Zettel: »Ung. Gulasch mit Gemüse und Kartoffeln: 1,20 Mark. Linsensuppe: 0,60 Mark.«
Die Küchenkessel sind demontiert. Eine schöne Wendeltreppe führt hinauf in das Obergeschoss. Kultursaal. Betriebsbibliothek. Hier stehen noch Honecker neben Heym und Kant neben Kafka. Die Betriebsschneiderstube. Und dann ein Extraschlüssel für das Fröbelzimmer. 1851 war der weltbekannte Pädagoge Friedrich Fröbel, der Vater des Kindergartens, in das 1833 errichtete Marienthaler Schlösschen eingezogen und gründete im Auftrag des Meininger Herzogs das erste Seminar für Kindergärtnerinnen in Deutschland. Hier starb er im Juni 1852, kurz nachdem die Kindergärten in Preußen verboten worden waren. An sein Grab in Schweina pilgern jährlich Hunderte Japaner, denn Fröbels Pädagogik ist ein Bestandteil des heutigen japanischen Erziehungssystems.
Wieder vor der Tür, fragt Herr Zimmermann, ob ich den Park besichtigen möchte.
»Nein, den kenne ich. Die Teiche müsste man aufräumen.«
Er schüttelt den Kopf. »Mit Aufräumen allein ist da |19|nichts getan, seit Jahren fließen die Abwässer des Betriebes dort hinein. Die Schlösser und Betriebe, die die Treuhand heutzutage immer noch wie Sauerbier anbietet, muss, das sind eben wirklich die Letzten.«
Zimmermann entschuldigt sich, er muss dringend in den Betrieb. In einer halben Stunde könnten wir dann weiter über Fröbel und das Schlösschen reden.
Ein fülliger Mann an der Pförtnerbude, der gehört hat, dass ich das Schlösschen kaufen will, zeigt mir grinsend seinen fliegenklatschenbreiten Daumen. Ja, er sei der sogenannte »breitgekloppte Karl«. Die alte Presse …! Und er müsse mir mal sagen, dass es die Leute hier einen feuchten Kehricht interessiert, ob dem Fröbel sein Zimmer erhalten bleibt und das Schloss gekauft wird.
»Von den 1.000 Leuten im Betrieb haben noch knapp 200 Arbeit und die wohl bald auch nicht mehr. Das interessiert die Leute, nicht der tote Fröbel und das Schloss!«
Die Treuhand hatte das Kugel- und Rollenwerk 1991 an den bayerischen Unternehmer Truckenmüller verkauft. Ein guter Geschäftsmann, wie sie versicherte. Sein bestes Geschäft: Er ließ den ölbelasteten Boden im Betrieb mit Hilfe von Treuhandgeldern abtragen. Brachte ihn für 100.000 DM auf eine Thüringer Müllkippe, berechnete aber über 3 Millionen DM Entsorgungskosten nach bayerischen Spezialdeponiepreisen. Da musste er vor Gericht und die Treuhand den Betrieb zurücknehmen. Zwei Tage vor Weihnachten 93 bestellte sie Betriebsratsvorsitzende, Geschäftsführer und Betriebsleiterin nach Berlin. Die hofften auf einen neuen Käufer, stattdessen verkündete die Treuhand die sofortige Liquidation. Die drei vom Betrieb schafften es, vor dem Fest das |20|»Geheimnis« für sich zu behalten, erst im neuen Jahr verkündeten sie es. Seitdem gibt es zwar volle Auftragsbücher, aber der Betrieb müsste der Rentabilität wegen räumlich verkleinert werden. Allein die Heizkosten fressen fast 20 Prozent vom Umsatz.
Zimmermann ist zurück, erzählt mir von den anderen Interessenten fürs Schlösschen. Großprotze seien dabei gewesen, wohl auch Geschäftemacher, aber auch solche Leute wie das Ehepaar Lewandowski aus dem Niedersächsischen. Das wollte keinen Profit um jeden Preis, sondern das Schlösschen in ein Spielzeugmuseum umwandeln. »Und schlecht erhalten ist das Gebäude nicht. Unsere Betriebshandwerker, wir hatten mal 20 – Neues gab’s selten in der DDR, deshalb mussten wir Altes immer wieder reparieren –, also die 20 haben viel gemacht in unserem Schlösschen.«
Werner Raßbach ist als Letzter von den 20 übriggeblieben. Ein »Vierundfünfziger«, wie er mir erklärt. »Sonderreglung. Wir werden im Mai entlassen, sozusagen als Vor-Vorruheständler.« Auf Arbeit hoffe er dann nicht mehr, hier, wo 20 Kilometer entfernt 1.000 Kalikumpels in Merkers ohne Job wären. Aber er wolle nicht klagen, ökonomisch gehe es ihm nicht schlecht, besser als zu DDR-Zeiten … Und was das Schlösschen beträfe, sie hätten dort regelmäßig gemalert, die Heizung neu verlegt. »Wissen Sie, wir besaßen als Betrieb aber nicht nur das Kulturhaus. An der Ostsee haben wir ein Betriebsferienheim gebaut. Hier in der Nähe am Krätzersrasen wunderschöne Bungalows für die Kinder. Und dafür verzichteten wir manchmal sogar auf die private Jahresendprämie – war nicht so wenig zu alten Zeiten – |21|und haben das Geld für die Kinderferienhäuschen auf dem Krätzersrasen verwendet. Haben also unser Privates gegeben, um für alle was zu schaffen. Und das ist doch nun die ganz große Scheiße: Wir haben mit unserer Arbeit in 40 Jahren immer nur sogenanntes Volkseigentum vermehrt, nie Privateigentum. Und nun, wo dieses Volkseigentum verscherbelt wird, können wir, die es erarbeitet haben, nicht mitbieten, weil wir kein nennenswertes Privateigentum besitzen.«
Bevor er sich verabschiedet, empfiehlt er mir, nicht das Schlösschen, sondern einen dieser wunderschönen Bungalows auf dem Krätzersrasen zu kaufen. »Weil mir das Herz weh tut, wenn ich sehe, wie die Häuschen, die ich auch von meinem Geld mitgebaut habe, nun vergammeln.«
Ich rufe an, erkundige mich nach den Bungalows. Ja, im Prinzip könnte ich sie kaufen, aber sie wären mit einer hohen Grundschuld belastet. Die habe der Herr Unternehmer Truckenmüller für seinen Kredit von einer guten halben Million DM von der Bank als Bürgschaft auf die Ferienhäuschen eintragen lassen …
Fünf Tage vor Weihnachten werden die grünen undurchsichtigen Bieterbriefe in der Treuhand geöffnet. 10 seriöse Angebote für das Schlösschen. In die engere Wahl kommen eine Firma aus Japan, die im Schlösschen eine Schule für japanische Manager einrichten will, die Bundeswehr, die Wohnungen ausbauen möchte, und die Spielzeugmuseumsleute.
Für das Geraer Rittergut ist unter anderem ein Hotel im Gespräch.
Fünf Tage nach Weihnachten rufe ich die Betriebsleiterin |22|in der Kugel- und Rollenfabrik an. Nein, die Entscheidung, ob Schließen oder Weiterarbeiten, sei noch nicht gefallen. Bislang gebe es keinen Käufer für den Betrieb. Doch die Uhr sei bald abgelaufen.
»Fairy-tales for sale. Feenmärchen zu verkaufen.«
|23|Die Meile der Eitelkeiten
Von der Kreuzung Unter den Linden bis zum Checkpoint Charlie treffe ich auf der Berliner Friedrichstraße, der »künftigen Flaniermeile Europas«, zwischen Bauzäunen, Baggern, bunten Visionsgemälden künftiger Großbauten des Kapitals und dem fast fertigen Lafayette-Glaspalast, der in Größe, Form und mit seinen leuchtenden Bulleyes an die Titanic erinnert, um 21 Uhr genau 32 Fußgänger.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!