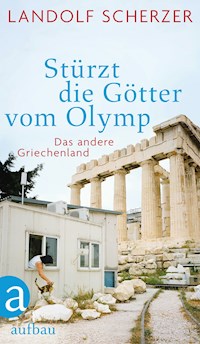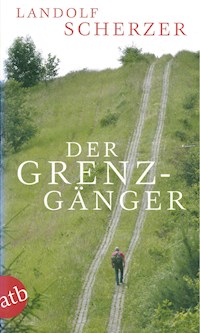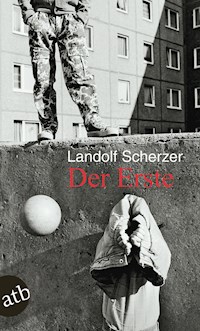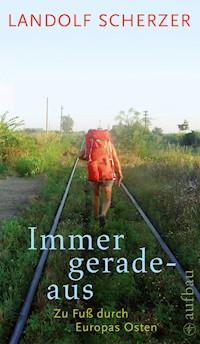9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Fremdsein in Deutschland.
Auch in der DDR gab es Gastarbeiter: Vietnamesen oder Afrikaner. Landolf Scherzer befragte damals Arbeiter, Parteisekretäre, Nachbarn und Freundinnen zu ihren ausländischen Mitbürgern, aber seine Aufzeichnungen durften nicht erscheinen. Nun, zwanzig Jahre später, als das Gespenst der Fremdenfeindlichkeit in Deutschland umgeht, nimmt er ihre Spuren auf. Entstanden ist ein eindrucksvoller Bericht, der direkt in die brisanten Debatten über Fremdenhaß und Asylsuchende eingreift.
„Seit der Wiedervereinigung zeigt sich, daß sich einiges an unseligen deutschen Untugenden paart und damit potenziert.“ Günter Wallraff.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 322
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über Landolf Scherzer
Landolf Scherzer, 1941 in Dresden geboren, lebt als freier Schriftsteller in Thüringen. Er wurde durch Reportagen wie »Der Erste«, »Der Zweite« und »Der Letzte« bekannt.
Im Aufbau Taschenbuch sind ebenfalls seine Bücher »Der Grenzgänger«, »Immer geradeaus. Zu Fuß durch Europas Osten«, »Urlaub für rote Engel. Reportagen«, »Fänger & Gefangene. 2386 Stunden vor Labrador und anderswo«, »Madame Zhou und der Fahrradfriseur. Auf den Spuren des chinesischen Wunders«, »Stürzt die Götter vom Olymp. Das andere Griechenland«, »Der Rote. Macht und Ohnmacht des Regierens« und »Buenos días, Kuba. Reise durch ein Land im Umbruch« lieferbar.
Günter Wallraff, 1942 in Burscheid bei Köln geboren, wurde auch international bekannt durch provozierende Reportagen wie »Ihr da oben – wir da unten« (1973, zus. mit Bernt Engelmann), »Der Aufmacher. Der Mann, der bei ›Bild‹ Hans Esser war« (1977), »Ganz unten« (1985), in denen er oft durch verdeckte Recherchen soziale Mißstände offenlegte.
Informationen zum Buch
Fremdsein in Deutschland
Auch in der DDR gab es Gastarbeiter: Vietnamesen oder Afrikaner. Landolf Scherzer befragte damals Arbeiter, Parteisekretäre, Nachbarn und Freundinnen zu ihren ausländischen Mitbürgern, aber seine Aufzeichnungen durften nicht erscheinen.
Nun, zwanzig Jahre später, als das Gespenst der Fremdenfeindlichkeit in Deutschland umgeht, nimmt er ihre Spuren auf. Entstanden ist ein eindrucksvoller Bericht, der direkt in die brisanten Debatten über Fremdenhaß und Asylsuchende eingreift.
»Seit der Wiedervereinigung zeigt sich, daß sich einiges an unseligen deutschen Untugenden paart und damit potenziert.« Günter Wallraff
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Landolf Scherzer
Die Fremden
Unerwünschte Begegnungen und verbotene Protokolle
Mit einem Nachwort von Günter Wallraff
Inhaltsübersicht
Über Landolf Scherzer
Informationen zum Buch
Newsletter
Teil I
Die Fremden
Gesprächsprotokoll von 1982, Nr. 1: »Die werden nich’ rot, wenn sie schwindeln.«
»Die Unterhosen auf Kante, im Sommer die kurzen vorn …«
Gesprächsprotokoll von 1982, Nr. 3: »Auch Kartoffeln ißt er oder Thüringer Klöße.«
»Chef, die Mutti gibt uns nichts!«
Gesprächsprotokoll von 1982, Nr. 5: »Unsere Leute haben auch die Moçambiquaner versaut.«
Gesprächsprotokoll von 1982, Nr. 6: »Alles meine Kinder!« Pustekuchen. Nichts ist!
Gesprächsprotokoll von 1982, Nr. 7: »Manche sagen, die hätten ’nen besonders Großen.«
Gesprächsprotokoll von 1982, Nr. 8: »Sie haben Respekt vor dem weißen Kittel, aber nicht vor der Frau im Kittel.«
Gesprächsprotokoll von 1982, Nr. 9: »Alle sind Schwarze, und deshalb trifft’s alle.«
Teil II
Urkunden für Morde oder: »Wir Russen brauchen keine neuen Synagogen«
Sag Sascha, nicht Alexander! oder: »Die Eltern haben drei Kinderärzte totgeschlagen«
10000-Dollar-Reise ohne Ankunft oder: »Ich hab’ mich geschämt wie’ n Bettsecher!«
Die Nacht auf Kohlen oder: »Nur mit zwei Gesichtern kann man überleben«
Der Tag der Pförtner oder: »Hier ware wir de Faschiste und blejbe de Faschiste«
Die Erben der Öfen oder: »Das ist der Bengel von dem Kriegsverbrecher!«
Der blonde Thüringer oder: »Die Südtiroler in Italien sind stolz auf ihr Deutschtum!«
Ein Gebirge wird verkauft oder: »Das Lied können Sie heute getrost wieder anstimmen«
Unterschrift für Bockwurstbuden oder: »Es dauert sehr lange, bis auch das Innere verbrennt …«
Günter Wallraff, Die Intoleranz des anderen zu dulden ist nichts anderes als Feigheit
Textnachweise
Anmerkungen
Impressum
I
Die Fremden
Nötige Vorbemerkung
Einige der Moçambiquaner und Bundesbürger, mit denen ich im Frühjahr 2002 sprach, baten mich, aus Angst vor Angriffen durch Rechte, ihre Namen zu anonymisieren. Auch ehemalige DDR-Bürger bzw. deren Angehörige waren nicht mehr bereit, das, was sie mir 1982 freimütig gesagt hatten, heute unter ihrem Namen veröffentlichen zu lassen. Ich habe deshalb in diesem Buch einige Namen verändern müssen. Sie sind mit * gekennzeichnet.
Einen sinnloseren Zaun habe ich nirgendwo gesehen. Er begrenzt das Nichts.
Das verrostete Maschengeflecht an verwitterten Betonpfosten, die so aussehen, als ob nicht sie den Draht, sondern der Draht die Pfeiler hielte, umzäunt eine von niedrigen winterbraunen Unkräutern bedeckte ebene Fläche. Mitten in diesem vielleicht viermal fußballplatzgroßen weiten Feld steht eine einsame Blaufichte.
»Betreten verboten! Eltern haften für ihre Kinder!«
Kein Durchschlupf im Zaun, auch nicht dort, wo immer noch asphaltierte Wege von ringsum neu erbauten großfenstrigen Villen und kleinäugigen alten Fachwerkhäusern in das Nichts hineinführen.
Früher standen auf dieser leeren Fläche zwei in Großblockbauweise errichtete Wohnheime für rund zweihundert Moçambiquaner und andere in der DDR beschäftigte Vertragsarbeiter. An die Blaufichte hatten die Afrikaner eine Wäscheleine gebunden, auf die sie ihre meist grellbunt karierten Hemden und die weißen Hosen zum Trocknen hängten. Damals begrenzte kein Zaun das Gelände. Zumindest kein sichtbarer …
Ich war nie an dieser freien Fläche stehengeblieben. Wozu auch? Nicht einmal Brennesseln für die Frühjahrssuppe oder Beifuß für den Winterbraten, Pflanzen, die sich sonst auf jedem Platz mit Resten von Bauschutt unweigerlich breitmachen, wachsen dort, denn es liegt kein Trümmerstein, kein einziges Überbleibsel der Wohnheime herum. Und wahrscheinlich wäre ich dort ein Leben lang gedankenlos vorbeigegangen, wenn nicht im Februar, als der hohe Schnee des Jahres 2002 geschmolzen war, ein frierender Afrikaner, nur in einem dünnen grauen Jackett (ich dachte, sie wissen immer noch nicht, wie man sich hier im Winter anzieht), vor dem Nichts gestanden und vergeblich nach einem Loch im Zaun gesucht hätte. Er sah vornehm aus, trug einen breiten schwarzen Schlips zum weißen Hemd.
Ich kramte in meinen Portugiesischkenntnissen und sagte die in Moçambique gebräuchliche Begrüßungsformel: »Bom dia, como está – Guten Tag, wie geht es dir?«
Er sah mich erschrocken an, lächelte unsicher und begann sich, wie ein erwischter Kaufhausdieb, in schnellem, gebrochenem Deutsch gestenreich zu verteidigen. Er sei Caetano Nantimbo, vierzig Jahre alt, wohne in der nördlichen moçambiquanischen Provinz Tete und sei 1980 mit dem ersten Transport (er sagte wörtlich »mit dem ersten Transport«) hierher nach Suhl gekommen. Danach hat er fünf Jahre lang im Fahrzeug- und Jagdwaffenwerk Mopeds gebaut. »So wie ein DDR-Mensch. Wenn ich fünfzig Jahre alt werde – durchschnittlich leben moçambiquanische Männer siebenundvierzig Jahre –, habe ich ein Zehntel meines Lebens in der DDR gearbeitet.« Und er nannte mir noch einmal, wie bei einer Legitimationskontrolle, seinen Namen: Caetano Nantimbo. Ich könne in der Kartei der Betriebsangehörigen nachsehen. »Die Akten wird es doch noch geben?« Er schaute mich fragend an.
Das Heim, in dem er gewohnt, die Fabrikhalle, in der er am Montageband gestanden hat, alles ist abgerissen. »Die Kneipe, wo wir Bier getrunken, steht noch. Aber Fensteraugen alle blind.« Caetano Nantimbo ist auf dem Weg vom Frankfurter Flughafen nach Stuttgart, wo er als Provinzvertreter des moçambiquanischen Erziehungsministeriums an einer internationalen Konferenz teilnehmen wird. Er hat einen Umweg gemacht und ist mit der Eisenbahn nach Suhl gefahren. »Ich wollte mein klein Leben noch einmal sehen.« Außerdem – verlegen zieht er eine Plastetüte aus der Hosentasche – möchte er Steine und Erde von hier mit nach Hause nehmen. »Für das Grab von Fabian.« Fabian war der moçambiquanische chefe in Suhl. Kaum älter als die achtzehnjährigen Arbeiter, aber Funktionär der OJM, der moçambiquanischen Jugendorganisation, und Mitglied der FRELIMO, der sozialistischen Regierungspartei.
»Als er aus der DDR zurückkam, haben ihn die Konterrevolutionäre, die bandidos, erschlagen.« In einem kleinen Dorf im nördlichen Cabo Delgado hätten ihm seine Freunde ein »großes Totenhaus aus Steinen« gebaut. Und dort möchte er für ihn Erde »von seiner Wohnung in Deutschland« hinbringen.
Am einzigen farbigen Punkt des langen Zaunes, einem gelb-rot-grünen Werbeplakat für Pizzen, finden wir endlich einen Durchschlupf und laufen über das weite Feld.
»Hier stand unser Heim, hier war der Eingang! … Warum? Warum alles weg? Es waren schöne große, neue Häuser. Wir wären glücklich, hätten wir in Moçambique solche Häuser.«
»Ich weiß«, sage ich. »Ich habe zu der Zeit, als Sie hier in Suhl arbeiteten, ein Jahr lang in Matundo am Sambesi mit Moçambiquanern kleine Häuser gebaut. Häuser aus blocos, aus per Hand mit kleinen Pressen gefertigten Hohlblocksteinen.«
Mit diesem Satz, sehr leise und sehr langsam inmitten der umzäunten leeren Fläche gesprochen, verwandelt sich das Nichts.
Zuerst kommen die Gerüche zurück. Auch wenn man die Wohnheime noch nicht sah, roch man in ihrer Nähe zu jeder Tages- und Nachtzeit die Düfte des moçambiquanischen »Nationalgerichtes«: mit Unmengen von Knoblauchzehen gespickte, goldbraun gebratene Broiler.
Danach die Geräusche. Stundenlang beobachteten die Moçambiquaner – wie alte Leute, die nicht mehr auf die Straße gehen können – von ihren Fenstern aus, wer unten ein und aus ging. Und sobald sie jemanden erkannten, und sie kannten sich fast alle, gab es ein minutenlanges Palaver, einer redete lauter als der andere. Falls sie nicht aus den Fenstern lehnten, standen dort Kassettenrecorder und beschallten die Gegend mit afrikanischer Musik. Manchmal trommelten die Moçambiquaner auch in der Nacht …
Und schließlich meine Gespräche: Ich schrieb, 1982 und 1983 aus Moçambique zurückgekommen, meine afrikanischen Erlebnisse auf und befragte DDR-Bürger – Mädchen, die mit den »Negern gingen«, eine Wirtin, SED-Sekretäre, Nachbarn des Wohnheimes –, was sie über die afrikanischen Gastarbeiter dachten. Ich hatte das Leben der Moçambiquaner in ihrer Heimat erkundet und wollte nun noch wissen, wie sie hier lebten, wie sie in der »neuen Heimat« behandelt wurden, was die Hiesigen über sie dachten. Zwei Seiten eines Themas …
Mit Karin*, einer zierlichen, hübschen Dreiundzwanzigjährigen, saß ich während des Gesprächs vor dem Heim unter der Blaufichte. Sie war zwar mit dem Moçambiquaner Lino verlobt, aber in das Heim mußte sie nachts heimlich durch das Küchenfenster klettern, damit es die deutschen Pförtner nicht merkten. Mit Genossen Seiler*, dem »Kaderchef« des Betriebes, der mir, während das Tonband lief, stolz verkündete, daß von den 15000 Moçambiquanern, die in der DDR arbeiteten, auch 180 in Suhl ihre zweite Heimat, eine Heimat der Solidarität und Freundschaft, gefunden hätten (als das Tonband aus war, drohte er, daß er seine Tochter rausschmeißen würde, käme sie mit solch einem Schwarzen an), unterhielt ich mich in seinem großen Arbeitszimmer. Mit der Wirtin der »Gaststube Krells Brauerei«, die immer einen Tisch für die Moçambiquaner reserviert hatte, damit sie nicht von den Einheimischen angepöbelt wurden, traf ich mich in der Gaststätte. Mit dem Meister der Mopedmontage, der mir plausibel zu machen suchte, daß die jungen Moçambiquaner im Betrieb nicht, wie ihnen zu Hause versprochen war, alle zu Facharbeitern ausgebildet würden, sondern fünf Jahre lang am Band die Staatsschulden Moçambiques abarbeiteten, redete ich im verdreckten Frühstücksraum. Und beim Gespräch mit dem in der Nachbarschaft des Wohnheimes lebenden Kraftfahrer Klaus Meurer*, der mir sagte, daß es besser wäre, die Schwarzen außerhalb des Wohngebietes zu kasernieren, saß ich 1982 in seinem sommerheißen Garten …
Mein Buch über das Leben der Moçambiquaner in Moçambique erschien ohne die Gesprächsprotokolle mit den DDR-Bürgern. Das zuständige Ministerium erteilte die Druckgenehmigung nur unter der Bedingung, daß die »nicht zum Thema gehörenden Protokolle herausgenommen werden«. Daß sie sehr wohl zum Thema gehörten, wurde mir erneut nach der Wende bewußt …
Als Caetano Nantimbo die Plastetüte mit Erde und Betonstückchen (»vielleicht vom Wohnheim«) gefüllt hatte, fragte er: »Wohnen noch Moçambiquaner aus der DDR-Zeit hier?«
»Ich weiß es nicht«, sagte ich. »Wahrscheinlich wurden 1990 alle zurückgeschickt.«
Er fotografierte den Zaun, der das Nichts begrenzt.
»Zu Hause«, sagte er, »habe ich noch Farbaufnahmen vom Wohnheim.«
Eine Woche nach meiner Begegnung am Zaun erkundige ich mich in Suhl-Heinrichs, dort wo die Wohnheime standen, nach den Moçambiquanern, nach der Wirtin, nach dem Meister in der Mopedmontage, nach dem Kaderdirektor … Die Wirtin hat die Kneipe schon ein Jahr nach dem Gespräch aufgegeben, der Kaderdirektor ist inzwischen gestorben, der Meister auch … Ob noch ehemalige moçambiquanische Vertragsarbeiter in Suhl leben, weiß keiner.
Das Haus neben dem Wohnheim, in dem ich mit dem Kraftfahrer Klaus Meurer im Garten saß, steht noch. Es ist in die Jahre gekommen. Viele Schiefer fehlen schon an seinen Wänden. Das Holz darunter ist nackt und schutzlos wie die schuppenlosen Hautstellen eines am Strande liegenden toten Fisches. Die Fensterrahmen sind brüchig wie Pfefferkuchen. Aber im obersten, dem ersten Stockwerk, hängen noch Gardinen. Und am Klingelknopf der Haustür steht: »Klaus Meurer«. Ich läute. Nichts. Beim zweitenmal wird oben ein Fenster geöffnet. Ein alter Mann mustert mich mißtrauisch. Als ich ihm sage, daß wir vor zwanzig Jahren in seinem Garten miteinander gesprochen haben, erinnert er sich. Lacht. Beim Lachen zeigt er immer wieder seinen Goldzahn. Das ist die einzige Vertrautheit. Mich hereinlassen und mit mir sprechen möchte er nicht. Sagt nur von oben aus seinem Fenster, es sei gut, daß der Betrieb, die Stadt, die Treuhand oder wer zum Teufel sonst der Eigentümer gewesen sei, die Wohnheime, die zehn Jahre unbewohnt und nur durch den Zaun vor Vandalismus geschützt waren, endlich dem Erdboden gleichgemacht habe. »Sonst hätten sie uns vielleicht noch Asylanten reingesetzt. Hier mitten ins Wohngebiet! Sie waren ja noch in Ordnung, die Wohnheime.«
Bevor er das Fenster schließt, bedauert er, daß die Moçambiquaner 1990 ausgezogen sind. »Danach war es plötzlich still hier. Niemand redete mehr mit mir, wenn ich im Garten saß. Niemand.«
Ob heute noch Moçambiquaner in Suhl leben, weiß auch er nicht.
»Die werden nich’ rot, wenn sie schwindeln.«
Gesprächsprotokoll von 1982, Nr. 1
Klaus Meurer, damals 46 Jahre alt, von Beruf Bau- und Kunstschlosser. Damit konnte man, wie er sagte, in der DDR kein Geld verdienen. Vier Jahre Armee. Anschließend Arbeit in derStanzerei des VEB Fahrzeug- und Jagdwaffenwerk Suhl (Fajas). Allerdings nur einen Monat. Danach achtzehn Jahre als Fahrer und Austräger im VEB Kohlenhandel »ganz schön Kohle gemacht«. Seit 1977 Fahrer beim Altstoffhandel. Seine Frau arbeitete auch im Fajas.
»Das Heim wurde 1978 gebaut, um deutsche Lehrlinge und Facharbeiter vom Fajas internatsmäßig unterzubringen. 1980 hieß es auf einmal, die oberen Etagen müssen geräumt werden, die Lehrlinge raus, es kommen Schwarze. Es kommen Schwarze! Gut. Zuerst waren wir der Meinung, die werden ähnlich sein wie die Vietnamesen, gesittet und ein bißchen zurückhaltend. Die werden eingeschüchtert sein, dachten wir, sie haben so was noch nie gesehen, Deutschland, dieses Angebot an Konsum und so. Sie haben ja nichts zu Hause. Die landläufige Meinung war: die Buschmenschen kommen. Vorher waren zwar schon Algerier als Arbeiter hier, aber der Algerier is’n anderer Mensch. Der Algerier schlägt ja nun mal mehr ins Europäische rein. Viele von den Algeriern haben in Frankreich gearbeitet.
Die ersten Tage, wie die Moçambiquaner hier waren, da haben sie probiert, von den Kindern hier unten vor dem Heim Deutsch zu lernen. Was ist das? Was ist das? – Das is’ eine Hose. Das is’ die Nase. Das is’ das Ohr. – Wie wird das gesprochen? Wie wird das geschrieben?
Und dann haben sie mit der Nachbarschaft viel Federball gespielt, das Verhältnis war sehr gut.
Ich hab selber zwei Mann gehabt, die ständig zu mir rübergekommen sind, der Kleinere, der kommt seit diesen Weihnachten nicht mehr, da hatt’ ich ihn eingeladen zu Weihnachten, angeblich hat er selbst Gäste gehabt. Das ist eben nicht wie bei uns: Wenn du sagst, du kommst, dann kommst du eben! Die machen nur, was sie gerade wollen. Der kommt nun nicht mehr. Der Paolo aber, der kommt regelmäßig. Für den hat meine Frau auch zu Weihnachten einen Pulli gestrickt. Jetzt hat er sich noch einen Pullover gewünscht, den hat er ihr allerdings bezahlt. Er schreibt uns auch sehr nette Briefe. Wenn er irgendwohin fährt, das erste, was er macht, ist, daß er ’ne Karte schreibt. Er ist ständig in der DDR unterwegs. Jetzt fährt er immer nach Erfurt zu seiner Freundin. Eine weiße Freundin, ja! Na gut, es ist keine Schönheit, aber die gucken nun mal hier nicht auf Schönheit, die wollen eben mal bumsen, ist ja klar – vier Jahre weg von zu Hause. Und er fährt zum Bumsen eben nach Erfurt, um hier mit den deutschen Betreuern keine Probleme zu haben. ›Ich möchte keine Probleme‹, sagt er immer.
Er weiß, daß einige seiner Kollegen nicht spuren, daß es deswegen Auseinandersetzungen gibt mit der Bevölkerung. So wie am Ostersamstag. Ich weiß das auch bloß vom Hörensagen. Allerdings die Schlägerei, die haben wir selbst miterlebt, das ging bald drei, vier Stunden. Und die Schwarzen, die nehmen ja nun auch keine Rücksicht auf die Volkspolizei, die sind die Polizei voll angegangen. Da flogen die Mützen von den Vopos da drüben durch die Gegend, das war ’ne wahre Pracht. Begonnen hatte die Schlägerei, weil der Junge vom Konsum mit dem Luftgewehr auf die Moçambiquaner geschossen hat. Als sie den Jungen hier beim Wickel hatten, ist der Vater dazwischen, natürlich, und die Mutter auch – und da hat’s Hiebe gegeben. Die haben ausgeteilt und die Verwandtschaft noch mit, der Junge hatte grade Jugendweihe, und da hat’s eben voll geraucht hier unten.
Aber das Palaver dann. Die machen ja ein unheimliches Palaver nachher. Du weißt ja nicht, was sie wollen, und auf einmal sprechen sie auch nicht mehr deutsch. Und dann sind sie immer unschuldig! Absolut unschuldig! Auf Teufel komm raus streiten die Schwarzen alles ab. Und das siehste eben nicht, wenn sie schwindeln, daß sie rot werden. Gut, wenn man genau hinschaut, sieht man’s auch. Ja, das Gesicht verfärbt sich, das Gesicht wird dann pechschwarz …
Wie sie hier ankamen, die Moçambiquaner, das waren noch ängstliche Menschen. Wirklich, die hatten Angst vor den Weißen. Sie waren sehr zurückhaltend. Kaum mal ›guten Tag‹ gesagt. Bis auf die Mischrassen, wo eine Weiße sich mal mit ’nem Schwarzen eingelassen hatte, die waren ja nun schon klein bißchen anders wie der Urschwarze. Die Mischlinge wußten, wie sie sich verhalten mußten. Die wußten auch, das ist ein Weißer – da geht es ruhiger zu, denen muß ich gesittet gegenübertreten. Demgegenüber die Urschwarzen, die hatten erst mal regelrecht Angst.
Wenn sie den Jungs Frauen dazugegeben hätten, moçambiquanische Frauen. Wenn sie die unmittelbar in die Nachbarschaft gebracht hätten, in die untere Etage, da wäre vieles anders geworden. Aber die sind ja wegen der Arbeit hier, da denkt keiner an die Liebe, da stecken wir Männer und Frauen getrennt in die Betriebe, wo sie eben gebraucht werden. Ökonomie ist alles, was anderes interessiert uns nicht an den Leuten. Es ist ja vorgekommen, daß sie hier die deutschen Frauen angefallen haben, die Männer verprügelt und so, deswegen mußte auch einer nach Hause, und einer sitzt zur Zeit noch … Meine Frau hat auch schon einer angefaßt, oben im Volkshaus, er wollte sie ›kussen‹. Die hat ihm paar Maulschellen gegeben, hat gesagt: ›Ich geb dir Kussen.‹ Da hat er gleich gesagt: ›Du nicht deinem Mann sagen!‹ Vor mir haben sie Angst.
Die hätten den Jungs hier einen Sportplatz schaffen müssen. Weil keiner da ist, spielen sie vor dem Haus. Voriges Jahr hatte ich achtzehn Bälle hier. Alle aus meinem Garten geholt. Sonntag vor vierzehn Tagen, wir saßen draußen im Garten, fliegt wieder ein Ball rein. Drei Blumen hinüber. Frisch gepflanzt. Ich hab den Ball genommen. Hab ihn weggeschlossen.
Dauert nicht lange, ruft einer aus dem Heim: ›Ich komm’ jetzt in dein Haus!‹ Frech. Schoß über den Platz, in Turnhosen, bis hier vor die Haustür. Als einer was von oben rief, ging er zurück, kam wieder und hatte lange Hosen an. Na, und er wollte es absolut nicht begreifen, daß ich den Ball eingeschlossen habe.
›Du kannst ihn wiederbekommen‹, sage ich.
›Nu, sofort!‹
›Nein, in zwei Jahren, wenn du nach Hause fährst, kommste rüber, kannst ihn mit nach Hause nehmen, nach Moçambique. Eher kriegste ihn nicht wieder!‹
Hin und her, warum, weshalb. Nu, und da hab ich ihm plausibel gemacht: Also, wer keine Pflanzen, keine Blumen und nichts liebt – der liebt auch keine Menschen und so. Da war er erst mal geschockt. Er grüßt jetzt freundlich.
Gestern saß er im Volkshaus am Nachbartisch. Er saß da und aß, hatte seine Zigaretten auf dem Tisch liegen, ein anderer Kollege kam – ich beobachte das ein bißchen –, wollte ’ne Zigarette von ihm nehmen. Da hat er sie weggenommen, eingesteckt und hat ihm gesagt, er soll an die Theke gehen und sich welche kaufen. Also da steckt auch wieder ein guter Kern in ihm: deutsche Sparsamkeit. Und er wird vielleicht verdorben von irgendwelchen Rabauken.
Was können sie schon machen in ihrer Freizeit? Sie können sich bei uns alles angucken, was sie wollen. Diese Möglichkeiten haben die ja nun mehr als unsereins. Wenn unsereiner ins sozialistische Ausland fährt, kann er nicht überall hingehen, wo er hin möchte. Wenn du in die SU fährst, siehste eben Leningrad, und dann ist Feierabend, da machste eben eine Woche Urlaub in Leningrad. Aber die Moçambiquaner hier, die können ja, wohin sie wollen. Sie reisen gerne. Sie gehen gerne spazieren. Einmal saßen wir beim Nachbarn gemütlich im Garten, als einer von ihnen vorbeilief. ›Na, wo kommst du denn her?‹ fragte ich.
›Ich war spazieren.‹
›Nu, wo?‹
›In Berlin.‹
›Wieso in Berlin?‹
›Bin heute morgen mit Taxe zum Bahnhof gefahren, in den Zug gestiegen, nach Berlin gefahren.‹ Um 4 Uhr losgefahren, war dort um 9, ist spazierengegangen und abends wiedergekommen.
So sind sie nun auch wieder. Als einfacher Bürger fährst du nicht einfach so nach Dresden oder Leipzig, nur um da zwei Stunden spazierenzugehen und dann wieder nach Hause zu fahren, so spontan und ohne Grund. Da tut dir erst mal das Geld leid, und dann hast du immer noch Bammel, krieg ich da auch was Vernünftiges zum Mittag zu essen? – Aber die interessiert das alles nicht.
Wenn die vom Betrieb schon die moçambiquanischen Jungs hierherholen, hätten sie das Heim in die Nähe des Betriebes bauen müssen, raus aus der Gegend, wo die Bevölkerung lebt, die ihre Ruhe haben will. Sie wußten ja, wie die Afrikaner eventuell sind, denn sie haben sich bestimmt angesehen, als sie ihre Verträge abgeschlossen haben, wie’s wirklich da unten zugeht. Und da sind ja im Betrieb auch welche, die älter sind, die vielleicht da unten im Krieg waren, im letzten Krieg, in Afrika. Die wissen, wie die Schwarzen leben, daß sie eben mit der Buschtrommel rumrennen und Rabatz machen, daß sie monotone, laute Musik machen, drei Stunden immer das gleiche, und daß sie so schnell nicht wieder rauszubringen sind, wenn sie einmal im Feiern sind.
Das hältst du manchmal nicht aus, wie gestern zum Beispiel: Der eine da oben hängt am Fenster, die Pudelmütze auf – eine brütende Hitze –, und dann spielt die Musik: ›Schön ist die Sonne von Maputo!‹ Und, also ungelogen, wir haben’s gezählt, fünfzehnmal das gleiche Lied! Wenn es zu Ende war, hat er nach hinten gegriffen, hat den Tonarm wieder rumgelegt, und da ging das wieder los. Ich hab gepfiffen, und da machte er leiser – keine Minute – wieder voll aufgeschraubt. Also da kriegste ’nen Klaps. Auf der anderen Seite des Heims, dort raus, ist’s noch schlimmer, da haben sie ’ne Kapelle, ’ne Band. Wenn se da spielen, na dann gute Nacht.
Man müßte sie wirklich separat halten. Oder in anderen Ländern ausbilden, wo die Leute auch so sind. In Bulgarien vielleicht. Aber wer weiß, ob’s da nicht auch zu Diskrepanzen käme zwischen Bulgaren und Moçambiquanern. Weil nu das bulgarische Volk – ich schätz’, die würden das nicht mitmachen. Die sind nicht so zu Gehorsam erzogen wie wir in der DDR. Drüben im Westen könnten sie das auch nicht machen.
Bei uns – mal ganz ehrlich –, bei uns getraut sich keiner, groß was gegen die Moçambiquaner zu sagen, denn wenn du heute was unternimmst gegen so einen Moçambiquaner, ja, na was bist’n dann? Ein Völkerfeind, gegen Solidarität und was nich’ alles. Schwarzer, Rassenhaß und sonstiges hieße es dann. Genau solche Typen von der Leitung würden dir dann so was antworten – aber wenn sie hier selbst wohnen müßten, würden sie in ihren eigenen vier Wänden über die Schwarzen schimpfen wie die Rohrspatzen. Viele Nachbarn haben Eingaben gemacht, die werden scheinbar immer noch bearbeitet. Es gab noch nicht einmal eine Einwohnerversammlung über diese Probleme. Darüber können wir nicht öffentlich sprechen, hat der Ausschußvorsitzende der Nationalen Front gesagt. Nicht öffentlich.
Die erste Zeit hatten wir angenommen, sie würden eventuell sehr streng gehalten. Da haben ihre Chefs sie jeden Tag hier draußen marschieren lassen. Auf, ab! Auf, ab! Auf, ab! Ein Lied. Wer nicht mitgemacht hat, raus! Den haben sie extra hergenommen. Haben sie extra gedrillt. Aber das ließ auf einmal alles nach. Der deutsche Heimleiter drüben bei den Schwarzen ist Büchsenmacher, Graveur. Den ersten Tag ist er mit ihnen spazierengegangen im Wald, vierzehn Tage später hat er vier Mann mitgenommen und hat sie seine Kohlen reintragen lassen.
Zum 1. Mai voriges Jahr mußten sie unten im Hof antreten. Da hat man ihnen all ihre Strafen, Verweise und Rügen erlassen, die sie bekommen hatten. Beispielsweise wenn sie abends zu spät ins Heim gekommen waren. Und danach? Wenn sie wieder um zwei kamen und wir noch auf waren und sie fragten: ›Nu, du kommst doch heut schon wieder zu spät!‹ – ›Ja, is’ bald wieder 1. Mai.‹ Also sind sie schon genauso wie wir.
Am Anfang waren die auch, ich möchte mal so sagen, wohnungsmäßig sehr sauber, da haben sie öfter mal die Fenster geputzt – das hat alles nachgelassen. Drüben muß es ja furchtbar aussehen in dem Bau. Türen fehlen, Fenster – haarsträubend. Ich war früher mal drin, ein sehr, sehr schönes Heim. Und wenn du dir das so überlegst, man gibt diesen Menschen, die das nicht kennen und die nicht wissen, was es für eine Mühe gemacht hat, das aufzubauen, solchen Komfort, zwei Mann ein Zimmer, mit Duschraum und allem, und unsere eigenen Lehrlinge, die hausen zu sechst in einem Zimmer. Die Moçambiquaner haben wunderschöne Liegen drin, Tisch, Schrank mit Schrankteilen. Wir hätten ihnen weniger Komfort bieten sollen. Wenn man so hört – es dringt ja nun doch durch –, daß sie am Anfang die Kartoffeln genommen haben und auf die elektrische Kochplatte draufgeschmissen und das andere Zeug auch. Woher sollten sie es besser wissen, es war doch niemand da, der es ihnen erklärt hat.
Wie oft werden sie nicht verstanden, auch wegen der Sprache. Was macht man dann, man trinkt. Im Suff verstehen sich alle. Aber keiner weiß, was sie für Sorgen haben. Als der Paolo Geburtstag hatte, kam er am Morgen hierher und sagte: ›Ich kann euch heute nicht einladen.‹
Sag ich: ›So, warum nicht?‹
›Hab ein Telegramm bekommen: Der Bruder und der Onkel verunglückt – tot.‹
Da dacht ich, guck einer an, also sippenmäßig wie bei uns, wenn so was ist, wird alles fallengelassen. Hab’ Beileid gewünscht, sein Geburtstagsgeschenk hat er trotzdem bekommen. Er hat nicht gearbeitet an dem Tag, wenn so was ist, dann arbeiten sie auch nicht … Man kann nun mal nicht reingucken in so ein Herzchen von so einem, was schleppt er mit sich rum. Der deutsche Bürger, der sich mit ihm unterhält, der will nur was Bestimmtes von ihm wissen. Und der Moçambiquaner getraut sich gar nicht, mal sein Herz voll auszuschütten. Sie genieren sich, weil sie nicht wissen, wie sie es ausdrücken sollen, damit der andere nicht eventuell über sie lacht.
Eines Abends saß hier einer beim Nachbar unten am Zaun auf der Bank. Und da weint er. Sag ich: ›Na, Marcel, warum weinst du?‹
›Nu, ich habe Heimweh, Heimweh, Sehnsucht nach meiner Mama.‹ Nuja, da hab ich ihn eben mal ’ne halbe Stunde in den Arm genommen, hab ihn getröstet – es war nachts halb eins, ein herrlicher Sommerabend –, na und da war er zufrieden.
Manchmal kommen auch Frauen rüber ins Heim. Eine Vierzigjährige aus Jüchsen. Die ist extra geschieden und zieht hier mit so ’nem zwanzigjährigen Schwarzen los. Also daß die anderen Frauen hier nicht gut reden über so was, das ist doch klar. Der Deutsche, der sagt: Sippe zu Sippe. Deutsch zu deutsch. Der Schwarze soll zu Schwarzen gehen, wo er hingehört. Und die Frauen, die was mit ’nem Schwarzen hatten, wie lange waren die verrufen. Und man sieht es ja auch an dem Kind, das dann heranwächst. Es ist heut nicht mehr so, wie’s war nach dem zweiten Weltkrieg, als die Amis hier waren, die Kinder waren doch Bastarde. Ein weißes uneheliches Kind heute, das kriegt den Namen der Mutter, und keiner fragt. Aber ein Mischling, das ist immer noch was anderes.
Ich find, ’ne deutsche Frau gehört nicht zu den Schwarzen, absolut nicht. Und ich würde auch keine Schwarze haben wollen, das gehört sich nicht. Eine einzelne Person, die würdest du vielleicht umerziehen, der Umerziehungsprozeß, der würde sich immer vom Weißen aus vollziehen, die Schwarze würde sich anpassen. Und auch eine Weiße würde den Schwarzen, wenn sie nicht bei ihm zu Hause ist, umerziehen. Er muß aus der Sippe raus, dann kann man ihn anpassen.
Manchmal überlege ich, ob man die Moçambiquaner besser nicht zusammen in einem Heim konzentriert hätte, sondern zu einzelnen Familien, deutschen Familien in der Nachbarschaft, zur Untermiete hätte geben sollen. Da müßten dann aber die familiären Verhältnisse aufs I-Tüpfelchen hinhauen, da dürfte keine leichtlebige Frau dabeisein. Und wer weiß, ob die Moçambiquaner das mitgemacht hätten, nachdem sie die Freiheit erlangt hatten. Denn sie wurden ja – solange sie unter Kolonialherrschaft lebten – als Kinder zu weißen portugiesischen Familien gegeben. Der Paolo, der war selbst zwei Jahre bei einer portugiesischen Familie, und er hatte es nicht gut dort, nur Dreckarbeiten, sagt er. Und im Heim kriegen sie vielleicht noch ein klein wenig mehr Sozialismus mit wie in dem privaten Kreis der DDR-Bevölkerung. Denn welcher deutsche Mann würde sich wegen des Moçambiquaners abends hinsetzen und nur das DDR-Fernsehen anmachen? Im Heim beim Gemeinschaftsempfang kann man bestimmt nicht Westen sehen. Und dann hättest du ja als Bürger der DDR an Schulungen teilnehmen müssen, wie verhältst du dich diesen Menschen gegenüber usw.
Der Paolo macht sehr schöne Geschenke. Das erste Jahr, wir hatten ihn zu Weihnachten eingeladen zum Abendbrot, er hat genauso seinen bunten Teller gekriegt wie jeder von uns, Plätzchen, einen Weihnachtsmann, meine Frau hatte den Pullover mit Norwegermuster gestrickt, zum Geburtstag hat sie ihm dann noch die Mütze dazu gemacht, also da brachte er, in Weihnachtspapier eingewickelt, einen Weihnachtsmann. ›Ein Geschenk‹ draufgeschrieben, noch ein bißchen kraklig. Drinnen Dollarstücke aus Schokolade. Mir schenkte er zum Geburtstag Rasierwasser, meiner Frau ein wunderschönes Kosmetiktäschchen mit Inhalt. Also ehrlich, ich wär ja nie auf den Gedanken gekommen, meiner Frau so’n Ding zu schenken. Weil ich weiß, was meine Frau braucht, und vor allem, wovon ich auch was hab, beispielsweise einen Kasten Pralinen.
Er hatte Schwierigkeiten wegen der Umstellung mit dem Essen und bekam einen Bandwurm. Und da hab ich ihm geraten: ›Du mußt viel Gemüse essen!‹
Manchmal abends kam er auch, spontan, um acht Uhr klopft’s. Sag ich: ›Was ist denn los, was willste denn?‹
›Will Gemuse essen!‹ Das mit den Umlauten ist absolut nicht drin.
Sag ich: ›Du spinnst, abends um acht!‹
›Nu, warum spinn?‹
›Na, abends um acht macht man kein Gemuse mehr. Und das heißt nicht Gemuse, sondern Gemüse, ja, morgen mittag kannste kommen zum Mittagessen.‹
›Nun gut. Gibt’s Gemuse?‹
›Ja.‹
Wenn er mitißt, mußt du dich beeilen mit dem Essen, daß du gleichzeitig fertig bist. Oder vor ihm, weil du ja ’nen zweiten Schlag essen willst. Denn wenn du nach ihm fertig bist, kommst du nicht zum zweiten Schlag. Dann räumt er ab – wenn er fertig ist, ist die ganze Familie fertig –, stellt alle Teller zusammen …
Ein Flug nach Maputo kostet hin und zurück 6000 Mark. Ich würd schon mal sparen, um da runterzufliegen. Aber eigentlich möchte ich nicht nach Moçambique, sondern nach … na, was früher Deutsch-Südwestafrika war. Da läuft jetzt im Westfernsehen ’ne wunderschöne Sendung, Fernfahrer, mit Manfred Krug. Als er unten ist in Windhoek und weiter rauf will, östlich, rät man ihm, nicht weiterzufahren, weil die Weißen da verschwinden. Ich kenne auch einen deutschen Farmer aus Deutsch-Südwestafrika. Der hat damals, zur Zeit der Nitribitt, eine Europareise gemacht. Seine Schwester wohnte mit meiner Schwester in Saalfeld zusammen. Die hat er auch besucht und mir geschildert, wie das mit den Schwarzen wirklich ist. Die wollen ja gar nicht selbständig arbeiten, die arbeiten gerne unter der Herrschaft der Weißen, da lernen die nämlich was. Und wenn er in die Stadt gefahren ist mit seinem schwarzen Chauffeur und hat sich einen neuen Anzug gekauft und zu seinem Chauffeur gesagt: ›Nu, kauf dir auch einen neuen‹, da hat der Schwarze erwidert: ›Nein, ich will lieber den vom Master, der vom Master ist besser als ein neuer!‹ So ist das, und das möcht’ ich mal sehen dort unten in Afrika.«
Ich hatte Klaus Meurer, als er goldzahnzeigend aus dem Fenster schaute, gefragt, ob er inzwischen unten war in »Deutsch-Südwestafrika«.
Er schüttelte den Kopf. »Sehe ich aus, als ob ich einen Goldesel im Keller stehen habe?«
Außerdem gebe es heute angenehmere Urlaubsreisen. Da müsse man sich nicht anschauen, wie die Schwarzen in Afrika leben …
Drei Tage später weiß ich, daß es in Suhl noch »afrikanische Überlebende« gibt; moçambiquanische Vertragsarbeiter, die vor zwanzig Jahren in die DDR kamen und das Ende des Sozialismus und die Wende ohne Ausweisung überstanden haben.
Einer von ihnen spielt Gitarre, ein anderer schlägt die afrikanische Trommel. Beide singen. Und die Zuhörer klatschen verhalten, denn die afrikanischen Klänge sollen nur die Eröffnung der Fotoausstellung »Auf halbem Wege Kamerun« umrahmen.
Der Suhler Oberbürgermeister sagt dem polnischen Fotografen freundliche Worte, erklärt lachend, daß er auf der Landkarte nachschauen mußte, in welchem Teil Afrikas Kamerun (»Das war ja wohl mal deutsch.«) liegt, und dankt den Musikern, Adelino Massuviro und Tomas Setou*, »die in unserer Stadt zu Hause sind«, für die original afrikanische Atmosphäre.
Dem Gitarristen Adelino, klein und schmächtig, wachsen über der Oberlippe und am Kinn kurzgeschnittene gekräuselte Barthaare. Aber auf der Kopfmitte fehlen ihm, was für einen Afrikaner selten ist, die Haare. Deshalb trägt er auch im Zimmer eine schwarze Baskenmütze. Er ist nicht tiefschwarz wie Tomas, der Trommler, ein muskulöser Schwergewichtler mit dichtem Kraushaar, wulstigen Lippen und großen kräftigen Händen. Gemeinsam ist ihnen, daß sie reden und lachen und lachen und reden. Und beide sind verheiratet. Adelino seit 1993 mit Ana, einer Moçambiquanerin, die auch 1980 in die DDR gekommen ist, und Tomas mit Karin, einer deutschen Frau, die wie er im Fajas arbeitete. Schon 1985 hatten sie sich verlobt, durften aber in der DDR nicht heiraten, sondern erst 1994.
»Ihre Frau heißt Karin?«
»Sim, Karin.«
Ich erzähle, daß ich 1982 auch eine Karin interviewt hatte, diese Karin sei damals jedoch mit dem Moçambiquaner Lino verlobt gewesen. Tomas zuckt unwissend mit den Schultern und schlägt einen Trommelwirbel.
»In welcher Abteilung hat Karin gearbeitet?«
»In der Rollermontage.«
»Die Karin, mit der ich sprach, arbeitete auch in der Rollermontage.«
Er wisse nichts von einem Lino, sagt Tomas. Und überhaupt: »Die Uhr tickt nur ab dem Tag, an dem wir uns kennengelernt haben.«
Ich frage, ob wir irgendwann über sein Leben reden könnten.
»Não. Nein.«
»Auch nicht, wenn ich keine Namen nenne, alles anonym bleibt?«
»Não. Nada. Nichts!« Ich müsse das verstehen. Es sei wegen seiner Frau. »Frauen haben am meisten unter der Öffentlichkeit zu leiden. Sie sind wehrlos, wenn sie als ›Negerschlampe‹ geschimpft werden.«
Er dagegen könne sich wehren, sagt der Afrikaner mit der Boxerstatur. »Beispielsweise damals bei der Telekommunikationsumschulung in Zella-Mehlis. Zwanzig Arbeitslose, achtzehn Deutsche, ein Russe und ich. Ein Deutscher, vielleicht so alt wie ich, er hatte eine kleine Tochter, hetzte die anderen gegen mich auf. Bis auf zwei, die sagten: ›Hör auf mit dem Scheiß‹, schwiegen alle oder freuten sich, wenn er fluchte: ›Alles stinkt hier, wenn du reinkommst, du Nigger!‹ Jeden Tag eine neue Beleidigung. Der Lehrer wußte es, doch er unternahm nichts. Und der Direktor, bei dem ich mich beschwerte, den interessierte nur das Geld, das er pro Umschulungsmensch vom Arbeitsamt kassierte. Als es immer schlimmer wurde, sagte ich zu dem Russen, der mir auch nicht half: ›Wart ab, die wollen erst mich. Aber wenn ich weg bin, kommst du dran! Erst die schwarzen Ausländer, dann die weißen Ausländer.‹ Die Frau auf dem Arbeitsamt meinte bedauernd: ›Ja, das ist eine schlimme Zeit für Sie, Herr Setou. Das verstehen wir.‹ Und draußen war ich. Wie zuvor bei der Post …«
Er lacht immer noch, während er spricht.
Als Adelino ihn auffordert, die Sache mit der Post und dem Fernsehen zu erzählen, verfinstert sich allerdings Tomas’ Gesicht. Nada! Nichts wird er erzählen. Nada! Und er beginnt, mit den flachen Händen seine Trommel zu traktieren. Ein wildes Schlagsolo. Als er aufhört, klatschen die Ausstellungsbesucher.
Ich verabschiede mich. Und Adelino sagt: »Kommen Sie am Freitag in die Jugendstunde vom Kirchenkreis. Die leite ich. Anschließend können wir reden.«
Adelino ist im Kirchenkreis Henneberger Land Jugend- und Ausländerbeauftragter. Jeden Freitag trifft er sich mit jungen Leuten im Kellerraum des Kirchenamtes. Die Wände sind bemalt mit Weihnachtssymbolen, daneben hängen Poster von »Brot für die Welt«, Starfotos von Popkünstlern, die ich nicht kenne, Kinoplakate. Die Jüngsten sitzen auf den Thekenstühlen. Ein Dutzend Jungen und Mädchen reden durcheinander.
»Wie stelle ich mir Gott vor?« Adelino steht vor einer großen Papierwand. Was die jungen Leute ihm leise und nachdenklich oder sehr laut und spontan zurufen, schreibt er säuberlich mit Filzstift an die Wand.
»Geduldig«, »liebend«, »sehr weise«, »Gott ist alles, was schön und lebendig ist« …
Adelino hebt seine schwarzen Hände mit den helleren Innenflächen wie zur Beschwörung vor sein Gesicht und fragt dann weiter: »Warum glaube ich an Gott?«
Hätte ich, während er die Antworten (»Er gibt Kraft«, »Er beschützt«) aufschreibt, schon gewußt, daß er, der in seinem Dorf im Glauben an die Naturgötter aufgewachsen ist und immer noch an sie glaubt, nach dem Besuch einer Missionarsschule katholisch getauft wurde, später der marxistisch-leninistischen Jugendorganisation OJM und der FRELIMO-Partei beitrat und heute im evangelischen Kirchenkreis jungen Leuten Gott nahebringt, dann hätte ich den zweiundvierzigjährigen Moçambiquaner zuerst gefragt: »An welchen Gott glaubst du?«
Adelinos Geschichte:
In einem kleinen moçambiquanischen Dorf »irgendwo in Afrika, aber nicht weit entfernt von der Welt«, ist Adelino als ältestes von acht Kindern aufgewachsen. Eigentlich als drittältestes, aber die zwei vor ihm Geborenen starben. Insgesamt sind sieben Geschwister Adelinos an Typhus, Malaria, Masern oder Hunger gestorben.
»Meine Mutter hat fünfzehn Kinder geboren.« Sie sei noch zierlicher und kleiner als er. »Mutter reicht mir gerade bis zu den Schultern.« Adelino mißt ungefähr 1,70 Meter.
»Mein Vater ist größer und kräftiger, er verlegte Gleise für die portugiesische Eisenbahngesellschaft.« Damals war Moçambique noch eine portugiesische Kolonie. »Wahrscheinlich hat o meu pai – mein Vater – die Strecke dicht an unserem Dorf vorbei in die Welt bis zur 150 Kilometer entfernten Provinzhauptstadt Nampula mitgebaut.«
Später stellte der portugiesische Chef den Vater als Hausdiener und Koch ein. So litt er bei der Arbeit keinen Hunger. Zu Hause aßen sie, »wenn die Götter uns Regen geschenkt hatten«, massa, Maisbrei mit grünen spinatähnlichen Matapablättern. Manchmal auch Maniok, eine kartoffelähnliche Wurzel.
Das Wasser holte Adelinos Mutter in einem alten Dreißig-Liter-Benzinfaß, das sie auf dem Kopf balancierte, von einem kilometerweit entfernten Brunnen oder einem kleinen Tümpel. Wenn die Kinder sechs oder sieben Jahre alt waren, mußten auch sie nach Wasser laufen.
»Kennst du den Unterschied zwischen Europa und Afrika? Drehst du hier den Hahn auf, läuft und läuft das Wasser. Brauchst du in Afrika Wasser, läuft und läuft und läuft das Kind.«
Manchmal, wenn die Tümpel und Brunnen ausgetrocknet und die Erde verbrannt waren, zogen die Dorfbewohner zu den Kultstätten ihrer Götter, zum hundert Jahre alten Affenbrotbaum, dem Haus des Fruchtbarkeitsgottes, oder dem Tümpel, in dem die Wasserschlange lebte, und erflehten Regen.