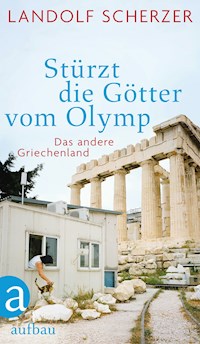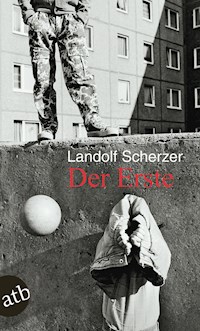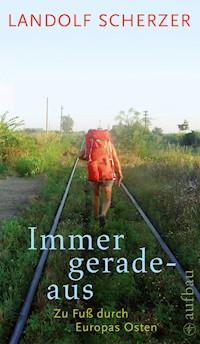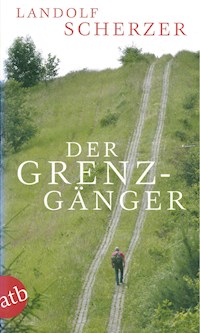
11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
»Der Meister der literarischen Reportage« Neue Presse.
Jedes Buch Landolf Scherzers beruht auf einem Abenteuer. Diesmal wanderte er in 15 Etappen auf dem ehemaligen innerdeutschen Grenzstreifen zwischen Thüringen, Bayern und Hessen, mehr als 440 Kilometer. Er erzählt von Einzelschicksalen wie von Problemen der Region, die stellvertretend für die des ganzen Landes stehen. Eine aufschlussreiche Langzeitbeobachtung – aktuell und kontrovers.
»Wertvolles Zeitdokument: voller Geschichten aus Ost und West, und mitten aus unserem Land.« Stern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 554
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über Landolf Scherzer
Landolf Scherzer, 1941 in Dresden geboren, lebt als freier Schriftsteller in Thüringen. Er wurde durch Reportagen wie »Der Erste«, »Der Zweite« und »Der Letzte« bekannt.
Im Aufbau Taschenbuch sind ebenfalls seine Bücher »Der Grenzgänger«, »Immer geradeaus. Zu Fuß durch Europas Osten«, »Urlaub für rote Engel. Reportagen«, »Fänger & Gefangene. 2386 Stunden vor Labrador und anderswo«, »Madame Zhou und der Fahrradfriseur. Auf den Spuren des chinesischen Wunders«, »Stürzt die Götter vom Olymp. Das andere Griechenland«, »Der Rote. Macht und Ohnmacht des Regierens« und »Buenos días, Kuba. Reise durch ein Land im Umbruch« lieferbar.
Informationen zum Buch
»Der Meister der literarischen Reportage« Neue Presse
Jedes Buch Landolf Scherzers beruht auf einem Abenteuer. Diesmal wanderte er in 15 Etappen auf dem ehemaligen innerdeutschen Grenzstreifen zwischen Thüringen, Bayern und Hessen, mehr als 440 Kilometer. Er erzählt von Einzelschicksalen wie von Problemen der Region, die stellvertretend für die des ganzen Landes stehen. Eine aufschlussreiche Langzeitbeobachtung – aktuell und kontrovers.
»Wertvolles Zeitdokument: voller Geschichten aus Ost und West, und mitten aus unserem Land.« Stern
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Landolf Scherzer
Der Grenz-Gänger
Inhaltsübersicht
Über Landolf Scherzer
Informationen zum Buch
Newsletter
Ein sehr kurzes Vorwort
Von einem Toten, der immer noch lebt, einem an der Grenze Himbeeren pflückenden Physiker und bayerischen Beamten, die keine Ossis in ihrer Verwaltung einstellen
Von einem Afrikahaus neben dem LPG-Stall, Dächern mit Asbestschiefer im Schiefergebirge und unsolidarischen Ossis auf der »Kalten Küche«
Von einem Saarländer, der im Spreewald transportable Klostühle findet, einem Schleusinger Tischlermeister, der in Spechtsbrunn Höfe fegt, und meinem Versuch, mich westfein zu machen
Von einem Bürgermeister, der nicht »Schande«, sondern »Schaden« heißt, einer türkischen Moschee im bayerischen Tettau und den Bettel-Aktenordnern eines ehrlichen Wende-Wohltäters
Von einem eigenwilligen Verkehrsregulierer in Judenbach, einem russisch sprechenden Polen, der Elektromüll verwertet, und einem DDR-Künstler, der den Bayern erklärt, was sie heute ohne Bismarck wären
Von einem ostdeutschen Freelancer, der bayerische Betriebe saniert, einer Kaserne, in der ich mich übergeben muß, und einem Heinersdorfer Grenzer, der die Eisenbahn in sein Haus fahren lassen will
Von einem nur noch Gelb und Weiß erkennenden Bauern, einer NVA-Gulaschkanone, bei der das DDR-Emblem nach Bedarf abgenommen werden kann, und einem Thüringer, der Wurst bayerisch würzt
Von einem Ost-West-Liebespaar, das im Zelt an der Grenze endlich Ruhe vor der Welt haben will, einer 63jährigen aus Gefell, die auf einem Segelschiff nach Amerika auswandert, und einer Billigarbeiterin, die den aufrechten Gang nicht verlernen will
Von einem Oberstleutnant, der Glück hatte, weil es keinen Toten gab, einem Imker aus Burggrub, der ostdeutsche Fahrschüler unterrichtete, und einem Ameisen rettenden bayerischen Arbeitslosen
Von Rotheuler Wustungen und verhinderter Inzucht, Rock ’n’ Roll tanzenden Möbelvertretern und einem vergessenen Jahrestag
Von einem berühmten Grenzschmuggler, herrenlosen DDR-Waldarbeitern und dem original Heubischer Fußball-Kescher
Von aussterbenden Schustern, einem Neustadter Verräter mit dem zweiten Herzen und dem Ausverkauf in Bayern
Von einem entsetzten Sonneberger Schuldirektor, der gefährlichen Nähe von Ost und West und dem Neustadter Schülerwunsch, gar nix zu arbeiten, gleich Millionär zu sein
Von der historischen Stunde an der »Gebrannten Brücke«, den letzten europäischen Tierstimmenherstellern und einem fast volkseigenen bayerischen Industriewerk
Von vierzehn Hektar Erdbeeren, die NVA-Grenzer in Roth bewachten, einem mit Schnaps erkauften Begräbnisweg nach Bayern und einer Lehrvorführung, wie man mit Hilfe von Zeitungspapier ohne erfrorene Füße aus dem Rußlandkrieg zurückkam
Von sturen Schafen in der Eisfelder Feldmühle, einem traditionsbewußten Malermeister und einer jungen Frau, die Arafat im Palast der Republik bediente
Von einer Westberliner Pastorin, die eintausendzweihundertmal im Interzonenzug kontrolliert wurde, dem Hildburghausener PDS-Bürgermeister, der Advent gesamtdeutsch feiert, und einem, der zuerst Held und dann Verurteilter war
Von einem Eishäuser Autolackierer, der seinen richtigen Vater nach über vierzig Jahren in Jugoslawien fand, einem DDR-Hanghuhn, das Siemens-Manager in der Slowakei wurde, und einer Rodacher Männerrunde in einem Kurstadt-Café
Von einem alten Schweden in Streufdorf, einem 105jährigen, der seinem schlimmsten Feind nicht wünscht, so alt zu werden, und einem von Geburtstagsfeiern geplagten rumäniendeutschen Pfarrer
Von einem Würzburger Ehepaar, das mir das Leben in der DDR erklären will, einer Schloßfrau, die nicht nur über den Brand der Heldburg Bescheid weiß, und einem ABM-Mann, der eine Kalaschnikow nehmen würde
Von einer auf dem Billmuthausener Friedhof gestohlenen Bronzeplatte, einem Hausmeister, der hofft, nicht mehr gesund zu werden, und Männergesprächen in der Bad Colberger Trinkhalle
Von der amerikanischen Bürgermeisterin in Thüringens kleinster Stadt, einem entsorgten roten Dienst-Wartburg und den Versuchungen der Macht
Von ehrenamtlichen Totengräbern in Poppenhausen, dem nächtlichen Faßrollen über die Grenze und dem Casimir, der Geschütze ziehen sollte
Vom 16jährigen Freiheitskampf im bayerischen Ermershausen, von Riether Legenden, die nicht im Bett sterben, und Schafschlachten in der Heimdusche
Von einem nicht mehr schwindelfreien Fischverkäufer, Bauern ohne Saatkartoffeln und einem gut entwickelten bayerischen Ostkrippenkind
Vom Glauben an die wachstumsfördernde Kraft des Mondes, von einem karrierehemmenden westdeutschen Groschenheft und Verrätern, die zu Helden wurden
Von einem Professor mit goldenem Notizbuch, einem geklauten Erdbunker und müden Sicherheitswesten
Von gastronomischem Schleuderservice, dem eingeschleppten asiatischen Holzborkenkäfer und einem Grenzturm-Bungalow
Vom gescheiterten Versuch, DDR-Grenzsteine auszugraben, von Europas bestem Lipizzanerfohlen in Unterharles und einer das Kreuz schleppenden Obrigkeit
Von einer alten Dame, die nur zwei Minuten Zeit hat, Schwierigkeiten mit dem Adelsnamen und einem pensionierten bayerischen Lehrer, der Gysi mag
Von Kaffeewasser aus dem Friedhofsbrunnen, einem Beschwerdebrief an Adolf Hitler und dem Nachtlager über dem Rhöner Schafstall
Von Blitzen und einem warmen Geldregen, unerwünschter religiöser Kunst und asozialen Staren
Von einem verhinderten Olympiasieger, gestohlenen Katzen und Dumpingpreisen für Grenzland
Von den Stehlern in Berlin und dem Hehler in Bonn, einem sechsmal tranchierten Eisbein und Florian Geyers Grenzerkameradschaft
Von terrorismusverdächtigen VIP-Gästen, meinem Gorbi-Händedruck und Schmetterlingsjägern auf dem Todesstreifen
Von Wallraffs Auftauchen, dem Lieblingsessen der DDR-Grenzer in Buttlar und einem am 17. Juni brennenden Schweinestall
Von einer Ost-West-Grenzdorf-Wette, volkseigenen Elektroschaltungen für den Leo-Panzer und einem nur auf der Toilette rauchenden polnischen Pfarrer
Von einem schreienden Dino aus Beton, nach keltischer Art in Heu gedünstetem Fleisch und dem Psychotest auf der Brücke in Vacha
Worterklärungen
Impressum
Ein sehr kurzes Vorwort
Sorgfältig versuche ich, einen Zwirnsfaden deckungsgleich auf die verschlungene thüringisch-bayerische und thüringisch-hessische Grenzlinie einer Landkarte Maßstab 1:150000 zu legen. Knote den Faden am Ende bei etwa zwei Metern. Messe ihn mit einem Zollstock und errechne, daß die ehemalige Staatsgrenze West, die ich in Südthüringen etappenweise ablaufen will, genau vierhundertachtzehn Kilometer lang ist. Wiederhole die Rechnung. Beginne noch einmal bei Gräfenthal im Südosten und ende bei Vacha im Südwesten der DDR. Mache einen neuen Knoten. Messe. Dreihundertachtundneunzig Kilometer. Ich fluche. Lege die Kurven, Kehren und Winkel der Grenze noch sorgfältiger aus. Knote. Messe. Rechne. Vierhundertzweiunddreißig Kilometer. Als auch beim vierten Versuch ein neuer Wert herauskommt, knülle ich das Papier mit dem Ergebnis zusammen. Schneide den Faden am hintersten Knoten ab und hänge ihn an einen Nagel neben meinem Schreibtisch.
Von einem Toten, der immer noch lebt, einem an der Grenze Himbeeren pflückenden Physiker und bayerischen Beamten, die keine Ossis in ihrer Verwaltung einstellen
Vier Wochen nach meinen mißglückten Messungen stehe ich mit einem aufgehuckten alten grünen Jägerrucksack und einem schwarz-roten (Gold fehlt!) Notizbuch in der Hand vor dem verschlossenen Grenzmuseum in Gräfenthal und frage auf dem Marktplatz, wer den Schlüssel zum Museum verwaltet.
»Wahrscheinlich der Bürgermeister«, meint eine Frau, berichtigt sich aber und stellt ihre schwere Einkaufstasche ab, um mir ausführlich zu erklären, daß es in Gräfenthal zur Zeit keinen Bürgermeister gebe. »Der Kosater hat zwar bei der Wahl trotz drei Gegenkandidaten vierundsechzig Prozent der Stimmen erhalten, denn er hat gut gearbeitet, aber er ist kürzlich wegen Stasi und so von der Landrätin abgesetzt worden.«
Ein fragender Fremder ist in der ehemaligen Grenzstadt immer noch verdächtig. Sofort versammeln sich vier oder fünf Neugierige um mich. Sie erkundigen sich zuerst mißtrauisch nach dem Woher und Wohin, erzählen dann aber bereitwillig die neuesten Ortsgeschichten. Karl-Heinz Kosater (früher SED) arbeitete schon vor der Wende als Bürgermeister. Er war dabei, als sich die Gräfenthaler und die Lauensteiner vor fünfzehn Jahren an der Grenze in die Arme fielen. »Und geheult haben wir damals.« Nach der Wende hat er als Werkzeugmacher gearbeitet. Als dann in Gräfenthal fast nichts mehr ging, die Porzellanfabriken dichtgemacht und der Zugverkehr zwei Jahre vor dem hundertjährigen Jubiläum eingestellt wurden, baten die Gräfenthaler Karl-Heinz Kosater, sich zur Bürgermeisterwahl aufstellen zu lassen.
Eine bisher schweigsame Frau mischt sich ein und schreit: »Hier an der Grenze kennt jeder jeden! Hier vergißt niemand was! In Gräfenthal kann keiner seine Vergangenheit verstecken!«
Eine andere verteidigt den Bürgermeister. »Der hat viel zuwege gebracht. Die Baugenehmigung für das neue Plasta-Werk durchgeboxt, das Grenzmuseum mit aufgebaut, und daß der Markt und die angrenzenden Straßen jetzt für neue Sammelkanäle aufgerissen werden, das hat er auch organisiert.«
Er klagt gegen seine Abberufung, und viele Gräfenthaler haben eine Petition für ihn unterschrieben.
Ich frage, wer den Museumsschlüssel außer dem Bürgermeister noch besitzen könnte.
»Vielleicht die Pastorin«, heißt es.
Im alten Gräfenthaler Pfarrhaus knarren die nach Bohnerwachs riechenden Holztreppen unter meinem Rucksackgewicht so laut, daß ich mich wie ein Dieb vorsichtig hinaufschleiche. Doch die Pastorin, eine schmächtige Frau mit kurzen dunklen Haaren, das Gesicht sehr schmal, als wäre sie lange krank gewesen, öffnet schon, bevor ich klingele. Den Museumsschlüssel besitzt sie nicht.
Als ich frage, wie sie und ihre Gemeindemitglieder fünfzehn Jahre nach der Grenzöffnung leben, bittet sie mich herein. Ihr Mann, schon grauhaarig, mit müden, nur selten lächelnden Augen, kommt wortlos dazu. Sie ist vor vier Jahren nach Gräfenthal gekommen. Zuvor war sie zweiundzwanzig Jahre Pastorin in Jena-Lobeda und Kaltennordheim. Sie kennt Plattenbauten und Kuhstall, aber die Pfarrstelle hier ist die bislang schwierigste, entmutigendste. Manchmal predigt sie in ihrer großen Kirche vor drei Zuhörern. Nie oben von der Kanzel, immer nah bei den Menschen, meist bei den Alten. »Die Jungen gehen weg, und die Alten bleiben aus Verantwortung für das Haus und die Kinder, solange die noch hier sind. Viele fühlen sich schon abgeschrieben.«
An dieser Stelle sagt der Mann in einem mir zuerst schlecht verständlichen Deutsch: »Eltern und Kinder machen sich hier gegenseitig traurig.«
Die Pastorin erklärt leise, daß sie ihn in Israel kennengelernt hat und nun mit ihm zusammen lebt. »Er ist ein Israeli.«
In der näheren Umgebung gibt es keine Synagoge. »Aber beten kann man überall«, sagt er. »Ich bete auch, weil ich Angst habe. Niemand von meiner Familie in Israel versteht, daß ich nach Deutschland gegangen bin, wo junge Neonazis frei herumlaufen und wieder Haß predigen.«
»Die Gräfenthaler leben immer noch unbewußt mit der Grenze«, meint die Pastorin. Man mißtraut einander – immer war ja einer der Judas, der Verräter unter ihnen.«
Der Mann bittet mich, seinen jüdischen Namen nicht aufzuschreiben. »Ich habe Furcht, daß eines Tages fanatische Nationalisten hier die Holztreppe heraufgestürmt kommen.«
Einen Schlüssel zum Grenzmuseum verwaltet der über der Pastorin wohnende Vorsitzende des Gräfenthaler Heimatvereins. Ein junger Mann, dessen T-Shirt mit der Aufschrift »Siemens mobile Handy-Service« über dem Bauch spannt, öffnet mir. Ich frage höflich nach seinem Vater, dem Vorsitzenden des Heimatvereins.
»Ich bin der Vorsitzende«, sagt er lachend.
An einer Längswand seines Wohnzimmers sind über dem Sofa, wie Reliquien, an die fünfzig Truck-Modelle – Bier-Trucks mit dazugehörigen Tanks und Dosen – angebracht. Nicht alle Dosen hat er selbst ausgetrunken. Sein Großvater, sagt er, war der Ortschronist von Gräfenthal, und als er dessen Aufzeichnungen gelesen hatte, verschrieb auch er sich der Heimatgeschichte. »Mit Heimat verbindet sich heutzutage nicht mehr die gemeinsame Arbeit an einem gemeinsamen Ort. Deshalb ist es wichtig, wenigstens die gemeinsame Geschichte zu bewahren.«
Er arbeitet seit über zehn Jahren in einem bayerischen Grenzort. In seiner »Brigade« sind die Ostdeutschen in der Überzahl. »Deshalb laufen unsere Leute, wenn Teile kaputt sind, auch seltener zum Materiallager. Wir Ostdeutschen reparieren erst mal. Es gibt eben noch Unterschiede zwischen den Bayern und uns.«
Das schöne Haus im englischen Landhausstil hat Herzog Georg 1893 den Gräfenthalern als Kinderbewahrungsanstalt geschenkt. Es wurde bis in die DDR-Zeit als Kindergarten genutzt, nun ist das Grenzmuseum darin untergebracht. An den Wänden hängen hinter Glas historische Aufnahmen der ehemaligen Staatsgrenze bei Gräfenthal: eine breite Schneise in sonst dicht bewaldeten Berghängen. Auf dem Fußboden steht ein Holzkreuz, und unter dem Kreuz liegt in blauschwarzem Schiefergeröll, einem großen Tankverschluß gleichend, eine schwarze Mine. Auf dem Kreuz ein Erinnerungsschild: »Gegenüber dieser Stelle wurde am 21. 05. 1973 der NVA-Soldat ›Harry‹ beim Verlegen von Minen tödlich verletzt. Er starb einen sinnlosen Tod. Errichtet von den Beamten des Zollkommissariates Ludwigstadt.« Trotz des Protestes der DDR-Regierung stand dieses Todeskreuz bis zur Wende auf BRD-Seite. Der NVA-Soldat »Harry« lebt noch …
Neben dem Kreuz hängen die Fotos eines Liebespaares, Sieglinde Bunde (21) und Laszlo Balogh (18). Als die Aufenthaltsgenehmigung des Ungarn in der DDR nicht verlängert wurde, beschlossen sie, in den Westen zu fliehen. Am 22. Juni 1973 überwanden sie nachts gegen drei Uhr zwischen Spechtsbrunn (DDR) und Tettau (BRD) den ersten Metallzaun. Vor dem zweiten explodierte eine Mine, zerfetzte dem Mädchen das Bein. Ihr Freund wollte sie über den Zaun heben. MPi-Salven. Er blieb »feindwärts« tot am Zaun liegen. Sie blutend über ihm.
Auf einer anderen Tafel ist die Geschichte eines Mannes dokumentiert, der abends in einer Kneipe von Zopten (DDR) wettete, daß er am nächsten Tag aus Lauenstein (BRD) eine Ansichtskarte schicken würde. Er schickte sie und kam unbemerkt über die Grenze zurück. Kurz danach gewann er auch eine zweite Wette, wurde denunziert und verhaftet. Und wenig später freigelassen. Die DDR-Sicherheitsorgane bezeichneten ihn als »nicht zurechnungsfähig«.
Zwischen originalgetreuen Stacheldrahtzäunen und Warnschildern stehen NVA-Grenzsoldaten mit porzellanenen Gesichtern. Sie haben lange, mädchenhafte Wimpern und unbeschmutzte Uniformen. Kein Geruch von Schweiß oder Stiefelwichse. Uniformierte, lächelnde Schaufensterpuppen mit geschulterter MPi.
Eine gute halbe Stunde später erreiche ich etwa drei Kilometer außerhalb von Gräfenthal über einen holprigen Wald- und Wiesenweg die ehemalige Grenze auf der Höhe. An dem Kolonnenweg, der »Autobahn der Grenzer«, konnten die Soldaten ohne Unterbrechung die Staatsgrenze West von der Ostseeküste bis zur ČSSR abfahren. »Geh nicht abseits vom Kolonnenweg. Die Räumtrupps haben noch nicht alle Minen gefunden«, hatten mir fürsorgliche Bekannte vor meiner Grenzwanderung geraten.
Aber noch laufe ich nicht. Ich stehe schweigend und versuche mir vorzustellen, wie es vor fünfzehn Jahren aussah, als hier noch Stacheldrahtzäune, Stahlgitter, Grabensperren, Signalanlagen und Wachtürme standen. Es gelingt mir nicht. In den Löchern der Gitterplatten des Kolonnenweges wachsen filigrane Farne, dickblättriger Breitwegerich, haarige Huflattichblätter, zarte Glockenblumen, kleine Fichtensämlinge. Und rot leuchtende Walderdbeeren. Ich pflücke mir eine Handvoll. Sie schmecken süß und aromatisch.
Zwischen groben Feldsteinen steht auf der Berghöhe eine Tafel: »Köchinnengrab. Hier wurde im 16. Jahrhundert eine Köchin von Schloß Lauenstein wegen Kindesmordes bei lebendigem Leibe begraben und gepfählt.«
Während ich noch überlege, wie man einen Menschen zuerst lebendig begraben und danach pfählen kann, grüßt mich in der vermeintlichen Grenzeinsamkeit eine kleine alte Frau mit einem freundlichen Kopfnicken. Trotz ihres Krückstocks geht und steht sie sehr gerade. Sie trägt viele Ringe an den Händen und zwei goldene Kettchen um den Hals. Der grün-weiß gepunktete Rock und die beigefarbene Seidenbluse sind sorgfältig aufeinander abgestimmt.
Sie wollte heute hier malen, sagt die, wie sie stolz verkündet, schon 88jährige, hat aber das Malzeug vergessen. » Der Blick hinunter auf Lauenstein ist sehr schön. Und hier oben die stille, friedliche Natur, die, seit fünfzehn Jahren unberührt, die deutsche Schande wieder zuwachsen läßt.«
Gunde Fröhlich stammt aus einer gutbürgerlichen Familie. Nach den Plänen ihres Vaters, des Architekten Scheinpflug, sei halb Zeulenroda gebaut worden.
Mit ihrem Mann, einem Juristen, ging sie noch vor dem Mauerbau nach dem Westen, weil sie in der DDR wegen ihrer bürgerlichen Vergangenheit keine Chance hatten. In Westberlin brachte er es bis zum Senatspräsidenten im Kammergericht. Seit vielen Jahren wohnt sie nun den Sommer über in Lauenstein, wo sie der alten Heimat nah ist. Sie hat im Herbst 1989 miterlebt, wie sich die Gräfenthaler und Lauensteiner »genau hier an dieser Stelle wieder umarmten. Wir sangen damals: ›Nun danket alle Gott.‹ Die Lauensteiner sangen lauter als die Gräfenthaler. Der Gräfenthaler Bürgermeister, Herr Kosater, gab sich große Mühe. Er bewegte sogar die Lippen, aber den Text kannte der Ärmste natürlich nicht.«
Wenn ich morgen noch einmal heraufkomme, sagt sie, wird sie mir ihre Bilder zeigen.
Aber da will ich schon fünfzehn Kilometer Grenzwanderung hinter mir haben.
Wenig später halten vier Radfahrer auf dem Paß, zwei ältere Männer und zwei Jungen. Vom bayerischen Ludwigstadt aus sind sie die Grenze entlanggefahren. »Für uns ist das eine wichtige Erinnerung, für die Kinder aber nur noch eine Radtour wie jede andere«, meint einer der Männer.
Ich frage, wie sie fünfzehn Jahre nach der Maueröffnung »drüben in Ludwigstadt« leben. Spontan antwortet der älteste: »Beschissen.« Und der andere: »Die Verlierer der Wende sind doch wir im Westen!« Weil mit dem Fall der Mauer auch die Zonenrandförderung wegfiel, seien Betriebe im Westen geschlossen worden, und die Unternehmer haben sie wegen der Ostförderung in zehn Kilometer Entfernung in Thüringen angesiedelt. »Und die Billig-Ossis sind wie Heuschreckenschwärme über unsere Betriebe hergefallen und haben unsere Leute arbeitslos gemacht.«
»Sie auch?«
»Nein, ich bin Gott sei Dank in der Verwaltung von Ludwigstadt beschäftigt. In unsere Verwaltung haben wir bisher keine Ostdeutschen hereingelassen und werden wir auch in Zukunft keine Ostdeutschen reinlassen.« Sie steigen auf und radeln zurück nach Bayern.
Schon beim ersten Anstieg des Kolonnenweges beginne ich nach zehn Minuten die Schritte zu zählen, die ich für eine Gitterplatte brauche. Wenn der Berg steil ist, vier, sonst drei. Nach fünfzehn Minuten schmerzen meine Füße, denn der löchrige Kolonnenweg ist nicht für Wanderschuhe, sondern für Gummireifen gebaut worden. Die Sonne brennt, und die Birken, Eschen, Erlen und Eichen sind noch nicht so groß, daß sie auf dem Grenzstreifen schon Schatten spenden. Nur die Hochstände der Jäger, die nun auf dem gut überschaubaren Gelände anstelle der geschleiften Grenzwachtürme alles überragen, werfen gespenstische Schatten. Vor einem, der mit Militärnetzen getarnt ist, erschrecke ich. Nun haben also die Jäger ein weites, freies Schußfeld …
Nach einer halben Marschstunde treffe ich den ersten Grenzwanderer. Ein älterer, lang aufgeschossener, hagerer Mann in kurzen Hosen. Eine flache Hühnerbrust, muskulöse Beine wie ein Marathonläufer. In seinen rot beschmierten Händen trägt er sorgsam ein Eimerchen, das zu einem Viertel mit Waldhimbeeren gefüllt ist. Er stammt aus Gräfenthal und macht dort Urlaub. Der Physiker aus Jena liebt die langen, einsamen, stillen Wege an der Grenze. »Ich kann hier stundenlang über Gott und die Welt nachdenken.« Am meisten, so sagt Dr. Welsch, staune er über das Wunder, »daß unsereiner in den vierzig Jahren DDR-Gefangenschaft nicht völlig verblödet ist«.
Wahrscheinlich denkt er, daß ich aus dem Westen komme, denn als ich ihm antworte, daß auch ich, ohne zu verblöden, vierzig Jahre in der DDR gelebt habe, relativiert er sofort: »Ich wundere mich andererseits genauso, daß manche Westdeutsche ihre vierzig Jahre Freiheit und Demokratie, die sie genießen konnten, nicht besser für ihre Persönlichkeitsentwicklung genutzt haben. Die reden oft so primitiv, als ob nicht wir, sondern sie …« Manchmal, sagt er, habe die Unfreiheit in der DDR die Menschen zum Denken gezwungen. Heute dagegen …
Ob er die Himbeeren zu Saft für den Winter einkocht, frage ich. Aber er zuckert sie ein und ißt sie gleich auf.
Der nächste Grenz-Gänger, den ich treffe, hat sich trotz der brütenden Hitze in einen dicken, an den Ärmeln schon aufgerissenen Anorak gemummelt. Was gegen Kälte schütze, sei auch gut gegen Hitze. Er schleppt zwei aus Weidenruten geflochtene Kartoffelkörbe. Beide sind so randvoll mit Birkenpilzen, Maronen, Rotkappen und Steinpilzen gefüllt, daß sie ihm die Arme nach unten ziehen und sich die vielen Pockennarben in seinem Gesicht auffällig röten. »Die Grenze ist mein bestes Pilzrevier.«
Ich frage ihn nicht nach den Minen, aber er redet davon, ungefragt.
Fünfzehn Jahre hat er als Pfleger im Gräfenthaler Krankenhaus gearbeitet. Damals lag es mitten im Grenzsperrgebiet und war das zentrale Krankenhaus für den Kreis Neuhaus. Die Patienten kamen ohne Probleme hinein, aber die Gesunden mußten erst einen Passierschein beantragen, um ihre vielleicht bei einem Unfall schwerverletzte Frau zu besuchen. Er habe auch Tote und von Minen verletzte Flüchtlinge gesehen. »Die brachte man alle zu uns.«
Nachdem das Kreiskrankenhaus in Neuhaus außerhalb des Sperrgebiets gebaut worden war, arbeitete er in der größten Porzellanfabrik von Gräfenthal. Nach der Wende wurde sie sofort geschlossen, und ihm blieben nur ein paar Gelegenheitsjobs. »Also macht Edgar im Winter Holz für die Leute, und im Herbst verkauft er Pilze … Haste ’nen Schnaps in deinem Rucksack?«
Trotz der Hitze gießt er sich einen Trinkbecher voll. In einem Seitenweg steht ein verrosteter Lada, in den er einsteigt.
»Mensch, du kannst doch mit sto Gramm im Blut nicht Auto fahren«, sage ich.
Er lacht. »Ich bleibe schön auf dem Kolonnenweg. Weißt du, wie besoffen die Grenzer waren, die hier entlanggerast sind? Einige habe ich mit reinem Äthanol aus dem Krankenhaus versorgt. Sonst hätten die das nicht ausgehalten, hier an der Grenze.«
Ich weiß nicht, ob das, was Edgar erzählt, Dichtung oder Wahrheit ist. Aber die zwei Körbe Pilze, die wiegen bestimmt zwanzig Kilo.
Von einem Afrikahaus neben dem LPG-Stall, Dächern mit Asbestschiefer im Schiefergebirge und unsolidarischen Ossis auf der »Kalten Küche«
Es ist inzwischen Nachmittag. Mein Magen knurrt. Ich habe an eine Regenplane, an Heftpflaster, Trinkwasser, frische Socken, Kugelschreiber, Papier und Schnaps gedacht. Aber ich habe, auf die Kneipen in den Dörfern hoffend, weder Brot noch Wurst in den Rucksack gepackt.
Hohe Brennesseln am Weg und Beifuß auf Schutt, zwei untrügliche Zeichen für »Zivilisation«, kündigen endlich das erste Dorf an. Der Beifuß blüht noch nicht. Ich weiß, daß man ihn vor der Blüte als Würzkraut für den Gänsebraten schneiden muß. Aber jetzt will ich nicht an Gänsebraten denken …
Als sich der Wald auf der Höhe lichtet, sehe ich im Tal das Dorf Lichtenhain. Am Weg, der von der ehemaligen Grenze zum Dorf führt, steht ein olivgrüner PKW Škoda. Hinter der Frontscheibe klemmt wie bei den Trucks ein Schild mit dem Vornamen des Fahrers. Der Fahrer heißt »MAMA«. Wenig später höre ich zwei Frauenstimmen, eine ängstlich: »Wenn es hier aber Kreuzottern gibt?«, die andere resolut: »Mußt nur richtig Lärm machen, dann verschwinden die Viecher!« Heidelbeerpflückerinnen. Die MAMA sieht wirklich wie eine Mama aus, eine prächtige, kräftige, füllige Mama: Frau Kelm aus dem nahe gelegenen Unterlugwitz.
»Wir haben schon als Kinder an der Grenze Heidelbeeren gepflückt. Manchmal ließen die Grenzer uns herein und sagten: ›Aber beeilt euch, damit ihr wieder raus seid, bevor unsere Ablösung kommt.‹«
Das erste, was sie sich nach der Wende gekauft hat, war ein Auto, um damit an die besten Heidelbeerstellen fahren zu können.
Jede Frau hat einen Fünf-Liter-Eimer randvoll und keine hat einen blauen Mund.
In Lichtenhain werde ich endlich etwas essen. Dort gibt es eine Gaststätte und einen kleinen Laden, hat die MAMA versprochen.
Am Dorfeingang liegen Haufen von Betonplatten und Steinschutt. Unter einstürzenden Hallendächern verrosten alte Zetor-Traktoren, Hänger mit platten Reifen, defekte Pflüge und Maschinen. Neben einer Scheune wächst das Gras über einen roten Mitsubishi ohne Nummernschild, und an dem mit einer Kette verschlossenen Scheunentor hängt ein Schild: »Unbefugten ist das Betreten verboten! LPG ›Sonnenstrahl‹ Lichtenhain.«
Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll.
Und dann sehe ich, an ein verfallenes LPG-Gebäude im rechten Winkel angebaut, ein … ich reibe mir die Augen, weil die Sonne blendet … ich sehe … reibe mir noch einmal die Augen … ich sehe ein langes, eingeschossiges weißes, an den Giebelseiten mit blauem Schiefer verziertes Haus. Weiße Holzpfeiler tragen einen weißen umlaufenden Balkon. Sprossenfenster.
Ich versuche mich zu erinnern, wo ich solche flachen, schönen weißen Holzhäuser schon gesehen habe. Am Meer, in der Nähe der Seebrücke, an der Strandpromenade. Und in Afrika! Die Villen der weißen Farmer in »Jenseits von Afrika«.
Aber ich stehe in Lichtenhain, an der Grenze zwischen Thüringen und Bayern.
Vor einer barackenähnlichen ehemaligen LPG-Werkstatt schneidet ein Mann auf der Kreissäge dicke Holzstämme. Ringsumher auf dem Hof stehen schon viele mit Draht verzurrte, ordentlich geschichtete Holzmeiler. Dillbündel hängen an der Hauswand. Auf einem großen Sieb trocknet ein einzelner Steinpilz, und auf einem vielleicht fünf Quadratmeter kleinen Beet wachsen so viele Gemüsearten, wie ich es auf solch winziger Fläche noch nie gesehen habe. Erdbeeren, sechs Stangenbohnen, sechs Krautköpfe, Sellerie, Buschbohnen, Kohlrabi, Porree, Möhren, Schoten.
Als er mich bemerkt, schaltet der Mann die Säge aus. Er wird an die Fünfzig sein, trägt derbes Uniformzeug mit dem runden Emblem der »DDR-Zivilverteidigung«.
»Dabeigewesen?«
Er lacht. »Nee, ich habe das erst nach der Wende gekauft. Hält ewig, das Zeug.«
Ich frage ihn nach dem weißen Afrika-Haus, das hier wie Helena zwischen den verrotteten LPG-Gebäuden steht.
»Die Geschichte ist eigentlich zu lang für einen Schwatz in der Sägepause, aber … Also: Die Tochter eines Lichtenhainer Zimmermanns ist 1957 nach dem Medizinstudium in den Westen gegangen. Sie war damals in der BRD wohl die jüngste Ärztin und hat sich für einen Einsatz nach Afrika, nach Uganda, gemeldet. So was wie ein weiblicher Albert Schweitzer. Wegen ihres Engagements ist sie dort eine geehrte und geachtete Frau. Während des Bürgerkriegs hatten zwanzig Rebellen ihr Auto beschlagnahmt und wollten es mitnehmen. Das müssen Sie sich vorstellen, eine Frau allein gegen zwanzig mit MPi bewaffnete Rebellen. Aber sie hat gesagt: ›Ich brauch das Auto. Denken Sie doch an Ihre Kollegen, wenn die verwundet sind, kann ich mit dem Auto auch Ihre Kollegen retten.‹« Er sagt wirklich »Kollegen«. »Sie ließen ihr das Auto. Solch eine Frau ist das, unsere Lichtenhainer Frau Professor Ellmer aus Afrika!«
Nach der Wende ist sie nach Lichtenhain zurückgekommen und hat die – noch von ihrem Vater gebaute – heruntergewirtschaftete LPG-Traktorenwerkstatt zu einem Wohnhaus umbauen lassen. »Im Sommer wohnt sie hier, im Winter arbeitet sie in Uganda.« Im Moment sei sie leider verreist. Sie habe ein Buch über ihr Leben geschrieben: »Die Bettelfrau von Buhinga«. Der kleine Verlag, der es herausbrachte, ist auch an der ehemaligen Grenze zu Hause, in Föritz.
»Im Osten?«
»Ja, im Osten.«
Ich frage ihn, wer die alten LPG-Gebäude noch nutzt. Ein Westdeutscher hat die Gebäude und die Ländereien gekauft. Aber die Ställe in Lichtenhain werden nur gebraucht, wenn Tiere krank sind und in Quarantäne müssen.
Bevor ich mich verabschiede, frage ich nach dem Weg zur Gaststätte. »Die hat heute Ruhetag.« Und der Dorfladen? Er lacht, nicht schadenfroh, aber spitzbübisch. »Der hat gerade für ein paar Stunden geschlossen.« Heute mußte die Martha, was diejenige ist, die den Laden betreibt, hinauf nach Gräfenthal, um Ware zu bestellen und auf der Bank Geld einzuzahlen. Die 81jährige läuft die acht Kilometer hin und oft auch wieder acht Kilometer zurück, weil kein Bus mehr fährt. Martha hat schon vor der Wende den Konsum im Dorf geleitet. »Als danach alle Konsumgeschäfte der Umgebung an einen Privatmann verkauft wurden, durfte die Martha zwar weiter verkaufen … Doch sie hat so lange weniger angeboten, bis …« Seine Frau, die inzwischen dazugekommen ist, unterbricht ihn: »Nee, Rolf, das kannste nicht sagen …« Er holt Luft, lacht. »Also bis sich der Laden nicht mehr …« – »Nee, Rolf, das kannst du wirklich nicht sagen …« – »… also bis der Laden sich nicht mehr rechnete und der neue Besitzer ihn loswerden wollte. Und da hat die Martha ihn schnell genommen, und seitdem ist er auch wieder rentabel und …« – »Nee, Rolf, das kannste nicht …«
Er selbst hat Arbeit als Werkzeugmacher bei »Plasta«.
»Unsereins hätte damals, als die Maschinen nach der Wende für einen Appel und ein Ei verkauft wurden, also unsereiner hätte wenigstens so viel Geld haben müssen, daß man sich ein paar von den Maschinchen hätte kaufen können. Aber das Geld dafür besaßen eben nicht wir, sondern die anderen.«
Rolf Scheibig schaltet die Kreissäge wieder an, und ich gehe hinüber zum weißen Afrika-Haus. Keine Gardinen oder Vorhänge vor den ebenerdigen Fenstern und Glastüren. Große Zimmer. An den Wänden hängen Felle afrikanischer Großwildkatzen. Tische und Sessel sind geschmückt mit afrikanischen Tüchern.
Während ich mir die Nase an den Scheiben platt drücke, kommt von nebenan, aus einer neuen Flachbauhalle, die einem modernen Heizhaus ähnelt, ein Mann mit unter dem Bauch gegürteten Jeans und kariertem Hemd. Er fragt mich sehr laut, was ich hier zu suchen hätte. Nach meiner Erklärung lädt er mich ein, die Halle zu besichtigen. Kein Heizhaus, sondern ein Werkzeugbetrieb für elektronische Schaltelemente. Der Mann ist der Chef.
»Schubart, Wolfhard – ja, mit ›d‹. Wir hatten in der DDR einen Sportreporter, der hieß auch Wolfhard – Wolfhard Kupfer.« Ich nicke bestätigend, und er wird gesprächig. Nach der Wende ist er der erste Bürgermeister in Lichtenhain gewesen. Seine Schwester – die seinerzeit in den Westen gegangen war und im Allgäu Besitzerin des Eloba-Stammbetriebes ist – hat damals in Lichtenhain einen Betrieb bauen wollen. Im August 1990 ist der Grundstein gelegt und im April 1991 mit der Produktion begonnen worden. Zwanzig Leute arbeiten in der Halle an alten WMW-Maschinen aus der DDR und modernsten Computerdrehbänken.
Ich frage ihn, ob er auch Arbeiter aus Bayern beschäftigt.
»Nein, wir hatten einen Wessi, einen aus Lauenstein. Den mußten wir entlassen. Der hat nur …« Er schnippt sich nach alter russischer Art mit Daumen und Zeigefinger an die Kehle.
Wolfhard Schubart hatte dreiunddreißig Jahre in dem volkseigenen Plasta-Betrieb gearbeitet. Nach der Wende war dort Schluß. »Was ohne das Geld meiner Schwester aus mir geworden wäre, weiß ich nicht.«
Im Zentrum von Lichtenhain sind das Spritzenhaus, Scheunen und alte Wohnhäuser mit Asbestschindeln verkleidet. Asbestschindeln mitten im Schiefergebirge! Nur ein paar Kilometer von den Gruben entfernt, in denen seit alters her Schiefer für Schiefertafeln, Schiefergriffel und Schieferschindeln, die die Häuser in dieser Gegend in blau geschuppte Karpfen verwandelt haben, gebrochen wird. Ich klingele an einem der nur schamvoll an den Kanten mit echten Schieferschindeln verzierten Wohnhäuser. Ein junger Mann in verwaschenem T-Shirt und in blauer Arbeitshose öffnet. Ich frage ihn, weshalb er hier mitten im Thüringer Schieferzentrum sein Haus mit diesem giftigen Asbestzeug …
»Weil es in der DDR keinen Schiefer zu kaufen gab. Der wurde gegen Devisen in den Westen geschickt. Sogar denkmalgeschützte Kirchen in der Gegend hat man mit Asbestschiefer gedeckt.«
»Und heute?«
»Heute kann man den Schiefer kubikmeterweise kaufen, aber kaum einer kann ihn und die Schieferdachdecker bezahlen.«
Er hat als Möbeltischler im VEB Werramöbel in Gräfenthal, der als einer der ersten Betriebe nach der Wende dichtgemacht wurde, gearbeitet. Mit seinem Bruder und dem Vater pachtete er einhundertsechzig Hektar Wiesen, auch Grenzland. »Wir lassen die Flächen nicht nur abweiden, sondern mähen sie im jährlichen Wechsel, was mühevoller und weniger rentabel ist. Aber man muß an die Natur denken, nicht nur an das Geld.«
Neunzig Muttertiere haben sie. Sie vermarkten das Fleisch selbst. Echte Thüringer Hausmacherwurst in Büchsen.
Da habe ich Hungriger also doch noch Glück in Lichtenhain. Ich will eine Büchse kaufen. Aber er schüttelt lächelnd den Kopf.
»Ist alles schon weg. Geschlachtet wird im Winter. Im Sommer holen auch wir unsere Wurst beim Fleischer.«
»Nicht eine einzige Büchse mehr?«
»Nein, keine einzige.« Nur ein Stapel Etiketten »Ackermanns gute Hausmacherwurst« liegt noch auf dem Fenstersims im Hausflur.
Er erklärt mir den Weg von Lichtenhain zurück zur Grenze. »Zuerst in Richtung Rennsteig und dann auf dem Rennsteig entlang bis zur ›Kalten Küche‹ bei Spechtsbrunn.«
Kalte Küche klingt gut.
Wieder allein im Wald, hoffe ich, daß ich noch am Abend in Spechtsbrunn ankomme. Die Wabenplatten des Kolonnenweges sind teilweise unauffindbar. Die Wäldler, erzählt mir später ein Bürgermeister dieser Gegend, haben sich daraus Wege zu ihren Gartenhäuschen gebaut.
Der Ackermann-Bruder rattert mir mit Traktor und angehängtem Mähwerk entgegen. Ja, ich sei noch auf dem richtigen Weg. Die Grenze verläuft genau am Rand der Weidefläche.
Dann verirre ich mich doch. Ich weiß nicht mehr, ob ich schon in Bayern oder noch in Thüringen bin, und laufe einen Kilometer an gelb blühenden, schnurgerade in einer Richtung stehenden Johanniskrautbüschen entlang, denn ich nehme an, daß sie an einer früheren Wegbegrenzung gewachsen sind. Johanniskraut, das natürliche Mittel gegen Depressionen. Ich versuche mir vorzustellen, wie Fremde aus Leipzig oder Dresden hier, ohne Karte und nur dem Gefühl folgend, nachts über die Grenze flüchten wollten. Und sich verirrten. Was noch das ungefährlichste gewesen sein wird …
Auf einer Waldlichtung liegen an die hundert große weiße Ballons, zusammengepreßtes und luftdicht mit Plaste verschweißtes Heu. Die Rißwunden der Ballons sind mit Heftpflaster verklebt. Manche riechen nach Weingärung, manche schon nach Silage. Nur hundert Meter davon entfernt, entdecke ich das erste an einen Baum genagelte »R«. Die ehemalige Grenze und der Rennsteig sind nun kilometerweit vereint. Und ich bin nicht mehr allein unterwegs. Rennsteig-Wanderer und Rennsteig-Radfahrer teilen mit mir den Weg.
In der DDR endete der Rennsteig schon bei Neuhaus. Ich erinnere mich noch an die erste organisierte Rennsteig-Wanderung. Das CDU-Ratsmitglied des Bezirkes Suhl für Tourismus, Werner Ulbrich, hatte Pressevertreter der DDR als Testwanderer eingeladen. Einhundertzwanzig Kilometer Rennsteig in fünf Etappen von Meura bis Neuhaus. Der Vertreter vom »Deutschen Sportecho« allerdings hat als einziger wegen Konditionsmangels bereits in Oberhof aufgegeben …
Eine Tafel an den Schildwiesen erinnert daran, daß am 28. 4. 1990 Tausende Wanderer den Rennsteig erstmals wieder von Bayern nach Spechtsbrunn in Thüringen entlanggelaufen sind. Unterschrieben ist sie vom Tettauer Bürgermeister Alfred Schaden und seinem Thüringer Amtskollegen Wolfgang Wiegand.
Wolfgang Wiegand will sich mit mir um achtzehn Uhr in Spechtsbrunn am Informationsgebäude des Naturparks neben der »Kalten Küche« treffen. Mich treibt der Hunger. Ich bin schon vor ihm an der verabredeten Stelle. Hier querte der Rennsteig die alte Handelsstraße Nürnberg–Leipzig. Auch heute herrscht hier noch geschäftiges Treiben. Ein Dieselaggregat, das einen fahrbaren Imbißstand mit Strom versorgt, tuckert und stinkt. Es gibt Kaffee, Bockwurst, Bratwurst, Suppen, Bier, Wasser. Gegenüber am Informationshäuschen, nur zehn Meter entfernt, steht noch ein Imbiß, ein stationärer mit Tischen und Bänken, und bietet Kaffee, Bockwurst, Bratwurst, Suppen, Bier und Wasser an. Die LKW-Fahrer essen am stationären Imbiß. Die Wirtin schimpft auf die Konkurrenz, die neuerdings gegenüber steht.
Ines – »Alle sagen nur Ines zu mir.« –, mit blauer Bluse, blauen, bis zum Knie hochgekrempelten Jeans und blauen Augen, ist von Beruf Chemielaborantin. Danach arbeitete sie im Konsum von Lichte, später hat sie in einem Behindertenheim gekocht. Nach der Wende arbeitslos, hat sie zuerst einen Broilerstand in Lichte aufgemacht und ist dann 1993 mit Bratwurst und Bockwurst hinauf zur »Kalten Küche«.
Sie wird jetzt auch nicht, sagt sie, vor der neuen mobilen Konkurrenz und ihren Vierzig-Cent-Kaffee-Dumpingangeboten kapitulieren. »Den Besitzer, der nicht mal selber verkauft, sondern billige Leute vom Arbeitsamt beschäftigt, kenne ich. Er stammt von hier, von Blechhammer. Er hat schon ein paar Imbißbuden laufen und vermietet Wohnungen …« Die nächsten Sätze spricht sie sehr gelassen aus: »Es ist nicht wahr, daß uns hier an der Grenze die Wessis kaputtmachen. Wir Ossis machen uns doch gegenseitig kaputt. Solidarität war mal, nun gilt nur noch: Wenn es um das Geld geht, ist einer des anderen Teufel. Aber die LKW-Fahrer, die kennen mich alle, die halten hier bei mir und nicht gegenüber bei diesen … diesen …«
Ich schlinge bei Ines zwei Bockwürste hinunter, ehe ich in das direkt an der alten Handelsstraße gelegene ehrwürdige holzverkleidete Gasthaus »Kalte Küche« gehe. Drinnen sitzen nur drei Gäste mit der Wirtin an einem Tisch. Sie ist, erzählt sie mir, 1932 geboren, genau in dem Jahr, als ihr Vater, ein Kellner, das Gasthaus erbaut hat. Seitdem lebt und arbeitet sie in diesem Haus. Als die Mutter 1980 starb, übernahm sie das Restaurant. Ich frage die 72jährige, wer es nach ihr weiterführen wird.
Die Tochter ist Bauingenieurin. Eine arbeitslose Bauingenieurin. Eine langzeitarbeitslose Bauingenieurin.
»Ab nächstes Jahr bekommt sie nur noch Sozialhilfe«, sage ich.
»Nein. Sie hat noch ein paar Versicherungen, die müßte sie zuvor verbrauchen und bekäme erst mal gar nichts.«
»Also wird sie deshalb lieber hier im Familienbetrieb, in der Küche oder in der Gaststube, arbeiten?«
»Vielleicht«, sagt die Wirtin. »Vielleicht.«
Das Haus hat schon viel überstanden. 1945 war ein deutscher Stab hier eingezogen, deshalb wurde es beschossen. Danach kamen die Amerikaner. »Und dann, die Schönsten, die Russen. Die quartierten sich ein, und wir mußten dreizehn Monate raus. Aber dafür kam in der DDR kein fremder Gast hierher, nur die Einheimischen mit Sperrgebietsausweis.«
Heute würden die Einheimischen lieber eine billige Bockwurst essen und ihr Bier bei Ines an der Imbißbude gegenüber trinken. Wenn nicht Bayern, wie die drei Stammgäste am Tisch, aus Tettau und Ludwigstadt herüberkämen, sähe es böse aus. »Die müssen noch nicht so auf das Geld schauen. Die trinken ihr Bier lieber gemütlich bei mir als bei der Ines. Und nun ist ja seit einer Woche noch ein Imbißwagen dazugekommen.«
Bürgermeister Wolfgang Wiegand fährt mit dem Auto vor. Der stattliche Mann trägt zwar keinen Schlips, aber mit seiner braunen Anzughose aus gutem Stoff und dem ordentlich gebügelten Hemd wirkt er eher wie der Oberbürgermeister einer kreisfreien Stadt als der Dorfbürgermeister einer Wäldlergemeinde am Rennsteig. Er könnte, was sein Wissen über die Historie seiner Gegend betrifft, auch Geschichtsprofessor sein, denn er gehört zu den Leuten, die mehr über die Vergangenheit der alten Häuser wissen als diejenigen, die drin wohnen. Im Informationszentrum liegen stapelweise von ihm verfaßte Handzettel. Über die Spechtsbrunner Kirche, die Herzog Georg II. 1911 als die »schönste Dorfkirche meines Sachsen-Meininger Landes« gepriesen hat, über die Geschichte des Berggasthofes »Brand«, zu dem ich gern hinaufgelaufen wäre, aber er liegt leider zehn Kilometer abseits von meiner Route und hätte den Zeitplan vollständig durcheinandergebracht. 1944 ließ die Geheime Staatspolizei Strom und Telefon auf den Berggasthof legen und dort eine Gestapo-Leitstelle errichten. Als die Nazis kurz vor dem Einmarsch der Amerikaner flohen, blieb die auf dem »Brand« versteckte wertvolle Bibliothek mit rund zehntausend Bänden Exilliteratur aus den besetzten Gebieten zurück, »Feindbücher«, geschrieben von Juden, Freidenkern, Kommunisten, Zeugen Jehovas … Die Wäldler aus den umliegenden Orten plünderten die Bibliothek. Bei seinem Großvater fand Wolfgang Wiegand kürzlich noch einige Exemplare wie das Buch der Jüdin Agatha Lasch, die als erste Professorin an der Hamburger Universität gelehrt hat und 1942 im KZ umgebracht wurde. Und die handschriftlichen erotischen Tagebücher einer Helferin, die ihre Sex-Abenteuer mit den Gestapoleuten auf dem »Brand« beschrieben hatte.
Auch über die »Kalte Küche« veröffentlichte Wolfgang Wiegand ein Merkblatt. Der Name der Gaststätte hat nichts mit Essen zu tun, sondern ist aus den Begriffen Calde – Grenze – und Kuche – kleine Kapelle – gebildet worden. Eine kleine Wegkapelle an der alten Heer- und Handelsstraße zwischen Nürnberg und Leipzig, die Lucas Cranach, Kurfürst Friedrich der Weise, Ablaßhändler Tetzel, Martin Luther, die Truppen von Kaiser Karl V. und fünfundzwanzigtausend Soldaten Napoleons entlanggezogen sind. Und vierzig Jahre lang die Grenzer …
»Genau hier, vor unserem Informationszentrum, befand sich der erste Grenzzaun. Die Posten, die zur Wache hineingingen, mußten ihn aufschließen und dazu eine Codezahl eingeben. Schlüssel ohne Codezahl nutzte sowenig wie Codezahl ohne Schlüssel.«
Wolfgang Wiegand hat in der DDR Maschinenbau studiert. Nach der Wende wurde er CDU-Kulturdezernent in Sonneberg und danach Bürgermeister der Großgemeinde Oberland. Dazu gehören vier Dörfer mit zweitausendfünfhundert Einwohnern, viel, viel Wald, zuwenig Kinder, in manchen Jahren gibt es nur noch zwölf Neugeborene … Aber ein fünf Hektar großes neues Gewerbegebiet hat er in Spechtsbrunn ansiedeln können. »Diese Industrieansiedlung sieht nicht schön aus, so direkt am Rennsteig, wo die Touristen vorbeiwandern. Im Dritten Reich durften fünfhundert Meter rechts und links vom Rennsteig keine Fabriken gebaut werden, heute verlangt der Gesetzgeber nur noch fünfundzwanzig Meter Abstand … Aber einhundert Arbeitsplätze …«
Der Bürgermeister hat recht. Wenn man von der Höhe kommt und die idyllisch an den sanften Berghängen stehenden schieferbedeckten Häuschen von Spechtsbrunn sieht, drängelt sich das Gewerbegebiet mit seinen blau, rot und gelb gestrichenen Hallen wie ein immerzu »Ich, ich, ich« schreiendes häßliches Kind in den Vordergrund. Aber ich werde es mir erst morgen anschauen. Für heute endet meine Grenz-Tour im Spechtsbrunner Hotel und Gasthaus »Zum Rennsteig«.
Von einem Saarländer, der im Spreewald transportable Klostühle findet, einem Schleusinger Tischlermeister, der in Spechtsbrunn Höfe fegt, und meinem Versuch, mich westfein zu machen
Die junge Frau am Tresen zeigt mir mein Zimmer im Obergeschoß. Kleine Bilder mit Alpenglühen hängen an den Wänden, und sauber abgestaubte tropische Kunstblumen stehen auf Fensterbank und Tisch. Auf dem Bett wölben sich dicke, mir aus der Kindheit gut vertraute Federkissen. Ich bin müde, aber als ich von der mit ihren rotblonden Haaren sehr norddeutsch aussehenden Frau, die Dolores heißt, erfahre, daß es außer Schnitzel, Bratwurst und Eisbein auch Saure Flecke – »mit Blut verfeinert, da schmecken sie lieblicher« – gibt, gehe ich noch einmal hinunter in die Gaststube.
Zwei ältere blonde Männer sitzen an einem Tisch, ein untersetzter Mann an einem anderen. Heute möchte ich mit niemandem mehr reden und setze mich an den noch freien Tisch, bestelle Rotwein und Flecke und lese die Zeitung. »Bundeskanzler Schröder verspricht in Polen anläßlich des 60jährigen Gedenktages des Aufstandes im Warschauer Ghetto, daß die Bundesregierung keinerlei Besitzansprüche von deutschen Vertriebenen akzeptiert.«
Während ich lese, kann ich nicht umhin, den Biertrinkern am Nachbartisch zuzuhören. Der eine hat endlich eine Handyverbindung. »Ob ich heiser bin?« schreit er. »Nein, nicht erkältet, mein Schatz … Morgen laufen wir den Rennsteig bis nach Limbach … Ja, die Rucksäcke sind sehr schwer … Aber wenn man sie erst aufhat … Transportieren lassen? … Das kostet 20 Euro von einem Gasthaus zum anderen … So teuer wie die Unterkunft … Die Landschaft? … Sehr schön … Und die Leute? … Nett … Wie sie leben? … Na ja, weiß ich nicht … Immer noch ein bißchen Zone hier … Morgen ruf ich nicht an … Muß ja nicht jeden Tag sein … Wird zu teuer … Mach’s gut, Schatz.«
Danach stellen sich die beiden Wanderer dem Gast am Nebentisch vor. Sie stammen aus Weida (früher DDR). Der eine ist in den Westen gegangen, weil er kein Abitur machen, der andere, weil er nach dem Abitur nicht studieren konnte. Beide leben jetzt im Badischen. Der Untersetzte am Nachbartisch kennt Weida. Am Platz der Freiheit hat er mal alte Türklinken mitgenommen …
»Der Freiheitsplatz«, sagt der große Blonde, »hieß früher Wilhelmsplatz. Dann Platz der SA. Dort bin ich noch als Pimpf marschiert. Danach war es immer der Platz der Freiheit, selbst in der DDR.«
Den Mann am Nachbartisch müssen die beiden nicht fragen, woher er kommt und was er macht. Er erzählt ungefragt sehr schnell und sehr viel von sich und lacht. »Bei mir ist alles umgekehrt. Ich bin im Saarland sieben Kilometer neben Honecker geboren.« Nach der Wende ist er mit Sechsundvierzig in den Osten gegangen, zuerst als Vertreter für Euro-Clean, Reinigungsmittel für Gaststätten, Arztpraxen, Krankenhäuser, Altersheime … War Tag und Nacht unterwegs, den Osten rauf und runter und rüber und nüber. Er kenne jede Stadt, jeden Winkel hier und habe sehr schnell bemerkt, welche Schätze es noch gebe. »Im Spreewald beispielsweise habe ich kistenweise Flachsspindeln, alte Tontöpfe und so ein Zeug auf den Böden gefunden.« Manchmal allerdings sei er zu spät gekommen wie in Gera. »Da hatten die in den alten Häusern die wertvollen Holztüren schon rausgedroschen, alles auf den Schutt gebracht, nur noch Löcher drin in den Häusern. Ist eben runtergekommen, das Gera, sag ich Ihnen …«
Aber noch heute treibt er Raritäten auf. Neulich hat er im Spreewald einen wertvollen, oben mit Samt verkleideten, transportablen Klostuhl gefunden. »Unten eine Kiste mit Topf und hinten ein Rohr mit Sand gefüllt, Hebel drücken, und Sand rieselt runter in den Topf.« Für 600 Euro hat er das Klo nach Braunschweig verkauft.
Ich, der ich bisher stumm dagesessen und mir nur ein paar Gesprächsbrocken so auf den Zeitungsrand geschrieben habe, als ob ich das Kreuzworträtsel lösen würde, frage: »600 mit oder ohne Sand?«
»Mit. Sand gibt es genug in der Lausitz«, belehrt er mich. Ich weiß das, ich habe acht Jahre dort gelebt. Er hat sich, erzählt er, in Dissenchen bei Cottbus auf einem fünftausend Quadratmeter großen Grundstück ein sehr geräumiges Haus gebaut. »Hundert Quadratmeter Garten für meine Frau. Sechzehn Meter langes Carport, zwei Garagen. Man kann es auch im Osten zu was bringen.« Er fährt immer noch als Vertreter für Reinigungsmittel, aber gleichzeitig als Aufkäufer von Antiquitäten umher und klagt, daß die Geschäfte, seit die Polen in die EU aufgenommen worden sind, nicht mehr so gut laufen. »Ich habe viele Haushalte von Alleinstehenden – dort sind die meisten Schätze zu finden – für 400 bis 1000 Euro aufgelöst. Jetzt kommen die Polen und machen es umsonst. Die räumen alles raus, auch das, was niet- und nagelfest ist, und übergeben die Zimmer besenrein. Außerdem – obwohl die Ostdeutschen weniger jammern als die Westdeutschen – werden die Zeiten immer schlechter. Da hören die Leute jeden Tag im Radio, daß wir immer ärmer werden, weniger Rente, weniger Stütze, weniger Lohn, und da stehe ich da mit meinem alten schönen Vertiko für 500 Euro. Und niemand will es.«
Dolores deckt die Frühstückstische. Ohne das blau-grün umrandete, dicke weiße Porzellan umzudrehen, sagt er: »Konsumgaststätten-Geschirr. Mitropa hat noch ein ›M‹ drauf. Das habe ich mir kartonweise umsonst besorgt. Manche Leute kaufen es heute wieder.«
Als die beiden Rennsteig-Wanderer schlafen gehen, will er mit mir reden und gibt mir seine Euro-Clean-Werbezettel: Peter Brück. Ich entschuldige mich, daß ich müde bin und hinaufgehen werde und auch keine Reinigungsmittel brauche.
»Macht nichts, aber wenn Sie mal nach Cottbus kommen, besuchen Sie mein Antiquitätengeschäft … oder wenn Sie was haben … oder was wissen wollen über den Osten … ich besorge Ihnen alles und weiß alles.«
Endlich bin ich allein. Und obwohl hundemüde, habe ich plötzlich das Bedürfnis, noch mit irgend jemandem zu sprechen.
»Gut, trinken wir noch ein Bier und reden wir«, sagt der Mann von Dolores, als ich zurück in die Gaststube komme. Ich erkläre ihm, wer ich bin, und bitte ihn, von sich zu erzählen. Der 38jährige spricht leise, stockend – ich muß immer wieder nachfragen.
»Ich bin kein Gastwirt, sondern Werkzeugmacher. Nur manchmal, wenn die Schwiegereltern nicht hier sind, helfe ich meiner Frau.« Er dreht sich aus feinem Tabakverschnitt eine Zigarette. Mit seinen hervorstehenden Backenknochen sieht er, wenn er die Augen wegen des Rauchs zusammenkneift, ein bißchen asiatisch aus.
Er hat seine Frau Dolores bei einem Kirchentreffen kennengelernt. Sie liebten sich, aber Dolores konnte die Eltern mit der Gastwirtschaft im Sperrgebiet nicht allein lassen, und er durfte sie dort nicht besuchen.
»Wir hatten in der Nähe von Eisenach selbst Landwirtschaft, und meine Eltern brauchten mich auch. Aber ich hab mich entschieden, zu ihr ins Sperrgebiet zu ziehen. Mutter schimpfte damals: ›Komm mir ja nicht wieder und jammere mir die Ohren voll!‹«
Ein halbes Jahr lang überprüften ihn die »Organe«, dann durfte er nach Spechtsbrunn ziehen. Manchmal half er seiner Frau in der Gastwirtschaft. »Wir machten um acht Uhr auf. Um neun Uhr kamen die LKW-Fahrer. Danach die Waldarbeiter. Der Förster. Die Handwerker. Eben alle, die nicht in der Fabrik an einer Maschine standen. Und ab vierzehn Uhr tranken die Grenzer hier ihr Bier. Es war immer rappelvoll. Das Bier lief und lief. Man verdiente nicht viel. Fünf oder zehn Pfennige am Liter. Aber die Menge brachte es. Es wäre noch lange so gut weitergegangen.«
Dann kam die Wende. Er ist nicht sofort mit der ersten Demonstration der Spechtsbrunner nach Tettau marschiert, sondern erst später mit einem Freund. »Als wir zurückkamen, fragten die Grenzer: ›Was mitgebracht?‹ Mein Freund sagte: ›Nur Kekse, Cola und Kondome!‹ Ich hatte drüben nur eine Wurstsemmel gegessen und ein Bier getrunken. Hätte ich hier auch haben können. Aber es war eben eine Westsemmel und ein Westbier.«
1990 lief das Geschäft noch gut. Zwar blieb, obwohl das Bier noch billig war, plötzlich die Hälfte der Einheimischen weg – »Wahrscheinlich die verpflichteten Grenzlauscher, die nun nichts mehr zu lauschen und zu melden hatten.« –, aber die Neugierigen aus Ost und West, die früher nicht ins Grenzgebiet reingekommen waren, saßen in der Kneipe.
»Und heute?«
»Das sehen Sie ja. Rennsteig-Wanderer, weil das Haus direkt am Kammweg liegt. Aber das Bier ist teuer, man muß an einem soviel verdienen wie früher an zehn. Manchmal kochen wir sonntags Braten und Klöße, und keiner kommt zum Essen. Man sitzt und wartet und wartet und wartet. Abends im Bett fragt man sich: Das war’s? Das war nun ein Tag in deinem Leben?«
Er dreht sich eine neue Zigarette, holt noch ein Bier. »Wissen Sie, ich bin ein Fremder in Spechtsbrunn geblieben. Als ich hierherzog, tratschten die Leute: ›Den hat uns die Stasi geschickt, der soll uns nur an der Grenze aushorchen.‹ Liebe galt für sie nicht als Grund, hierherzuziehen. Und so denken manche immer noch. Ich habe meine Akte verlangt. Es steht nichts drin. Das zählt für die Leute hier nicht.« Lange Pause. Dann, sehr nachdenklich und leise: »Man macht doch keine zwei Kinder, nur um Leute aushorchen zu können. Unsere Kinder sind für mich das größte, der Sinn meines Lebens. Was will man denn sonst noch? Hoch hinaus? Nee. Ich bin zufrieden. Man muß bewahren, was einem anvertraut ist.«
Gegen Mitternacht sagt er, daß er um drei Uhr aufstehen muß. Er hat Frühschicht drüben im Glaswerk Heinz in Tettau, in Bayern. Seit vierzehn Jahren ist er dort Lagerarbeiter.
Ich entschuldige mich. »Das konnten Sie nicht wissen«, sagt er. »Außerdem war es gut, mit Ihnen zu reden.«
Ich danke ihm und sage, daß ich nun besser schlafen werde unter dem geblümten schweren Deckbett.
Am nächsten Morgen machen sich die aus Ostdeutschland stammenden und im Westen wohnenden Rennsteig-Wanderer, nachdem sie sich von Dolores einen Stempel in ihr Wanderbuch haben drücken lassen, auf den Weg nach Limbach, und der aus Westdeutschland stammende und im Osten wohnende Reinigungsmittelvertreter begibt sich auf die Tour in Richtung Eisenach. Und ich gehe zur Spechtsbrunner Kirche.
In den Gärten stehen Pfeife rauchende Förster, bebrillte Großväter und Großmütter als Gartenzwerge. Dazu Windmühlen und stilisierte Störche. In den Fenstern Kunstblumen. »Hier oben ist lange Winter, aber wir Wäldler lieben das Bunte«, sagt mir ein freundlicher Mann im Rollstuhl. Auf den Teppichstangen vor den Häusern hängen dicke rote Inlettfederbetten in der Frühsonne. Und die alten Frauen grüßen, als müßten sie ihnen Benehmen beibringen, die vorbeigehenden Touristen zuerst.
Die Tür der schiefergedeckten Kirche aus dem Jahr 1746 ist verschlossen, aber Frau Eschrich, die neben der Kirche wohnt, schließt sie mir auf. Es riecht wie in einer Tischlerei nach frischem Holz. Eine Bauernkirche mit bunten Holzsäulen und Blumenornamenten an der Holzdecke. Blau und Grün dominieren. Aber im farbigen Gestühl und in den farbigen Balken der Emporenbrüstung leuchtet frisch eingesetztes Holz. Der Vorraum ist völlig neu gezimmert.
Alles sei vom Pilz befallen gewesen. 1990 begann die Rettungsaktion. Die Fußböden mußten herausgerissen werden, neue Holzstücke paßgenau in die herausgeschnittenen pilzbefallenen Wunden gesetzt werden. Die meisten Spechtsbrunner, gleich ob Christen oder Atheisten, haben viele Stunden, viele Tage und Wochen umsonst gearbeitet.
»Einer der Fleißigsten«, sagt Frau Eschrich, »ist der Porzellanmaler Schmidt. Sie finden ihn in seiner Werkstatt an der Hauptstraße. Im Schaufenster stehen Porzellanfiguren.«
An der Werkstatt hängt ein rundes Porzellanschild mit Lasurschrift: »Kunden bitte hier läuten!« Aber die Klingel darunter funktioniert nicht mehr. Ich läute an der Wohnungstür. Er kommt, fragt, was ich kaufen möchte. Dreißig Jahre lang hat er als Maler in der Porzellanfabrik Spechtsbrunn gearbeitet. Als die schloß, wurde er Gemeindearbeiter, und in seiner Freizeit – »Ich kann’s halt nicht lassen.« – bemalt er Rohlinge und brennt sie.
Seit 1990 hilft er bei der Restaurierung der Kirche. »Am Anfang gab es reichlich Fördermittel von überall. Da standen die Architekten und Holzgutachter hier Schlange. Eine Zeichnung – eine Rechnung. Ein Gutachten – eine Rechnung. Nur wir Spechtsbrunner haben alles umsonst gemacht. Ich glaube, die, die Geld besitzen, tun nichts mehr umsonst, nur die kleinen, weniger reichen Leute leisten sich hierzulande noch Ideale.« Inzwischen steht das Schild »Denkmalgeschützt« an der Kirche. Aber das nutzt nichts. Der Landkreis hat für Kirchenrestaurierung nichts mehr im Säckel.
In einiger Entfernung hält an der Hauptstraße ein kastenförmiges Auto, klappt die rechte Seitenfläche wie einen Flügel nach oben und hupt. Daraufhin laufen zwei oder drei Frauen hinüber zur mobilen »Rennsteig-Bäckerei«. Ich habe mir zwar heute zwei Not-Semmeln aus dem Gasthaus mitgenommen, aber als der Flügel wieder eingezogen wird, renne ich trotzdem zu dem Wagen. Er hält noch einmal, fährt die Klappe wieder aus. Die junge Verkäuferin ist ärgerlich, weil ich nichts kaufe, erklärt mir dann aber freundlich, doch in Eile, daß sie, weil es in den kleinen Dörfern keine Bäcker mehr gibt, täglich an die zwanzig Orte abfährt. Sie ist siebenundzwanzig Jahre alt, Kauffrau für Bürotechnik und ohne Job.
Ob sie als »Ostbäckerei« auch Dörfer in Bayern beliefert, frage ich. Sie nickt.
»Und gibt es Unterschiede beim Einkaufen?«
»Die Frauen drüben kaufen frühmorgens zwei frische Semmeln oder ein halbes Brot, warten aber, bis am Nachmittag ein anderes Auto kommt, um frischen Kuchen zu kaufen. Hier bei uns kaufen die Frauen Kuchen, Brot und Brötchen auf einmal. Oft mehr, als sie gerade brauchen. Die Vorratswirtschaft steckt noch drin.«
Von Spechtsbrunn zur Grenze laufe ich wieder am Gewerbegebiet vorbei. Ich wäre wahrscheinlich vorbeigegangen – in der Sonne funkeln die Hallen wie viereckige Aluminiumbrotbüchsen oder verzierte Glassärge –, hätte mir der Mann von Dolores gestern nacht nicht erzählt, daß es dort eine Agentur gibt, die Zeitarbeit vermittelt. Ich könnte ja mal nachfragen … Ich studiere die Firmenschilder: Plastbearbeitung. Siebdruck. Maschinenbau.
Vor dem Siebdruck kehrt ein vielleicht 50jähriger Mann den Dreck am Bordstein zusammen. Er kennt die Jobvermittlung nicht, denn er ist erst seit zwei Tagen hier, selbst von einer Agentur in Sonneberg vermittelt.
Er kommt aus der Nähe von Schleusingen, aus Hinternah, und ergänzt, wie um mir den Ort dadurch vertraut zu machen: »In Hinternah wohnt die frühere PDS-Chefin, die Frau Zimmer.«
»Was sind Sie von Beruf?«
»Tischlermeister. Das heißt, zuerst nur Industriemeister. Aber weil man den in der BRD nicht anerkannte, habe ich mich 1992 mit meinen fünfundvierzig Jahren noch einmal auf die Schulbank gesetzt und mühsam meinen Handwerksmeister gemacht. Über 20000 dafür bezahlt.« Danach arbeitete er mit einem Zimmermeister in Suhl zusammen. Aber das sei nicht gutgegangen. Allein konnte er sich anschließend nicht selbständig machen, denn er hatte kein Kapital mehr, und die Bank gewährte keine Kredite.
Er kehrt schweigend weiter, flucht dann aber: »Und das hier: Sklavenhandel! Moderner Sklavenhandel!« Für neun Monate habe er bei der Zeitarbeitsfirma, die ihn nun an Betriebe ausleihe, unterschrieben. Vorige Woche hat er in Kassel Fenster eingesetzt, nun kehrt er hier in der Glasfabrik den Hof.
»Und der Lohn?«
»Ich habe es durchgerechnet. Drei Euro und sechzig Cent in der Stunde auf die Hand.« Davon muß er noch das Benzin für die rund einhundert Kilometer Fahrt täglich bezahlen. Sein Vater ist beinamputiert. Er sitzt in Hinternah im Rollstuhl und braucht ihn jeden Tag.
Zwischen Holzcontainern mit Medizin- und Kosmetikfläschchen finde ich den Weg zur Verwaltung des neuen Glasbetriebs. Die Tür der Geschäftsleitung steht sperrangelweit offen. Ein halbes Dutzend Frauen und Männer wuseln und reden durcheinander. Vorsichtig frage ich nach dem Chef.
»Jürgen, hier ist jemand für dich«, ruft eine Frau in die Runde. Sie spricht fast hochdeutsch, der Chef dagegen Sunbarger Dialekt. Er hat in Sonneberg als Ingenieur in der »PIKO« gearbeitet, nach der Wende bei »Märklin«.
Eine bayerische Firma, teilweise vom Siebdruck Röser aus Tettau übernommen, hat ihn nun als Geschäftsführer eingesetzt. Wenn sie voll produzieren, beschäftigen sie etwa achtzig Leute.
»Fest eingestellte?«
»Rund vierzig Festangestellte und, je nachdem, wie die Auftragslage sich entwickelt, noch dreißig bis vierzig Leiharbeiter. Mit Leiharbeitern ist man flexibler.«
In seinem Büro hängt ein Spruch: »Zukunft hat man nicht, man schafft sie sich.« Ich frage, ob er sich den selbst ausgesucht und aufgehängt hat.
Er nickt. »Hier hing noch ein zweiter: ›Wer keine Feinde hat, hat keinen Charakter.‹ Aber meine große Chefin aus Tettau hat darauf bestanden, daß er entfernt wird.«
Ich frage ihn, wieviel der Betrieb der Zeitarbeitsfirma pro Stunde für einen Leiharbeiter zahlen müsse.
»Etwa zwölf bis dreizehn Euro.« Mit dem Tischlermeister aus Hinternah habe er schon gesprochen, er wolle versuchen, ihn länger zu behalten.
Als ich mich verabschiede und erzähle, daß ich jetzt nach Tettau gehe und auch dort unangemeldet in ein oder zwei Betriebe wolle, schaut er meine abgeschnittenen, ausgefransten kurzen Jeanshosen sehr kritisch an und rät mir, eine lange Hose anzuziehen, wenn ich dort einen Geschäftsführer sprechen wolle.
Der Weg nach Tettau gefällt mir. Er geht über abgemähte Wiesen gemütlich bergab, und ich vermeide es, daran zu denken, daß ich irgendwann wieder hinauf muß.
Das Eingangsschild zum »Markt Tettau« steht genau an der Grenze zwischen Thüringen und Bayern. Ich setze den Rucksack ab, krame die lange Hose heraus. Verspotte mein Tun, ziehe mich aber trotzdem um. Mache mich »westfein«.
Von einem Bürgermeister, der nicht »Schande«, sondern »Schaden« heißt, einer türkischen Moschee im bayerischen Tettau und den Bettel-Aktenordnern eines ehrlichen Wende-Wohltäters
Am ersten Haus fuhrwerkt ein Mann mit einer großen Heckenschere in seinen Sträuchern herum. Ich sage freundlich guten Tag und erkundige mich nach Bürgermeister Alfred Schaden und den Betrieben in Tettau. Er sagt, daß er keine Zeit habe. Ein stummer Wegweiser hilft mir weiter: »Königlich privilegierte Porzellanfabrik Tettau. 500 Meter. Geradeaus.«
Da ich den Verwaltungsaufgang der »Königlich Privilegierten« nicht finde, frage ich im Fabrikverkaufsladen eine sehr damenhaft aussehende, reich beringte blonde Frau mit glitzerndem Ausschnitt an ihrer Bluse nach dem Geschäftsführer.
»Den Herrn Prokuristen, den Herrn Hopf?«
Ich nicke. Wen sie melden dürfe.
»Einen Schriftsteller aus Thüringen.«
Sie telefoniert. Der Geschäftsführer sagt bedauernd, daß er leider … also unangemeldet und überhaupt … keine Zeit habe. Mir ist warm in meinen langen Hosen. Aber im Geschäft umziehen? Nein.
Die mondäne Dame erklärt mir, daß sie hier im bayerischen Grenzzipfel – »reingesteckt wie in einen Sack« – früher auch für fünf Mark arbeiten mußten. »Wir kennen das, und die im Osten sollen sich heute bloß nicht beschweren.«
Die königliche Porzellanfabrik hat nach der Wende die ostdeutschen Porzellanfabriken in Scheibe-Alsbach, Plaue, Unterweißbach und Volkstedt aufgekauft. Drei davon sind inzwischen geschlossen und die erfahrenen Gestalter teilweise in Tettau übernommen. Im Fabrikladen stehen noch die ostdeutschen Spezialitäten. In der Porzellanfabrik Plaue konnte man sich nach einem Foto modellieren und daraus eine wiedererkennbare Porzellanfigur brennen lassen. Hochzeitspaar, Bundeswehroffizier, Goldjubelpaar … Je 50 Euro. »Natürlich kann man sich auch als Akt abformen lassen«, erklärt die Frau. »Aber die stellen wir hier nicht aus.«
Die Zeiten würden schlechter, meint sie. »Früher haben die Amerikaner jede Menge Napoleons und porzellanene Prinzen gekauft. Hochnäsig und arrogant waren die ja schon immer, die Amerikaner. Aber sie haben wenigstens gekauft. Doch nach dem 11. September ist nichts mehr mit den Amis …«
Ob ich etwas kaufen möchte?
»Nein«, sage ich, »mein Rucksack ist schwer genug.«
Am Marktbrunnen erleichtere ich den Rucksack um das Wasser und die Brötchen. Ich staune, weil mit mir und einem alten Ehepaar nur junge Türken um den Brunnen sitzen. Ich grüße »Merhaba« und freue mich, daß sie sich freuen. Sie sprechen gut Deutsch, fragen, wo ich zu Hause sei. Suhl kennen sie nicht. »Ost oder West?« Als ich geantwortet habe, stehen zwei ruckartig auf. Einer spuckt vor mir auf dem Boden aus, der andere schreit: »Ihr klaut uns die Arbeit! Verkauft euch noch billiger als wir Türken. Aber wir schon hier gearbeitet, als ihr noch eingesperrt. Allah strafe euch! Ihr … Ihr … verdammten Ossis.« Die beiden gehen sehr schnell weg, die übrigen trollen sich auch. Das alte Ehepaar sagt nur: »Schlimm! Sehr schlimm, die Zeiten heutzutage!«
Ein graues kastenförmiges Auto hält nebenan, hupt. Die Klappe öffnet sich. Eine mobile Gemüsehandlung. Die erste Frau möchte Kirschen kaufen. »Kirschen habe ich heute nicht mitgenommen, die sind noch zu teuer. Warten Sie, bis der Preis runtergeht.« Sie kauft eine Melone. Eine ältere Frau bringt Papiertüten mit. »Die können Sie sicher noch einmal verwenden.«
Der Verkäufer wiegt jeden Posten sorgfältig ab, rechnet, schwatzt, bedankt sich freundlich. Seit vierzehn Jahren fährt Klaus Milich mit seinem Gemüseauto umher. Er hat das Geschäft von seinem Vater übernommen.
»Waren Sie nach der Grenzöffnung auch im Osten?«
»Na ja, anfangs mit Bananen.« Jetzt fährt er nur noch mit Kartoffeln hinüber.
»Weshalb mit Kartoffeln?«
»Weil die drüben sich noch freuen, wenn ich sie ihnen in den Keller trage. Die geben auch ein Trinkgeld. Hier dagegen …«
Ich frage nach Bürgermeister Alfred Schaden. Eine Frau, die Pfirsiche kauft, meint, daß ich den Bürgermeister um diese Zeit wahrscheinlich nicht antreffen werde. Erstens arbeitet er nach über fünfundzwanzig Amtsjahren jetzt ehrenamtlich, um der Gemeinde Geld zu sparen. Und zweitens ist er oft nur von Viertel vor sieben bis gegen neun Uhr im Büro. Anschließend mischt er sich unter das Volk. Ja, auch in der Kneipe.