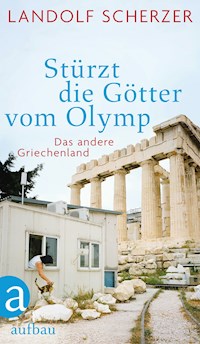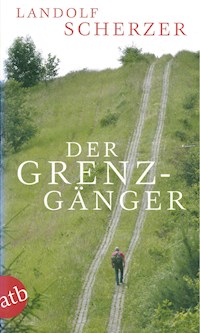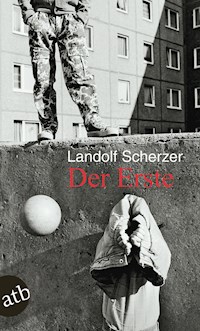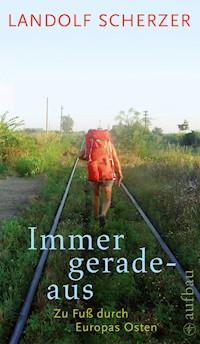9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
"Schreib das auf, Scherzer!" Günter Wallraff.
Nach der Wende begleitete Landolf Scherzer den Landrat im thüringischen Bad Salzungen bei seiner Arbeit und erfuhr dabei ein einzigartiges Spektrum von zeittypischen Schicksalen, Aufgaben und Schwierigkeiten. Eine Reportage entstand, so spannend und unglaublich wie die Realität.
„Scherzer schildert mit Anteilnahme und unaufdringlichem Witz, wie die kleinen Leute den großen Prozeß der Vereinigung erleben. Wie unter der Lupe sind im Mikrokosmos Bad Salzungen die Verwerfungen und Verkrampfungen zu besichtigen, die überall die Nachwendezeit im Osten prägen. Das ist Geschichtsschreibung von unten, aus dem Blickwinkel der Betroffenen. Scherzers Nahaufnahmen haben Tiefenschärfe.“ DER SPIEGEL.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 366
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über Landolf Scherzer
Landolf Scherzer, 1941 in Dresden geboren, lebt als freier Schriftsteller in Thüringen. Er wurde durch Reportagen wie »Der Erste«, »Der Zweite« und »Der Letzte« bekannt.
Im Aufbau Taschenbuch sind ebenfalls seine Bücher »Der Grenzgänger«, »Immer geradeaus. Zu Fuß durch Europas Osten«, »Urlaub für rote Engel. Reportagen«, »Fänger & Gefangene. 2386 Stunden vor Labrador und anderswo«, »Madame Zhou und der Fahrradfriseur. Auf den Spuren des chinesischen Wunders«, »Stürzt die Götter vom Olymp. Das andere Griechenland«, »Der Rote. Macht und Ohnmacht des Regierens« und »Buenos días, Kuba. Reise durch ein Land im Umbruch« lieferbar.
Informationen zum Buch
»Schreib das auf, Scherzer!« Günter Wallraff.
Nach der Wende begleitete Landolf Scherzer den Landrat im thüringischen Bad Salzungen bei seiner Arbeit und erfuhr dabei ein einzigartiges Spektrum von zeittypischen Schicksalen, Aufgaben und Schwierigkeiten. Eine Reportage entstand, so spannend und unglaublich wie die Realität.
»Scherzer schildert mit Anteilnahme und unaufdringlichem Witz, wie die kleinen Leute den großen Prozeß der Vereinigung erleben. Wie unter der Lupe sind im Mikrokosmos Bad Salzungen die Verwerfungen und Verkrampfungen zu besichtigen, die überall die Nachwendezeit im Osten prägen. Das ist Geschichtsschreibung von unten, aus dem Blickwinkel der Betroffenen. Scherzers Nahaufnahmen haben Tiefenschärfe.« DER SPIEGEL
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Landolf Scherzer
Der Zweite
Inhaltsübersicht
Über Landolf Scherzer
Informationen zum Buch
Newsletter
Buch lesen
Der Probetag
Der erste Tag
Gespräche mit dem Landrat (1)
Der zweite Tag
Gespräche mit dem Landrat (2)
Der dritte Tag
Der vierte Tag
Gespräche mit dem Landrat (3)
Der fünfte Tag
Gespräche mit dem Landrat (4)
Der sechste Tag
Gespräche mit dem Landrat (5)
Der siebente Tag
Gespräche mit dem Landrat (6)
Der achte Tag
Gespräche mit dem Landrat (7)
Der neunte Tag
Gespräch mit den Eltern vom Landrat
Der zehnte Tag
Gespräche mit dem Landrat (8)
Der elfte Tag
Gespräche mit dem Landrat (9)
Der zwölfte Tag
Gespräche mit dem Landrat (10)
Der dreizehnte Tag
Gespräche mit dem Landrat (11)
Der vierzehnte Tag
Gespräche mit dem Landrat (12)
Die Demonstration
Gespräche mit dem Landrat (13)
Frühe Herbsttage
Gespräch mit der Frau vom Landrat
Späte Herbsttage
Der Kampf um den Landratsposten
Letzte Erkundungen
Impressum
Mit * gekennzeichnete Namen wurden geändert.
Die Welt scheint an diesem 92er Novembermorgen verdreht zu sein. Denn obwohl die endlose Lichterschlange nur ruckweise aus der Stadt Bad Salzungen herauskriecht und mit mir lediglich einzelne Autos in die – so kenne ich das noch – »Kreis- Garnisons- Kur- und Industriestadt« hineinfahren, sind die Straßen und Plätze vor dem Landratsamt mit parkenden Wagen verstopft. Ich stelle meinen PKW notgedrungen auf den früher überfüllten und heute fast leeren Parkplatz des größten Betriebes der Stadt, des Kaltwalzwerkes.
Die Tür zum Landratsamt steht offen. Ein beschlipster Pförtner sitzt gelangweilt in der Eingangszentrale. Er verlangt nicht wie früher den Personalausweis, fragt nicht nach dem Woher, Wohin und Warum und trägt auch keine Personalien in eine dicke, verschmuddelte Besucherkladde ein. Dieser Pförtner läßt jeden passieren. Er stiert ins Leere, als sei man ein Nichts. Ein Nichts, das keinen Blick, geschweige denn eine Personalüberprüfung wert ist. Im Treppenhaus aber riecht es so, wie es in diesem Amt schon roch, als es noch »Rat des Kreises« hieß und ich es 1987 zum erstenmal betreten hatte: nach einem Gemisch von Rotkraut, verbrannter Panade, Mischgemüse, Bratfisch, Sauerkraut, Roten Beeten und Erbsensuppe. Damals hatte ich im zehn Minuten entfernten sogenannten »Großen Weißen Haus« den 1. Sekretär der SED-Kreisleitung, den Genossen Hans-Dieter Fritschler, vier Wochen bei seiner Arbeit beobachten dürfen. (Und danach das Buch »Der Erste« geschrieben.) Fritschler war mit mir schon am zweiten Tag in das heutige Landratsamt marschiert, um mir den Vorsitzenden vom Rat des Kreises – also den obersten Vertreter der staatlichen Macht im Kreis – den Genossen Eberhard Stumpf vorzustellen …
Auf der Orientierungstafel lese ich, daß der neue Landrat Baldus im selben Zimmer regiert, in dem bis 1990 der Ratsvorsitzende Genosse Stumpf saß. Der war, als ich ihn kennengelernt hatte, fünfundvierzig Jahre alt, von Wuchs ein Hüne und als gelernter Maschinenschlosser zum Staatsfunktionär umfunktioniert worden. Er beschäftigte sich damals unter anderem mit solchen Problemen: »Eine Verkäuferin, die an ihrer Arbeit in einer kleinen staatlichen Einraumverkaufsstelle hängt, kommt Rotz und Wasser heulend zu mir gelaufen und sagt, daß sie ihr Geschäft nicht mehr bis 18 Uhr auflassen könne, denn die Kinderkrippe schließe neuerdings um 17.30 Uhr. Niemand würde ihr Kind abholen. Die Oma arbeite Schicht, und ihr Mann hätte sich scheiden lassen. Wenn ich der guten Frau sage, daß sie den Laden um 17 Uhr schließen darf, entscheide ich mich für diese eine Kollegin und ihre Sorgen, aber letztendlich gegen hundert andere Bürger, die dort abends noch einkaufen wollen. Außerdem handle ich gegen unseren Ratsbeschluß zur Durchsetzung der Ladenöffnungszeiten. Ich weiß nicht, was ich machen soll …« Und hilflos fragte er mich damals, wie ich in diesem Fall entscheiden würde.
Das Treffen mit dem Landrat wird meine erste Begegnung mit der neuen Staatsmacht sein. Auf der Toilette wasche ich mir die Hände. Die Toiletten erinnern nicht mehr an Vergangenes. Sie glänzen in Chrom, und die Wasserspülung wird jetzt automatisch an- und abgestellt.
Bevor ich die Treppe zum Zimmer des Landrates hinaufsteige, beobachte ich verwundert drei junge Leute in löchrigen, alten Anoraks und schmutzigen Hosen. Plastebeutel in den Händen haltend, tappen sie unrasiert und frierend in das Amtsgebäude hinein. Der wahrscheinlich Älteste von ihnen trägt eine lange, viel zu große braune Kunstlederjacke und hat einen feuerroten wildwachsenden Vollbart. Zu dem Jüngsten des Trios, einem milchgesichtigen und etwas hilflos Dreinschauenden, sagt er, als sie an mir vorübergehen: »Andreas, die Beamten haben heute gut für uns geheizt.« Und der mit Andreas Angesprochene kramt Handtuch, Seife und Zahnbürste aus seiner Plastetüte und erledigt am Waschbecken auf dem Gang seine Morgentoilette. Der Rotbärtige setzt sich wortlos in die Reihe. Und der Dritte von ihnen holt eine Flasche Korn aus seiner Anoraktasche, reicht sie dem Nachbarn. Ein Angestellter, der sieht, daß ich die Szene neugierig betrachte und vielleicht mißdeuten könnte, sagt mir: »Die gehören nicht hierher! Die holen hier nur ihr Geld ab. Assis!«
Im Vorzimmer vom Landrat empfängt mich eine junge schöne Frau. Sie trägt hohe Stiefel, schwarze Strümpfe, Minirock, weiße Spitzenbluse und hat lange blonde Haare. Vom Fenster des Konferenzzimmers, in dem ich auf den Landrat warten soll, versuche ich, die Umgebung draußen zu betrachten. Aber anstelle von Gardinen hängen weiße papierähnliche Streifen davor, die durch Fäden miteinander verbunden sind und sich lediglich in ihrem Neigungswinkel verändern lassen. So kräftig ich auch an den Strippen ziehe, die Sicht nach draußen wird nicht frei. Kein Durchblick.
Vor einigen Wochen hatte ich im Büro des Landrates angerufen und gebeten, den neuen Landrat, Stefan Baldus, für einige Wochen bei seiner Arbeit begleiten zu dürfen. Die sehr schnell sprechende männliche Stimme am Telefon, die manchmal die Anfangssilben verschluckte, erkundigte sich, ob ich der Schriftsteller wäre, der das Buch über den SED-Ersten des Kreises, den Genossen Hans-Dieter Fritschler, geschrieben hätte. Und als ich das bestätigte, wußte der Mann am Telefon sofort, daß »unser Herr Landrat an einer Zusammenkunft nicht interessiert ist, er arbeitet sich jetzt erst ein«. Weil ich nicht aufgab, versprach er, meine Bitte an den »Herrn Landrat« weiterzuleiten. »Rufen Sie mich in zwei Wochen wieder an und verlangen Sie Klaus Urban.« Klaus Urban? Ich fragte: »Sind Sie der Urban, der zu SED-Zeiten erster Kreissekretär der CDU war?« Er sagte leise »Ja«, und ich erinnerte mich, daß Hans-Dieter Fritschler mir über Klaus Urban gesagt hatte: »Wenn ich mit allen Genossen so gut auskäme wie mit dem CDU-Kreisvorsitzenden und wenn alle SED-Parteifunktionäre so verantwortungsbewußt und ordentlich arbeiten würden wie er, dann wären wir mit dem Sozialismus in der DDR schon ein gutes Stück weiter.«
Vierzehn Tage später erhielt ich von Klaus Urban eine Absage, denn wie er schon zuvor gewußt hätte: »Die meisten Parteifreunde des CDU-Kreisvorstandes sind dagegen … äh … ich wollte sagen, der Landrat ist dagegen, daß Sie ihn jetzt bei seiner Arbeit begleiten. Leider.« Ich sagte, daß ich auch ohne behördliche Genehmigung über den neuen Landrat und die neue Zeit im Kreis Bad Salzungen schreiben würde. Zehn Tage später erhielt ich einen Termin beim Landrat.
Stefan Baldus ist 84 Tage nach der Gründung der Bundesrepublik Deutschland und 21 Tage vor der Gründung der Deutschen Demokratischen Republik geboren worden. Er war Offizier in der Bundesrepublik und kommandierte von 1991 bis zum Herbst 1992 das Panzergrenadierbataillon in Bad Salzungen. Danach wählten die Abgeordneten des Werrakreises den katholischen Christdemokraten aus dem Westerwald zum Landrat. Zum zweiten nach der Zeitenwende. Und der erste, der einheimische Vorgänger Achim Storz, räumte nach Stasi-Vorwürfen den Schreibtisch aus.
Am Abend vor dem Gespräch mit dem Landrat hatte ich sein Foto aus der Zeitung herausgerissen und versucht, mir das Gesicht einzuprägen. Auf den ersten Blick schien das Bild aus der Kartei der Kriminalpolizei zu stammen: kurzgeschorener Kopf, die Bartstoppeln genauso lang wie die Haare, die Augen eng stehend, ein wenig zusammengekniffen. Doch wenn man genauer hinschaute, konnte das Bild auf einem Zirkusplakat auch den Clown ankündigen, denn die Mitte des Gesichts zierte eine extrem dicke Knollennase, die das kurzgeschorene Drumherum freundlich machte. Neben dem Zeitungsfoto standen einige Sätze der Rede, die der neue Landrat beim Hubertusfest in Dermbach gehalten hatte: »Kommunismusbelastete Menschen müssen sich erst bewähren, bevor sie wieder gleichberechtigt in öffentliche Ämter eingefügt werden dürfen.« Bewähren? Und wer darf einfügen?
Als ich noch erfolglos an der Jalousie im Konferenzzimmer zerre, geht die Tür auf. Ich fühle mich ertappt und zucke zusammen. Doch wahrscheinlich wäre ich ohnehin erschrocken, denn der Mensch, der in der Tür steht, muß sich ein wenig bücken, um nicht mit dem Kopf anzustoßen. Das Foto in der Zeitung stimmt. Der Landrat geht sehr schnell, Schlips- und Anzugfarbe sind sorgfältig aufeinander abgestimmt, die Begrüßungsworte sind freundlich und gleichzeitig unverbindlich.
In seinem Arbeitszimmer sehe ich an der Wand zuerst das große Portrait. An derselben Stelle, von der aus früher Erich Honecker seinen SED-Ratsvorsitzenden, Genossen Eberhard Stumpf, bei der Arbeit kontrollierte, beobachtet nun Konrad Adenauer die Geschäfte seines CDU-Landrates Stefan Baldus. Der zündet sich im Stehen eine klobige Pfeife an. Ich sage, daß sich nicht viel verändert hat in diesem Arbeitszimmer. »Lediglich die Bilder vertauscht. Wie überall. Nur die Strukturen und Verordnungen ausgewechselt und der ehemaligen DDR dafür die Gesetze der Bundesrepublik übergestülpt.« Das hätte ich zur Begrüßung besser nicht gesagt, denn er widerspricht sofort sehr energisch: »Sie irren, Herr Scherzer! Die DDR ist auf eigenen Antrag ein Teil der Bundesrepublik geworden. Es ist ihr nichts, aber auch gar nichts übergestülpt worden, sie hat sich den Mantel selbst angezogen – oder anders gesagt: Sie ist unter den Mantel der BRD gekrochen!« Und danach, damit ich wüßte, mit wem ich es zu tun hätte: Er sei in einem katholischen, konservativen Elternhaus aufgewachsen und im Glauben an Gott, Freiheit und Demokratie, in der sich alle Menschen selbst verwirklichen könnten, erzogen worden. »Jede Form von Diktatur lehne ich ab, gleich ob sie sich Faschismus oder Kommunismus nennt.« Er kramt in einem Zettelkasten, der auf seinem Schreibtisch steht, und zitiert. »Mit Charakter bezeichnet man das Festhalten an seiner Überzeugung … Offenbar wird man von einem Menschen, der seine Ansicht alle Augenblicke ändert … nicht sagen: Er hat Charakter. Man bezeichnet also nur solche Menschen mit dieser Eigenschaft, deren Überzeugung sehr konstant ist. Clausewitz.« Ich habe Clausewitz nicht gelesen und sage ihm, daß es leichter sei, an einer Überzeugung festzuhalten, wenn sie – wie seine antikommunistische – gerade bestätigt worden ist. Unsereiner dagegen …
Er schlägt vor, daß wir nebenan im Bistro zu Mittag essen, zieht seinen knöchellangen schwarzen Wollmantel an und setzt einen schwarzen breitkrempigen (Cowboy- oder Mafiosi-?) Hut auf. Im Bistro sitzen wir auf barhockerähnlichen Drehstühlen. Der Landrat hat Mühe, bei Essen aus seiner Höhe herunterzukommen.
Leidenschaftlich erzählt er mir von seinem Hobby, dem alpinen Bergsteigen. »Anfangs sind meine Frau und ich auch auf schwierige Berge ohne Seil hinaufgeklettert. Deshalb kenne ich das Gefühl der totalen Panik, der Bewegungsunfähigkeit. Todesangst, wenn man an der Wand hängt und unten die Tiefe sieht. Das dauert nicht nur zwei oder drei Minuten, das dauert manchmal viel länger. Doch am nächsten Tag muß man denselben Berg wieder hinauf.« Mittlerweile sei das seine Lebensmaxime … Ich habe keine Ahnung vom Bergsteigen. Ich wechsle das Thema und frage nach den Überlebenschancen für die Kalibetriebe in Thüringen. Da legt er Messer und Gabel zur Seite. Es gebe zwei Möglichkeiten: Entweder die ostdeutschen Kalibetriebe würden einzeln privatisiert, dann müßten sie sehr schnell und radikal Kumpel entlassen, damit sie effektiver produzierten. In diesem Fall könnten sie über die Entlassungen selbst entscheiden. Die schlechtere Variante wäre die Fusion mit der westdeutschen Kali und Salz AG. »Wenn die erst einmal die ostdeutschen Kali-Konkurrenzbetriebe geschluckt haben, werden sie nach der Fusion natürlich unsere Thüringer Gruben schließen und die eigenen hessischen verschonen.« Er hat wirklich »unsere« gesagt. »Ich bin dafür, im Kalibetrieb Merkers noch mehr Kumpel zu entlassen, denn nur dadurch werden einige dort ihre Arbeit behalten können. Im Jahr 2000 wird in Deutschland ein Drittel aller Arbeitsfähigen sehr viel arbeiten müssen. Ein Drittel ein bißchen. Und ein Drittel wird überhaupt nicht arbeiten dürfen. Die müssen dann von den übrigen miternährt werden.«
Doch wenn Arbeit für dieses letzte Drittel nicht nur Geldverdienen zum Zwecke der Ernährung bedeutet?
Baldus bezahlt unser Essen und unseren Wein.
Auf dem Rückweg in das Landratsamt sage ich, daß ich über seine Arbeit schreiben möchte. Er bleibt stehen, grient zum erstenmal und antwortet: »Wenn ein Roter über einen schwarzen Landrat schreibt, ist das keine gute Reklame für dessen Wiederwahl.«
»Ein Roter?«
»Einige meiner Salzunger CDU-Freunde, die schon in der DDR im Kreisvorstand arbeiteten, haben mich eindringlich gewarnt: ›Der Scherzer war ein staatsnaher Schriftsteller.‹«
»Sie als hoher Bundeswehr-Offizier standen dem Staat doch wohl sehr viel näher als ich?«
»Aber im Gegensatz zu Ihnen immer auf der richtigen Seite!«
Beim Abschied lädt er mich für Mitte Dezember zu einem Probetag bei ihm ein.
Auf der Heimfahrt steht eine Anhalterin neben dem Ortsausgangsschild von Bad Salzungen. Sie zeigt nicht charmant lächelnd mit dem Daumen in die Fahrtrichtung, sondern fuchtelt ungeschickt und wild mit ihren Armen, als müßte sie einen in den Abgrund rasenden Zug anhalten. Sie hat eine graue Hose und einen beigefarbenen Anorak an und sieht wie ein kleiner, aus dem Nest gefallener Vogel aus. Will nach Schmalkalden, ist aber auch zufrieden, daß ich sie nur bis zum Abzweig nach Niederschmalkalden, der »Zwick«, mitnehmen kann. Als rechts von uns der Schornstein des Immelborner Hartmetallwerkes zu sehen ist, erzählt sie, daß ihr Mann in der Mittagspause einmal mit umgehängter Sani-Tasche den rund 20 Meter hohen Schlot hinaufgeklettert sei. »Dort oben nistete jedes Jahr ein Storchenpaar, und die Kollegen hatten meinem Mann weisgemacht, daß sich ein Jungstorch das Bein gebrochen hätte und dringend Hilfe bräuchte. Und weil der Herbert, was mein Mann ist, mittags schon wieder angetrunken war, kletterte er hinauf.« Danach hätte er jahrelang keinen Schnaps angerührt. Inzwischen sei das Immelborner Werk pleite. Der westdeutsche Unternehmer Kauhausen hätte zuerst vor den Arbeitern große Reden geschwungen: »›Wir sitzen alle in einem Boot. Euer Schicksal ist auch mein Schicksal.‹ Aber in Wirklichkeit interessierten den nur die Fördermillionen der Treuhand. Und als er die verbraten hatte, meldete er Konkurs an. Glauben Sie bloß nicht, daß sich einer dieser Spekulanten aus dem Westen darum kümmert, was aus den Ostarbeitern wird. Die Arbeiter sind nur ein notwendiges Übel beim Geldmachen. Und wenn man Geld machen kann ohne die Arbeiter, dann schert man sich einen Dreck um sie.«
Vor einem halben Jahr sei ihr Mann entlassen worden. Und seit zwei Monaten säße er wieder in der Kneipe. Die Kinder würden es Gottseidank nicht merken, er käme immer erst gegen 11 Uhr nachts nach Hause.
Die kleine Frau hat in der Kammgarnspinnerei Niederschmalkalden an einer Spinnmaschine gearbeitet. Mittlerweile arbeiten dort von früher 1000 Leuten noch rund 120. »Ich habe über vierzig Bewerbungen geschrieben, mich angeboten als Reinemachfrau bis zur Haushaltshilfe. Die einzige positive Antwort erhielt ich vom Versandhaus Quelle in Nürnberg. Aber wie soll ich mit zwei kleinen Kindern zu Hause täglich bis nach Nürnberg fahren?« Allerdings wolle sie nicht klagen, denn für das nächste Jahr hätte ein Bekannter ihr eine Stelle an einem Bratwurststand in Schmalkalden versprochen. In der Zwischenzeit würde sie zweimal in der Woche zu ihrer arbeitslosen Schwester, einer ehemaligen Schuldirektorin, in das Salzunger Neubaugebiet fahren. »Wir essen Kuchen, kochen Kaffee und stricken dann bis zum Nachmittag Pullover. Eine Psychologin hat meiner Schwester geraten: besser stricken als in die Klapsmühle.« Sie lacht, als sie das sagt.
An der Abzweigung nach Schmalkalden neben der »Zwick«, dem Betrieb, in dem sie früher gearbeitet hat, halte ich und frage die kleine Frau nach ihrem Namen. Sie schaut mich plötzlich mißtrauisch an und fragt: »Wozu brauchen Sie meinen Namen? Sind Sie vom Arbeitsamt? Wir verkaufen die Pullover, die wir stricken, doch nicht!« Ich beruhige sie, aber sie will ihren Namen nicht nennen. Ich sage, daß ich sie die zehn Kilometer bis nach Schmalkalden noch fahren könnte. Doch sie greift hastig zum Türgriff. Nein, sie würde lieber mit dem Zug weiterfahren.
»Und weshalb wollen Sie mir Ihren Namen nicht sagen«, frage ich.
»Mein Bruder«, sagt sie, »mein jüngerer Bruder, der hat noch Arbeit! Und vielleicht bekomme ich auch wieder eine Stelle. Aber wenn jemand liest, was ich Ihnen gesagt habe, solch eine, die so etwas sagt über die Unternehmer, die nimmt doch keiner.« Sie geht an der »Zwick«, in der die meisten Fenster verstaubt und blind sind, über die Kreuzung zur Straße nach Schmalkalden. Und dreht sich kein einziges Mal nach ihrem ehemaligen Betrieb um.
Der Probetag
Schon vor 7 Uhr bin ich im Landratsamt. Eine Frau im hellblauen Kittel werkelt noch mit Staubsauger und Putzlappen im Vorzimmer. Ich frage sie, ob der Landrat drin ist. Sie drückt beide Arme ins Kreuz und sagt mißmutig: »Lag sein großer schwarzer Hut etwa draußen auf der Garderobe?« »Nein«, sage ich. »Na also. Kein Hut draußen – kein Chef drin, so einfach ist das, junger Mann.« Außerdem, Arbeitsbeginn sei hier zwischen 7 und 8 Uhr. Gleitende Dienstzeit. Kontrolliert würde alles von der Stechuhr, genau wie in der Fabrik. Der Herr Landrat und seine Dezernenten, die müßten allerdings nicht stechen. »Und wenns der Landrat nicht merkt, daß die zu spät kommen, und einige von diesen Herren die haben eben früh noch was in der privaten Firma zu erledigen, also wenns der Landrat nicht merkt, die Untergebenen halten schön die Klappe … Aber wehe, unsereiner ist nicht pünktlich oder es sieht noch wüst aus, wenn der Herr Landrat erscheint, da sind die hohen Herren schnell mit der Abmahnung und der Entlassung. Haben Sie mal den großen runden Tisch im Zimmer vom Landrat gesehen? Der, auf dem Hunderte Zettel, Akten, Prospekte und Notizen herumliegen. Und dazwischen sogar Zuckerstücke! Ja Zuckerstücke! Da darf ich nicht ran, hat der Landrat gesagt. Dort will er irgendwann selber aufräumen.«
Als sich ein junger Mann mit pausbäckigem Gesicht und rundlicher Figur auf einen der zwei kleinen Wartestühle im Vorraum setzt, sein Aktenköfferchen neben sich stellt und dann schweigend, die Innenflächen der Hände aneinandergelegt und artig zwischen die Knie gepreßt, sitzen bleibt, verstummt die Putzfrau sofort und bückt sich wieder. Kurz danach marschiert der Landrat im Eilschritt in sein Zimmer. Er bedeutet dem Aktenkofferträger einzutreten und stellt ihn mir als Innendezernent Rauschelbach vor. Wir setzen uns an den papierüberladenen runden Tisch. Rauschelbach schlägt sein Notizbuch auf. »Gestatten Sie, Herr Landrat, daß ich Sie kurz informiere?«
»Ich bitte darum!«
Während er berichtet, dringt, zuerst kaum hörbar, später immer deutlicher, eine laute, erregte Männerstimme durch die ledergepolsterte, aber wahrscheinlich nicht ordentlich verschlossene Tür. »Eine Sauerei ist das … keiner fühlt sich verantwortlich in diesem Laden. Zu DDR-Zeiten hätte ich schon längst einen Brief an Honecker geschrieben.«
Ob der Mann draußen mit der Reinemachfrau spricht?
»Wenn die erst einmal auf dem Beamtenstuhl sitzen, heben sie den Arsch nicht mehr hoch. Das war früher so und heute erst recht. Und gut bezahlt wirds außerdem. Denken Sie ja nicht, daß einer der Staatsdiener zu mir gesagt hätte, es ist gut, daß Sie die Kaserne kaufen wollen und daraus ein Nachfürsorgeheim für alte Leute, die aus dem Krankenhaus kommen, machen wollen.«
Ich schaue mich zwischen den Akten, Zetteln, Prospekten und Visitenkarten, die auf dem runden Tisch vor uns liegen, neugierig um. Und entdecke zwischen all den Haufen Papier wirklich Zuckerstückchen.
Der Landrat fragt seinen Innendezernenten, ob er inzwischen auch dem »Verein der Immelborner Kiesrebellen« beigetreten sei. Und der Dezernent beeilt sich zu erklären, daß er als Mitarbeiter im Landratsamt diesem aufmüpfigen Verein natürlich nicht angehöre. Er kämpfe allein gegen die westdeutsche Firma Kirchner, die auch auf seinem Grundstück Kies zu einem Schnäppchenpreis für 1 oder 2 Mark pro Quadratmeter Grundstücksfläche ausbaggern wolle. Im Westen müßten sie dafür 30 bis 40 Mark bezahlen. Der Landrat rät seinem Dezernenten zur Mäßigung. »Es hängen viele Arbeitsplätze an dem Kieswerk. Wenn die Leute, unter deren Grundstücken Kies liegt, den Kirchner nicht mehr weiterbaggern lassen, muß der die Arbeiter entlassen.«
Der Mann von draußen hat sich beruhigt, er läßt sich überreden, noch einmal in die Wirtschaftsabteilung zu gehen, flucht nur noch: »Wäre ich ein Wessi, müßte ich hier nicht selbst herumlaufen, dann hätte das meine Bank für mich erledigt!« und schlägt die Tür zu.
Dezernent Rauschelbach erhebt sich. »Herr Landrat, ich darf mich verabschieden.« Der Landrat sagt: »Ich bitte darum.«
Beim Frühstück im kleinen Hinterzimmer, dem Vorzimmer des Landratbüros, begrüßt mich der ehemalige CDU-Kreisvorsitzende Klaus Urban freundlich und berichtet danach dem Landrat, sprudelnd wie ein Wasserfall, über seine Inspektion in den Schulen des Kreises. »Ich sage dir Stefan, das ist unvorstellbar, Stefan, das kann man nicht beschreiben, der Zustand in den Schulen des Kreises … alles haben die vergammeln lassen in der DDR, der Putz bröckelt herunter, Löcher im Fußboden und in Dächern. Es ist unvorstellbar, wie die das heruntergewirtschaftet haben, die … die … die SED-Genossen.«
Baldus trinkt nur einen Schluck Kaffee im Stehen. Dringende Gesprächstermine. Der Vertreter der Thüringer Verbraucherzentrale (»Es werden immer mehr Konsumenten im Osten durch dubiose Geschäftemacher aus dem Westen schändlich, Verzeihung, schändlich beschissen, Herr Landrat.«) müßte in Salzungen die Zweigstelle schließen lassen, wenn nicht das Landratsamt wenigstens eine halbe Stelle kostenmäßig übernehmen würde.
Der Wirtschaftsdezernent Klüber macht Mitteilung, daß er vor Gericht soeben erfolgreich gegen Verleumdung geklagt hätte, denn die Leute, die ihm jetzt nachsagten, daß er sich als Dezernent während der Dienstzeit bei Fahrermangel selbst an den LKW setze und sein Amt benutze, um in die Fuhrunternehmerstasche seiner Frau zu wirtschaften, das wären schon zu DDR-Zeiten Nörgler und kleine Gernegroße gewesen, die es damals wie heute zu nichts gebracht hätten. Damals nicht, als er noch kleiner CDU-Bürgermeister in der Grenzgemeinde Schleid gewesen sei, und heute nicht, wo er es bis zum Wirtschaftsdezernenten gebracht hätte. Ich will widersprechen, sagen, daß damals ein Bürgermeister an der Grenze schon was Bedeutendes war, denn dafür nahm man nur die zuverlässigsten Genossen und die allerzuverlässigsten Blockpolitiker, aber der Dezernent verschwindet so schnell, wie er gekommen ist.
Nach ihm beschwert sich der westdeutsche Bauherr vom großen Salzunger Hotel über den heftig rauchenden Schlot der Post und den »unzumutbaren geschäftsschädigenden Geruch« des Bratwurststandes, den die hiesige Treuhand neben seinem Hotelneubau genehmigt hätte. »Man könnte denken, in Post und Treuhand sitzen noch die alten Roten und sabotieren unsere freie marktwirtschaftliche Arbeit.«
Danach kurze Terminpause. Unterschriftenmappe. Baldus schaltet mit der Fernbedienung den CD-Player ein. Mozart. Ich schaue mich in seinem Zimmer um. An der Tür hängt eine große Bahnhofsuhr mit elektronischer Anzeige. Ihr gegenüber tickt laut und majestätisch ein prächtiger Westminster. Daneben stehen auf einem Tischchen die Europafahne, die Thüringer Fahne und dickbäuchige leere Vasen. Auf einem Schränkchen neben der Tür, für jeden, der hinausgeht, nicht zu übersehen, das Farbfoto einer jungen Frau. Lachend. Lockenkopf. Braungebrannte nackte Schulter. »Meine Frau.« Sie hat ihr Geschäft in Hannover aufgegeben und ist dem Landrat nach Bad Salzungen gefolgt. Ebenfalls nicht zu übersehen: ein aus Pappmaché und Gips geformtes großes Schlachtenpanorama. Auf dessen Sockel steht: »Zur Erinnerung an die Schlacht am Mühlberg. 14.September1987.« Als der Landrat sieht, daß ich es aufmerksam begutachte, legt er die Unterschriftenmappe zur Seite. »Ich war bei dieser Übung Stellvertreter des Bataillonskommandeurs und Führer des Gefechtsstandes. Unser Bataillon war in einer Breite von 14 Kilometern und einer Tiefe von 3 Kilometern zur Verteidigung eingesetzt. Aber der Kommandeur hatte sich in der entscheidenden Gefechtsphase verfahren und den Funkkontakt zu seinen Untergebenen verloren. Die Verteidigung brach zusammen. Er saß hilflos in seinem Schützenpanzer. Die Reservekompanie, die den Gegenangriff starten sollte, verirrte sich irgendwo im hessischen Bergland. Und dann tauchten die Panzer der Angreifer auf, woher wußten wir nicht, und hinter dem Gefechtsstand landeten gegnerische Fallschirmspringer. Ein absolutes Chaos. Ich habe einige Soldaten, die ziellos umherliefen, um mich geschart und doch noch eine Verteidigung organisiert. Zum Schluß stand ich mit der Pistole in der Hand auf dem Schützengraben.«
»Sind Sie in die ehemalige DDR gegangen, um hier Landrat zu werden?«
»Nein, ich bin rübergekommen, um bei der Umstrukturierung der NVA zu helfen, mehr nicht.«
Der Mann, der die NVA-Kaserne in Buttlar kaufen und daraus ein Nachfürsorgeheim bauen will, ist erfolglos wieder im Landratsvorzimmer gelandet. Kürschner, der »Persönliche« vom Landrat (früher Ingenieur im benachbarten Leuchtstoffröhrenwerk), fragt, ob er ihn für eine Minute hereinschicken dürfe. Baldus nickt. Und der Mann in Rollkragenpullover und Windjacke redet schnell und laut und ohne Umschweife. Der Landrat mustert ihn von oben bis unten. »Und woher soll ich wissen, daß Sie, wenn Sie Gebäude und Grundstück gekauft haben, dort wirklich eine Pflegeeinrichtung aufbauen und nicht die rote Laterne heraushängen?«
»Sie brauchen sich nur zu erkundigen. Ich komme doch nicht aus dem Westen, die Leute hier kennen mich als einen ordentlichen Bürger. Ich wohne in Sünna. Sünna, Herr Landrat, ist ein Nachbarort von Buttlar.« Der Landrat verärgert: »Ich weiß selber, daß Sünna ein Nachbarort von Buttlar ist.« Der Mann, nun den Reißverschluß seiner Windjacke nervös hoch- und herunterziehend: »Verzeihung, Herr Landrat, ich dachte nur … Weil Sie nicht von hier sind.«
Als nächster (»Grüß Gott, Herr Landrat«) erscheint der Fuhrunternehmer Sostmeyer in bayerischer Trachtenjacke, mit seinem Ostpartner, dem ehemaligen Direktor des VEB Kraftverkehr Bad Salzungen. Der dankt Sostmeyer weitschweifig, daß er geholfen hätte, für 150 der ehemals 400 Beschäftigten die Arbeit zu erhalten. Sie wären nun Partner … Sostmeyer dreht unruhig an den Hornknöpfen seiner Jacke und unterbricht die Rede abrupt. »Was heißt Partner, lediglich Schrottkisten von Autos fuhren hier, marode wie alles in diesem Land. Aber das kennen Sie, Herr Landrat, vom Fuhrpark in der NVA. Die Erneuerung hat uns Millionen gekostet. Doch es war eine Zeit der Euphorie, wir sind schließlich nur gekommen, um den Brüdern und Schwestern in der Zone zu helfen. Ich erinnere mich an die ersten Fahrten in den Osten. Jeder wollte den Kindern – wie haben deren Augen dankbar geleuchtet – wenigstens ein paar Bananen schenken. In manchem Dorf habe ich zwei oder dreimal angehalten.«
Nun hat er wirklich einen Hornknopf abgedreht. Er steckt ihn in die Tasche, ohne seine Rede zu unterbrechen.
»Ich bin schon fünfundsechzig, Herr Landrat, hätte es gar nicht mehr nötig, mich hier aufzureiben. Denn lohnend ist das Geschäft im Osten nicht, nur Einbahnverkehr. Voll beladen mit Westwaren in den Osten bis zur Oder und leer wieder zurück in den Westen. Außerdem würde ich mein Unternehmen lieber an die polnische Grenze verlegen. Dort sind die Leute noch auf unsereinen angewiesen, sagen trotz niedriger Löhne ›danke‹. Die können nämlich nicht wie die Thüringer täglich nach Bayern oder Hessen zur Arbeit fahren.« Außerdem würden die neuen Westunternehmen, die wie das hiesige Kabelwerk Millionen DM Ost-Fördergelder kassiert hätten, ihr Material mitnichten von Ostfirmen, also beispielsweise seiner, fahren lassen, sondern die würden die Transportaufträge auch noch ihren alten Bekannten aus dem Westen zuschanzen.
»Und dagegen, verehrter Herr Landrat, sollte der Staat endlich im Sinne des Aufschwungs Ost sehr energisch einschreiten.«
Baldus schüttelt den Kopf. Er kenne das Problem aus dem Salzunger Kaltwalzwerk. Das hätte im Bosch-Werk Brotterode angefragt, ob es seine Scheinwerfer nicht aus hiesigem Stahlblech herstellen könne. Aber das entscheide nicht die Geschäftsführung in Brotterode, sondern die Boschzentrale in Stuttgart. Und die bestelle für ihr Ostwerk eben kein Material aus dem 20 Kilometer entfernten Bad Salzungen, sondern zusätzliches Blech aus den westlichen Walzwerken.
»Meine Herren, es ist doch schlicht und ergreifend so: Das Kapital geht seine fremdbestimmten Wege und nicht die Wege, die wir gerne hätten. Daran ist nichts zu ändern. Und den Staatssozialismus mit Planwirtschaft wollen wir doch nicht noch einmal?« Sostmeyer verneint heftig, aber dann sagt er aufbegehrend: »Ich denke, daß die Unternehmen von den Politikern solidarische Unterstützung verlangen können! Wozu denn sonst haben wir CDU und Sie, Herr Landrat, gewählt?« Baldus, sehr bestimmt, aber immer noch freundlich: »Sie irren, Herr Sostmeyer, nicht die Unternehmen haben mich gewählt, sondern der Souverän, das Volk.«
Und er empfiehlt ihm, sein Transportproblem solidarisch am Unternehmerstammtisch zu klären …
Vor der Sitzung des Bildungsausschusses, an der er nachmittags teilnehmen will, marschiert Baldus im Eiltempo durch die Stadt, um einen Hosengürtel zu kaufen. »Einen echten, aus Leder.« Die Verkäuferin präsentiert drei verschiedene Muster. »Mehr haben Sie nicht?« »Nein, das ist alles an Herren-Ledergürteln.« Mißmutig geht er wieder. »Dreißig Kilometer weiter, in Fulda, hätten sie mir zehn verschiedene angeboten.«
Wir kommen zu spät zur Sitzung des Bildungsausschusses. Für den Landrat wird am Tisch zur Seite gerückt, ich setze mich abseits. Baldus informiert, daß der Herr Scherzer heute sein Gast sei. Die Versammelten taxieren mich von freundlich bis gleichgültig. Nur ein älterer untersetzter Mann, der mühsam einige Haarsträhnen auf seiner Glatze »flächendeckend« geordnet hat, zischelt mit dem Landrat und guckt böse. Beraten wird im Ausschuß die Trennung der »Stadt- und Kreisbibliothek Bad Salzungen«. Allerdings nicht räumlich, nur die Mitarbeiter und die Bücher sollen »gerecht« auf die Stadt und den Landkreis verteilt werden. Die Bibliotheksleiterin gibt zu bedenken, daß anschließend hunderttausende Bücher neu zu beschriften und zu katalogisieren wären.
Vor der Abstimmung meldet sich der Herr mit den geordneten Haarsträhnen. »Es ist bitternötig, daß wir auch im Kulturbereich unnatürliche Gebilde, die man uns im Sozialismus aufgezwungen hat, durch die bewährten ideologiefreien Strukturen der alten Bundesländer ersetzt. Solange wir die alten Strukturen beibehalten, behalten wir damit auch die Denkweise derjenigen, die sie eingeführt haben, nämlich der SED-Genossen.«
Nach der Abstimmung – die Aufteilung der Bücher und Bibliothekarinnen wird einstimmig beschlossen – zischelt jener Mann wieder mit dem Landrat, und vor dem nächsten Tagesordnungspunkt weist Baldus mich an, den Raum zu verlassen. Die Sitzung sei nicht öffentlich.
Ich gehe durch die Verbindungstür in das Nachbarzimmer, in dem die Bibliothekarin sitzt, Rotz und Wasser heult und sich nicht beruhigen will über diesen »hirnverbrannten Blödsinn«. Ich erwidere, daß es ein demokratisch gefaßter Beschluß wäre. Später frage ich sie nach dem Mann, der so böse guckte und leidenschaftlich gegen die alten SED-Strukturen agitierte. »Das ist der jetzige CDU-Kreisvorsitzende Karl Klobisch*. Früher war er Lehrer, heute Direktor in Schweina.« Und eine der Sekretärinnen im Zimmer weiß, daß er angeblich noch kurz vor der Wende um Aufnahme in die SED gebeten hätte. Aber wegen der strengen sozialen Quotenreglung, damals wären zu viele Lehrer und zu wenige Arbeiter in der Partei der Arbeiterklasse gewesen, nicht aufgenommen worden und notgedrungen in die CDU eingetreten sei.
Mein Probetag ist vorzeitig beendet, und ich suche eine Kneipe. Vom Markt aus laufe ich in Richtung »Hübscher Graben«. Das große, weiße Haus (»SED-Kreisleitung Bad Salzungen, Hübscher Graben«) steht noch, genau wie die kleine baufällige Gaststätte »Zur Hilde«. Die Holztische dort sind blank gescheuert, und die junge Wirtin in ausgewaschenen Jeans fragt mich, ob ich »unser Bier« aus Kaltennordheim oder Bier »von drüben« trinken möchte. Neuankommende grüßen, indem sie auf die Tische klopfen. Es gibt Wurstsuppe, Kohlrouladen und Bratwurst mit Sauerkraut. Am runden Stammtisch qualmen die Männer wie die Schlote, und als die Wirtin den Ventilator vor der Rauchabzugsklappe anstellt, klappert er wie ein altertümlicher Webstuhl. »Schaltet ihn in fünf Minuten wieder aus«, bittet sie die Gäste und geht inzwischen nach nebenan, um Flaschenbier zu verkaufen. Als Hilde wiederkommt, kramt ein junger Mann am Stammtisch einen Packen Antragsformulare für Wohngeld und Sozialfürsorge aus seiner Tasche. »Morgen, mein lieber Freund, wir füllen es morgen aus«, sagt die Wirtin. Und schenkt eine Saalrunde Korn aus. Auch ich kriege ein Glas. Spendiert wird die Lage von zwei Immelbornern am Stammtisch. Sie arbeiten noch im Hartmetallwerk und glauben, daß sie – entgegen allen Unkenrufen – ihre Arbeit behalten werden. Denn es gäbe noch andere Wessis als diesen Kauhausen, der das Hartmetallwerk Immelborn nur wegen der Kredite und der zu verhökernden Immobilien erworben hätte. Beispielsweise diesen Peter Winter! »Hat zwar schon einen Bauch, ist aber sonst noch ein junger Revolutionär. Der steht vor dem Werktor, die Ärmel hochgekrempelt, die rote Fahne der IG-Metall in der Hand und ruft durchs Megaphon: ›Kollegen, wir lassen uns von den Westunternehmern nicht wie der letzte Dreck behandeln. Wir sind wer! Und wer wir sind, das werden sie noch spüren.‹ Der ballt die Fäuste und sagt, daß nicht nur der Betrieb erhalten bleiben wird, sondern auch der Lohn für die Arbeiter erhöht werden soll. ›Die Geldsäcke aus dem Westen müssen es endlich rausrücken! Die Ostarbeiter sind nicht schlechter als die Westarbeiter, sie lassen sich nur leichter bescheißen.‹« So rede der und sei selber aus dem Westen. Einer, der schon drüben auf der Seite der Arbeiter gestanden hätte und nun den IG-Metallchef von Südthüringen mache.
Und sie trinken auf diesen Peter Winter, und ich trinke mit, ohne ihn zu kennen …
Bevor ich gehe, frage ich, ob einer weiß, was Hans-Dieter Fritschler, der ehemalige erste Kreissekretär der SED, heute macht. Genaueres erfahre ich nicht, er hätte wohl bei seinem Freund, dem Autohändler Neubert, in der Waschanlage ausgeholfen.
»Und der Vorsitzende vom Rat des Kreises, der Eberhard Stumpf?«
»Der Genosse Stumpf läuft als Angehöriger der Wach- und Schließgesellschaft in Salzungen herum und paßt auf, daß den Unternehmern das Privateigentum an Produktionsmitteln nicht geklaut wird.«
Und darauf trinkt man noch eine Runde Korn.
Erst kurz vor Weihnachten erhalte ich in einem Brief vom Landrat das Ergebnis meines Probetages.
Er schreibt: »Sehr geehrter Herr Scherzer, für Ihren ganztägigen Aufenthalt in meinem Hause sage ich Ihnen nachträglich herzlichen Dank. Unsere anregenden Gespräche fand ich besonders informativ und wertvoll. Es ist Ihnen sicher nicht verborgen geblieben, daß einige unserer Mitmenschen erhebliche Vorbehalte gegenüber Ihrer Person und Ihren journalistischen Absichten hegen. … Persönlich bin ich zu der Auffassung gekommen, daß Sie sich ernsthaft mit der Vergangenheit und der heutigen Zeit auseinandersetzen, und dem gegenüber die Ihnen entgegengebrachte Animosität durchaus einen kompensatorischen Charakter haben kann. Ihrem Wunsch, die Arbeit des Landrates von Bad Salzungen zirka drei Wochen lang kritisch zu begleiten, stehe ich aufgeschlossen gegenüber. Für das bevorstehende Weihnachtsfest wünsche ich Ihnen alles Gute und Gottes Segen. Mit freundlichen Grüßen, Stefan Baldus.«
Wir vereinbaren, daß ich am Montag, dem 12.Januar1993, frühmorgens im Landratsamt antreten werde. Doch am Tag zuvor schickt der Landrat vorsorglich ein Telegramm: Am Montag könne ich ihn noch nicht begleiten, erst am Dienstag.
Der erste Tag
Am Dienstag erscheint der Landrat sehr spät zum Dienst und entschuldigt sich stolz: »Ich war gestern als einziger Südthüringer Landrat zum Neujahrsempfang beim Bundespräsidenten geladen. Und das, obwohl ich dem Kreis erst hundert Tage vorstehe.«
Doch davon würde er später berichten, im Moment gäbe es im Landratsamt nur ein Thema: die Gebietsreform.
Nach BRD-Vorbild sollten die kleinen DDR-Kreise sehr schnell zu größeren Verwaltungseinheiten zusammengelegt werden. Dadurch könnten sich die 36 Thüringer Kreise nach Vorstellungen des Innenministers auf 18 reduzieren. »Das heißt, es müßten dann 18 Kreise, 18 Kreisstädte, 18 Kreisverwaltungen und auch 18 Landräte zugunsten der größeren Strukturen ›abgeschafft‹ werden.« Im ungünstigsten Fall würde er, kaum als Landrat bestätigt, seinen Kreis, seine Kreisstadt und sich selbst »wegrationalisieren« müssen.
Er diktiert seiner hessischen Pressechefin: »Wenn in den 40 Jahren DDR je etwas Vernünftiges getan worden ist, dann war es die Gründung des Kreises Bad Salzungen. Ich verstehe, daß der eine Nachbarkreis von Bad Salzungen, nämlich Meiningen, mit seinen 70000 Einwohnern zu klein zum Überleben ist, also überredet dessen Landrat Puderbach Salzunger Gemeinden mit allen Mitteln zum Übertritt nach Meiningen. Ich verstehe auch, daß unser anderer Kreisnachbar, Schmalkalden, Sitz der Kreisverwaltung bleiben will und nicht mit Salzungen fusionieren möchte. Das wird der Schmalkalder Landrat Luther morgen auf unserer Kreistagssitzung deutlich aussprechen. Und ich verstehe auch, daß der dritte Nachbar, Eisenach, ein paar Gemeinden von uns braucht. Ansonsten ist der Kreis – wenn Eisenach, wie die Opelwerke das gern hätten, kreisfreie Stadt wird – ebenfalls zu klein.« Er unterbricht das Diktat und sagt, daß einige Wochen im neuen Eisenacher Opelwerk für meine Arbeit wahrscheinlich ergiebiger wären, als die Erkundungen im Landratsamt. Allerdings dürfte man auch Opel nicht nur durch die politische Erfolgsbrille sehen, denn: »Deutschland ist volkswirtschaftlich betrachtet durch die neuen Opelwerke in Eisenach nicht reicher geworden. Dort hat man sich ein Drittel der Investitionen für das neue Werk aus dem Steuersäckel bezahlen lassen, wird bald, dank der guten Facharbeiter und der supermodernen Technik, effektiver produzieren können als in den alten Westwerken und die Ostarbeiter trotzdem geringer entlohnen als im Westen. Und irgendwann den alten Betrieb in Rüsselsheim dicht machen können. Der volkswirtschaftliche Wert solcher Transaktionen ist gleich null.«
Ende des Einschubs für mich – weiter zur Gebietsreform. »Mit diesen Kreisveränderungen wittern meine politischen Gegner in der Partei, beispielsweise die Leute um den Mehlmüller Wehner aus Weilar, eine Chance, mich zu beseitigen. Sie konspirieren mit dem Eisenacher Landrat Dr. Kaspari, bieten den Kreis Bad Salzungen zur Einverleibung nach Eisenach, wenn dafür der Wessi Baldus als Landrat verschwindet. Die Hochzeitspolitik der deutschen Duodezfürsten war demokratischer als die Ränke, die heute einige Kommunalpolitiker zu ihrer Machterhaltung inszenieren.«
Nach dem Pressediktat fahren wir zum Heim der Tschernobyl-Kinder nach Motzlar. Den Cheffahrer, einen kleinen, etwas gedrungenen Mann mit flinken Augen, kenne ich, denn der hat schon den Ratsvorsitzenden Eberhard Stumpf und manchmal aushilfsweise auch den ersten Kreissekretär der SED gefahren. Ich klopfe Gerhard Greulich kameradschaftlich auf die Schulter. Aber ihm ist meine Vertrautheit peinlich. Er lächelt verlegen. Dann sagt er: »Der Scherzer hier … der Scherzer. Da müssen Sie gut aufpassen, Herr Baldus, das ist noch ein echter Roter aus der alten Zeit.«
Das Kinderheim finden wir in einer der immer gleich aussehenden Baracken, die in der DDR als Kinderkombination, Kaserne oder Schulungszentrum genutzt wurden. Diese hier sei vor der Wende die Kinderkrippe des Dorfes gewesen, sagt die Heimleiterin, Frau Hämisch. Sie hat vor der Tür auf den Landrat gewartet. Geleitet ihn hinein zu den Mädchen und Jungen, die Hemden und Blusen mit rot-weißen ukrainischen Folkloremustern und in Deutschland gekaufte amerikanische Jeans tragen. »Für die Kinder ist Deutschland ein Paradies auf Erden. Und das, obwohl sie in ihrem kommunistischen Land früher nicht einmal über Gott und das Paradies reden durften. Hier leben sie zum erstenmal als freie Menschen. Und heute sogar Ihr Besuch, verehrter Herr Landrat! Im Sowjetsystem war das ja unmöglich: Ein Landrat kommt höchstpersönlich zu den Kindern.« Ich staune, was die frühere Angestellte der HO-Kreisverwaltung von sich gibt. Der Landrat ist gerührt.
Die ukrainische Helferin gruppiert die Kinder im größten Raum, und Frau Hämisch informiert den Landrat, daß die Kinder ihm zu Ehren das Neujahrsfest wiederholen, das die russisch-orthodoxen Christen vor sechs Tagen, am 7. Januar, gefeiert hätten. Unter den Kommunisten sei dieses Neujahrsfest verboten gewesen, aber nun würden die Kinder das alte christliche Fest wieder feierlich begehen. Zuerst singen die Ukrainer ein Loblied auf Gospodin, auf Gott. Danach schmettern sie in akzentfreiem Russisch die alten Lieder der sowjetischen Pioniere. Der Landrat aus dem Westerwald kennt keines dieser Lieder. Nicht das »Lob auf die Heimat« und nicht die »Zukunft der Jugend«. Und andächtig lauscht er den »kirchlichen Liedern des russischen Neujahrsfestes«.
Während eines Laienspiels der Kinder in russischer Sprache begrüßt der Landrat die zweite deutsche Helferin. Die kennt er schon, es ist die Frau vom Bürgermeister aus Völkershausen, jenem Ort, der bei einem Gebirgsschlag im Merkerser Kalirevier teilweise zerstört worden war. Die stämmige Frau, der man ansieht, daß sie ordentlich zupacken kann, erzählt dem Landrat, daß sie die Bäcker der Nachbardörfer um Brot- und Brötchenspenden bitten, daß sie Mark für Mark sammeln, um wenigstens die 4000 Mark für den Transport der Kinder von der Grenze bei Brest bis nach Motzlar bezahlen zu können, daß sie, um Geld zu sparen, die Kleidung der Kinder selber waschen würden … Und ich ahne, weshalb Frau Hämisch wohl wider besseres Wissen so reden muß, wie sie glaubt, daß es der kirchliche Westlandrat gern hört. Auch das Laienspiel der Kinder handelt vom Spendensammeln. Beim russischen Neujahrsfest ziehen die Kinder von Haus zu Haus, singen und bitten um milde Gaben. Währenddessen beklagt sich die Frau vom Bürgermeister aus Völkershausen beim Landrat bitterlich über die Asylanten im Nachbarort Geisa. »Wissen Sie, solange zu DDR-Zeiten nur die Neger hier waren, die haben sich höchstens einmal einer Frau unsittlich genähert. Aber das blieben immer die Ausnahmen. Da griff die Staatsmacht gleich ein, da herrschte sofort wieder Ruhe und Frieden. Aber heutzutage, wo diese Asiaten und vor allem diese Zigeuner hier sind. … Herr Landrat, wir haben nur noch zwei Hasen im Karnickelstall. Alle anderen sind geklaut! Und da stört es diese Asylanten nicht einmal, daß sie die Rammler vom Bürgermeister klauen! Und die Ausländerweiber sitzen im Dorf und betteln um Geld. Aber sie haben genug Geld, um sich an einem Tag so viel Kosmetik ins Gesicht zu schmieren, wie unsereiner das nicht in einem Jahr verbraucht! Denen soll ich Geld geben für Brot? Und wie gesagt, Herr Landrat, zwei Hasen noch im Stall. Wenn Sie nicht bald was unternehmen, ich meine die Staatsmacht …«
Zum Abschied schenken die Tschernobyl-Kinder dem Landrat einen ukrainischen Holzteller, einen Bildband mit Ansichten vom sozialistischen Kiew, eine Flasche russischen Wodka und ein rundes, kunstvoll mit Blumen und Ornamenten verziertes selbstgebackenes Weißbrot.
Im Auto philosophiert Baldus darüber, daß man Deutschland, um den armen Ländern zu helfen, wirtschaftlich noch stärker und reicher machen müßte. Ich sage, daß es besser wäre, den Reichtum der Welt gerechter aufzuteilen. »Sie irren«, sagt der Landrat. »Nur, wenn die reichen Länder noch reicher werden, können sie den Armen mehr geben.«
Ich erwidere, daß heute, nachdem die Konfrontation der Militärblöcke durch die Selbstauflösung des einen Blockes beendet ist, Milliarden Dollar für die Erforschung und Produktion von Atomwaffen eingespart, diese Waffe weltweit geächtet und verschrottet werden könnte. Der Landrat schaut mich an, als hätte ich empfohlen, Greulich solle ein Rad seines Mercedes abschrauben und nur noch mit dreien fahren. »Herr Scherzer, sie müßten als gebildeter Mensch doch wissen, daß in der Geschichte noch nie eine Waffe abgeschafft worden ist, bevor eine neue, entschieden wirksamere entwickelt ist.« Das sei sozusagen ein Naturgesetz.
Die Mitarbeiter im Landratsbüro bewundern das ukrainische Brot, das Baldus in einem Regal oben auf dem Papierstapel der erledigten und unerledigten Terminwünsche deponiert.
Danach bespricht er mit dem Vertreter der Thüringer Landeswirtschaftsförderung, einem jungen Mann in Nadelstreifenanzug, die schwierigsten Wirtschaftsprobleme des Kreises: das Hartmetallwerk Immelborn, der Kalibetrieb Merkers und der Gewerbepark in Oechsen.
In Immelborn, wo der Unternehmer Kauhausen für eine D-Mark unter anderem eine hochmoderne Fertigungslinie, qualifizierte Facharbeiter, große Flächen an Grund und Boden, eine umfangreiche Kundenkartei sowie 8 Millionen Mark Anschubfinanzierung von der Treuhand erhalten hätte, müßte nach dem Verschwinden von Geld und Kauhausen sehr schnell mit Landeshilfe eine Auffanggesellschaft für vielleicht 80 der einmal 1400 Beschäftigten gegründet werden. Dann könnten die Leute wenigstens aufräumen und abreißen.
Bei »Kali« hat sich inzwischen die Vermutung von Baldus bestätigt. Die ostdeutschen Gruben sind nicht als eigener Verbund privatisiert, sondern insgesamt dem ehemaligen westdeutschen Konkurrenten »Kali und Salz AG« und deren Mutter BASF zugeschlagen worden. Und der ehemalige westdeutsche Konkurrent kündigte sofort an, die Gruben in Bischofferode und Merkers zu schließen. An einen Protest denken weder Baldus noch der Mann im Nadelstreifenanzug. Es sei besser, sagt der Landrat, statt dessen schon jetzt ein Konzept für die Zeit nach der Schließung zu entwickeln. Er schlägt vor, in Merkers einen Recyclingpark zu fördern, denn der Müllmarkt sei derzeit in Deutschland der einzig prosperierende Markt und außerdem in den neuen Bundesländern noch nicht restlos aufgeteilt.