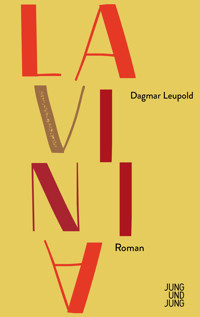11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Ungewöhnliche Familienverhältnisse: Ajot, der Rollstuhlfahrer, braucht eine Pflegerin, die wiederum findet in ihm einen Ersatzvater für ihren unehelichen Sohn Bert. Die Krankengymnastin Elisabeth dagegen verläßt Mann und Kinder, weil sie sich nach einem Liebhaber sehnt. Dagmar Leupolds Roman über das empfindliche Gleichgewicht, in dem diese Menschen balancieren und das sie »vorübergehend glücklich macht«, ist mit federnder Leichtigkeit geschrieben – und von großem menschlichen Gewicht. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 253
Ähnliche
Dagmar Leupold
Federgewicht
FISCHER E-Books
Inhalt
A Sandro
Io vivere vorrei addortmentato entro il dolce rumore della vita.
Sandro Penna, Poesie (1927–38)
[Sein wollt’ ich im Schlaf eingetaucht im süßen Lärm des Lebens.]
D.L.
Herbst
ALS ARPAD JANOS NACH ZEHN WOCHEN aus dem Koma erwachte, sprach er in vollständigen Sätzen. Janos war Ungar, Deutsch demnach nicht einmal seine Muttersprache. Einziger Hinweis darauf in seiner Aussprache des Deutschen war ein kräftig gerolltes »r« gewesen und gelegentlich die falsche Betonung der ersten Silbe: Kartoffel hatte er beispielsweise immer gesagt. Wundersamerweise war nun der Akzent verschwunden, der Schlaganfall schien auch die Stelle im Hirn getroffen zu haben, wo fehlerhafte Aussprache ihren Ursprung nimmt. »Eine aufwendige Korrektur kultureller Eigenart«, pflegte Janos zu spotten, kaum daß er wieder spotten konnte.
Sein erster Satz war bemerkenswert und hatte die diensthabende Nachtschwester einen Schritt zurücktreten lassen. Er sagte mit hoher, kräftiger Stimme:
»Erst die geteilte Lust an Wundern läßt diese geschehen.«
Sein halbgelähmtes Gesicht verzog sich zu einem lautlosen Lachen, und die Nachtschwester legte ihren Finger auf den Rufknopf an der Tür, als müsse sie sich für einen Notfall rüsten. Ihr Patient schien zu verstehen und glättete seine Gesichtsmuskeln, bis sein Ausdruck wieder die reglose Starre des Komas angenommen hatte.
Wie es zu dem Schlaganfall gekommen war, ließ sich nur schwer rekonstruieren, weil Arpad Janos allein lebte: eine fast spurenlose Existenz, wie sich herausstellte.
Man fand ihn über das Steuer seines Wagens gesunken, auf der Standspur einer befahrenen Autobahn und mit eingeschalteter Warnblinkanlage, was darauf schließen ließ, daß er noch in den letzten Sekunden vor dem Schlaganfall klar dachte.
Die Schwestern stellten mit Verwunderung fest, daß jedes Kleidungsstück, das er am Tag der Einlieferung getragen hatte, Unterwäsche eingeschlossen, mit seinen aufgenähten Initialen versehen war. Ajot nannten sie den Komatösen deshalb unter sich.
An einem stürmischen Herbsttag öffnete er die Augen. Die taghelle Beleuchtung der Noteinfahrt, über der sein Zimmer lag, machte aus den im Wind sich biegenden und ächzenden Bäumen ein gespenstisches Schauspiel.
»Ich versteh euch nicht«, rief Ajot den wild gestikulierenden Ästen zu; dann, an die Schwester gewandt: »Gott fliegt.«
Sie war einiges gewöhnt, und die Müdigkeit tat das Ihrige, daher zuckte sie nur resigniert mit den Schultern und strich sacht über seine Bettdecke. »Warum nicht?« sagte sie und überprüfte die Infusionen. »Er schreibt auch«, fügte sie hinzu und deutete auf die grün leuchtende Schrift der Computeranzeige am Tropf. Ajot nickte entzückt mit dem Kopf: »Ein wunderbarer Planet.«
Er schloß die Augen, erschöpft von seiner wiedergekehrten Beredsamkeit. Die Schwester löschte das Licht, an der Tür drehte sie sich noch einmal um, denn sie wollte sicher sein, daß ihr nicht ein zweites Wunder, wie zum Beispiel das Zurückbilden aller Lähmungen, entging. Es hätte sie nicht erstaunt, wenn Ajot aufgesprungen wäre, ihr die Tür aufzuhalten. Aber er schlief.
Am nächsten Morgen schien es zunächst, als habe er seine kaum wiedergefundene Sprache ein zweites Mal verloren. Er war apathisch, stumm und feindselig. Eine Schwester, die kam, um sein Bett zu richten, hatte durch den Nachtdienst von dem Wunder erfahren und sagte mit der dem Pflegepersonal eigenen, übertriebenen Euphorie: »Jetzt geht es aufwärts, Herr Janos! Sie werden sehen, Weihnachten können Sie sich schon selber den Gänsebraten in die Röhre schieben!« Sie dachte, daß alle Ungarn eine Weihnachtsgans äßen und daß die Erwähnung derselben ihm guttun würde. Doch Ajot warf ihr einen Blick zu, so verächtlich, als hielte er sie selbst für eine. Sie klingelte nach einem Pfleger, um Ajot aus dem Bett zu heben. Vom langen Liegen hatten sich trotz regelmäßiger Vorsorge an seinem Rücken und an den Fersen wunde Stellen gebildet, die er jetzt zum ersten Mal schmerzhaft spürte. Mit der Schmerzempfindung kehrte seine am Abend zuvor so furios ausgebrochene Vitalität zurück: »Ein rosa Alpenveilchen möchte ich auf der Fensterbank«, befahl er und fügte hinzu (vielleicht weil er sah, daß seine Aufforderung gleichmütig aufgenommen wurde): »für Rosa.«
Er wurde vorsichtig in einen mit Schaumgummi ausgelegten Rollstuhl gesetzt. Er saß, schmächtig und schief wegen der linksseitig stärker ausgeprägten Lähmung, wie ein zu früh flügge gewordener Vogel und wiederholte mit Nachdruck: »Rosa.« Der Pfleger, der flink und ohne eine überflüssige Bewegung Bettücher auswechselte, straff zog, glattstrich und sich dabei mit seiner Kollegin unterhielt, fragte, reichlich nebenher: »Welche Rosa?« Und ohne Ajots Erklärung abzuwarten, fuhr er in seiner Unterhaltung fort. Vor Empörung überschlug sich Ajots zarte Stimme und wurde schrill: »Rosa! Rosa! Deren Däumling du nicht wert bist, nicht mal ihre Schuhe dürftest du mit deiner Spucke putzen, geschweige denn!«
In den langen Wochen seines Komas hatte Ajot keinen Besuch erhalten. In seiner Brieftasche fand man außer seinem Führerschein, einem Blutgruppennachweis, einer Busfahrkarte und zwei Zehnmarkscheinen nichts: kein Adreßbuch, keine Zettel mit Telefonnummern. Nicht einmal sein Name war im Telefonbuch eingetragen; ein Janos, Hans-Albert, stellte sich als nicht verwandt heraus. Ajot schien tatsächlich nur aus seinen Initialen zu bestehen. Jetzt gab es immerhin Rosa. Die Schwester fragte, ob er sich mit ihr in Verbindung setzen wolle?
»Rosa telefoniert nicht«, gab Ajot entrüstet zur Antwort. »Rosa spricht zu mir.« Dabei wies er mit der Rechten auf sein Herz.
Um den Raum nicht stillschweigend zu verlassen, aber unsicher, was er zum Thema Rosa gefahrlos beitragen könnte, fragte der Pfleger: »Möchten Sie etwas zum Lesen?«
Ajot bekreuzigte sich: »Haltet mir solche Gaunereien vom Hals. Gauner, nichts als Gauner!« Mit jeder Wiederholung dehnte er die Silben länger, als wolle er das Wort zum Zerreißen bringen. Pfleger und Schwester verließen Ajots Zimmer ohne weiteren Kommentar, aber mit der festen Absicht, über Frauen und Bücher kein Wort mehr zu verlieren.
Auf dem Nachttisch hatte man das Frühstückstablett abgestellt, ungeachtet der Tatsache, daß Ajot sich wegen der Lähmung und der zahlreichen Schläuche kaum bewegen konnte. Er erreichte nur den Löffel und betrachtete neugierig das in die Länge gezogene, großnasige Gesicht, das er darin sah. Dann hielt er den Löffel quer und kicherte, als er seine Pausbacken begutachtete. Er war sicher, daß Rosa insgeheim so ihr Aussehen überprüft hatte beim gemeinsamen Kaffeetrinken. Jedesmal, wenn sie gegangen war, hatte er den Abdruck ihres rosa Lippenstiftes auf der Kaffeetasse geküßt.
Nach mehreren Tagen konstanter Fortschritte beschloß man, Ajot auf die Rehabilitationsstation zu verlegen. In vier bis sechs Wochen, erklärte ihm ein munterer Oberarzt, werde man versuchen, ihn wieder alltagstüchtig zu machen. »Alltagstüchtig?« wiederholte Ajot angewidert. »Ich habe doch Rosa.« Diese Bemerkung veranlaßte das anwesende Personal zu vermuten, daß Rosa seine Putzfrau oder Köchin sei. Die im Führerschein angegebene Adresse erwies sich als ein fünfstöckiges, nicht besonders schmuckes Wohnhaus mit unzähligen Namensschildchen.
»Lauter Einzeller«, hatte Ajot zu Elisabeth, der Physiotherapeutin, gesagt, die ihn von ihrer Absicht unterrichtete, seine Wohnung aufzusuchen.
Ein gräßlicher Geruch schlug ihr entgegen, als sie die Tür aufschloß, und sie war sich trockener Kehle bewußt, daß Rosa drei Schritte weiter – Ajots Beschreibung zufolge in der Küche – tot liegen müsse. Die Finger zur Faust geschlossen, stieß sie die halb angelehnte Küchentür weit auf. Es schepperte. Durch das schwungvolle Öffnen hatte sie einen metallenen Kübel, der Ajot als Mülleimer diente, umgeworfen und seinen Inhalt in der Küche verteilt.
Es war nicht die tote Rosa, die stank, sondern es waren die zehn Wochen alten Reste von Ajots letzten Mahlzeiten. Elisabeth hielt sich ein mentholversetztes Taschentuch aus einer irrtümlich erstandenen Packung vor die Nase, froh über diese Zerstreutheit beim letzten Einkauf. Der Pfefferminzgeruch trieb ihr die Tränen in die Augen. Erst als sie vor der Haustür stand, ballte sie es zusammen und warf es aufatmend weg. Sie schaute sich um: Schräg gegenüber gab es eine Reihe von Geschäften. Sie kaufte große Mülltüten, die für Gartenabfälle gedacht waren, Putzlappen und eine Flasche Essigreiniger, die sie sofort öffnete und sich unter die Nase hielt. Unter den betretenen Blicken der Anwesenden schöpfte sie zweimal tief Luft und drehte die Verschlußklappe wieder zu. Mit gereinigten Atemwegen machte sie sich auf den Rückweg, hörte noch, wie die zurückbleibenden Kunden etwas von »Schusterleim« und »brasilianischen Straßenkindern« murmelten, und stand wieder vor Ajots schäbiger Eingangstür. Auf der Innenseite der Tür, im Licht einer zu hellen und zu tief hängenden Deckenlampe, sah sie auf halber Höhe Spuren von Abnützung: als sei ein Hund an ihr hochgesprungen. Sie beugte sich vor, um durch den Spion zu schauen. Das Treppenhaus krümmte sich schwindelerregend in der häßlichen Fischaugenperspektive, und Elisabeth spürte, wie die von Menthol und Essig vertriebene Übelkeit zurückkehrte. Sie stützte sich ab und sah, daß ihre Hände genau auf der zerkratzten, abgeschabten Fläche des Holzes Stellung bezogen hatten. Vielleicht hatte Ajot so stundenlang gestanden und in den Strudel des Hausflurs hinausgestarrt?
Sie ließ in Küche und Bad Wasser laufen, das anfangs dunkelbraun und stoßweise, wie gegen seinen Willen, aus den Hähnen rann. In der Küche unter dem Waschbecken fand sie eine altertümliche Metallschaufel mit rissigem Emaillebelag; die Borsten des dazugehörigen Handbesens waren so abgenützt, als hätte Ajot damit halb Ungarn gefegt, dachte Elisabeth. Sie kehrte den Müll zusammen und hielt die Luft an. Rosa konnte nicht Ajots Köchin sein, dazu waren zu viele leere Dosen von Fertiggerichten im Abfall. Aber es gab sie, das stand ebenfalls fest. Elisabeth fand zahlreiche Papiertaschentücher mit Lippenstiftspuren, oft so deutlich, als hätte Rosa ihren Mund daraufgepreßt, um einen dezenteren Rotton zu erreichen. Einen weiteren Hinweis auf ihre Existenz fand Elisabeth im Schlafzimmer, das durch seine Kleinheit und karge Möblierung – Bett, Schrank und ein Stuhl, der als Nachttisch diente – mehr den Eindruck einer Zelle erweckte. Auf der Fensterbank standen nämlich die Überreste eines Alpenveilchens, verschrumpelt und fast farblos. Ein welkes Blütenblatt zeigte jedoch noch schwache Spuren eines einst kräftigen, aber jetzt vor Resignation stark erblaßten Rosas. Als Elisabeth es berührte, zerfiel es vollends und wurde grau. Ajots Bettwäsche trug seine Initialen, sie war so sorgfältig gebügelt, daß die Falten trotz mehrerer Übernachtungen (Elisabeth, mit erwachtem detektivischem Eifer, fand einzelne Haare und auch hier verwischte Spuren roten Lippenstifts) wie scharfe Gebirgskämme Kissen und Decke umsäumten.
Sie setzte sich auf die Bettkante, um einen besseren Überblick zu gewinnen: Wenn Ajot Rollstuhlfahrer bliebe, würde es eng werden in seiner Wohnung. Sie stand auf, um den Türrahmen auszumessen, und stolperte über ein Paar Schuhe. Es waren Damenschuhe, mit ziemlich hohem Absatz, und sehr groß. Mindestens Größe 41, schätzte Elisabeth. Hoffnungslos unmodisch. Im Zimmer würde man Griffe anbringen müssen, so daß Ajot sich aus dem Rollstuhl ins Bett und umgekehrt vom Bett in den Rollstuhl ziehen könnte. Sie bückte sich. Über dem Stuhl, der als Nachttisch diente, hing ein Foto; eine kräftige Mittvierzigerin, die die Schuhe trug, die Elisabeth fast zu Fall gebracht hätten. Ein Kleid, das mit Hilfe eines Gürtels eine Taille erzwang, Hut, Handtasche und Lächeln wie aus dem Versandhaus. Rosa? Wenn ja, dann mußte Rosa Ajots Schwester sein, die Ähnlichkeit war erdrückend. Die gleiche List in den tiefliegenden Augen, die die Nase um so vorspringender erscheinen ließen, geschürzte, scharf gezeichnete Lippen, geschmäcklerisch, zum Maulen bereit, fand Elisabeth. Sie konnte nicht sagen, ob sie Ajot über die berufsbedingte Teilnahme hinaus mochte. Sie schaute hinter einen zwischen Kleiderschrank und Wand gespannten Vorhang: eine Schublade voll Damenwäsche, rundherum aufgetürmte Bücherstapel, dreisprachig: ungarisch, russisch, deutsch. Viersprachig, korrigierte sich Elisabeth, als sie ein Buch mit dem Titel Les fleurs du mal neben voluminösen Büstenhaltern fand. Diese Wäsche trug keine Initialen.
Im Schrank hingen vorwiegend Ajots Anzüge, zwei, drei Frauenkleider, eins davon vielleicht das, das sie auf dem Schwarzweißfoto trug. Geruch nach Mottenkugeln. Durch das Wohnzimmer ging Elisabeth zurück in die Küche. »Hier hätte er die Bücher auf Regalen unterbringen sollen«, dachte sie, als sie die kahlen Wände musterte, deren einzige Dekoration zwei Porzellanteller mit Goldrand waren. Ein schönes, altes Radio mit Holzverkleidung stand auf einem Teewagen, der so zierlich war, daß man sich wundern mußte, wie er einem größeren Gewicht als dem graziöser Teetäßchen standhalten konnte. Auch er ein Problem für den Rollstuhl – Elisabeth nahm ihn in ihr Protokoll der Unzulänglichkeiten auf. In der Küche riß sie – wer weiß, warum – noch siebzig Tage von dem Kalender und las den Spruch auf der Rückseite des letzten: Der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert. »Sei’s drum«, dachte sie und entfernte auch dieses Blatt mit einer entschlossenen Handbewegung.
Das Bad war erstaunlicherweise nicht nur der größte Raum, sondern dazu noch der wohnlichste. Auch hier natürlich rosa, und zwar in Form von flauschigen Vorlegern, Klodeckelpolstern und einem U-förmigen Fußwärmer unterhalb der Toilette. Ein Gummibaum aus Gummi stand neben der Badewanne, alle möglichen Utensilien waren an seinen starken Ästen aufgehängt: eine Massagebürste, Flüssigseife, zwei rauhe Sisalwaschlappen, steif vor Trockenheit. Eine Art Weihnachtsbaum, lachte Elisabeth. Sie öffnete den Spiegelschrank und fand die kleinen Regale vollgestellt mit Kosmetika; Fläschchen und Dosen standen diszipliniert in der Reihenfolge ihrer Größe. Der Anblick erinnerte Elisabeth an Kindergartenausflüge, bei denen sich alle Kinder an einem dicken Seil festhielten und im Gänsemarsch der Erzieherin folgten. Die erste und größte Flasche enthielt ein Enthaarungsmittel. Als sie das Licht einschaltete, um mit dem Ausmessen zu beginnen, verschwammen die Gegenstände in einem warmen Rot und bekamen weiche Umrisse. Ajot hatte das Milchglasgehäuse der Deckenlampe rot übermalt, und jetzt entdeckte Elisabeth auch ein kleines Kofferradio, das auf einem plüschigen Schemel am Fuß der Badewanne stand. An der Tür zwei Haken mit Bademänteln, darunter ein poppiger Schriftzug: Let’s party.
Je mehr Elisabeth über Ajot von den stummen Zeugen in seiner Wohnung erfuhr, desto rätselhafter wurde er ihr. Mechanisch setzte sie ein Fragezeichen hinter die zuletzt aufgeschriebenen Maße der Badezimmertür, bevor sie den Notizblock wieder in ihre Tasche steckte.
Sie kehrte in die Küche zurück und stellte das Küchenfenster schräg. Ihre Nase hatte sich an den Gestank gewöhnt, so sehr, daß sie im Bad trotz aufgestellter Duftfläschchen nichts von der Waldfrische wahrgenommen hatte. Die abgerissenen Kalenderblätter wirbelten im Durchzug auf, als feierten sie ihre Entlassung aus der Chronologie. Die gewichtigen Prophezeiungen auf ihren Rückseiten ließen sie jedoch rasch wieder nach unten sinken. Elisabeth schreckte sie mit dem Fuß noch einmal auf, als wären sie altes, trockenes Laub, und zog die Tür fest ins Schloß.
Ajot hatte ständig nach ihr gefragt, zur Verwunderung der anderen Therapeuten und Pfleger, denn er hatte bisher keine besondere Anhänglichkeit erkennen lassen. Aber an diesem Tag klingelte er, kaum daß Elisabeth sich auf den Weg zu seiner Wohnung gemacht hatte, um sich über ihre Abwesenheit zu beschweren. Er fuhr in unruhigem Zickzackkurs mit seinem Rollstuhl im Flur umher, machte abrupte Kehrtwendungen, ohne sich bei denjenigen zu entschuldigen, die gerade noch rechtzeitig zur Seite springen konnten.
Von sich selbst sprach er jetzt meist in der dritten Person: »Janos will essen«, wobei es oft vorkam, daß er essen sagte, aber trinken meinte. Seine Arme waren noch immer sehr dünn; wenn er die Reifen seines Rollstuhls umklammerte, traten deutlich sichtbar die Muskelstränge hervor, die Fingerknöchel wurden vor Anstrengung weiß. Er sorgte sich um sein Auto, Automobil nannte er es und fügte kichernd hinzu, daß es sich jetzt tatsächlich von alleine bewegen müsse. Seine Beine behandelte er wie ein lästiges Stück Gepäck; unwirsch korrigierte er ihre Position im Rollstuhl, indem er sie unsanft hin und her schob. Zornausbrüche folgten: »Benehmt euch«, schrie er, »sonst werdet ihr verkauft.«
An seinem Rollstuhl war vorne, ähnlich wie Spielzeug bei einem Kinderwagen, eine Art Abakus angebracht worden; man hatte Ajot erklärt, daß das Spielen mit den Kugeln zur Verbesserung der Feinmotorik seiner Finger beitrage. Anfangs hatte er die bunten Holzperlen völlig ignoriert, nach zwei Tagen begann er jedoch hingebungsvoll komplizierte Rechnungen aufzustellen: Mit Wucht schob und teilte er die Perlreihen nach rechts und links, bewegte die Lippen, als murmele er Zaubersprüche, veränderte erneut ihre Stellung und setzte abschließend mit ungeduldigen, zornigen Handbewegungen die Perlen in Schwung. Dann summte er vor Vergnügen mit.
»Ich bin ein Idiot«, verkündete er, »das heißt Privatmann – griechisch«, fügte er schadenfroh hinzu, sobald die erwünschten Einwände (»Aber Herr Janos, Sie hatten einen Schlaganfall; mit Hilfe der Therapie werden Sie …«) erfolgt waren. Er verblüffte durch Belesenheit; sein kategorisches Ablehnen jeder Lektüre ging einher mit einem reichen, bei jeder Gelegenheit zum besten gegebenen Zitatenschatz. Meistens zitierte er nur den Beginn, als wolle er ein Quiz mit den Schwestern veranstalten. Diese blieben aber meistens stumm, aus Desinteresse eher als aus Unwissenheit. Er machte dann eine wegwerfende Handbewegung, als gäbe er es endgültig auf, Ignoranten belehren zu wollen.
Seine Behinderung nahm er mit eigentümlichem Gleichmut an. So sagte er hochfahrend zu der Nachtschwester, die ihn angesichts seiner Hilflosigkeit trösten wollte, daß ein Handicap eine individuelle Auszeichnung sei.
»Man denke nur an die Bonsai«, führte er aus und schmatzte mit den Lippen im Vorgeschmack der kommenden Pointe, »ihr Wachstum wird behindert, sie werden mit viel Aufwand und Kosten verkrüppelt, damit sie sich von ihren banalen, großwüchsigen Geschwistern unterscheiden. Bei mir hat das mein Gehirn mittels einer winzigen Verweigerung des Dienstes kostenlos erreicht.«
Man ließ ihn reden. Wichtig war allein, in spätestens vier Wochen, wenn Ajot entlassen würde, jemanden zu finden, der ihm beistand. Elisabeth sollte mit ihm darüber sprechen; vielleicht würde Ajots neuerdings erkennbare Anhänglichkeit eine Lösung des heiklen Problems erleichtern.
Sie hatte eigentlich vorgehabt, im Anschluß an ihre Wohnungsbesichtigung zu Ajot zu gehen und mit ihm sein Leben nach der Entlassung zu besprechen. Aber auf dem Weg zu seinem Raum machte sie kehrt, sie spürte eine starke Abneigung und bodenlose Traurigkeit und wußte weder, worauf sich das eine noch das andere gründete. Das Schwindelgefühl, das sie beim Blick durch den Türspion empfunden hatte, kam zurück, und sie lehnte sich gegen die Wand. »Man wird so schnell alt zwischen all den Kranken«, flüsterte sie so leise, daß sie es selbst kaum hörte. Ein scharfer Schmerz am Hinterkopf: Ein Reißzwecken hatte sich durch den Druck von dem schwarzen Brett gelöst und sie verletzt. Gereizt wandte sie sich um und drückte die Nadel wieder in den weichen Kork. Der kleine Zettel, den sie gehalten hatte, lag am Boden. Ehemalige Krankenschwester sucht Anstellung von Privat. Dorothea Pracht. Adresse und Telefonnummer waren angegeben. Elisabeth steckte den Zettel in die Tasche ihres Kittels, mechanisch. Am nächsten Tag würde sie mit Ajot reden.
Essensgeruch hing schwadendick und viel zu früh in den Gängen, Tellerklappern mischte sich unter die halb gestöhnten, halb gesprochenen Silben der Schwergelähmten. Sie waren durch Unfälle und Zufälle zu Tischgenossen geworden, über die sie sich jetzt nicht einmal richtig austauschen konnten. Dem einen war auf einer Baustelle das halbe Gerüst auf den Kopf gestürzt, und seit diesem Tag hielt er sich für den Bruder seines dreijährigen Sohnes. Und irgendwie stimmte es ja. Der grauhaarigen, fülligen Patientin zu seiner Linken hatte der Schlaganfall ein seliges Lächeln festgefroren, sie zum ewigen Glück gelähmt. Sie schüttelte mit einer leisen, geduldigen Bewegung unentwegt den Kopf, als könne sie es selbst nicht ganz glauben. Sie hatte, an einem Sommertag, nur Wäsche aufhängen wollen, da setzte still die heftige Blutung ein. Ihr Mann fand sie später auf der Wiese hinter dem Haus, in sich zusammengesunken auf seinem weißen Hemd, in jeder Hand eine Wäscheklammer. Wenn ihr Mann sie jetzt besuchte, waren seine Hemden ungebügelt. Im Vorbeigehen erwiderte Elisabeth das unausrottbare Lächeln mit einem freundlichen Kopfnicken.
Ein schwingender, mit Rüschen besetzter Glockenrock, eine Schneckenhausspirale, ein Pfauenauge (einziger Schmuck seines Kinderzimmers), auf durchweichter Waffel schwindelerregend getürmtes Softeis, das die Kehle hinabrast wie ein Bob auf der Rodelbahn, der Strudel in der Toilettenschüssel, ein Orkan auf der Wetterkarte, der sich wie eine geballte Faust westwärts wälzt, ihn mitwirbelt, bis er nach Luft ringt. Im Auge des Hurrikans kommt er endlich zur Ruhe, schwerelos, flüssig und dabei fest, ein Ärgernis für Chemie und Physik gleichermaßen.
Der Traum löste sich auf, trotzte dem Wachwerden sowenig wie dünne Nebelschwaden starker Sonneneinstrahlung. Und als Ajot davon erzählen wollte, spürte er erzürnt die Lähmung der Sprache, einen störrischen Brocken im Hals. Er riß an den Schnüren der Infusion, als hielten diese die Worte von ihm fern. Als Elisabeth eintrat und sich zu ihm auf die Bettkante setzte, war seine Wut gerade verebbt, mit halbgeschlossenen Lidern trauerte er den Bildern nach.
Sie widerstand dem Reflex, ihre Hand auf die seine zu legen. Ajot schaute sie jetzt mit weit offenen Augen an, und auf einmal verstand sie, daß er selbst Rosa war. Sich selbst zur Gesellschaft verkleidete und mit dem erfundenen Gegenüber die Gespenster seiner Einsamkeit verjagte.
»Bei mir«, dachte Elisabeth, während Ajots Augen ohne Verlegenheit auf ihr ruhten, »sind es Mann und Kinder.« Sie war froh, daß sie es begriffen hatte, denn ursprünglich hatte sie fragen wollen, ob Rosa ihm nicht beistehen könne.
Ajot unterbrach ihren Gedankengang: »Haben Sie die ersten Menschen auf dem Mond gesehen? Wie sie federten statt gingen? Und dann hat die Fahne alles verdorben: das Sternenbanner auf dem Mond!«
Elisabeth lächelte zustimmend: »Die türkische Fahne hätte besser gepaßt.«
Ajot wandte den Kopf ab, schaute aus dem Fenster, wie abwesend. »Herr Janos«, begann Elisabeth, »Ende des Monats werden Sie voraussichtlich entlassen. Sie werden auf den Rollstuhl angewiesen sein und Hilfe brauchen. Kennen Sie jemanden, der Ihnen, wenigstens stundenweise, beistehen könnte?«
»Ich muß mit Rosa darüber sprechen«, erwiderte Ajot und sehnte sich schon wieder nach seinen Träumen zurück. Er merkte nicht, daß Elisabeth aufstand, »Gut, lassen Sie mich es wissen« sagte und hinausging.
Sein Kopf war voller Blut, warm und rot wie seine Badezimmerbeleuchtung, wenn er mit Rosa gefeiert hatte. Musik und Wasser, Rosa, die ihn einseift, streng wie eine Mutter ihr Kind, mitpfeift. Rosa legt den Bademantel auf die Heizung, damit er es schön warm hat, wenn er aus der Wanne steigt. Am liebsten mag sie Frank Sinatra, Stranger In The Night, sie kann Englisch. Manchmal konnte Rosa auch häßlich sein, zum Beispiel wenn sie ihn wegen seines Akzents hänselte. Aber meist war sie, noch bevor er Liebling zu Ende sagen konnte, wieder sanft und anschmiegsam und folgte ihm ins Bett, eilig und fröstelnd, weil es im Bad in der Zwischenzeit richtig heiß geworden war. Und dann hielten sie sich in den Armen, und Ajots Akzent schien vor Behagen zu schmelzen, bis sein Rosa so weich klang wie Katzengeschnurr. Nur schade, daß sie es immer so eilig hatte, nach Hause zu kommen. Wenn er nach ihrem Liebesbalgen, wie Rosa es nannte, sich im Bad waschen ging und zurück in sein Schlafzimmer trat, war Rosa schon fort. Seufzend legte sich Ajot auf ihre noch warme Seite des Bettes und trocknete mit seinem Körper den nassen Fleck.
In dem fahlen Licht des Krankenzimmers sah Ajots Gesicht wieder glatt aus und jung.
Elisabeth trat ins Eßzimmer, küßte ihren Mann auf den Mund, fuhr dem Sohn durchs Haar und strich der Tochter über die Wange. Dann setzte sie sich zu ihnen an den Abendbrottisch, starrte auf den Aufschnitt und die Käseplatte, den scharfen und den milden Senf, die Silberzwiebeln und die Rote Bete und begann zu weinen.
»Einfach so«, antwortete sie, als die Kinder sie besorgt musterten und ihr Mann kauend »wo fehlt’s?« fragte. Sie ging in die Küche, kam mit dem Blütenhonig in der Hand zurück, setzte sich wieder. Zum Erstaunen aller strich sie sich ein Leberwurstbrot und tropfte in feinen Schlangenlinien Honig darauf. »Wenn es dir bekommt«, sagte ihr Mann und schenkte ihr ein Glas Bier ein, mit fester Schaumkrone. Elisabeth trank in großen Schlucken, als sie das Glas absetzte, hatte sie einen weißen Schnurrbart und vom Honig klebrige Lippen. Mit der Geistesgegenwart, die Kindern zu eigen ist, wenn sie das Aufweichen ansonsten unerschütterlicher pädagogischer Prinzipien wittern, füllten sie ihre eigenen Gläser auch mit Bier. »Bitte, bitte«, sagte Elisabeth zerstreut. Sie empfand die vertrauten, optimistischen Melodien, die aus dem Fernsehgerät ertönten und in der Regel dem ebenso optimistischen Programm des frühen Abends vorausgehen, auf einmal als tröstlich.
Ein ganz banaler Abend. Sie wurde fröhlich.
Man hatte die Psychotherapeutin, die Ajot an diesem Morgen im Rahmen einer routinemäßigen Begutachtung aller Schlaganfallpatienten befragen sollte, vor dessen cholerischer Veranlagung gewarnt. Man wolle sie nicht gegen ihn einnehmen, hieß es, aber angesichts der Vorfälle in jüngster Vergangenheit halte man es für angebracht, dies zu erwähnen. Die Psychotherapeutin erwiderte, daß sie von Berufs wegen gegen Parteinahme gefeit sei.
Als sie eintrat, wurde sie von Ajot mit einem Lächeln begrüßt und mit einer gewinkten Einladung, sich zu ihm zu setzen. Sie schob einen Stuhl an sein Bett und bedauerte einen Moment lang, ihre Brille gegen Kontaktlinsen eingetauscht zu haben, weil sie das Gefühl hatte, sich an etwas festhalten zu müssen, und sei es nur am Gestell einer Brille. Ajot schaute sie neugierig an, intensiv, als wolle er von ihrem Gesicht ablesen, was sie zu ihm führte, noch bevor sie sich dazu äußerte. Sie stellte sich vor und sagte so unverfänglich wie möglich: »Ich möchte mich mit Ihnen unterhalten.«
Da er nicht reagierte, begann sie in ihrem Notizblock zu blättern, schaute auf, traf auf Ajots unverändert neugierigen Blick und sagte schließlich verzweifelt, wie ein Schulkind, das sich an nichts erinnert und blindlings rät: »Haben Sie finanzielle Probleme?«
»Meines Wissens nicht«, erwiderte er korrekt.
Sie vollführte mit dem Kugelschreiber in der Hand vage Kreisbewegungen: »Uns ist nicht klar, wie Sie Ihren Lebensunterhalt bestreiten, die Unterlagen …« Ajot unterbrach sie:
»Rosa und ich, wir brauchen nicht viel. Ein Tänzchen in Ehren, die Briefmarkensammlung meines Vaters wurde an einen Philatelisten in Budapest verkauft, der Rosa zuliebe ein paar Scheinchen mehr dazulegte –«, er machte eine Pause: »Das Teuerste in meinem Leben kostet nichts. Außerdem habe ich – hatte ich – einen Beruf: Ich bin röntgentechnischer Assistent.«
Sie schrieb. »Wo?«
»Am Kreiskrankenhaus.«
»Warum haben Sie überall Ihre Initialen einnähen lassen?«
»Lassen? Ich habe es selbst getan«, antwortete er gekränkt, »damit ich weiß, wer ich bin.«
Ihre Hand mit den schönen, roten, schmal gefeilten Nägeln hielt kurz inne, dann notierte sie weiter. »Hat Sie etwas bedrückt, hatten Sie Ärger, bevor es passierte?«
»Ich war eifersüchtig«, sagte Ajot, »aber das gehört dazu; es tut dem da gut.« Er zeigte auf sein Herz.
Sie senkte den Kopf und sah ihn jetzt von unten herauf an, als wolle sie mit ihrem Blick sein Kinn anheben und ihn Auge in Auge zu Aufrichtigkeit zwingen. »Rosa gibt es nicht.«
Ajot hielt die Hand vor den Mund, prustend und lachend, daß ihm die Tränen aus den Augen traten. »Ich habe sie gut versteckt! Wie eine Geheimsprache. Der Zunge sieht man auch nicht an, welche Sprache sie spricht!« Er hatte sich vor Aufregung halb aufgerichtet und sprach mit erhobenem Zeigefinger. »Und der Haut nicht, wer sie liebkost und wen sie schützt.« Er griff nach ihrem Arm, als wolle er das Gesagte demonstrieren, aber die Psychotherapeutin schüttelte seine Hand erschrocken ab; und drückte den Notizblock mit verschränkten Armen gegen ihre Brust, vergeblich nach der Frage suchend, die Ajot durch seinen Übergriff aus ihrem Gedächtnis vertrieben hatte.
»Ich brauche keinen Trost«, sagte Ajot, bevor sie, trotz ihres wissenschaftlichen Widerwillens dagegen, improvisieren konnte.
»Dies« – er deutete auf sich – »ist nicht die Folge von irgend etwas, und deshalb verzichte ich auf eine Ursache.« Zufrieden schloß er die Augen; für ihn war die Audienz beendet.
»Beruhigen Sie sich«, sagte die Psychotherapeutin zu Ajot, der vollständig bewegungslos lag, »wir können auch jemandem wie Ihnen helfen.«
»Beim Schlafen?« fragte er listig und schloß seine Augen gleich wieder. Sie erhob sich, griff nach der Brille, die sie nicht trug, und ging. Ajots Nasenflügel weiteten sich, als er im schwachen Luftzug ihr Parfüm roch. »Charmant.«
Als Kind, eine staubige Straße ohne Bürgersteig, so holprig, daß er unentwegt stolperte, weil er aus Zerstreutheit seine Füße nicht hob. Die Fersen taten weh, die Wollstrümpfe scheuerten in den offenen Blasen. Er lief stundenlang, seine Mutter würde Augen machen, wenn sie ihn im Büro auftauchen sah. Er pflückte ein paar mickrige Blumen, Spitzwegerich? Hießen sie so? Am Wege standen sie jedenfalls, aber waren bei weitem nicht so schön wie die Kornblumen, die er in einem Buch abgebildet gesehen hatte, so blau, daß sie inmitten des fahlen Korns aussahen wie geschminkt. Als er das Haus betrat, in dem seine Mutter arbeitete, klopfte er sich den Staub aus der Kleidung, befeuchtete sich die Lippen mit der fast ebenso trockenen Zunge und dachte sehnsüchtig an die schönen Lippenstifte, die sie besaß. Er spürte die Ohrfeige nur schwach, die sie ihm gab, kaum daß er nah genug an ihrem Schreibtisch stand. Die Blumen fielen auf den Boden. Von dem Tag an war Kornblumenblau seine Lieblingsfarbe.
Dorothea wachte auf, noch bevor Bert anfing zu schreien. Anscheinend gab es doch so etwas Ähnliches wie Instinkte. Auf diesen hätte sie gerne verzichtet und eine Viertelstunde länger geschlafen. Andererseits war ihr Hemd durchnäßt von überschüssiger Milch; die Milchdrüsen schienen sich noch schlechter mit der Nacht abzufinden als Bert. Dorothea lag still, in Erwartung des ersten Schreis. In der Dunkelheit wirkte ihre winzige Wohnung groß. Sie schlief in ihrem Wohn- und Arbeitszimmer, ein großer Schreibtisch, umgeben von Regalen, füllte den größten Teil des Zimmers aus.
Sie stand auf; da sie barfuß lief und am wechselnden Bodenbelag spürte, wo sie war, erreichte sie das Bad, ohne an etwas zu stoßen. Mit dem Fön trocknete sie zuerst ihr Hemd, dann die Milchlache im Bett. Sie richtete den warmen Wind auf ihr Gesicht und spürte mit geschlossenen Augen, wie er ihr durch das kurze Haar fuhr. Eine Brise füllte ihre Nase, die nach Sand roch und nach salzigen Krebsen, denen das mittägliche Dösen auf dem nicht mehr von der Brandung überspülten Fels das Leben gekostet hatte. »Was für ein schöner Tod«, dachte Dorothea und lief, als sie das erste, zögernde Klagen von Bert vernahm, in das angrenzende Kinderzimmer.
Es roch nach geronnener Milch, und nachdem Dorothea die Windel geöffnet hatte, mischte sich der süßliche Geruch des Urins mit der schweren Luft zu einem Duft, der in ihr ein geradezu körperliches Besitzgefühl auslöste. Sie beugte sich herab und küßte den abgeheilten Nabel; Reste des Desinfektionspuders waren noch zu schmecken. Sie schloß die Windel und genoß die deutlichen Zeichen der Ungeduld, des Hungers. Sie setzte sich, ihren Sohn zu stillen. Das rhythmische Schmatzen, unterbrochen von Protest, dann wieder zufriedene Grunzlaute, die kleinen Hände, die atavistischen Massageimpulsen zur Steigerung des Milchflusses zu folgen schienen: alles war so vollkommen, so einleuchtend, daß Dorothea den Eindruck gewann, selbst Teil eines Überleben gewährenden Programms zu sein – sie schlief ein.
Während Bert mit weit geöffneten Augen die Dunkelheit furchtlos ertrug, lag wenige Kilometer entfernt Elisabeth wach und hörte teilnahmslos auf die Atemzüge ihres Mannes. Ajot träumte auf ungarisch, und seine Schmerzen vergingen, als gäbe es sie nur in der anderen Sprache.