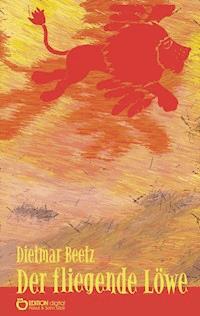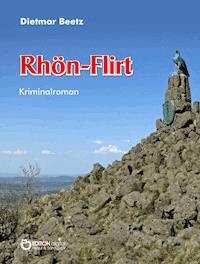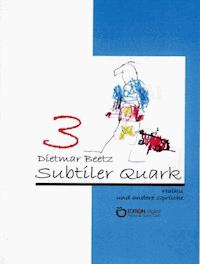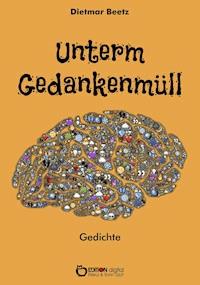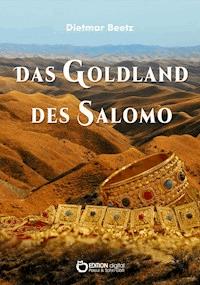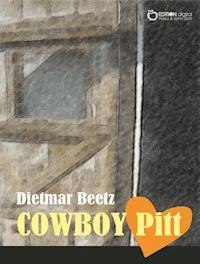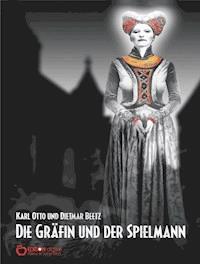8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Es ist August 1904 in Deutsch-Südwestafrika, dem Land zwischen den Flüssen Oranje und Kunene. zwischen Atlantik und Kalahari. Die Kolonialtruppen des deutschen Kaisers, der seit knapp einem Jahrzehnt dieses Land als Kolonie beansprucht, bewegen sich zu den Südhängen des Waterberges, zur Entscheidungsschlacht gegen das Volk der aufständischen Herero. Nach Monaten erbitterten Kampfes haben sich Zehntausende zu dem rostroten Felsmassiv zurückgezogen, in der Hoffnung auf Wasser. Ihnen bleibt, wenn sie weiter in die Wüste jenseits des Berges getrieben werden, nur der Tod des Verdurstens … Pieter Koopgaard, durch Geburt zwischen den Rassen stehend und unfreiwillig Söldner in deutschen Diensten, weiß, dass er sich entscheiden muss. Omutima, die Frau, die er liebt, ist eine Herero. Er muss zu ihr, muss fliehen ... Aber Koopgaard war vor Jahren Späher der Witbooi-Krieger im Kampf gegen die Deutschen. Und noch immer, lange schon ohne Nachricht, glaubt er an den Auftrag von Hendrik, dem legendären Führer des Stammes. Also bleiben und warten ... Doch da ist dieser Schwur, gegeben einem Weihepriester der Herero, bei jener Zeremonie. Koopgaard fühlt sich zerrissen und zwischen den Fronten. Was soll er tun? Und dann wird er hineingezogen in einen Strudel unvorstellbarer Ereignisse. Dietmar Beetz schreibt über einen wenig bekannten Zeitabschnitt deutscher Kolonialgeschichte. Er erinnert daran, dass mit dem Völkermord an den Herero, 1904 in Deutsch-Südwestafrika (dem heutigen Namibia), jenes Kapitel deutscher Perfektion und Gründlichkeit begann, das Jahrzehnte später seinen schrecklichen Höhepunkt finden sollte. INHALT: Späher im Hereroland Zwischen den Fronten Zwecks Abschreckung Trügerische Stille Lichtscheues Treiben Todgeweihte Omutima Schlachtfeld Bundesgenossen Unterwegs
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 317
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Impressum
Dietmar Beetz
Flucht vom Waterberg
Roman
ISBN 978-3-95655-175-8 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien erstmals 1989 im Verlag Das Neue Berlin.
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2014 EDITION digital® Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
ERSTER TEIL
Späher im Hereroland
1
Die Kolonne ist fast zwei Kilometer lang. An der Spitze reitet eine fünfzehnköpfige Vorhut. Ihr folgt in einigem Abstand die Kompanie mit den Geschützen, den Ochsenwagen, der Nachhut.
Das Tempo bestimmen die Ochsen vor den schweren, knarrenden Planwagen, die zum Transport von Munition, Proviant und Ausrüstung dienen. Paarweise hintereinandergeschirrt, ziehen achtzehn oder zwanzig eines der urzeitlichen Fuhrwerke, wobei sie, von Scharen dunkelhäutiger Treiber mit Geschrei und mit Peitschenhieben traktiert, stoisch Huf vor Huf setzen.
Über der Kolonne ballen sich Staubwolken, und die schweißigen Leiber werden von Mücken umschwirrt, von Schmeißfliegen zerstochen. Am Tag brennt die Sonne herab, und nachts lässt die Kälte mitunter die Spiegel der Tränkstellen erstarren. Ständig ist der Durst Begleiter, denn Wasser zählt hier in Südwestafrika zu den Kostbarkeiten.
Jetzt, Anfang August 1904, sind in diesem Teil des Hererolandes die Teiche meist ausgetrocknet und die Flüsse durchweg versiegt. Die letzte Regenzeit liegt acht, neun Monate zurück, und das lebenswichtige Nass findet sich nur noch da und dort in schlammigen Löchern.
Solche Wasserstellen sind die Stationen im Krieg, den die deutsche Kolonialmacht seit Januar gegen das Volk der aufständischen Herero führt. Der Verlust von Wasser und Weide, ihr Ausverkauf an Händler mit Wucherpreisen und an nachdrängende Siedler - das hat die Herero zur Verzweiflung, zum Aufstand getrieben. Und nun, nach Monaten erbitterten Kampfes, kann das Wasser, das letzte im Osten des Landes, am Rande der Kalahari, über das Schicksal der Herero entscheiden.
Seit Wochen zieht sich ihr Volk, von den Truppen des Kaisers attackiert, dorthin zurück. Frauen, Kinder, Greise schleppen sich, von Kriegern beschützt, zu Tausenden, zu Zehntausenden mitsamt ihrem Vieh und den Resten ihrer Habe zu den Südhängen des Waterberges, der sich wie ein Mauerblock vor den Weiten der Wüste erhebt. Auf den Wegen, den Trampelpfaden durch abgeweidete Dornbuschsavanne, liegen allenthalben die Kadaver oder die Gerippe verdursteter Rinder.
Auch die Kolonnen der Kolonialmacht leiden unter der Dürre, unter dem Durst. Um der Hitze zu entgehen, marschieren sie meist nachts, rücken in breiter Front gegen den Waterberg vor; ihre Späher können seit Ende Juli das rostrote Massiv manchmal schon in der Ferne erkennen.
So an diesem Morgen Anfang August die drei Reiter einer Patrouille, die zur Vorhut jener Kolonne gehören. Leutnant von Kirchhoff, der Kommandeur der Vorhut, hat sie anhand einer verwischten Faustskizze auf die Suche nach Wasser geschickt, und nun zügeln sie auf einer Anhöhe vor einem ausgetrockneten Flussbett ihre Pferde und schauen zu dem Bergblock, der im Nordosten über dem dornbuschbewachsenen Land zu schweben scheint.
Omuveroumue, sagt einer der drei, ein Bursche um die Zwanzig, versonnen.
»Stimmt«, meint ein anderer, einer im selben Alter, nach einem spöttischen Blick, »so heißt der Berg bei den Kaffern - eins ihrer unmöglichen Wörter.«
Der erste, Daniel Kok, zieht die Brauen zusammen, schweigt aber, und Pieter Koopgaard, der dritte bei diesem Patrouillenritt, tut es ihm gleich. Auch ihm missfällt, dass Moses Witbooi die Herero »Kaffern« genannt, das Schmähwort der Kolonialherren für Schwarze benutzt hat. Nicht mehr lang, und der nennt die Nama, den eigenen Volksstamm, »Hottentotten«, und das als Enkelsohn des großen Hendrik Witbooi!
»Reiten wir weiter?«, fragt Daniel Kok. Er wendet sich dabei an Koopgaard, so deutlich verratend, wen er respektiert und für den eigentlichen Patrouillenführer hält.
Moses zuckt kaum merklich zusammen, und mit heller, herrischer Stimme befiehlt er: »Vorwärts!«
Die Pferde, kräftige, struppige Hengste, steigen mit zitternden Flanken den Hang hinab. Sie sind zuletzt gegen Mitternacht, kurz vor dem Aufbruch der Kolonne, getränkt worden, und nun wittern sie wohl das Wasser, das die Patrouille, nachdem sie an drei, vier anderen Stellen vergebens gesucht hat, hier im Flussbett zu finden hofft.
Oder spüren sie eine Gefahr, vielleicht einen Hinterhalt der Herero? Sind sie deshalb unruhig geworden?
Koopgaard hält die Augen offen, obwohl ihm vor Übermüdung die Lider brennen, und auch die beiden anderen spähen zu den Hängen rechts und links, die noch im Schatten liegen.
Ringsum ist es still, so still, dass Koopgaard das Schnauben der Pferde und die Geräusche ihrer Hufe auf dem sandigen, gerölldurchsetzten Grund hören kann. Fern, auf Wogen der kühlen, sich aufheizenden Luft - der gedämpfte Lärm der Kolonne.
Vor einer Biegung des Flussbetts, einem Felsen im Hang, der in die Rinne vorspringt, zügelt Witbooi sein Pferd. Koopgaard und Kok verhalten ebenfalls. Die drei Reiter lauschen.
Nichts. Eine Weile nicht einmal mehr das ferne, eben noch wahrnehmbare Lärmen der Kolonne. Über dem Tal, das hinter dem Felsen zur Schlucht wird, kreist lautlos ein Geier.
»Weiter!« Witbooi lässt seinem Pferd freien Lauf, aber nach kurzer Zeit gleitet er aus dem Sattel.
Bei der Biegung, dicht am Fuße des Felsens, hat der Fluss, der während der Regenzeit hier tage-, manchmal auch nur stundenlang vorbeischießt, eine Mulde gegraben, und in dieser Senke steht, von kalkigen Streifen gerahmt, trübes, glitzerndes Wasser.
Koopgaard und Daniel Kok sind ebenfalls abgesessen. Während die Pferde saufen, knien die Reiter, in der Hand das Halfter, am Rand des Tümpels und trinken ebenso gierig. Koopgaard wird dabei das Gefühl nicht los, beobachtet zu werden.
Wieder auf den Beinen, entdeckt er unweit der Tränke frische Spuren. Im feuchten, schlammigen Sand haben Rinder Abdrücke ihrer Hufe hinterlassen, Tapfen, die noch nicht verweht oder gar verwittert sind. Nahebei findet sich zwischen geschwärzten Steinen die Asche einer Kochstelle.
»Kalt«, sagt Moses Witbooi, »kalt und alt.«
»So alt vielleicht doch nicht«, wendet Koopgaard ein, und Daniel Kok schlägt vor, noch ein Stück talaufwärts zu reiten.
»Ach was!«, erwidert Moses. »Wir kehren um. Wasser haben wir gefunden; das genügt. Außerdem sollen wir uns beeilen. Wenn wir sie nicht vor der Kreuzung erreichen, ziehen sie vorbei und müssen wenden oder einen Umweg machen.«
Ausflüchte, denkt Koopgaard. Zuviel Gerede. Hendrik, sein Großvater, würde einfach befehlen und sich nie vor einem Untergebenen rechtfertigen.
Im Übrigen stimmt natürlich, was Moses gesagt hat, wenngleich es nicht die ganze Wahrheit ist. Gewiss hat der Leutnant die Patrouille nur auf die Suche nach Wasser geschickt, doch zu einem solchen Auftrag gehört selbstverständlich die Erkundung des Geländes, in das die Kolonne vordringen wird.
Wieder mustert Koopgaard die Hänge. Die Sonne wärmt bereits, und er spürt, wie müde er ist, spürt auch die Erschöpfung des Pferdes.
Vielleicht hat Moses recht, und es ist überflüssig, zumindest nicht ratsam, das Gelände eingehender auszukundschaften. Außerdem, wie könnten sich drei übernächtigte Reiter, in diesem unübersichtlichen Terrain, auf entkräfteten, stolpernden Pferden, irgendwelcher Überraschungen durch die Herero erwehren?
Wozu auch? geht es Koopgaard durch den Kopf. Zum Teufel mit den Schnurrbärten, den Eindringlingen aus dem fernen Land! Sollen sie doch in eine Falle tappen oder in die Irre ziehn, an der Wasserstelle vorbei, weiter in Hitze und Dürre!
Unwillkürlich schaut Koopgaard zu Daniel Kok. - Hat der nicht vorhin, als Moses so beflissen von der Rückkehr zur Kolonne redete, verächtlich und voller Hass gelächelt?
Ein Ruck unterbricht die Gedanken von Koopgaard. Das Pferd ist gestolpert, in den Vorderläufen eingeknickt, und nun kniet es am Fuße jener Anhöhe, von der die Reiter vor dem Einschwenken in das Flussbett Ausschau gehalten haben.
Auch Moses und Daniel steigen ab. Sie führen und ziehen ihre Pferde wie Koopgaard die Steigung hinauf. Oben schwitzen alle und keuchen.
»So früh - so heiß!«, sagt Koopgaard, den Schecken tätschelnd.
»Heute werden die Schnurrbärte dampfen«, erwidert Kok verdrossen.
Moses schweigt.
Nach einem Blick zu der Rinne, die leer und verlassen zwischen den reglosen Hängen liegt, und zum Waterberg in der Ferne sitzen die Reiter auf.
Und wenn wir sie nun tatsächlich in die Irre ziehen lassen? fragt sich Koopgaard^
Einfach abhauen, sich in die Büsche schlagen, fliehen zu Omutima!
Das ist ein unsinniger Gedanke, entstanden aus Sehnsucht und Verdruss, und Koopgaard weiß das. Klar ist ihm auch, dass er Omutima, das Herero-Mädchen, die Frau, die ihm mehr als alles andere bedeutet, erst suchen und wiederfinden muss.
Omutima - ihre Augen, ihre Art zu lachen, ihr Duft nach Buchu-Puder ...
Die Idee zur Flucht war schon vor Monaten da; eigentlich bildete sie sich bereits bei der Nachricht vom Ausbruch des Aufstandes. Noch aber will Koopgaard warten, den richtigen Moment abpassen. Außerdem, jetzt abhauen - mit einem erschöpften Pferd?
Sind erst die Stellungen für die Entscheidungsschlacht bezogen, denkt er, lässt es sich leichter desertieren.
Und dann haben die Patrouillenreiter die Vorhut erreicht. Moses meldet, wo sich die falsch eingezeichnete Wasserstelle tatsächlich befindet, und rund eine Stunde später rollen bereits die Ochsenwagen knarrend und quietschend zum Flussbett hinab.
2
Die ersten Schüsse fallen auch für Pieter Koopgaard völlig überraschend.
Wenn das Feuer vorhin eröffnet worden wäre, auf die Patrouille, oder Stunden vorher, irgendwann im Dunkeln, auf die Kolonne ...
Die Reiter der Vorhut reagieren unterschiedlich beim Hall der Salve. Drei oder vier reißen, eh sie erfasst haben, was vor sich geht, den Karabiner aus dem Gewehrschuh; die anderen schrecken auf, stocken und starren aus müden, geweiteten Augen.
Koopgaard hat seinen Schecken unwillkürlich gezügelt. Nun duckt er sich auf den Rist des Pferdes und späht voraus und zu den Hängen.
Nichts, zumindest nichts Auffälliges. Und doch ist geschossen worden, und jetzt knallt es wieder. Mündungsfeuer - vorn und links, wo über dem Dornengestrüpp einzelne blassblaue Wölkchen schweben.
Schreie eines Verwundeten, Gewieher von Pferden, die steigen, die gewendet werden, die schrille Stimme des Leutnants.
»Vorwärts!«
Koopgaard glaubt erst, sich verhört zu haben, und auch die anderen Reiter, die noch im Sattel sitzen, knapp ein Dutzend, zögern, dem Befehl zu folgen.
»Abteilung, mir nach! Die Wasserstelle besetzen!«
Der Leutnant schlägt dabei auf sein Pferd, einen Schimmel, ein, traktiert das erschöpfte Tier mit den Stiefeln und dem Schaft des Karabiners, streckt, um den Befehl zu bekräftigen, den Arm mit der Waffe aus.
Im selben Moment kracht es wiederum, diesmal scheinbar von allen Seiten. Der Schimmel scheut; sein Reiter stößt einen Schrei aus, lässt den Karabiner fallen, stürzt.
Da ist Koopgaard bereits aus dem Sattel geglitten und hat den Schecken niedergezogen. Auch die anderen Reiter der Abteilung, Deutsche und Nama, sind in Deckung gegangen oder liegen verwundet am Boden. Die meisten ducken sich, von den Leibern ihrer Pferde geschützt, auf dem zerstampften, sandigen Weg und schießen.
Den Finger am Abzug, sucht Koopgaard die Hänge ab, rasch erst, noch mit der Hast eines Überrumpelten, dann bedächtiger. Entdecken kann er nach wie vor nichts; das Gestrüpp gegenüber, zwei, drei Steinwürfe entfernt, die Felsbrocken vorn in der Rinne und das Gesträuch weiter weg am anderen, sonnenbeschienenen Hang - alles liegt reglos und scheinbar friedlich unter dem hohen, tiefblauen Himmel.
Hier am Grund des Tals fallen nur noch vereinzelt Schüsse, aber nun wird hinten bei der Hauptmacht geschossen; im Staub, der die Senke füllt und sich in dichten, graugelben Wolken über der Kolonne ballt, kann Koopgaard Mündungsfeuer blitzen sehen.
Verdammt, denkt er, sie haben uns in der Falle. Wären wir zurückgegangen - oder wenigstens an einer besseren Stelle in Deckung ...
Der Leutnant liegt auf dem Rücken, das helle, von Schweiß verklebte Haar unbedeckt. Der graue Hut ist beiseite geflogen, der braune Uniformrock an der rechten Schulter blutig verfärbt, und über das schnurrbärtige Gesicht läuft ein Zucken.
Verwundet und ohnmächtig, sagt sich Koopgaard. So ein Dummkopf. Mit einer Handvoll erschöpfter Reiter eine Wasserstelle stürmen und besetzen zu wollen!
Kurz darauf verebbt der heftige Schusswechsel weiter hinten im Tal. Offenbar ist der erste Versuch der Kompanie, sich zur Vorhut durchzuschlagen, verhindert worden. Hier vorn werden in der aufkommenden Stille die Laute der Verwundeten vernehmbar.
Koopgaard glaubt auch den Leutnant stöhnen zu hören, und er richtet sich auf, um hinzulaufen und dem Verletzten zu helfen. Eine Bewegung seines Pferdes lässt ihn stocken - vielleicht seine Rettung; zwei, drei Kugeln schwirren über ihn hinweg, und Hoffmann, ein Unteroffizier, schreit: »Deckung, Bastard!«
Abermals werden die Schüsse erwidert, doch ist das Feuer nicht viel wirkungsvoller als vorher. Da und dort splittert es im Gestrüpp, oder es klatscht am graugelben, erdigen Hang. Ein Gegner lässt sich auch jetzt weder sehen noch hören.
»Zeigt euch, verdammte Kaffern!«, brüllt jemand.
Als Antwort - wiederum nur Schüsse aus dem graugrünen Gewirr.
Eine Kugel streift den Widerrist von Koopgaards Schecken, der wie unter einem Peitschenhieb aufspringt.
Verflucht! Sie haben uns festgespießt und lassen uns schmoren, denkt Koopgaard, während er über den heißen Sand aus dem Schussfeld kriecht, dem Pferd, das nur leicht verwundet ist, ein Stück hinterher. In der Nähe des Leutnants, der noch immer bewusstlos scheint, bleibt er in einer Kuhle liegen.
Es ist wieder still ringsum, sodass Koopgaard Stöhnen und Rufe nach Wasser hören kann, dazu einen Fluch, ein Wort in der Nama-Sprache. Die Herero haben also nicht nur den Leutnant getroffen, sondern auch einen Witbooi, vermutlich Elias.
Was, wenn jetzt er, tot oder verwundet, hier läge?
Koopgaard denkt an die Schlachten und Scharmützel gegen die Aufständischen, an denen er beteiligt war, daran, dass er nun schon seit elf Jahren in Uniform unterwegs ist - Jahre der Verstellung, der Angst, Jahre voller Schuldgefühle.
Wenn ihn nach all dem heute, bei diesem Geplänkel, eine Kugel erwischen würde ...
Ende März 1893, an einem für ihn denkwürdigen Tag, verließ Pieter Koopgaard heimlich Rehoboth, seinen Geburtsort, um sich zu den Witbooi-Nama durchzuschlagen.
Die Rehobother Gegend war damals bereits das Siedlungsgebiet einiger Dutzend Familien, die von Nama und Buren, europäischen, meist holländischen Einwanderern aus den Gebieten südlich des Oranjeflusses, abstammten. Mit ihrer gelbbraunen Haut und dem büschelförmigen Kraushaar ähnelten die Rehobother Mischlinge mehr oder weniger den Nama, die von ihnen nichtsdestotrotz »Hottentotten« geschimpft wurden. Sie waren stolz auf das »Burenblut« in ihren Adern, nannten sich selber »Bastards«, siedelten gemeinsam und hielten sich für eine »Nation«, die hehre Nation der Bastards von Rehoboth.
Pieter Koopgaard gehörte in dem bigotten Tausendseelenort zu den Verachteten, beinahe Geächteten. Seine Mutter hatte sich in jungen Jahren mit einem Witbooi, einem Gesandten Hendriks, eingelassen; Pieter war also eine Schattierung »hottentottischer« als die meisten Angehörigen der »Nation«, war als Kind einer Ledigen ein Bastard im ursprünglichen Sinn des Wortes und stand somit auf der untersten Sprosse des Rehobother Moral- und Rassendünkels.
Kein Wunder, dass es ihn seit Langem zu den Witbooi-Nama, seinen väterlichen Anverwandten, zog. Sein Vater, jener Gesandte, war zwar verschollen, bei einem Sonderauftrag wahrscheinlich umgekommen, aber Koopgaard hoffte, Hendrik, der Häuptling, »Chief« oder »Kapitän« des Stammes, würde vielleicht eine Art Ersatzvater werden.
Die Witbooi-Nama lebten damals, 1893, in Hoornkrans, einem Hochtal, das von Bergkämmen umgeben war. Sie hatten sich nach Auseinandersetzungen innerhalb ihres Stammes unter Führung von Hendrik dorthin zurückgezogen, und sie wähnten sich in Sicherheit vor den Truppen des deutschen Kaisers, der seit knapp einem Jahrzehnt Südwestafrika, das Land zwischen den Flüssen Oranje und Kunene, zwischen Atlantik und Kalahari, als Kolonie beanspruchte.
Bislang hatten sich die Witbooi erfolgreich geweigert, sich einen »Schutzvertrag« des Kaisers aufzwingen zu lassen. Mehr noch: Hendrik war drauf und dran, die Stämme der Nama zu einen und zu einem Bündnis mit den Herero, den Damara, den Bastards zu bewegen - ein Pakt gegen die Kolonialmacht.
Ende März 1893 wurde einer seiner Emissäre von der kaiserlichen Truppe in Rehoboth gestellt und kurzerhand" erschossen. Der Zufall wollte es, dass Koopgaard dem Witbooi, einem Gesandten Hendriks, vorher im besten Glauben eine falsche Auskunft gegeben, ihm gesagt hatte, die Deutschen wären weit weg. Er hatte ihn arglos ins Verderben geschickt und fühlte sich deshalb mitverantwortlich für dessen Geschick, fühlte sich schuldig. Um wiedergutzumachen - auch deshalb verließ er Rehoboth.
Nach Tagen langte er in Hoornkrans an, und bald darauf wurde er Zeuge eines Gewaltstreichs: Im Morgengrauen des 12. April 1893 überfiel die Kolonialtruppe den Ort in den Bergen, beschoss die Hütten, die Menschen, das Vieh und eröffnete damit den Krieg gegen die Witbooi.
Getötet wurden bei jenem Überfall vorwiegend Wehrlose. Die Krieger zogen sich mitsamt dem Großteil des Stammes an einen Platz namens Karibib zurück, und schon Stunden später verließen einige den neuen Zufluchtsort: Späher der Witbooi, Kundschafter im Orlog - im Krieg gegen die Kolonialmacht.
Auch Pieter Koopgaard wurde losgeschickt, sogar von Hendrik persönlich, und das schmeichelte ihm, wenngleich es nur wenige Wochen nach der Ankunft bei den Witbooi bereits den Abschied von ihnen bedeutete. Immerhin konnte Koopgaard nun für die, denen er sich verbunden fühlte, etwas tun, sich seines Vaters würdig erweisen, und dabei glauben, das Vertrauen von Hendrik zu genießen.
Der Auftrag führte ihn nach Norden, ins Grenzgebiet von Nama- und Hereroland. Dort hatten die Deutschen in einem Tal, das wegen seiner heißen Quellen bei den Nama Eikhams, bei den Herero Otjimuise hieß, zweieinhalb Jahre vorher, im Oktober 1890, einen Ort namens Windhoek gegründet, die spätere Hauptstadt ihrer Kolonie Deutsch-Südwestafrika, und dort begann der Bastard Pieter Koopgaard im Dienste der Deutschen, die Sprach- und Landeskundige benötigten, sein Doppelleben als Späher der Witbooi-Krieger.
In Swakopmund und Walvisbaai, den beiden Häfen am Atlantik, sah er neue Truppenverbände an Land kommen, Verstärkung mit Kanonen und Schnellfeuergewehren, lernte die Fremden aus der Nähe kennen, gab seine Beobachtungen heimlich weiter, Beobachtungen über die Stärke der Truppe, über deren Bewaffnung, über geplante Aktionen ...
Indessen wuchs die Macht der Deutschen mehr und mehr, zumal sich die anderen Namastämme und die Herero zurückhielten, und im September 1894, fast anderthalb Jahre nach dem Überfall auf Hoornkrans, zwangen die Kolonialtruppen die Witbooi in der Noukloof, einem Gebirgsmassiv im Namaland, zum entscheidenden Gefecht.
Die Kämpfe endeten für die Truppen des Kaisers mit einem halben Sieg, mit der bedingten Unterwerfung erschöpfter Männer, Frauen, Kinder, Greise unter die dezimierte, gleichfalls erschöpfte, aber besser gerüstete Militärmacht. Die Witbooi, damals noch etwa dreitausend Personen, durften - so ihre Bedingung - ihre Waffen behalten, mussten im Süden des Landes, im kargen, wasserarmen Gebiet von Gibeon, siedeln und waren verpflichtet, dem Kaiser, ihrem fernen »Schutzherrn«, fortan eine einhundertköpfige Hilfstruppe für Feldzüge gegen aufständische Stämme zu stellen.
Koopgaard hatte gehofft, nach dem Krieg zu den Witbooi zurückkehren zu können. Seine Mutter war inzwischen verstorben; nach Rehoboth zog ihn nun erst recht nichts mehr. Außerdem ließ sich wohl verstehen, dass er als Sohn eines Witbooi beim Stamm seines Vaters leben wollte, und dieser Wunsch - war der nicht durch seine Verdienste als Späher in gewissem Maße sogar zu einem Anspruch geworden?
Hendrik, das Oberhaupt, entschied anders. Koopgaard, der die Deutschen so geschickt getäuscht hatte, der bei ihnen als Späher und Dolmetscher in Ansehen stand, den niemand der Tätigkeit für die Witbooi verdächtigte - er hatte auch künftig im Geheimen für den Stamm zu wirken.
»Soll das heißen, der Kampf geht trotz dieses Schutzvertrages weiter?«
»Der Kampf, Koopgaard, hört nie auf; nur die Formen ändern sich bisweilen.«
»Und mit welcher Form habe ich von nun an zu tun?«
»Das wird die Zukunft zeigen. Am besten, du hältst dich erst einmal zurück, hältst dich in Bereitschaft. Wann und wie es weitergeht - das muss Hendrik entscheiden.«
So Josua, ein Unterkapitän der Witbooi, am 15. September 1894, dem Tag der Unterzeichnung des »Schutz- und Trutzvertrages« durch Hendrik und den Gouverneur des Kaisers.
Es sollte das letzte Gespräch dieser Art sein, die letzte Instruktion. All die Jahre danach - keine Anfrage aus Gibeon, kein Auftrag, kein Wort. Pieter Koopgaard, der Späher, schien von Hendrik und dessen Vertrauten vergessen.
Dabei spürte er, dass sein Eindruck trog, hoffte es zumindest, hatte aber keine Gewissheit, keinen Beweis. Das Warten, Ausharren, Lauern wurde für ihn zum Dauerzustand.
Nach außen hin änderte sich an seiner Situation nichts oder nur wenig. Da er außer seiner Muttersprache, dem Afrikaans der Buren, Deutsch und Nama sprach, sich zudem in Otjiherero verständigen konnte, blieb er auch nach den Kämpfen in der Noukloof ein geschätzter Dolmetscher und Späher der Kolonialmacht, und da er als Eingeborener, als Bastard, als »Halbhottentotte«, deutschem Verständnis zufolge, nicht mit reinrassigen Weißen in einer Stube wohnen oder im selben Biwakwinkel kampieren konnte, wurde er der Witbooi-Hilfstruppe zugeteilt.
Nun befand er sich bei seinesgleichen, bei Söldnern von Hendriks Stamm, bei Kriegern vom Stamme seines verschollenen Vaters; ein »Bastard« war und blieb er trotzdem. Die Witbooi, die vor jeder Regenzeit wechselten, misstrauten ihm, der mit der Zunge der Deutschen sprach, der beim Verhör Gefangener dabei war, der für solche Verdienste vor versammelter Mannschaft belobigt wurde, hielten sich vor ihm zurück, schlossen ihn aus.
Mit dem einen und dem anderen unter ihnen kam er dennoch in näheren, fast kameradschaftlichen Kontakt, und im Laufe der Jahre hörte er manches von dem, was sich in Gibeon und anderswo im Verborgenen tat. So erfuhr er, dass Josua, jener Unterkapitän und Vertraute Hendriks, bei einem Ritt durch die Kalahari nach Britisch-Betschuanaland in einen Sturm geraten und verdurstet war.
Die Nachricht berührte ihn eigenartig. Josua hatte während des Krieges gegen die Deutschen den Späher Koopgaard angeleitet, »geführt«; außer Hendrik war Josua wahrscheinlich der Einzige gewesen, der von der geheimen Tätigkeit des Bastards gewusst hatte. Nun, da er tot war, schien die Verbindung zu Hendrik endgültig gerissen, und merkwürdig: Koopgaard fühlte sich frei, auf zwiespältige Art verwaist und ungebunden.
Unabhängig davon - seine Überlegungen, die sich an die Nachricht knüpften: Josua war auf dem Weg ins Nachbarland gewesen, offenbar also unterwegs zu den Briten, die über die Stämme der Betschuanen oder Tswana herrschten. Was aber hatte ein Unterkapitän und Vertrauter Hendriks, ein Spezialist für Geheimaufträge, bei den Engländern, den Widersachern der Deutschen, zu tun?
Das fragten sich vermutlich auch die Witbooi, mit denen Koopgaard in Okahandja, der Hauptsiedlung der Herero, in Garnison lag. Es waren Rekruten der Hilfstruppe, die eben die Nachricht vom Tod Josuas ihren Stammesbrüdern, deren Dienst zu Ende ging, überbracht und damit für den Bastard, ohne es zu wissen oder gar zu wollen, Entscheidendes verändert hatten.
Danach begegnete Koopgaard den Witbooi, mit denen er in Sold stand, gleichmütiger und lockerer. Gedanken an Flucht oder an den Abschied von der Truppe hegte er damals noch nicht. Er hätte nicht gewusst, wohin er gehen sollte, und trotz allem hoffte er noch auf eine Weisung von Hendrik. Zudem hatte er sich gewissermaßen an das Leben in Uniform gewöhnt, obwohl er seine Handlangerdienste für die Deutschen hasste.
So harrte er aus - ein Bastard in der Abteilung der Witbooi, Jahre älter als die meisten im Kontingent und dennoch bald mit einigen vertraut wie mit keinem ihrer Vorgänger.
Besonders gut stand er sich mit den Rekruten, die wenige Monate vor dem Aufstand der Herero, bei der Ablösung im September 1903, in Okahandja eingerückt waren, und mit einem von ihnen, mit Daniel Kok, verband ihn geradezu Freundschaft.
Begonnen hatte diese Beziehung bereits im September, dem ersten Frühlingsmonat der Herero. Da war eines Abends ein Grüppchen Witbooi-Rekruten, bei ihnen Daniel Kok, durch Okahandja geschlendert, und auf dem Platz vor der Bahnstation hatten die Neulinge plötzlich Pieter Koopgaard, ihren Stubengefährten, in Begleitung einer jungen, lachenden Herero erblickt.
Die Burschen in der neuen, ungeliebten Uniform verstummten. Von daheim, wo Hendrik mit calvinistischer Strenge gebot, waren sie den ungezwungenen Umgang mit dem anderen Geschlecht nicht gewohnt. Um so beeindruckender nun für sie, wie Koopgaard ihnen Omutima, diese verteufelt anziehende Schwarze, vorstellte.
»Mann« - so Daniel Kok später - »ist das ein Weib! Wie bist du denn an die rangekommen?«
»Einfach war’s nicht«, gab Koopgaard zu, »aber schließlich bin ich ja schon lange genug hier, und außerdem wollen wir heiraten.«
»Richtig heiraten? - Und die Kinder?«
»Das werden Bastards sein, Bastards wie ich, nur etwas dunkler, vielleicht so schwarz wie Jakob Morenga.«
Ein Ruf reißt Koopgaard aus den Erinnerungen, in die er minutenlang - oder bloß für Sekunden? - versunken war. Er liegt noch immer in jenem ausgetrockneten Flussbett, das zur Falle geworden ist, und gerufen hat Hoffmann, der Unteroffizier, der offenbar seit dem Ausfall des Leutnants das Kommando über die Vorhut führt.
»He, Bastard, wie geht’s? Hat’s dich erwischt?«
»Nein, Herr Unteroffizier, alles in Ordnung.«
»Gut. Dann sieh mal nach, was der Leutnant macht! Aber Vorsicht! Lass dich nicht abknallen!«
Der Leutnant stöhnt, und Koopgaard kriecht aus seiner Mulde, betastet den zerfetzten, blutgetränkten Uniformrock. Jetzt hebt von Kirchhoff die Lider.
»Wo bin ich?« Er versucht sich aufzurichten.
»Liegen geblieben!«, stößt Koopgaard, ihn zurückdrückend, hervor.
»He, Bastard, wie sprichst du mit mir?«
»Melde, Herr Leutnant, wir werden beschossen! Der Feind hat uns festgespießt.«
Der Leutnant runzelt die Stirn, die von Schweißtropfen bedeckt ist, und presst die Lippen zusammen. »Gott, ist mir übel!« Er krümmt sich, einmal und wieder, würgt grünlichen Schleim heraus, erschlafft.
Koopgaard wischt ihm den Mund ab, späht zu den Hängen, über denen die Luft flimmert, berührt die blutige Schulter. »Melde, Herr Leutnant: Der Herr Leutnant sind verwundet. Der Herr Leutnant müssen verbunden werden!«
Keine Reaktion, nicht einmal ein Stöhnen. Das Gesicht sieht fahl aus, eingefallen, und Koopgaard blickt unschlüssig hinüber zu Hoffmann.
»Na?«, ruft der. »Was sagt er?«
»Nichts mehr, Herr Unteroffizier. Er ist wieder ohnmächtig geworden, hat viel Blut verloren.«
»Verdammt! Wart, ich komm rüber! - Leute, gebt mal Feuerschutz!«
Während ein paar Schüsse abgefeuert werden, Schüsse vor zu den Felsbrocken und ins Gestrüpp hinüber - währenddessen robbt Hoffmann zu Koopgaard. Dabei wird er von den Herero entweder nicht bemerkt oder nicht beachtet; jedenfalls bleibt er unbehelligt von ihren Kugeln.
Und dann hat auch er den Leutnant untersucht, nach dem Puls getastet, den zerfetzten Rock inspiziert.
»Bewusstlos und ziemlich ausgeblutet ... Wir müssen ihn verbinden und wegbringen.«
Wir? denkt Koopgaard.
»Bastard, halt mal!«
Hoffmann hat ein Messer aus der Tasche geholt. Während er, auf Deckung bedacht, den Ärmel bis hinauf zur Schulter aufschlitzt, hält Koopgaard den Arm. Der Leutnant stöhnt dabei, öffnet aber nicht einmal die Augen.
Die Wunde sieht böse aus, verschmutzt, von Stofffasern gleichsam gespickt, und die Kugel scheint noch im Körper zu stecken. Stoßweise kommt Blut gequollen.
»Da muss der Sanitäter ran«, sagt Hoffmann. »Und bald ein Arzt! Sonst, Herr Baron ...«
Er bricht ab, kramt fluchend in den Taschen seiner Uniform, holt ein Verbandpäckchen heraus und wickelt, von Koopgaard unterstützt, den Mull, der sich rasch blutig färbt, auf der Wunde fest.
»So, Bastard ... Nimm dir einen Witbooi mit! Oder - besser - gleich zwei ... Wir geben euch Feuerschutz.«
Das ist ein Befehl; Koopgaard weiß es. Trotzdem zögert er.
»Ist was?«, fragt Hoffmann, während er, sein Gewehr bereits im Anschlag, zu den Hängen späht.
»Melde, Herr Unteroffizier«, sagte Koopgaard, »auch die Witbooi haben Verwundete, wenigstens einen, wahrscheinlich Elias ...«
Hoffmann dreht den Kopf, schaut den Bastard nachdenklich an und erwidert schließlich: »Stimmt, Koopgaard, auch bei den Witbooi hat’s einen erwischt, aber wie das so ist: Ein Leutnant und Herr Baron geht vor. Mach was dagegen!«
Er betrachtet von Kirchhoff, der noch immer bewusstlos ist, aus schmalen Lidern, gibt sich einen Ruck.
»Beeil dich, Bastard! Und sag dem Hauptmann, dass er schnell machen muss! Lang halten wir uns nicht mehr.«
3
S. 23
»Nimm dir einen Witbooi mit!«, hat Hoffmann gesagt. »Oder besser gleich zwei ...«
Als ob’s wer weiß wie viele gäbe, denkt Koopgaard. Als ob ich ihnen befehlen könnte oder jemand sich zu diesem Auftrag drängen würde!
Bei der Vorhut befinden sich acht Witbooi; einer ist verwundet worden, und die restlichen sieben liegen mit einem halben Dutzend Deutscher und den Pferden, die noch nicht ausgebrochen sind, über eine Strecke von dreißig und mehr Metern verteilt.
In einiger Entfernung entdeckt Koopgaard Jonathan Pyp, einen Burschen, den er nicht sonderlich mag. Er unterdrückt diese Abneigung, ruft ihn, nennt ihn Gásab - Bruder - und bittet ihn in der Nama-Sprache, den Leutnant wegbringen zu helfen.
Pyp stellt sich taub.
Zudem setzt wieder der Schusswechsel ein.
Da besinnt sich Koopgaard auf Daniel Kok und schreit nach ihm.
»Was ist?«, fragt Hoffmann. »Wollen sie nicht? Soll ich selber zwei bestimmen?«
»Nicht nötig«, sagt Koopgaard.
»Ach was! - Du da! Herkommen!«
Gemeint ist Jonathan Pyp, und diesmal hilft keine Verstellung. Der Unteroffizier hat befohlen, und Pyp muss gehorchen.
Von weiter vorn kommt Daniel Kok gerobbt.
»Na bitte!«, sagt Hoffmann. »Und vergesst nicht zu melden, dass wir mit der Munition bald am Ende sind! Ganz zu schweigen vom Wasser ...«
Das müsste der Hauptmann eigentlich selber wissen, denkt Koopgaard, und er wagt, von der Art dieses Unteroffiziers verführt, zu äußern: »Und wenn alle nun zurückgehen würden, die ganze Vorhut mit den Verwundeten ...?«
»Nee, Bastard, nee!«, fällt ihm Hoffmann ins Wort. »Zurückgehen gibt’s nicht. - Befehl vom Hauptmann, und der hat’s vom Major. Zurückweichen vorm Feind - das verträgt sich nicht mit ihrer Ehre! Und auch nicht mit der Karriere.«
Eine Kugel schwirrt über ihn hinweg, und er duckt sich. Verändert sein Ton danach.
»Was wartet ihr noch? Sollen sie uns abknallen, oder wollt ihr uns vor Durst hier krepieren lassen? Schnappt ihn - wenn’s geht: behutsam - und sperrt die Augen besser auf als heute früh! Eure Patrouille hat vielleicht noch ein Nachspiel, und wenn ihr ihn rausbringt, wenn er durchkommt, kann’s nur von Vorteil für euch sein.«
Die letzten Bemerkungen wirken bereits wieder verträglich, ja beinah vertraulich. Zudem hat Hoffmann mehr geredet, als es eigentlich seine Art ist. Koopgaard wird aus diesem Unteroffizier nicht recht schlau.
Im Übrigen hat er jetzt keine Zeit zum Grübeln. Die Lage ist klar, der Auftrag eindeutig: Leutnant von Kirchhoff, noch immer bewusstlos, muss unter dem anhaltenden Beschuss zurück zum Sanitäter der Kompanie gebracht werden.
Über dem Tal, hinten, wo die Kolonne ins Stocken geraten und in Stellung gegangen ist, schwebt unverändert Staub in Wolken, und die Sonne brennt mittlerweile höllisch. In dieser Glut mit einem Schwerverwundeten im Schlepp einen halben Kilometer oder weiter kriechen ...
»Fasst mit an!«, sagt Koopgaard zu Daniel Kok und zu Jonathan Pyp.
Zwischen den Fronten
4
Koopgaards Abneigung gegen Jonathan Pyp hat ihre Vorgeschichte, und die Wurzeln reichen bis nach Rehoboth. Dabei geht es letzten Endes um Omutima.
Im Verständnis der Bastards bilden die Herero und die anderen Dunkelhäutigen eine minderwertige Rasse. Sie stehen noch unter den Nama und überragen eigentlich nur die Saan oder Buschmänner - Wesen auf der alleruntersten Stufe.
Undenkbar für einen rassebewussten Rehobother, ein Buschmannmädchen oder eine Schwarze zu ehelichen.
So eine bespringen, ihr ein Kind machen - das ja; das war schließlich selbst bei den Buren, den kapholländischen Vorfahren der Bastards, der beliebteste Sport.
Wichtig nur, dass er heimlich getrieben wird, dass der Missionar und die Angetraute nichts davon erfahren.
Obwohl Pieter Koopgaard Rehoboth als Siebzehnjähriger verlassen hat, kennt er diese Haltung zur Genüge, kennt und hasst sie. Der Dünkel der Rehobother hat ihm die Kindheit vergällt, ihn einsam, verletzlich und hellhörig gemacht; Heuchelei und Überheblichkeit empören ihn.
Daher rührt auch seine Abneigung Pyp gegenüber, und das begann nach jener Begegnung vor der Bahnstation von Okahandja. Pyp hatte Omutima genauso neugierig wie die anderen Rekruten und genauso lüstern angegafft. Am Abend aber, als Daniel Kok seiner Bewunderung für Omutima freien Lauf ließ, verzog Jonathan Pyp das Gesicht.
Koopgaard bemerkte das erst, als er von seinen Heiratsplänen geredet und sich zu Kindern, die er mit Omutima haben könnte, bekannt hatte.
»Das werden Bastards sein, Bastards wie ich, nur eben dunkler, vielleicht so schwarz wie Jakob Morenga.«
»Nun, warum nicht?«, meinte Daniel Kok leise, mehr für sich.
Die anderen Witbooi schwiegen - Pyp mit schiefem, verächtlich geschürztem Mund. Betretenheit kam auf.
Bastards - so schwarz wie Jakob Morenga, der Sohn eines Nama und einer Herero, der Anführer der Nama vom Stamm der Bondelzwart, der drauf und dran war, Hendrik Witbooi an Rang und Ruf zu überflügeln?
Allein, dass Morenga als Bastard zum Kriegshäuptling eines Namastammes aufgestiegen war ... Und dass er tatsächlich kämpfte, und das in einer Zeit, wo andere längst resigniert hatten!
Koopgaard bemerkte das Befremden seiner Stubengefährten und gestand sich ein, dass er im Begriff war, die Bewunderung, die er für Witbooi empfunden hatte, auf Morenga zu übertragen.
Empfanden die anderen das bereits als Verrat? Konnte im Übrigen ein Mann aus dem Volk, ein Spross gewöhnlicher Leute, überhaupt mit einem angestammten Führer konkurrieren?
Von den Stubengefährten äußerte sich niemand weiter, zumindest nicht gleich und nicht im Beisein von Koopgaard. Der hörte eher zufällig eine Bemerkung von Jonathan Pyp, eine Äußerung, die dem Ort, an dem sie fiel, angemessen schien.
Pyp sagte auf der Latrine das zum Umgang mit einer Schwarzen, was Koopgaard von Rehoboth her zur Genüge kannte, was er hasste, sagte es zu Moses Witbooi, um dessen Beifall er buhlte und dessen Erwiderung im eigenen Gelächter unterging.
Ein dummer Junge, versuchte Koopgaard sich zu beschwichtigen. Dieser Jonathan Pyp sprach die Redensarten dummer Männer nach, obwohl er wahrscheinlich nur vom Hörensagen wusste, wie eine Frau unter dem Rock oder unter dem Schurz beschaffen war.
Dennoch hatte die Bemerkung Koopgaard getroffen, verletzt. In den Wochen danach ging er Pyp aus dem Weg - und schloss Freundschaft mit Daniel Kok, der sich ebenfalls ein Hereromädchen angelacht hatte.
Und nun sind diese beiden Koopgaards Gefährten beim Transport des verwundeten Leutnants.
Sie haben den Verletzten auf eine Satteldecke gelegt und die Zipfel gepackt. So sind sie - Koopgaard und Kok am Kopfende, Pyp bei den Beinen - losgekrochen, und so kriechen sie immer weiter voran.
Die Sonne nähert sich bereits dem Zenit, und der Sand scheint zu glühen. Dazu das Geröll, die faust- bis kopfgroßen Steine, auf die sie stoßen, über die sie hinwegmüssen ...
Von Kirchhoff liegt schlaff und schwer auf der dünnen, fleckigen Decke. Er ist immer noch bewusstlos, wiewohl er mitunter stöhnt und Unverständliches lallt. Wenn er über holprigen Grund oder über eine Erhebung geschleift wird, laufen Wellen durch seinen Körper.
Koopgaard, am Zipfel bei der verwundeten Schulter, hat versucht, die Erschütterungen möglichst gering zu halten. Gelungen ist ihm das nur bedingt. Indem er aber sein Deckenende vor jedem Hindernis höher gestemmt hat als Daniel den anderen Zipfel, ist er über Gebühr ermüdet und hat zudem Jonathan den Anlass für eine Attacke geliefert.
»Bist du verrückt? Willst du ihn runterkippen oder mit deinen Verrenkungen die Kaffern auf uns aufmerksam machen?«
Zu diesem Zeitpunkt haben sie bereits ein gut Teil der Strecke geschafft. Überraschend, dass sie weder beim Aufbruch noch seither beschossen worden sind, obwohl die Stellungen der Vorhut nach wie vor von den Herero unter Beschuss gehalten werden.
»Vielleicht«, sagt Kok; »schonen sie uns, weil wir einen Verwundeten wegbringen?«
»Deshalb Schonung?« Pyp lacht verächtlich. »Da kennst du die aber schlecht!«
Kok will etwas erwidern, doch Koopgaard hält ihn zurück. Streit ist das letzte, was sie gebrauchen können.
Sie haben sich verschnauft und kriechen weiter, kriechen jetzt offenbar von einem Geplänkel zu einem Gefecht. Das Feuer bei der Kolonne, das schon vorher ein-, zweimal aufgeflammt war, ist von Neuem und nun mit Gewalt losgebrochen.
»Halt!«, stößt Jonathan Pyp hervor. »Ich bleibe hier. Dort kommen wir ja vom Wind in den Sturm!«
Die anderen müssen ihm recht geben. Also bleiben sie und warten, hoffen, dass der Kolonne diesmal der Durchbruch gelingt.
Bisher haben sie etwa die Hälfte der Strecke zwischen Vorhut und Hauptmacht bewältigt, und die drei befinden sich mit dem Verwundeten nach wie vor auf dem Weg, der dem ausgetrockneten Flussbett folgt - ein Gewirr aus Hufspuren und Fußtapfen in einer Rinne, stellenweise tiefer als das eigentliche Tal. In diesem flachen Graben sind sie dicht am Boden vor Beschuss von den Hängen leidlich geschützt; wenn aber eine Gefechtswelle, eine Front heranrollt ...
»Wir müssen hier verschwinden«, sagt Koopgaard, und er späht zu ein paar Felsbrocken - hüfthohe Gesteinstrümmer, näher bei der Kolonne, etwas links und abseits vom Weg. »Vielleicht dorthin?«
Die Brocken liegen von der rechten Talwand genügend weit weg, liegen auch in einiger Entfernung vom linken Hang. Sie scheinen von den Herero nicht besetzt zu sein und ausreichend Deckung zu bieten - ein günstiger Zufluchtsort, solange die Lage unklar bleibt.
»Gut«, sagt Jonathan Pyp, »dort können wir abwarten, was wird.«
»Oder weiterkriechen«, fügt Daniel Kok hinzu, »aus dieser verdammten Falle heraus ...«
»Wie meinst du das?«, erkundigt sich Pyp lauernd.
Kok schweigt.
Koopgaard weiß ohnehin, wie es gemeint ist.
»Soll das heißen, ihr wollt abhauen?«, bohrt Pyp weiter.
»Soll es nicht«, erwidert Daniel Kok, und Koopgaard sagt: »Wie kommst du denn auf die Idee?«
»Na, ihr - bei eurem Hang zu den Kaffern ...«
»Und du«, fährt Kok ihn an, »mit deiner Kriecherei vor den Schnurrbärten ...«
»Schluss!«, fällt ihnen Koopgaard ins Wort. »Seid ihr verrückt? Jetzt zu streiten!«
Kok und Pyp starren aneinander vorbei.
Der Leutnant bewegt die blutleeren, rissigen Lippen.
Bei der Kolonne - oder schon näher? - blitzen und knattern Schnellfeuergewehre.
»Los!«, drängt Koopgaard. »Dort rüber! Jetzt!«
Sie springen auf, setzen über den Rand der Rinne, rennen geduckt auf die Felsbrocken zu.
Als sie es fast geschafft haben, als sie bereits keuchen, das Herz hämmert und Schweiß in den Augen brennt - da fällt vom Hang rechts gegenüber ein einzelner Schuss, und Jonathan Pyp schreit auf.
Verdammt! zuckt es Koopgaard durch den Kopf.
Im nächsten Moment stolpert er, stürzt.
Später liegt der Leutnant wieder auf der Decke, von der er herabgerollt war, weil Pyp die Zipfel losgelassen hatte, getroffen von einer Kugel der Herero.
Getroffen am verlängerten Rücken, an der linken Backe.
»Nur ein Streifschuss«, stellt Koopgaard fest, »eine saubere Wunde«, und Daniel spottet: »Wenn du reiten willst, musst du dich mit dem Bauch auf den Sattel legen.«
»Ihr habt gut lachen«, meint Jonathan, doch immerhin zwingt er sich zu einem Grinsen.
Sie haben die Felsbrocken erreicht - ein Nest aus Gesteinstrümmern, das Deckung zu den Hängen hin und Deckung ringsum gewährt. Allerdings ist man inmitten der Steine wie in einem Tiegel der Sonne ausgesetzt, und der Tag hat seine heißesten Stunden noch vor sich.
»Wasser!«, lallt der Leutnant. »Wasser!«
Koopgaard versucht, die matte, fast tonlose Stimme zu überhören. Vergebens. Er hat sie im Ohr, hat die blassen, aufgesprungenen Lippen selbst bei geschlossenen Lidern vor Augen.
Und da ist noch eine andere Stimme: die von Hoffmann.
Wenn ihr den Leutnant rausbringt, ist’s nur von Vorteil für euch.
Und wenn wir ihn nicht rausbringen, wenn er nicht durchkommt?
Vielleicht hat eure Patrouille ein Nachspiel ...
»Wir dürfen ihn nicht abschnappen lassen«, sagt Koopgaard unvermittelt zu Daniel Kok.
Der schaut her - ein Blick aus hitzegetrübten Augen. Von Spott keine Spur mehr.
»Dann bring ihn doch hin!«, erwidert er gereizt. »Rette sein kostbares Leben! Du wirst es bestimmt nicht bereuen.«
Der Hohn ist offenkundig, und auch Jonathan Pyp erfasst, dass zwischen Koopgaard und Kok, den beiden »Hererofreunden«, Streit schwelt. Lauernd hebt er den Kopf.
Kok späht wieder hinaus ins Tal, wo sich Pulverqualm und Staubfontänen mischen - ein lichtes Gewölk, dessen Ausläufer, blaugraue Schlieren, bereits vor dem Hang gegenüber schweben. Und in der Rinne davor, auf dem Weg - kommen dort nicht Uniformierte gekrochen?
Koopgaard bemerkt, wie Daniel einen Blick nach links wirft, zum anderen Hang, wie er dorthin starrt.
»Na«, fragt Pyp, der auf dem Bauch liegt, sich aufstützt, »noch immer Fluchtgedanken?«
Daniel Kok stößt einen Fluch aus, und nun sieht auch Koopgaard die graubraun uniformierten Gestalten, die dort drüben sprungweise vorrücken, die vom linken Hang her Feuer erhalten.
Ein Vorstoß der Deutschen in breiter Front.
Zu spät für Daniel, denkt Koopgaard.
5
Der Vorstoß der Kompanie ist bei der Vorhut zum Stehen gebracht worden. Dort verengt sich das Tal, wird vollends zur Falle, zum Schlauch, aus dem nur ein Ausbruch oder ein geschlossener Rückzug herausführen kann.
Die umkämpfte Wasserstelle aber befindet sich, vom Felsennest aus gesehen, hinter einem Riegel, den die Herero dicht bei jenem vorspringenden Felsen, an der für sie günstigsten Stelle also, vorgeschoben haben.
Das Feuer von den Hängen war bisher nur Geplänkel, gerade kräftig genug, die Vorhut niederzuhalten, am Vordringen zu hindern. Nun, da die Hauptmacht, ausgenommen der Tross, mitsamt den Geschützen nachgerückt ist, zeigt sich erst, über welche Kräfte die Herero verfügen. Ihrer sechzig, siebzig scheinen an den Hängen und an der Wasserstelle in Deckung zu liegen. Das ist zwar weniger als bei den Deutschen, und zudem sind die Herero schlechter bewaffnet, doch zweifelsfrei haben sie die weitaus besseren Stellungen, und schließlich ist die Zeit auf ihrer Seite, die Sonne, die Hitze, der Durst, der den Deutschen zunehmend zu schaffen macht.
Kaum ist die Schützenkette vorbeigestoßen, kriecht Jonathan los. »Ich benachrichtige schon mal den Sanitäter. Kommt mit dem Leutnant nach!«
»Lass ihn!«, sagt Koopgaard zu Daniel Kok. »Soll er sich ruhig wichtig machen! Wir schaffen’s auch ohne ihn.«
Sie packen die Decke mit dem Leutnant, der zu fiebern scheint und folgen Pyp, anfangs gleichfalls am Boden, dann auf den Beinen, geduckt.
Die Herero haben die Hänge in der Nähe des Trosses vermutlich geräumt. Zudem sind die Ochsenwagen dort, wo das Feuer die Hauptmacht überrascht hat, zu einem Kreis zusammengefahren worden - eine Wagenburg, die dem Tross und den Verwundeten, die es auch hier gegeben hat, Schutz bietet.
Unterwegs entdeckt Koopgaard seinen Schecken, der sich gleich anderen Pferden der Vorhut aus der Feuerlinie gerettet hat; der Hengst zupft an mageren, gelblichen Halmen. Nahebei ruhen Treiber, brüllen Ochsen nach Wasser, liegen Tiere erschöpft oder krepiert in der prallen Sonne ... Geier hacken an den Kadavern.
Jonathan Pyp erreicht die Wagenburg weit vor Daniel und Koopgaard, und er humpelt schnurstracks zum Sanitäter, einem Gefreiten, der für seine Derbheit bekannt ist.
Er humpelt, hinkt zumindest, als er zwischen zwei Wagen verschwindet. '
Zuvor ist er ziemlich flott ausgeschritten.
Koopgaard und Kok erblicken ihn erst wieder, als sie in der Wagenburg anlangen, sehen, wie er beiseite schleicht, und hören den Sanitäter fluchen.
»So ein Arschloch! Glaubt, ich warte auf Arbeit! Als ob ich nicht schon genug zu tun hätte!«
Er kommt, hochrot im Gesicht, verschwitzt und staubig, hergestapft, fasst dem Leutnant an die Stirn, greift nach dem Puls. »Noch einer, der was zu saufen braucht, erst mal und vor allem was zu saufen. - Wie sieht’s denn mit dem Vorstoß aus?«
Koopgaard berichtet, was er dazu weiß.