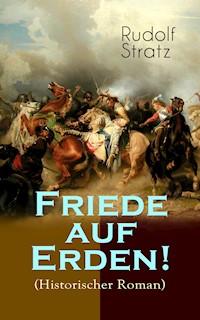
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieses eBook: "Friede auf Erden! (Historischer Roman)" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Aus dem Buch: "Vor mehr als zwei Jahrzehnten schrieb ich das hier folgende Zeitbild aus Deutschlands tiefster Zerrissenheit und Not. Damals, am Ausgang des vorigen Jahrhunderts, zu Bismarcks Lebzeiten, schien der Gedanke undenkbar, daß für Deutschland, das blühende, starke, friedliche Deutschland, die Tage des Dreißigjährigen Krieges je wiederkehren könnten. Sie sind auch nicht gekommen. Aber sie hätten kommen können in diesen vier großen und furchtbaren Jahren, die hinter uns liegen. Nicht das Verdienst der Menschheit ist es, daß nicht, wie vor einem Vierteljahrtausend ganz Europa, so diesmal fast die ganze Erde ihre Wut und ihren Wahnwitz in Mord und Raub, Brand und Blut über Deutschland ausspie. Nur der Heldenmut unserer Heere und der Opfermut der Heimat haben uns davor bewahrt, oder, was beides zusammenfaßt: die deutsche Einigkeit." Rudolf Stratz (1864-1936) war ein erfolgreicher Romanschriftsteller, Theaterkritiker und Essayist. Mit seinen zahlreichen Romanen und Novellen hatte Stratz großen Erfolg. Die Auflagenzahl von Friede auf Erden hatte 1921 die 230.000 überschritten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 136
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Friede auf Erden! (Historischer Roman)
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Vor mehr als zwei Jahrzehnten schrieb ich das hier folgende Zeitbild aus Deutschlands tiefster Zerrissenheit und Not. Damals, am Ausgang des vorigen Jahrhunderts, zu Bismarcks Lebzeiten, schien der Gedanke undenkbar, daß für Deutschland, das blühende, starke, friedliche Deutschland, die Tage des Dreißigjährigen Krieges je wiederkehren könnten. Sie sind auch nicht gekommen. Aber sie hätten kommen können in diesen vier großen und furchtbaren Jahren, die hinter uns liegen. Nicht das Verdienst der Menschheit ist es, daß nicht, wie vor einem Vierteljahrtausend ganz Europa, so diesmal fast die ganze Erde ihre Wut und ihren Wahnwitz in Mord und Raub, Brand und Blut über Deutschland ausspie. Nur der Heldenmut unserer Heere und der Opfermut der Heimat haben uns davor bewahrt, oder, was beides zusammenfaßt: die deutsche Einigkeit.
Noch nie ward Deutschland überwunden, wenn es einig war. Aber immer war Deutschlands Zwietracht Deutschlands Verhängnis. Das ist die Brücke, die von diesem kleinen Buch in die große Gegenwart führt, aus dem ungeheuren deutschen Bruderkrieg, den man den Dreißigjährigen Krieg nennt, zu dem noch ungeheureren Völkerringen, das durch die Jahrtausende der Weltkrieg heißen wird. Am Schluß des Dreißigjährigen Krieges steht der jammervollste Verzichtfrieden unserer Geschichte, der Westfälische Frieden. Jahrhunderte deutscher Erniedrigung, Armut und Schwäche waren die Folge. Ueber dem Weltkrieg von heute steigt jetzt schon glorreich der siegesstarke, weltüberwindende deutsche Friede empor. Jahrhunderte deutschen Blühens in Wohlfahrt, Freiheit und Gesittung werden ihm folgen.
Berlin, im deutschen Frühling von 1918 Rudolph Stratz
1.
»... so können wir an der Donau nicht mehr subsistieren und ziehen sich die verbündeten Armaden gegen Augsburg, um den Lechstrom zu maintenieren und, wenn sie sich dorten unbeweglich gesetzt, die Völker in etwas zu refraichieren und des Grases zu genießen.
»Schwed' und Franzose marschieren indes im Bayerischen auf und ab, in welches Hin- und Hervagieren sich kein Mensch zu richten weiß. Sollten sie aber von uns nicht lassen, so duldet der status belli, so travaillieret auch die Kaiserlichen Völker sind, doch keinen Aufschub und steht uns ein schweres Treffen bevor.
»Darum reise der Herr, wann seine Geschäfte zu Wien erledigt, quam citissime zur Armada, daß er in bevorstehender Bataglia zur Hand sei.«
Der Feldobrist hatte den Brief schon oft genug auf seinem Ritt von Wien nach Augsburg gelesen. Aus Gewohnheit prüfte er noch einmal die Unterschrift des Kaiserlichen Generalissimus, Melanders Reichsgrafen zu Holtzapfel, das Datum, das den 22. April im 1648sten Jahre nach Christi Geburt, dem dreißigsten seit Beginn des Glaubenskrieges, wies, und die Adresse, die mit den endlosen Schnörkeln der Kriegskanzleien auf lateinisch verkündete, daß das Schreiben für »den wohlgeborenen Herrn Albinus liber baro â Habstein, equitum colonell« bestimmt war.
Der Freiherr von Habstein faltete das Papier zusammen und schob es in eine Tasche seines Elenkollers, von dem an breitem Bandelier das Schwert herabhing, ein handliches, mächtiges Schwert, wie es auch seine Kürassiere, die Knechte des gefürchteten Regiments Habstein, trugen.
In flackernden Lichtern übergoß das Lagerfeuer die hohe, hagere Gestalt und das scharfgeschnittene, wettergebräunte Gesicht, über das die Augen herrisch hinfunkelten. Dunkel war der mächtige Knebelbart, dunkel auch die nach der Sitte der Zeit unter dem Eisenhut bis auf die Schultern herabfallenden Haarsträhne des zu Ende der Dreißiger stehenden Edelmannes. Das kleine Häuflein kurbayerischer Reiter, die unter einem greisen Hauptmann seine Reisebedeckung bildeten, hatte sich scheu und ehrfurchtsvoll von ihm abgerückt und lagerte abseits um ein Faß Wein, das sie unter dem Ritt beim Durchstöbern eines verlassenen Gehöfts gefunden und mit sich geschleppt. Unweit kauerte am Boden eine Wache und spähte aufmerksam in das Dunkel. Denn es war nicht geheuer. Weg und Steg wimmelten von Freibeutern und Marodeurs, denen die Waffen und Pferde der Kriegsknechte wohl zu paß kommen konnten.
So schwatzten die Reiter auch nur im Flüsterton mit einander.
»Jüngst hat's wieder bei Lauffen Blut in den Neckar geregnet,« sagte ein bayerischer Dragoner nachdenklich nach langer Pause, ... »eine Stunde und mehr –«
»Und in Wien« – einer der Diener des Obristen Habstein rückte näher ans Feuer – »in Wien hat man bei hellem, lichtem Tag auf offenem Feld zwei Gespenster, gleich wie man den Tod zu malen pflegt, in weißer Gestalt tanzen sehen –«
»Ei, und zu Reutlingen« – der Knecht dämpfte seine Stimme zum Flüstern – »sind da nicht jüngst zwei Totenbahren am Himmel erschienen, und hat man dort nicht männiglich zwei Kriegsheere in den Lüften bemerkt? Die kämpften wider einander und verloren sich unter viel Geschrei nach einer Viertelstunden.«
»Gott sei gelobt! So geht der Krieg weiter!« murmelte andächtig ein alter Reitersmann, und keiner widersprach.
So geht der Krieg weiter! Albinus von Habstein hatte sich nicht um das Gerede der Knechte gekümmert. Aber diese Worte weckten ihn aus seinem Brüten. Und nochmals zog er den Brief des Generalissimus hervor und las darin die willkommene Stelle: »Als aber Seine Kurfürstlichen Gnaden von Bayern beim Widerpart wegen einer armistitio anfrugen, da erwiderte Graf Wrangel, der Kron Schweden bestallter Generalissimus, in allem Hochmut: ›Als nun der allgewaltige Gott den Zustand des Krieges dergestalt dirigieret, daß die Völker meiner allergnädigsten Königin und Fräulein alles in währendem Kriege durch die Waffen erzwungen, so habe ich den Intent, auch fürderhin auf dem Kriege zu bestehen!‹«
Also nichts vom Frieden, der seit Jahren, ein fremdes und leeres Wort für die Meisten, die da lebten, in der Luft schwebte. Der Kampf in deutschen Landen ging weiter. Schwede und Franzos durchzog kreuz und quer das heilige Reich. Das heilige Reich stritt wider sich selbst im Bruderzwist. Man wußte es nicht mehr anders. Fern die Zeiten, da noch der römische Kaiser deutscher Nation vor wenig mehr als hundert Jahren mit seinen frommen Landsknechten den Franzosenkönig mitten in Welschland gefangen genommen. Jetzt kamen die Welschen über Rhein und Alpen, die Nordländer über See, die Völker aus Hispanien und Hungarn und von den Grenzen der Türkei nach Germanien in Waffen zu Gast. Dem Colonel von Habstein war das recht. So brauchte man sie nicht erst lange aufzusuchen. Es war Krieg. Zum Krieg gehörten Feinde. Etwas anderes kannte er nicht als den Krieg.
Wäre er nur schon in Augsburg! Aber zwei Tagereisen trennten ihn noch von der Reichsstadt, und man mußte vorsichtig reiten in dem menschenleeren, unheimlichen Land.
Die Soldaten schwatzten weiter.
»Wahr und wahrhaftig,« sprach ein finsterer Kerl mit schwarzem Bart, »ist jüngst das gewaltige Wunder zu Güstrow in Mecklenburg. Ward dort in einer Kirche ein nackend Knäblein gefunden. Der Pfarrherr wollt' solches taufen und frug die Gevattern, wie es heißen möge. Hat das Kind selbst geantwortet: ›Nein! Täuft mich nit! Ich bin von Gott gesandt. Euch Ketzer zu vermahnen. Das jüngste Gericht ist nahe. Darum greift Gott in die Ruten.‹ Und ist darauf verschwunden.«
Der greise, dicke Hauptmann der bayerischen Reiter wendete sich zu dem Obristen und lüftete den Spitzhut mit roter Stoßfeder: »Was dünkt dem Herrn um solche Omina?«
»Ihre Bedeutung bleibt dem allwissenden Gott allein bekannt,« erwiderte der düstere Reichsfreiherr, »aber das weiß ich: der Teufel ist wach! Er schleicht um uns bei Tag und bei Nacht. Seit Wochen setzt er mir zu, so hart wie nie zuvor.«
Der Bayer sah zur Seite, um sein Lächeln zu verbergen. »Der Herr ist streng wider sich und andere,« sprach er ehrerbietig. »Es fällt einem Kriegsmann sauer, gleich einem Mönch zu leben!«
Da schaute ihm Herr Albin fest ins Gesicht.
»Das mag Euch so dünken!« sprach er rauh. »Mir nicht!«
Der Hauptmann wagte nichts zu erwidern. Dazu stand der Freiherr von Habstein im kaiserlichen Lager zu hoch in Ehren. Ein Oberster ohne Fehl und Mangel und unerschroken vor den Reitern. Gewaltig war seine Tapferkeit, und im Lager der Schweden und Franzosen nannte man ungern seinen Namen.
Die Knechte lachten über einen schwarzen Kater, der sich unbemerkt auf der Rast eingefunden hatte und schnurrend um das Weinfäßchen herumstrich.
»Wer weiß, was das ist,« sagte ein junger Bursche blinzelnd. »Merkt auf: Ich traf unlängst einen Kerl, der hatte auf einen Hasen geschossen und ihn erlegt. Wie er aber hinkommt, ist der Hase fort und liegt hinter der Hecke ein altes Weiblein, die also in des Teufels Gaukelei draufgegangen.«
Wieder wandte sich der alte Bayer zu dem Feldobristen. »Der Bursch hat recht,« murmelte er gedankenschwer, »die alten Weiber können hexen!«
Herr Albin hob den Kopf. »Merkt's Euch, Herr!« sprach er nachdrücklich. »Die alten Weiber können hexen. Aber die jungen noch viel mehr! Drei Waffen hat der Teufel: das Geld, den Wein und das Weib. Die meide ich. Das ist mein weltlich Gelübde!«
»Das ist von dem Herrn Colonel männiglich bekannt!«
»Der Held Tilly, unter dem ich zum ersten Mal ins Feld ritt, und der unweit von hier am Lech in Ehren und währendem Bataglia dahingefahren ist, der lebte so und lehrte es mich. Er war mein glorreich Exempel, und so schwur ich mir auch solchen leiblichen Eid. Denn ein rechter Kriegsmann soll nur für den Krieg vorhanden sein. Er soll das Eisen in Fäusten haben und nicht das Gold in der Taschen, er soll sein Blut vergießen und nicht Wein in sich schütten, er soll töten und nicht lieben ...«
»So lebt der Herr Obrist wahrlich vor aller Augen ...«
»... und ob es Euch lieb sei oder leid: Ich spreche es zum andern Mal: Drei Schlingen legt der Böse. Heißen Gold, Wein und Weib! Wißt Ihr, warum ich so rasch aus Wien hinwegritt, wohin mich der Generalissimus gesandt? Sie boten mir Geld, viel Geld, wollte ich ihn verraten. Denn Graf Holtzapfel ist ein Calvinist und also manchem in Wien ein Dorn im Auge. Ich aber verlachte die Versucher, führte meinen Auftrag aus und ließ das Pferd satteln.«
»Da hat der Herr Obriste wohlgetan,« sagte der alte Bayer andächtig und leerte seinen Becher, »aber ein guter Trunk Wein –«
»Schaut die Knechte an!« unterbrach ihn Herr Albin finster. »Die Augen fallen ihnen zu, und doch sollten sie wachen, denn an Wegelagerern, Freireitern und hinterlistigen Bauern ist hier wahrlich kein Mangel!«
»Nein!« sprach der Hauptmann. »Erst jüngst haben wir drei gefangen, die uns einen Leutnant aus dem Hinterhalt durch einen Pistolenschuß niedergelegt, und sie zum abscheulichen Spektakel mitten im Lager aufgeknüpft. Aber die Schelme von Bauern liegen überall in den Wäldern. Sie haben geschworen, da man ihnen nun wieder die Völker auf den Hals führe, alles, wes sie mächtig werden könnten, totzuschlagen und ihm das Licht auszublasen ... aber sie sollen nur kommen,« setzte er schläfrig hinzu, und sein greises Sünderhaupt sank vornüber, »wir wollen sie trefflich mit Kraut und Lot bedienen –«
Es wurde still. Nur die Katze, die auf dem Fasse saß, schnurrte leise.
Herr Albin schaute unruhig um sich. Er schüttelte den Hauptmann: »Wachet und betet, Herr! Das ist besser als Schlaf!«
Der alte Krieger lächelte stumpfsinnig. »Wenn der Herr Obriste wacht, wagt sich der Teufel nicht heran. Wie sollt' er auch! Der Wein ist schlecht. Gold haben wir nicht. Und ein Weib ist nicht da. Leider!«
Und wieder schlief er ein.
Freilich – der Wein mochte schlecht sein. Aber Herr Albin empfand doch plötzlich einen quälenden Durst. Der Drang regte sich in ihm, seinen erschlafften, von der Reise ermatteten Körper durch einen Schluck zu stärken, nur durch einen kleinen Schluck aus jenem Fäßchen dort.
Gleich darauf lachte er über solch billige Anfechtung. Damit kam man ihm nicht bei. Aber immerhin war es besser, das Fäßchen nicht anzusehen. So blieb er der Versuchung überhoben.
Er stand auf und trat aus dem Schein des erlöschenden Wachtfeuers hinaus in das Dunkel der milden Maiennacht. Die Schildwache war zu seiner Beruhigung auf dem Posten. Sie rief ihn an und machte die Muskete schußbereit.
Er schritt an ihr vorbei. Weiter und weiter trieb ihn sein Träumen in die Nacht hinein, bis das Lagerfeuer hinter ihm im Nebel verschwand, und um ihn der Wald rauschte.
Weit von dem Schwarm der rohen Knechte und ihrem Hauptmann warf sich der Feldobrist auf einen kleinen Grasplatz mitten im Dickicht. Hier wollte er den nicht mehr fernen Morgen abwarten. Eine lauwarme, zuweilen von leisem Taugeriesel durchschauerte Luft umgab ihn. Um ihn rauschten im Nachtwind die Zweige. Die Ermattung des langen Rittes machte sich geltend, Herr Albin schloß die Augen.
Aber nicht um zu schlafen. Er verfiel in den unruhigen Halbschlummer des Biwaks, eine Art Betäubung, die sich beim geringsten ungewöhnlichen Geräusch blitzschnell in klares Bewußtsein umsetzte. Seine Gedanken wanderten zurück sein Leben entlang durch drei Jahrzehnte. Die drei Jahrzehnte waren Krieg gewesen. Immer Krieg. Von dem Tag ab, da ihm als Bub in der Klosterschule die Nachricht geworden, daß die feindlichen Völker das feste Haus derer von Habstein im Odenwald überrannt. Und was von den Seinen im Schlosse war, das blieb in selber Nacht tot. Er war nun der letzte Sprosse des Geschlechtes, das, nach der Chronik, seit den Tagen des Aeneas auf dem Habstein gehaust.
Und der Morgen danach stieg vor ihm auf, wie er, heimlich der Klosterschule entlaufen, als Kind in das Lager der Kaiserlichen gekommen, wie sie ihn da freundlich aufgenommen als einen verwaisten Junker von Geblüt, wie er unter Tilly den ersten Küraß umgeschnallt und die Fortuna am Schopf gepackt, wie der große Albrecht Waldstein selbst an ihm Gefallen gefunden und er in der blutigen Lützener Schlacht mit Ehren zum ersten Male ein Fähnlein kommandiert, wie er höher und höher gestiegen, bis er endlich selbst dem Kaiser ein Regiment geworden und die Habstein-Kürassiere dem Feind allerorts mit Schrecken bekannt gemacht hatte. Und wenn der Obrist von Habstein sein Leben vor sich sah, so war es Feind und war Feindesgeschrei und war Feindestod. Was tat man auf der Welt, wenn man nicht mit blanker Klinge gegen die Konfederierten oder mit blankem Gelübde wider den Teufel stritt? Die Welt war um des Krieges willen da. Drum wollte es ihm nicht in den harten und wettergebräunten Kopf, daß sie sichtlich den Krieg nicht mehr trug.
Ueberall verödete das deutsche Land. Er wußte es wohl. Ueber Buschsteppen und kahle Felder, durch Trümmerhaufen zogen die Heere. Wenn der Krieg noch lange währte, so mußten sie in ihren Lagern verhungern, umgeben von der Wildnis, die sie sich selbst in den dreißig Jahren geschaffen. Denn überall stieg in diesen Tagen der Wald wieder von den Bergen herab und überzog die Orte, wo die Menschen gehaust, und wo der Wind sonst über wogende Kornfelder strich, da tummelten sich jetzt schreiend die Krähen und Elstern zwischen Gestrüpp und Unkraut.
Der Feldobrist fuhr plötzlich empor. Er fühlte, wie sein Herz zu pochen begann. Auf einem Waldweg, der unfern von ihm durch das Dickicht führte, klang es wie Stimmengewirr und Hufgetrappel.
»Die Gäule sind kaiserlich,« grollte ein rauher Baß, »nur fort – fort – je mehr Meilen zwischen uns und Augsburg, desto besser für unsere Hälse –«
»Nach Ulm müssen wir reiten,« zischelte ein anderer, »zum Schweden –«
»Oder nach Lothringen zu den welschen Völkern.«
Der Lärm verlor sich. Herr Albin fand sich wieder allein in der Einsamkeit des Waldes.
Hastig und lautlos schlüpfte er durch das Gestrüpp zurück und näherte sich vorsichtig spähend dem Lagerfeuer.
Das Feuer war auseinander geworfen. In verzerrten Stellungen lagen die Knechte herum am Boden, ohne Waffen, mit aufgerissenen Wämsern und umgestülpten Taschen. Zwischen ihnen der dicke Hauptmann, Seine Augen waren glanzlos, wie die der andern, sein Mund halboffen. Er regte sich nicht mehr, und nichts rührte sich an den anderen Körpern. Im Zucken der verlöschenden Flammen glänzten breite Blutlachen über dem zerstampften Boden. In sie hinein rieselte der Rest des Weins aus dem umgestürzten Fäßchen.
Die Pferde waren verschwunden. Während Herr Albin zu ihren Pflöcken schlich, stieß er auf die Leiche der Schildwache, die die Freibeuter offenbar ebenso wie die anderen Knechte von Schlaf und Wein trunken übermannt und abgewürgt hatten, ohne daß ein Schuß fiel.
Da war nichts mehr zu helfen. Der Hauptmann und seine Leute waren tot. Die Merodebrüder hatten reinen Tisch gemacht. Die ließen nur stille Leute hinter sich zurück, schon der eigenen Sicherheit wegen.
Herr Albin trat in das Dickicht zurück und sprach hastig ein Gebet für die Sünder, die so unbußfertig dahingefahren, indes er allein dem Teufel entrann. Dann überdachte er seine Lage.
Die war schlimm genug.
Fand er sich doch ohne Gefährten, ohne Pferd und Feuerwaffe, ohne Speise und Trank zur Nachtzeit in einer unwirtlichen, verwüsteten Gegend, wo hinter jedem Baume der Tod lauerte.





























