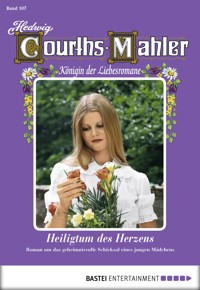Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wie muss es sich anfühlen, den eigenen Verlobten mit einer anderen Frau zu ertappen? Noch dazu, wenn es sich bei der "Anderen" um die eigene Stiefschwester handelt! Diese schwierige Situation widerfährt Friede Sörrensen. Sie löst daraufhin ihre Verlobung mit Fritz von Steinbach und widmet sich fortan ganz ihrer Arbeit, während Stiefschwester Lizzy und ihre ehemals große Liebe heiraten. Doch soll alle Beteiligten das Schicksal noch einmal zusammenführen...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 241
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hedwig Courths-Mahler
Friede Sörrensen
Saga
Friede Sörrensen
Coverbild/Illustration: Shutterstock
Copyright © 1919, 2021 SAGA Egmont
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9788726950380
1. E-Book-Ausgabe
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung vom Verlag gestattet.
Dieses Werk ist als historisches Dokument neu veröffentlicht worden. Die Sprache des Werkes entspricht der Zeit seiner Entstehung.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - ein Teil von Egmont, www.egmont.com
Erstes Kapitel.
Friede Sörrensen stand neben dem Tor, das aus dem Hofe der grossen Molkerei ins Freie führte. Sie liess die Milchwagen an sich vorüberfahren. Einer nach dem andern rollte den breiten Fahrweg hinab, der sich zwischen Wiesen und Wald bis zu den ersten Häusern der Provinzhauptstadt L... hinzog. Wie an eine Schnur gereihte Perlen zogen die Wagen in regelmässigen Abständen dahin. Die ersten hatten schon die etwa eine Viertelstunde entfernt liegenden Häuser erreicht, als die letzten aus dem Tore fuhren.
Friedes scharfen Augen wäre nicht die kleinste Unregelmässigkeit an den vor Sauberkeit blitzenden Wagen entgangen bei dieser Parade. Die in blauen Leinenkitteln sehr sauber aussehenden Kutscher und Austräger rückten sich auf ihren Sitzen stramm zusammen, wenn sie an der Herrin der Molkerei vorüberfuhren.
Als der letzte Wagen hinaus war, sprang ein Knecht herbei, um das Tor zu schliessen. Friede sah den Wagen nach, bis die Torflügel die Aussicht hemmten. Noch einmal sah sie die Dächer der Stadt im Frühsonnenschein aufblitzen, dann war die Aussicht versperrt. Aber durch die klare Luft drangen, wenn auch nur schwach vernehmbar, die Klingeln herüber, welche Köchinnen und Hausfrauen auf das Nahen der Milchwagen aufmerksam zu machen hatten.
Friede Sörrensen steckte befriedigt das bereitgehaltene Notizbuch in eine Ledertasche, die am Gürtel ihres einfachen, aber tadellos sitzenden grauen Leinenkleides befestigt war. Sie hatte keinen Anlass gefunden, eine Rüge zu notieren. Langsam ging sie über den grossen Hof, der einem Gutshofe glich. Die Sonne schien so recht vergnügt über all die sauberen Stallungen und Wirtschaftsgebäude; zuweilen erscholl das dumpfe Brüllen einer Kuh aus den Ställen und unterbrach den gleichmässig surrenden Ton der elektrischen Maschine, die für Betrieb und Beleuchtung zu sorgen hatte.
Knechte und Mägde gingen hin und her, um ihr Tagewerk zu verrichten; alle sahen achtungsvoll und doch zutraulich in das ruhig freundliche und dabei sehr ausdrucksvolle Gesicht der Herrin.
Diese wechselte im Vorbeigehen hie und da ein Wort mit den Leuten, die ihr dann aufs merksam zuhörten. Eine junge Magd erhielt einen Tadel über ihr nachlässig aufgestcktes Haar.
„Stecke dir in Zukunft die Zöpfe fester um den Kopf, Minna, in einer Molkerei darf nicht ein einziges Haar herumfliegen. Geh jetzt gleich in deine Kammer und ändere das,“ sagte sie ruhig, aber so bestimmt, dass man merkte, sie war an unbedingten Gehorsam gewöhnt.
Während das Mädchen mit rotem Kopf davonging, betrat Friede Sörrensen das Wohnhaus, welches den Mittelpunkt der verschiedenen Gebäude bildete. Es war ein schlichtes, zweistöckiges Gebäude mit einer Front von zehn Fenstern. Hier unten, nach dem Hof hinaus, war es ohne Putz und harmonierte mit den Ziegelsteinbauten der Ställe, vorn, nach dem Garten zu war es sauber mit heller Ölfarbe gestrichen und zeigte um die Fenster einige schmückende Sandsteinverzierungen. Der Hausflur war mit Steinfliesen belegt.
Friede öffnete rechter Hand eine Tür. Sie führte zur Küche, einem grossen, wie alles hier im Hause blitzblank gehaltenen Raum. Hier sassen ein paar Mädchen und pusten Gemüse. An dem grossen Anrichtetisch zwischen den Fenstern stand eine ältere, grauhaarige Frau. Sie trug über dem blaugedruckten Kleid eine breite weisse Schürze und gleich den Mädchen eine weisse Haube auf dem glattgescheitelten Haar.
„Jetzt kannst du mir mein Frühstück in die Laube schicken, Mutter Triebsch,“ rief ihr Friede zu.
Mutter Triebsch war ein Zwischending zwischen Köchin und Haushälterin. Sie war in Friede Sörrensens Diensten, schon bevor diese vor nahezu fünfundzwanzig Jahren die damals sehr kleine und bescheidene Molkerei gekauft hatte. Schon damals war sie eine angehende Dreissigerin gewesen, aber sie nahm es noch heute mit der Jüngsten auf, so hurtig und kräftig versah sie ihr Amt. Neben Friede war sie eine Art Vorgesetzte der. Sörrensenschen Molkerei.
Sie wandte jetzt der Herrin ihr frisches, immer vergnügtes Gesicht zu.
„Soll gleich geschehen, Fräulein Sörrensen, gehen Sie man schon immer hinaus. Ist ein rechter Gottesmorgen heute.“
„Ja, Mutter Triebsch, das gibt gutes Heu. Du vergisst doch nicht, den Leuten Kaffee auf die Wiesen zu schicken.“
„Ih, wo werd ich das vergessen! Gehen Sie man ruhig in die Laube Ihre Zeitungen hab ich schon rausgelegt.“
„Schön, Mutter Triebsch.“
Friede Sörrensen zog die Küchentür ins Schloss und verliess das Haus durch die entgegengesetzte Tür.
Hier lag ein sehr grosser, mit schattenspendenden Bäumen bepflanzter Garten, zum grössten Teil mit Kies bestreut. Nur ringsum befanden sich zwischen Rasenstreifen bepflanzte Beete und Sträucher, die von einem grünenden, regelrecht verschnittenen Zaun umgeben waren.
Der grosse, mit Kies bedeckte Mittelteil des Gartens war mit weisslackierten Tischen und Stühlen besetzt. Einige junge Mädchen, alle in dunkelblauen Waschkleidern mit weissen Schürzen und Häubchen, waren eben beschäftigt, die Tische mit bunten Leinentüchern zu bedecken.
Friede warf, während sie zwischen den Tischen hindurch dem hinteren, am dichtesten bepflanzten Teil des Gartens zuschritt, einen Blick auf ihre Taschenuhr, die sie im Gürtel trug.
„Tummelt euch, Mädels. In zehn Minuten kommen die ersten Gäste,“ rief sie den Geschäftigen zu. Und dann blickte sie nach dem Hause zurück.
Rechts und links vom Eingang des Wohnhauses waren überdachte Hallen angebracht. Dort standen weissgescheuerte Tafeln, mit grossen Körben voll Weissbrot und Zwieback und langen Reihen blitzender Gläser besetzt. Die Hallen zogen sich auch noch vor den Stallgebäuden hin. Durch eine Stalltür wurden eben die ersten Milchkübel herausgebracht und auf breite Bänke neben den Tafeln gesetzt. Auf Brettergerüsten wurden Satten mit dicker Milch aufgestellt.
Überall herrschte reges Leben und Treiben. In den Ställen wurde noch fleissig gemolken. Nachdem der Bedarf für die Kundschaft in der Stadt in den Milchwagen verstaut war, wurde jetzt noch für die Gäste gemolken, die in dem Sörrensenschen Molkereigarten eine Milchkur gebrauchten und dieselbe mit einem Morgen- und Abendspaziergang verbinden wollten. Aus allen Schichten der Bevölkerung kamen Damen und Herren jeden Morgen um sieben Uhr und jeden Abend um sechs Uhr durch den schattigen Stadtwald nach der reizend gelegenen Molkerei, um sich an frischer Luft und der rühmlichst bekannten guten Milch und Sahne und dem knusperigen Weissbrot zu laben. Selbst die Offiziere der Garnison verschmähten es nicht, in dem schattigen Garten auszuruhen und ein Glas oder eine Satte Milch zu sich zu nehmen, wenn sie vom Exerzierplatz oder der Reitbahn nach der hinter dem Walde belegenen Kaserne zurückehrten. Sie mussten dicht an Fräulein Sörrensens Garten vorbei. Und man traf dort oft hübsche, junge Damen, die sich durch eine Milchkur von den Anstrengungen der winterlichen Bälle erholen wollten und nicht böse darüber waren, wenn sie eine im Ballsaal begonnene kleine Liebelei hier fortsetzen konnten. Friede Sörrensen gehörte selbst zur besten Gesellschaft von L...... und war eine sehr beliebte Persönlichkeit. Es ging etwas Frisches, Lebenskräftiges von ihr aus, und sie gehörte zu den Menschen, die in ihrer gesunden schaffensfrohen Tatkraft eine beeinflussende Wirkung auf alle Personen ausüben, mit denen sie zusammenkommen. Ungewollt wusste sie sich überall Geltung zu verschaffen, und zwar nicht nur, weil sie mit zu den höchsten Steuerzahlern der Stadt gehörte.
* * *
Es fiel niemand ein, daran zu denken, dass Friede Sörrensen eine ,alte Jungfer‘ war. Sie machte auch durchaus nicht den Eindruck einer solchen. Es lag in ihrem ausgeglichenen, zielbewussten Wesen etwas Frauenhaftes. Und ihr angenehmes Gesicht, das gleich ihrer stattlichen Figur von blühender Gesundheit redete, bestrickte durch einen herzlichen, fast mütterlichen Ausdruck, zumal wenn sie mit jungen Leuten verkehrte. Alles in allem machte sie den Eindruck einer in sich gefestigten Persönlichkeit, die ihren grossen Pflichtenkreis mit Sicherheit beherrschte und dem fordernden Leben aufrecht gegenüberstand.
Wer Friede Sörrensen jedoch zuweilen in Stunden mondscheinstiller Einsamkeit hätte belauschen können, der hätte etwas in den klugen, grauen Augen gesehen, das nicht zu ihrem sonstigen Wesen zu passen schien. Es lag dann etwas Verlorenes, Trauriges in ihrem Blick, etwas wie Sehnsucht und Verlangen nach dem höchsten Daseinswert, nach einem höchsten und besten Glück, das ihr unerreichbar geblieben war.
Friede Sörrensens Vater war ein sehr reicher Mann gewesen, als ihre Mutter starb. Damals zählte sie erst drei Jahre. Zwei Jahre später hatte Friede bereits eine Stiefmutter, und diese Frau, ein oberflächliches, verschwenderisches Geschöpf, wurde der Vater zum Verhängnis. Um die anspruchsvollen Launen seiner zweiten Frau befriedigen zu können, liess er sich in gewagte Unternehmungen ein. Das alte Lied: ein Leben im grossen Stil, Glanz und Fülle nach aussen, und heimlich ein verzweifeltes Ringen, den entschwindenden Reichtum festzuhalten. In diesem Treiben wuchs Friede mit ihrer um mehr als fünf Jahre jüngeren Stiefschwester Lizzi auf, fast ganz der Dienerschaft überlassen. Friedes tief angelegte Nakur erhielt dadurch etwas Ernstes, Stilles und früh Selbständiges, während ihre jüngere Schwester, die ganz den leichtfertigen Sinn ihrer Mutter geerbt hatte, sich zu einem oberflächlichen, berechnenden und ziemlich herzlosen Geschöpf auswuchs. Lizzi trat sehr bald in die Fussstapfen ihrer verschwenderischen Mutter. Sie war sehr anspruchsvoll und drängte die stille, bescheidene Friede um so leichter in den Hintergrund, als sie ein blendend schönes Geschöpf war und durch einschmeichelndes Wesen sich alle Vorteile zunutze zu machen wusste.
Von dem heimlichen Verfall im Vaterhause merkten weder die Schwestern noch die Hausfrau etwas. Sie ahnten nicht, welche verzweifelten Kämpfe es dem Gatten und Vater kostete, den Schein des Reichtums aufrecht zu erhalten.
Lizzi kam gleich ihrer Schwester mit sechzehn Jahren in eine vornehme Erziehungsanstalt. Während ihrer Abwesenheit lernte Friede einen jungen Offizier kennen, der ihr, weil er wertvolle Eigenschaften besass, und weil seine ernste, stille Art der ihren ähnlich war, bald sehr teuer wurde. Ein halbes Jahr später war sie Fritz von Steinbachs glückselige Braut. Steinbach war arm. Trotzdem willigte Friedes Vater in die Verlobung. Er hoffte dadurch seinen bereits etwas wankenden Kredit zu befestigen. Es musste den Leuten einleuchten, dass seine Verhältnisse noch immer glänzend waren, wenn er einen armen Offizier als Schwiegersohn annahm. Friede verlebte ein Vierteljahr lang eine wundervolle Brautzeit. Sich ganz eins fühlend mit dem Verlobten, erblühte sie wie eine Blume im Sonnenschein. Ihr liebeverlangendes, bisher darbendes. Gemüt erschloss sich dem Geliebten in seiner ganzen Tiefe und Schönheit. Ihm gegenüber schmolz ihr zurückhaltendes Wesen in hingebungsvolle Weichheit. Fritz von Steinbach erkannte gerührt, welche Macht er über dies sonst so starke, selbständige Mädchen besass, und sein Gefühl für sie nahm täglich zu an Wärme und Tiefe.
Und doch verriet er sie. —
* * *
Ein Vierteljahr nach Friedes Verlobung kam ihre Schwester Lizzi nach Hause zurück. Sie war noch schöner, noch reizender geworden, und aus ihren grossen, dunklen Augen strahlte ein süsser, verlockender Zauber. Diese Augen verrieten nicht, welch kleine, niedrige Seele in ihr lebte.
Don dem Augenblick an, da Lizzi dem hübschen, stattlichen Verlobten ihrer Schwester entgegentrat und ihn mit ihren schönen lockenden Augen anstrahlte, war es wie ein feiner Riss zwischen die beiden Verlobten hindurch gegangen.
Lizzi hatte nie vertragen können, dass Friede etwas besass, worauf sie nicht auch Anspruch hatte. Es reizte sie, ihre Macht an Fritz von Steinbach zu erproben. Mit allen Künsten der Berechnung umwarb sie ihn, stellte Friede in den Schatten und verwirrte mit ihren heissblickenden Augen die Sinne des Mannes, der ihre Schwester, liebte.
Friede stand hilflos dabei und zog sich stolz und herb in sich selbst zurück. Niemand sollte sehen, wie sie litt unter diesem Treiben der Schwester. Sie schämte sich auch ihrer erwachten Eifersucht, und statt den Kampf aufzunehmen und ihr Eigentum zu verteidigen, liess sie eine lähmende Angst über sich Herr werden.
Und eines Tages, als sie unvermutet ins Zimmer trat, fand sie Lizzi und Fritz in leidenschaftlicher Umarmung, die Lippen aufeinandergepresst.
Sie schrie nicht auf, sprach kein Wort — nur totenbleich wurde sie und ging aus dem Zimmer.
Steinbach starrte ihr nach, wie aus einem Traum erwacht, schuldbewusst, zerknirscht und ernüchtert. Nie hatte er deutlicher gefühlt als in dieser Stunde, dass sein Bestes — seine Seele — Friede gehörte, und dass nichts ihn an Lizzi fesselte als die durch ihr berechnetes Spiel aufgereizten Sinne. Noch in derselben Stunde erzwang er sich eine Aussprache mit Friede. Aber all seinen Bitten und Beschwörungen gegenüber blieb sie starr und kalt. Sie zog den Ring vom Finger und löste ihre Verlobung, weil sie das Vertrauen zu ihm verloren hatte. Sie war noch so jung und unerfahren und wusste nichts vom Leben; sie kannte nicht die Widersprüche im Wesen eines Mannes, ahnte nicht, dass Sinne und Herz verschiedene Sprachen reden können.
Sie hielt sich an die mit eigenen Augen entdeckte Untreue und wies ihren Verlobten mit wenigen, heiseren Worten der Schwester zu.
Als er erschüttert von ihr ging, brach sie zusammen wie ein gefällter Baum.
Am anderen Morgen reiste Friede, nach einer kurzen Aussprache mit dem Vater, nach L....., zu einer verwitweten Schwester ihrer verstorbenen Mutter. Kurze Zeit darauf verlobte sich Fritz von Steinbach mit Lizzi und nach kurzer Brautzeit wurde sie seine Frau.
Friede kehrte nicht nach Hause zurück. Bei ihrer Tante hatte sie die liebevollste Aufnahme gefunden. Diese war kinderlos und betrachtete es als ein Glück, Friede um sich haben zu dürfen.
Und dann — etwa ein Jahr nach Lizzis Verheiratung mit Fritz von Steinbach — trat das Unglück ein, das sich jahrelang heimlich vorbereitet hatte: Friedes Vater war zugrunde gerichtet, nichts konnte mehr den Zusammenbruch verbergen, und die Aufregungen dieser Zeit trafen den Mann so schwer, dass er starb. Lizzis Mutter bekam einen Schlaganfall bei der Kunde von diesem doppelten Unglück und siechte rasch dahin.
Friede war erschüttert, aber nicht fassungslos. Sie hatte das Ärgste, was ihr geschehen konnte, den Verlust des Geliebten, mit Würde getragen, kein Mensch wusste um die qualzerrissenen Nächte, die sie durchkämpfte, nun trug sie auch diesen Schicksalsschlag gefasst.
Noch einmal sah sie Fritz von Steinbach und Lizzi am Grabe ihres Vaters. Sie sprachen nur wenige Worte zusammen, Redensarten, von denen das Herz nichts wusste. Dann kehrte Friede mit der Tante nach L.... zurück. Seit jenem Tage hatte sie weder Fritz noch Lizzi wiedergesehen. Sie standen auch nicht in Briefwechsel miteinander. Nur ein paar flüchtige Zeilen hatten die Schwestern über Erbschaftsangelegenheiten gewechselt. Aus dem Zusammenbruch waren knapp zwanzigtausend Mark gerettet worden. Friede verzichtete auf ihren Anteil und stellte ihn grossmütig der Schwester zur Verfügung, denn sie wusste ja, in welche bedrängte Lage das junge Paar durch den Fall des Vaters geraten war. Fritz von Steinbach wollte um keinen Preis dies Opfer annehmen und verbot seiner Frau, darauf einzugehen. Aber Lizzi zuckte die Schultern:
„Von was sollen wir leben, bis du Hauptmann wirst? Friede braucht das Geld nicht. Ihre Tante hat eine sehr hohe Pension und besitzt auch, so viel ich weiss, einiges Barvermögen. Für Friede ist also gesorgt, denn sie allein wird einmal ihre Tante beerben. Ich werde nicht so töricht sein, ihr Anerbieten zurückzuweisen. Im Gegenteil, ich finde es selbstverständlich, dass sie mir den traurigen Rest überlässt,“ hatte sie geantwortet.
Lizzi fand es immer selbstverständlich, wenn andere Menschen ihr Opfer brachten. Ihr Gewissen war nicht im mindesten beschwert dadurch, dass sie Friede auch den Verlobten abspenstig gemacht hatte.
Um so tiefer war Fritz von Steinbachs Schuldbewusstsein. Er kannte Friede zu gut, um nicht zu wissen, was er ihr angetan hatte. Nur zu bald war die blinde Leidenschaft verraucht, die ihn zum Treubruch verleitet hatte, er erkannte mit peinvoller Schärfe, dass er Talmi für echtes Gold eingetauscht hatte. Mit Friede zusammen hätte er den Zusammenbruch seines Schwiegervaters vielleicht bald verschmerzt, als Lizzis Gatte trug er schwer daran, sein ganzes Leben lang.
Dass er sich schliesslich fügen und Friedes Erbteil mit annehmen musste, um mit seiner Frau und dem Kinde, welches sie erwarteten, über die schwerste Zeit hinwegzukommen, beschämte ihn furchtbar.
Er sowohl wie Friede sahen eine Erleichterung darin, dass jeder Verkehr zwischen ihnen aufhörte; sie waren sich nicht gleichgültig genug, um sich wiedersehen zu können. Die einzigen Lebenzeichen, die zwischen ihnen getauscht wurden, waren die Geburtsanzeigen eines Söhnchens und zweier Töchter, und seitens Friedes die Anzeige vom Tode ihrer Tante. Sonst hörte man nie etwas voneinander.
* * *
Friede war über ihr Unglück hinweggekommen. Sie hatte es bezwungen in ihrer stiller, tapferen Art. Kraftvoll wehrte sie sich gegen das eigene Leid. Aber die Blüte ihres Herzens war gebrochen. Noch manches Mal war sie begehrt worden, aber sie hatte sich nicht zu einer Ehe entschliessen können, so sehr ihr ganzes Wesen auch nach Entfaltung des heiligsten Triebes im Leben des Weibes verlangte — nach einem Kinde, dem sie alles sein konnte. Die Erinnerung an Fritz von Steinbach stellte sich immer wieder trennend zwischen sie und einen neuen Bewerber.
Je älter sie wurde, je selbständiger und zielbewusster sie ins Leben schaute, desto weiter wics sie den Gedanken an eine Verheiratung zurück.
Als ihre Tante dann, jetzt vor fünfundzwanzig Jahren, starb — es war dies kurz nach der Geburt des ältesten Kindes ihrer Schwester — erbte Friede von ihr ein Vermögen von fünfzigtausend Mark. Friede war nicht die Person, die Hände in den Schoss zu legen und von ihren bescheidenen Zinsen ein tatenloses Leben zu führen. Sie verlangte nach einer Aufgabe, um ihre Kräfte zu betätigen, und schickte suchend ihre klugen Blicke ins Leben.
Schon oft hatte sie, wenn sie mit ihrer Tante im Stadtwalde spazieren ging, in der damals sehr kleinen Meierei an einem kleinen, wackeligen Tisch ein Glas Milch getrunken. Dabei hatte sie sich gesagt, wie schade es sei, dass dies reizende Anwesen so arg vernachlässigt sei. Sie malte sich aus, wie hübsch sich hier ein schmuckes Häuschen, saubere Ställe und ein gepflegter Garten ausnehmen müssten.
Kurz nach dem Tode ihrer Tante bemerkte sie an dem verwahrlosten Zaun einen Zettel: „Diese Meierei ist zu verkaufen!“ Sie stand lange und sah nachdenklich darauf, dann umschritt sie langsam das Grundstück von allen Seiten. Es stiess auf der einen Seite an den Stadtwald, die zweite Seite begrenzte der Fluss, an die dritte Seite schloss sich gutes Wiesenland, das sich bis an die neuerbauten Kasernen erstreckte. Und die vierte Seite lag nach der Stadt hinaus an der gut gepflegten Fahrstrasse.
Nicht umsonst kreiste das Blut Kluger Kaufleute in Friedes Adern. Sie überlegte sich, dass die Stadt sich nach den Kasernen zu ausbreiten, und dass nach Jahren der Grund und Boden hier an Wert sehr gewinnen würde. Ausserdem liess sich die Meierei unter tüchtiger Leitung entschieden ertragsfähig gestalten.
Kurz entschlossen kaufte sie die Meierei für den geringen Preis von vierzigtausend Mark. Die Hälfte zahlte sie an. Für den grösseren Teil ihres Vermögens kaufte sie anstossendes Wiesenland, welches man ihr billig überliess. Einen kleineren Teil verwandte sie, um noch einige Kühe anzuschaffen und die notwendigsten Verbesserungen treffen zu können.
Ihr Unternehmen bewährte sich so glänzend, dass sie selbst davon überrascht ward. Im Laufe einiger Jahre bezahlte sie die andere Hälfte der Kaufsumme, kaufte noch Kühe hinzu, für die sie auf ihren eigenen Wiesen das Futter baute. Man wurde in der Stadt aufmerksam auf die blitzsaubere Molkerei. Immer grösser wurde der Kundenkreis. Dann schaffte Friede die ersten Milchwagen an, und seitdem beherrschte sie das ganze Milchgeschäft von L . . . . . Ein Wagen nach dem andern wurde angeschafft, eine Kuh nach der andern. Und allen Gewinn legte Friede an, um neues Wiesenland zu kaufen. Man glaubte, das geschähe nur des Futters wegen für ihre Kühe. Aber Friede sah weiter. Sie merkte wie die Stadt wuchs und sich ausdehnte. Und als dann auch andere kluge Köpfe auf den Gedanken kamen, dass der Grund und Boden jener Gegend bald den zehnfachen Wert haben würde — da gehörte schon das ganze Wiesenland Friede Sörrensen. Da bewunderte man ihre Klugheit.
Wenige Jahre später verkaufte Friede eine Reihe von Grundstücken an reiche Leute der Stadt, die sich in der Nähe des Stadtwaldes Villen bauen wollten, um den zehnfachen Preis, den sie selbst dafür gezahlt hatte. Sie wusste klug ihre Zeit zu erfassen. Eine ganze Villenstrasse entstand so am Rande des Stadtwaldes, und Friede Sörrensen wurde sehr reich. Jetzt rechnete man sie unter die Millionäre.
Trotz dieses Reichtums hatte Friede ihre einfachen Lebensgewohnheiten beibehalten. Ihre Freunde rieten ihr, die Molkerei aufzugeben und den Grund und Boden zum Verkauf in kleinere Grundstücke zu zerteilen; aber Friede schüttelte lächelnd den Kopf. Die Molkerei war ihre Lebensaufgabe geworden, von der sie sich nicht trennen mochte, solange sie schaffensfreudig und gesund war. Und mit ihren fünfzig Jahren war sie noch so frisch und stark, dass sie noch lange nicht daran dachte, auszuspannen. Sie liebte ihren Besitz, den sie sich selbst aus kleinen Anfängen geschaffen hatte, und war stolz darauf, und sie wusste auch, dass er nicht an Wert verlieren würde, sondern nur gewinnen konnte, je mehr die grosse Stadt die Arme nach ihm ausstreckte.
Von Fritz von Steinbach und ihrer Schwester hatte sie nach der Geburtsanzeige der jüngsten Tochter Ellen, nichts mehr gehört. Sie wusste nur, dass Friss von Steinbach jetzt Major war und seit einigen Jahren mit seiner Familie in Berlin lebte. Auch, dass sein Sohn Hans bereits Offizier sei, hatte sie in Erfahrung gebracht. Obgleich sie heimlich zuweilen Sehnsucht empfand, sich mit Schwager und Schwester auszusöhnen — etwas in ihrem Innern hielt sie davon zurück. Das war die Angst vor einem Wiedersehen mit ihrem einstigen Verlobten — davor fürchtete sie sich im stillen. Und diese Furcht war ein Zeichen, dass sie bis heute nicht zu vergessen vermochte, was er ihr einst gewesen war.
___________
Zweites Kapitel.
Friede Sörrensen hatte eben in der Laube Platz genommen und entfaltete ihre Zeitung, als ein hübsches, blondes Mädchen, genau so gekleidet wie die im Garten beschäftigten, mit dem Frühstück eintrat.
„Guten Morgen, Fräulein Sörrensen,“ sagte sie artig und stellte die Platte auf den bereits gedeckten Tisch.
Friede sah auf nnd erwiderte freundlich den Gruss. Lächelnd sah sie zu, wie das Mädchen das Geschirr vor ihr ordnete.
„Nun Lies — du hast mir noch nicht gesagt, wie es deiner Mutter geht. Warst du zu Hause gestern abend?“
„Ja, Fräulein Sörrensen. Vielen Dank, Mutter geht es wieder besser.“
„Braucht sie dich nicht?“
„Nein, meine verheiratete Schwester ist bei ihr.“
„Kann die so leicht abkommen?“
„Sie hat ihr Kind mitgebracht. Und der Mann ist ohnedies auf Landarbeit.“
„So so. Nun, sonst hätte ich dich gern einige Tage beurlaubt, bist ja sonst tüchtig auf deinem Posten.“
„Ich habe es Mutter gesagt, dass Sie mir erlauben wollten, sie zu pflegen. Aber sie hätte es gar nicht zugelassen, auch wenn meine Schwester nicht kommen konnte.“
„Warum denn nicht?“
,,Mutter hat so Angst, dass ich hier bei Ihnen die Stelle verlieren könnte, wenn ich nicht auf dem Posten bleibe.“
Friede lächelte, während sie sich ein Brötchen zurecht machte.
„Deine Mutter ist eine sehr brave, gewissenhafte Frau, Lies. Aber ihre Angst ist überflüssig. Ich machte dir doch das Anerbieten aus freien Stücken. Solange du sonst deine Pflicht tust und bleiben willst, ist dir deine Stellung sicher.“
,,O, bleiben will ich gewiss, Fräulein Sörrensen.
Friede nickte lächelnd, und sah wohlgefällig auf das schmucke Mädchen.
„Also gefällt es dir bei mir?“
Lies nickte strahlend.
Sehr, ach sehr. Sie sind so gut und gerecht. Und dann — ich verdiene doch auch hier viel mehr als in jeder andern Stellung. All die Herrschaften, denen ich Milch und Sahne an den Tisch bringe, geben ein Trinkgeld. Gestern habe ich von Herrn von Volkmar sogar eine ganze Mark für ein Glas Sahne bekommen, und er wollte nichts heraus haben.“
Friede lachte.
„Das ist natürlich der Heinz gewesen, nicht wahr?“
„Ja, Fräulein Sörrensen. Der ältere Herr von Volkmar war gestern gar nicht hier.“
Friede nickte.
„Ich weiss es, Lies.“
„Aber braun gebrannt ist der ältere Herr von Volkmar von seiner weiten Reise zurückgekehrt. Ist es wahr, Fräulein Sörrensen, dass er bei den wilden Menschenfressern war?“
Friede lachte herzlich über das ängstliche Gesicht des Mädchens.
„Lies, du siehst aus, als wärst du selbst mitten drin im Lande der Menschenfresser und solltest schon diesen Mittag verspeist werden. In fernen entlegenen Gegenden und bei wilden Völkerstämmen ist Herr von Volkmar wohl gewesen, ob Menschenfresser dabei waren, weiss ich nicht. Möglich ist es schon. Aber nun geh an deine Arbeit, Lies. Es wird Zeit, ich sehe schon Leute kommen. Und höre — gehe hübsch sparsam um mit dem verdienten Gelde. Alle Tage gibt es nicht so fürstliche Trinkgelder. Nichts für Kinkerlitzchen ausgeben!“
Lies schüttelte ernsthaft den Kopf.
„Ich trage alles zur Sparkasse, Fräulein Sörrensen. Zweihundertundvierzig Mark hab ich schon.“
,,Ei, das ist ja ein Vermögen, Lies. Nun, es wird noch mehr dazu kommen.“
Lies nickte Strahlend und lief dann eilig davon, um die ersten Gäste der Molkerei zu bedienen.
Friede frühstückte nun behaglich mit gesundem Appetit und las ihre Morgenzeitung dabei. Diese ruhige Morgenstunde pflegte sie auszukosten. Später gab es wieder allerlei Geschäfte für sie zu ordnen. Sie war von früh bis spät auf dem Posten und ging ihren Leuten mit gutem Beispiel voran. ,Es liegt immer an der Herrschaft, wenn die Dienstboten nichts taugen,‘ pflegte sie zu sagen. Und bei ihr traf es ein. Ihre Leute waren alle tüchtig.
Während sie so stillfriedlich in der mit dichtem Weinlaub bewachsenen Laube sass, füllte sich nach und nach der Garten mit Menschen. Alle Tische und Stühle waren in Anspruch genommen. Vom kleinen Angestellten und Ladenfräulein bis zu den Offizieren und Damen der Gesellschaft waren alle Klassen vertreten. Die meisten tranken schnell ihre Milch und gingen dann wieder fort, um anderen Platz zu machen. Das waren die Menschen, deren Tagewerk ihnen nicht viel Zeit liess zur behaglichen Ruhe. Andere sassen eine Stunde und länger, genossen den Labetrunk mit Ruhe, und wenn sie keine andere Unterhaltung fanden, dann fütterten sie die beutehungrig herumflatternden Spatzen mit Brotkrumen.
Als Friede ihre Zeitung gelesen hatte, erhob sie sich und ging durch den Garten dem Hause zu. Nach allen Seiten musste sie Grüsse austeilen; hier und da blieb sie stehen, um einige Worte mit einem näheren Bekannten zu wechseln. Es geschah in ihrer ruhigen und doch erfrischenden Art, und aus dem Benehmen der Leute konnte man sehen, wie beliebt Friede Sörrensen überall war.
In der Nähe des Hauses, dicht am Eingang des Gartens, sassen an einem Tisch mehrere junge Offiziere. Ihre bestaubten Anzüge verrieten, dass sie schon anstrengende Dienststunden hinter sich hatten, trotzdem schienen alle in heiterster Laune und liebäugelten mehr oder minder ernsthaft mit den jungen Damen, die in der Nähe sassen.
Als Friede neben ihren war, erhoben sie sich gleichzeitig und begrüssten sie mit artiger Verbeugung.
Sie dankte lächelnd.
„Schon fertig für heute mit dem Dienst, meine Herren?“ fragte sie freundlich.
Ein schlanker, lustig aussehender Leutnant mit blondem Schnurrbart und etwas dunklerem kurzgeschnittenen Haar hatte ihre Hand ergriffen und schaute ihr schelmisch verliebt ins Gesicht.
„Für die nächsten zwei Stunden sind wir frei, Tante Friede. Jetzt stärken wir uns zu neuen Strapazen an diesem Trank von süsser Labe.“
Er ergriff sein Milchglas und hielt es ihr entgegen. Friede nickte ihm lachend zu: „Nur keinen spottenden Unterton, Heinz. Wenn dir auch ein Glas Sekt lieber wäre, bekömmlicher ist dir dieses harmlose Getränk jedenfalls.“
„Natürlich, das ,Kind‘ sollte überhaupt nichts anderes zu trinken bekommen,“ neckte ein etwas beleibter Hauptmann.
„Salten — wenn du nicht mein Vorgesetzter wärst, würde ich dir das ,Kind‘ eintränken,“ drohte Heinz von Volkmar mit blitzenden Augen und sah eroberungssüchtig nach dem Nebentisch, wo zwei junge Damen mit einer älteren zusammensassen. Der Hauptmann knurrte behaglich in sich hinein, hob aber nun seinerseits das Glas und trank Friede mit einer Verbeugung zu.
„Was wären wir ohne Ihre treffliche Verpflegung, mein gnädiges Fräulein. Wenn die Offiziere unseres Regiments mit Recht die ,schönsten‘ und ,stärksten‘ genannt werden, so ist das nicht zum mindesten Ihr Verdienst,“ sagte er scherzend.
Friede machte ein schelmisch stolzes Gesicht.
„Ei, darauf will ich mir in Zukunft etwas einbilden, Herr Hauptmann.“
„Aber unsere schlanken Taillen werden bei dieser Verpflegung elend zuschanden werden,“ seufzte ein kleiner schwarzhaariger Leutnant, indem er den Waffenrock straff zog und ebenfalls nach dem Nebentisch hinüberschielte.
,,,Lasst wohlbeleibte Männer um mich sein, mit glatten Köpfen, und die nachts gut schlafen,‘“ sprach der Hauptmann mit Nachdruck.
„Soll das auf meinen üppigen Haarwuchs zielen?“ fragte Leutnant Bülau entrüstet und strich sich über seine bereits recht kahle Stirn.
„Was denn? Das mit der Wohlbeleibtheit?“
„Nein — das mit den glatten Köpfen.“
„Fühlst du dich getroffen, wird es wohl stimmen.“
„Fräulein Sörrensen, bitte, nehmen Sie mich in Schutz. Ich befinde mich auf Ihrem Grund und Boden. Bitte, machen Sie von Ihrem Hausrecht Gebrauch.“
„Ich schlage vor, die Herren einigen sich auf friedliche Weise.“
„Gut, weil Sie es wünschen, gnädiges Fräulein — sonst müsste Salten dran glauben.“
„Heissen Dank, gütige Schutzherrin!“ rief Hauptmann Salten.
Friede wollte lachend weitergehen. Da hing sich Heinz von Volkmar in ihren Arm.
„Tante Friede, ich darf doch ein Weilchen mit dir hineingehen?“
Sie sah mit einem humorvoll forschenden Blick in sein hübsches gebräuntes Gesicht.
„Drückt dich der Schuh an irgend einer Stelle?“ fragte sie halblaut, indem sie mit ihm in das Haus trat.
Er seufzte. „Nicht zu wenig, Tante Friede.“
Sie öffnete ihr Wohnzimmer, welches der Küche gegenüberlag, und zog ihn mit sich hinein. Als die Tür hinter ihnen ins Schloss fiel, blieb sie vor ihm stehen.
„Nun beichte, du Strick. Wie viel brauchst du denn?“
„Fünfzig Mart, Tante Friede, nur bis zum Ersten. Ich bin vollständig abgebrannt, weil ich meinem Kameraden ausgeholfen habe.“