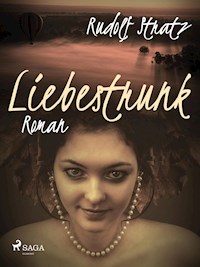1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
In Rudolf Stratz' Buch 'Für Dich' wird die Geschichte einer unerfüllten Liebe zwischen zwei jungen Menschen im frühen 20. Jahrhundert erzählt. Der Autor beschreibt einfühlsam die Gefühle und Gedanken der Protagonisten und lässt den Leser tief in ihre Welt eintauchen. Stratz' literarischer Stil zeichnet sich durch seine feine Beobachtungsgabe und die lebendige Darstellung von Emotionen aus. Das Buch ist ein Meisterwerk der deutschen Literatur seiner Zeit und wird oft als Beispiel für die sentimental-romantische Literatur des ausgehenden 19. Jahrhunderts zitiert. Mit 'Für Dich' schuf Stratz ein Werk, das die Leser auch heute noch fesselt und bewegt. Rudolf Stratz, geboren 1864 in Augsburg, war ein bekannter deutscher Autor und Journalist. Seine eigenen Erfahrungen mit unerfüllter Liebe und die Beobachtung der gesellschaftlichen Normen seiner Zeit inspirierten ihn, dieses ergreifende Buch zu schreiben. Stratz' feinfühliges Erzählen und sein Gespür für emotionale Nuancen machen 'Für Dich' zu einem zeitlosen Klassiker der deutschen Literatur. 'Für Dich' ist ein Buch, das die Leser auf eine emotionale Reise mitnimmt und sie dazu anregt, über die Tiefe menschlicher Gefühle nachzudenken. Dieses Buch ist ein Muss für alle, die sich für romantische Literatur und die Abgründe der menschlichen Seele interessieren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Für Dich
Inhaltsverzeichnis
I.
Der Hauptmann Georg Gisbert ahnte an diesem Berliner Märzabend nicht, daß in einer halben Stunde für ihn die schicksalsschwerste Wendung seines Lebens beginnen würde. Er stand in seiner reichen Wohnung in der Meinekestraße draußen im Westen nahe dem Kurfürstendamm, in Waffenrock und Epauletten, zur Gesellschaft fertig, knöpfte sich die weißen Handschuhe zu, sah auf die Uhr und rief dann in das Nebenzimmer: »Otti–i! ... Ott–i! ... Ott–i!«
Das klang mahnend wie zwei gleichmäßige Glockenschläge. Durch die halboffene Türe antwortete es: »Ja doch! Gleich ...«
»Otti – wir kommen zu spät!«
»Nur noch eine Sekunde!«
Ja – die Sekunde! Der Hauptmann Gisbert seufzte, ging im Zimmer hin und her, blieb wieder stehen und prüfte sich im Spiegel, ob er wenigstens gefechtbereit sei. Das Glas warf ihm sein Bild zurück, eine straffe preußische Offiziersgestalt, einen energischen schnurrbärtigen Kopf, dessen gesunde Luftbräunung unter dem Stubenhocken noch nicht gelitten hatte. Denn er war erst seit kurzem aus seinem Provinzregiment zur Dienstleistung beim Kolonialamt nach Berlin kommandiert worden.
»Ottilie!« Wenn er »Ottilie« statt »Otti« sagte, wurde er energisch.
»Ottilie! Ich werde jetzt einfach an Muthardts telefonieren, wir kämen überhaupt nicht mehr! Du würdest mit deinem Krimskrams heute abend nicht mehr fertig!« ...
Er war jetzt entschlossen, selber hineinzugehen, um dem Mädchen beim Zuhaken der Taille zu helfen. Aber im selben Augenblick trat seine Frau über die Schwelle. Ihr rosiges Gesicht war etwas erhitzt von der Eile. Ihre weißen Schultern glänzten. Sie trug ein Kleid aus blaßgrünem Crepe de Chine mit Silberspitzen und in dem dunklen Haar ein Efeukränzchen, das gut zu dem sanften Ausdruck ihrer nußbraunen Augen paßte. Sie hatte etwas Kindliches an sich, trotz ihrer zwei- oder dreiundzwanzig Jahre. Ein reicher Smaragdschmuck flimmerte ihr an Hals und Hand. Sie warf ebenso wie ihr Mann noch einen schnellen Blick in den Spiegel und sprach dann: »So! ... Ist ein Auto unten?«
»Ja! Vorwärts!«
Sie nahmen sich eben nur noch die Zeit, im Vorbeigehen in das Kinderzimmer hineinzuschauen, wo der kleine zweijährige Robert und sein einjähriges Schwesterchen Martha friedlich schlummerten, dann stiegen sie die Treppen hinunter und in den Wagen. Und im Fahren sagte der Hauptmann resigniert: »Du bist eben immer unpünktlich!«
»Ich bin gerade so pünktlich wie die andern!«
»Nee, mein Kind! Das ist eben der Unterschied! Bei uns in der Armee ist das in den Familien jedermann seit Generationen anerzogen. Bei euch draußen, da muß man es erst lernen!«
Es war bei ihm immer ein Zeichen von Ungeduld, wenn er seiner Frau nahelegte, daß ihr Vater der Weingroßhändler Jean Baptiste Dörsam in Worms war. Sie selber machte von ihrer Herkunft aus der Firma Dörsam, Fröhlich und Kompanie hier in Berlin nur den notwendigsten Gebrauch und schwieg versöhnlich, während er rief: »Vorwärts, Kutscher! ... Dabei wohnen diese Muthardts noch am Kronprinzenufer! Wenn man Eile hat, wohnen die Leute immer am Kronprinzenufer. Es ist merkwürdig!«
Als sie in den Korridor der Muthardtschen Wohnung traten, in dem alles voll war von Helmen und Hüten, von Säbeln und Regenschirmen, von bunten und dunklen Paletots, kam ihnen ein Lohndiener schon mit einer Suppenschüssel entgegen. Man saß also bereits bei Tisch. Es war eine lange Tafel in einer regelmäßigen Abwechslung von hellen Damenkleidern, Waffenröcken und Fräcken. Der Leutnant von Muthardt war zur Artillerie- und Ingenieurschule in Charlottenburg kommandiert. Seine Frau hatte den weit bekannten, süddeutschen Universitätsprofessor und Abgeordneten Röttger zum Vater. So hatten sie in Berlin gleich Anschluß nach verschiedenen Seiten hin gefunden. Zwei noch blutjunge, nette Leute kamen sie dem eintretenden Ehepaar Gisbert entgegen und schnitten liebenswürdig und erregt die Entschuldigungen wegen des Zuspätkommens ab, und der Hausherr nahm seinen Kameraden am Arm und stellte vor: »Gestatten Sie, meine Herrschaften! Herr Hauptmann Gisbert und Gemahlin, Bruder meines dicken Spezialkollegen von der Bombe hier, aber begabter als der ...«
»... wozu nicht viel gehört!« erklärte der gemütliche Spandauer Artillerist, der ganz nahe dabei saß, mit einem Lächeln in den schlau zwinkernden Äuglein und auf dem roten Gesicht.
»... alter Chinakämpfer – Schutztruppler in Ostafrika – jetzt im Kolonialamt tätig ...«
»... kurzum: ein Streber!« ergänzte der Bruder, und der junge Hausherr, nachträglich etwas verwirrt darüber, daß er den ihm doch halb Fremden in seiner Erregung so scherzhaft eingeführt hatte, sagte hastig: »Bitte, gnädige Frau: Hier ist Ihr Stuhl frei! Sie erlauben: Ihr Tischherr: Herr Regierungsrat Freiherr von Steinling! Ihr anderer Nachbar – da hab' ich selbst den Vorzug! ... Und Sie, Herr Hauptmann, wenn ich bitten darf, dort drüben, neben Frau von Laitz!«
Georg Gisbert nahm neben der jungen Leutnantsfrau Platz, die er oberflächlich kannte und durch einen Händedruck begrüßte, und Frau von Laitz, die nicht hübsch, aber lustig war, sagte sofort: »Ich dachte schon, die Wilhelmstraße wäre Ihnen so zu Kopf gestiegen, daß Sie mit uns Frontproletariern überhaupt nicht mehr verkehren wollten!«
Er entfaltete seine Serviette.
»So bin ich gar nicht, gnädige Frau! Ich hab' eigentlich furchtbar wenig Ehrgeiz in mir!«
»Jawohl! Das sagen alle, wenn sie glücklich so weit sind!«
»Nein. Wahrhaftig! Manchmal kommt es mir vor, als wäre ich gar nicht Offizier!«
Sie sah auf die Kriegsorden mit gekreuzten Schwertern auf seiner Brust, die er sich in Asien und Afrika geholt, und frug erstaunt: »Ach, du guter Gott! ... Was denn sonst?«
»Das weiß ich nicht!«
Frau von Laitz lachte.
»Na ja! Sie haben ja so vielerlei Gaben! Das habe ich schon gehört! Sie singen. Sie spielen wundervoll die Geige. Sie komponieren auch – nicht wahr?«
»Das sind alles nur Dummheiten, gnädige Frau!«
»Ach wo! ... Wo haben Sie denn bis jetzt in Garnison gestanden?«
»In Metz!«
Sie pfiff durch die Zahne.
»Eben ... Metz! ... In Berlin wird's Ihnen schon besser gefallen! Ich bin gräßlich gern hier! ... Ich bin bis an die Decke gesprungen, wie es hieß: wir kommen hierher! Na – in Oberschlesien sind die Decken ja auch niedrig! Finden Sie nicht auch die Berliner Wohnungen so riesenhaft hoch? Namentlich da draußen im Westen? Sie sollen ja auch so prachtvoll eingerichtet sein!«
Georg Gisbert hörte längst nicht mehr auf das eilfertige Geplapper neben ihm. Er hatte zerstreut über den Tisch hingeblickt – es war da ein Gewirr – die vielen Gesichter – das Lachen – die Blumen und Lichter – die bloßen Schultern, die bunten Krägen, die weißen Frackhemden – wie ein flimmernder Nebel lag es über der Tafel. Und in dem Nebel sah er plötzlich eine Dame – schräg ihm gegenüber am anderen Ende – wohl zehn, zwölf Stühle von ihm entfernt – und sein Herz stand still.
Erst glaubte er es nicht. Dann schaute er wieder hin. Und nun wußte er es: Da drüben saß seine geschiedene Frau ...
Sechs Jahre waren es her, seit er sie zuletzt gesehen.
Damals war sie schwarz gekleidet und dunkel verschleiert vor ihm die Stufen des Amtsgerichts, aus dem sie vom Scheidungstermin kam, hinab zum Wagen geschritten. Und als sie, ohne den Kopf nach ihm zu wenden, das Kleid raffend, in die Droschke gestiegen war, da hatte er gedacht, nun würde er ihr nie wieder im Leben begegnen.
Der Lohndiener schob sich mit einer Platte an seine linke Seite. Er nahm sich mechanisch und hörte, wie die kleine Frau von Laitz neben ihm sagte: »Dieser ewige grillierte Zander ist gräßlich! ... Der und die gefüllte Pute ...« und ließ dabei kaum den Blick von seiner einstigen Frau da drüben ...
Sie mußte jetzt gegen dreißig sein. Ihre blonde Schönheit schien ihm noch gewachsen gegen früher. Er hatte sie nicht so schön in der Erinnerung. Sie überraschte ihn. Sie hatte sich überhaupt verändert. Sie war ruhiger. Gereift. Die Jahre hatten die schmalen, blassen Züge noch veredelt. Der leichte, kaum merkliche Ansatz zwischen Kinn und Hals gab ihnen etwas Frauenhaftes, was sie früher nicht so besessen. Aber ihre Gestalt war so schmächtig-schlank wie einst.
Sie trug ein weißes Kleid ohne allen Ausputz. Keinerlei Schmuck. Nur an ihrer linken Hand funkelte, als sie jetzt den weißen Arm ausstreckte, um an dem Rotweinglas zu nippen, ein ganz schmaler goldener Ring. Vor ihr auf dem Tisch lag ein Blumenstrauß aus Veilchen und Maiglöckchen. Sie war die einzige Dame in der Gesellschaft, die diese Auszeichnung bekommen hatte. Sie beachtete ihren früheren Mann gar nicht, obwohl sie ihn ja bei seinem Eintritt in das Zimmer sofort erkannt haben mußte. Sie schaute mit keinem Blick zu ihm hinüber, sondern hatte sich zu ihrem Nachbar zur Linken gewandt und sprach leise und ruhig mit ihm und lächelte dabei ein wenig, – Georg Gisbert kannte dies süße, melancholische Lächeln, das zuweilen ihr Gesicht erhellte – und der Herr neben ihr nickte und erwiderte gedämpft etwas. Die beiden plauderten sehr vertraut. Sie schienen sich wohl zu kennen. Er war nicht mehr jung – ein guter Fünfziger – groß und beleibt, mit einem gutmutigen, von viel frischer Luft und starkem Wein geröteten Gesicht und angegrautem Haar und Schnurrbart. Seine Stimme klang etwas knarrend. Er trug zu seinem Frack den Johanniterstern. Er machte trotz seiner Schwerfälligkeit den Eindruck eines vornehmen Mannes. Jetzt beugte er sich ganz nahe zu seiner Nachbarin. Beide nickten gleichzeitig, als ob sie über etwas einig wären.
Georg Gisbert unterbrach das Redegeplätscher der Frau von Laitz neben ihm, die ihm eben irgend eine Schreckenstat ihres Dienstmädchens mit aller Ausführlichkeit berichtete, und frug unvermittelt: »Sagen Sie, gnädige Frau – kennen Sie den Johanniter da drüben? – Den korpulenten Herrn, der sich eben das Menü anschaut?«
Sie war etwas erstaunt über seine Unhöflichkeit. Dann erwiderte sie: »Das ist ein Freiherr von Ulerici – Major a. D. und Rittergutsbesitzer. Sehr reich. Er stand, glaube ich, früher bei den neunten Kürassieren ...«
Und nach einer Pause setzte sie hinzu: »Er ist verlobt, wie Sie sehen – auf seine alten Tage ...«
»Mit wem?«
Die kleine Frau lachte.
»Na aber, Herr Hauptmann – natürlich mit der Dame neben ihm! Ein Brautpaar sitzt doch immer beisammen. Eine Frau von Dingsda ... ich habe den Namen nicht recht verstanden ...«
»Frau von Vogt,« sagte der Hauptmann Gisbert mechanisch vor sich hin.
»Nein. Sie ist eine geborene von Vogt-Neetzow. So heißt ihr Vater. Aber sie ...«
»Sie heißt geradeso.«
»Aber erlauben Sie mal: Wenn sie als Witwe ...«
Georg Gisbert wandte sich zu seiner Tischdame und sagte mit der seltsamen Offenheit, die er zuweilen gerade Fremden gegenüber hatte: »Sie ist keine Witwe, sondern meine geschiedene Frau!«
»Was?«
»Ja gewiß! Darum frug ich nach dem Herrn neben ihr.«
»Nun machen Sie aber keine Witze, Herr Gisbert ...«
Er versetzte ebenso ruhig und brüsk wie bisher: »Warum soll ich es Ihnen denn nicht sagen? Nach Tisch tuschelt es doch einer dem andern brühwarm ins Ohr. Es sind genug Leute da, die uns kennen. Sehen Sie doch nur die sonderbaren Gesichter!«
Frau von Laitz war ganz erschüttert. Sie hielt die Hände im Schoß und schwieg. Das hieß bei ihr viel. Endlich meinte sie beklommen: »Das wußte ich ja gar nicht, daß Sie schon einmal verheiratet waren!«
»Gerade vor zehn Jahren habe ich geheiratet. Und vor sechs Jahren war es aus.«
»Ach so ... deswegen gingen Sie dann ...«
»Deswegen ging ich in die Kolonien! Und wäre jetzt noch dort, wenn ich nicht wegen meiner Verwundung in Ostafrika hätte zurück müssen ...«
Es war ein Stillschweigen. Dann versetzte die kleine Leutnantsfrau: »Na – das ist eine schöne Geschichte! Ich begreife die Muthardts nicht! Man sieht sich doch an, wen man zusammen einlädt!«
Georg Gisbert zuckte die Achseln.
»Meine verehrte gnädige Frau – wie sollen Muthardts denn das wissen? Die sind neu in Berlin. Ich bin auch vor kurzem hierher versetzt. Kann man denn einem Menschen, den man kaum kennt, an der Nase ansehen, daß er vor sechs, acht Jahren in Westpreußen in Garnison gewesen und in Danzig geschieden worden ist und wie seine damalige Frau mit dem Mädchennamen geheißen hat? Das ist zuviel verlangt in Berlin!«
So sprach er. Aber er dachte sich doch: Deutschland ist groß und die Welt ist weit. Ich bin in die Welt hinaus gegangen, unter Chinesen und Hottentotten, um die da drüben zu vergessen – und nun sitzen wir doch wieder im selben Zimmer beisammen ...
»Das wird der armen Muthardt schrecklich sein!« sagte seine Nachbarin.
Er erwiderte nichts. Jetzt, während er mit seiner Tischdame so angelegentlich gesprochen, hatte Frau von Vogt ihre großen graublauen Augen für eine Sekunde zu ihm hinüber gewandt, nicht verstohlen, sondern in einem stolz und gleichgültig über die Tafel schweifenden Blick. Dem begegnete jetzt der seine. Sie wichen sich nicht aus. Sie sahen sich ruhig ins Gesicht. Ihm schien, als sei sie etwas blasser geworden, in diesem Moment – aber es konnte auch eine Täuschung sein. Sie drehte wieder ihr blondes Haupt und richtete eine lächelnde Frage an ihren Bräutigam. Und der alte gutmütige Lebemann lächelte zärtlich dagegen, mit einem glücklichen Schein in seinen kleinen, wässerigen Augen. Er war offenbar bis über die Ohren verliebt in seine schöne Braut.
Und Georg Gisbert dachte sich: ›Welch sonderbares Ding ist doch der Mensch!‹ Er hatte jetzt eben, wie er das Strahlen auf dem roten, übergrauten Gesicht da drüben sah, einen ganz deutlichen, ganz lebhaften Stich von Eifersucht im Herzen empfunden, als wolle der Freiherr von Ulerici etwas nehmen, was ihm, dem Hauptmann Gisbert, gehörte! So stark war jetzt noch, nach sechs Jahren, die Macht der Gewohnheit, des unbewußten Empfindens. Das war lächerlich! Sie war doch weiß Gott frei! Mochte sie nur den alten, schnaufenden Junker da drüben heiraten und seine Rittergüter erben! Er, Georg Gisbert, hatte doch auch schon vor drei Jahren Fräulein Otti Dörsam, vom Hause Dörsam, Fröhlich und Kompanie, Rhein- und Moselweine en gros, geehelicht. Sie hatte ebensogut ein Recht, für ihre Zukunft zu sorgen, wie er.
Und eine plötzlich aufquellende Bitterkeit in ihm sprach: Ja, wir sind klug geworden, du und ich! ... Wir sind nicht mehr die Sonntagskinder, die es in dem engen Alltag miteinander nicht aushielten! Wir rechnen jetzt wie andere Leute und zählen die Groschen und gehen manierlich auf der breiten Bahn ...
Wieder streiften sich, diesmal ganz unbeabsichtigt, ihre Blicke. Zugleich runzelte Georg Gisbert die Stirne: Herrgott – seine Frau! ... Man konnte ja Otti keinen Vorwurf machen! Sie ahnte natürlich nicht, wer ihr da gerade gegenüber saß. Und in ihrer nächsten Nähe war keiner, der es ihr hätte zuraunen können. Aber mußte sie denn gerade zu Frau von Vogt über den Tisch hinüber so unendlich liebenswürdig sein und sie immer wieder in ein Gespräch verwickeln? Die andere antwortete lächelnd und freundlich. Sie ließ sich nichts merken. Sie war wirklich ganz große Dame geworden. Er sah: sie hatte etwas gelernt vom Leben! Lieber Gott – wer ihr früher solche Selbstbeherrschung zugemutet hätte ...
Er warf einen mißgünstigen Blick auf das Menü. Diese törichten Gerichte wollten nicht enden. Muthardts trumpften viel zu sehr auf! Er hätte gewünscht, daß es schon vorbei wäre, und wandte sich wieder an Frau von Laitz: »Warum sind Sie denn auf einmal so still, gnädige Frau?«
Die kleine Frau erwiderte nervös: »Ich denke über das alles nach! Nein, bitte, Herr Gisbert – machen Sie jetzt keine banale Unterhaltung! Das wäre wirklich Sünde. Sie können nicht in der Stimmung sein. Und ich bin's auch nicht!«
Er neigte fügsam seinen gebräunten Kopf und entsann sich, daß er mit seiner Nachbarin zur Linken noch kein Wort gesprochen. Er raffte eine Handvoll Phrasen zusammen. Aber das unbekannte altjüngferliche Wesen neben ihm blieb säuerlich und unergiebig, und er schwieg wieder und schaute geradeaus vor sich hin. Nach rechts, in die Gegend, wo Vera von Vogt saß, zu blicken, vermied er jetzt durchaus. Er merkte, wie er nun, nachdem die erste Verblüffung überwunden war, doch immer erregter wurde, und fühlte sein Herz hörbar pochen.
Neben ihm versetzte Frau von Laitz, während sie gespannt nach der Hausfrau blickte: »Da! ... Ich wette, eben hat Herr von Allmerode es ihr gesagt!«
Der Doktor von Allmerode, der bekannte konservative Abgeordnete, war das große Tier der heutigen Gesellschaft. Deswegen hatte er auch die kleine Frau Leutnant von Muthardt zu Tisch geführt. Es war sehr wahrscheinlich, daß er, als Agrarier, den alten von Vogt auf Neetzow in der Altmark, Veras Vater, kannte, und ebenso begreiflich, daß er, um die Dame des Hauses nicht vorzeitig unnütz aufzuregen, ihr erst jetzt, bei Schluß der Tafel, schonend ihr Mißgeschick mitgeteilt hatte. Jedenfalls wurde Frau von Muthardts Gesicht auf einmal merklich rot. Sie blickte verwirrt und hilfesuchend nach dem anderen Ende des Tisches, wo ihr Mann saß. Aber der ahnte noch von nichts. Er scherzte und lachte mit Frau Otti Gisbert, und beide zogen immer wieder Vera von Vogt in das Gespräch, die ihnen mit gleichbleibender Gelassenheit antwortete. Es war ein unhaltbarer Zustand. Die junge Hausfrau gab sich einen gewaltsamen Ruck und hob aufstehend die Tafel auf, beinahe ehe noch die letzten Gäste ihre Birnen geschält und die Fingerspitzen in die Spülschalen getaucht hatten. Und in dem Stühlescharren wandte sich Frau von Laitz zu Georg Gisbert: »Seien Sie nicht böse: Ich habe noch eine Frage auf dem Herzen!«
»Bitte, gnädige Frau!«
»Hatten Sie denn aus Ihrer ersten Ehe Kinder?«
»Eine Tochter! Sie geht jetzt in das neunte Jahr. Sie wird bei meiner Mutter in Schlesien erzogen.«
Er reichte seiner Nachbarin den Arm und führte sie in den Salon. Dort war das allgemeine Händegeschüttel und Mahlzeitgemurmel nach Tisch. Er konnte es nicht vermeiden, daß er plötzlich seiner früheren Frau gegenüberstand. Es schien ihm, daß einige Umstehende diese Begegnung bereits gespannt erwartet hatten und ihnen beiden mit unterdrückter Neugier zusahen. Das ärgerte ihn. Er machte Vera von Vogt ruhig seine Verbeugung. Sie erwiderte sie ebenso durch eine leichte Neigung des Kopfes – dann war das vorbei, ohne daß ein Unbefangener irgend etwas Auffälliges hätte bemerken können, und der Hauptmann Gisbert zog sich in eine Ecke zurück, wo er seine Frau erblickt hatte.
Er stellte sich neben sie und sagte gedämpft: »Otti – hör mal!«
Sie wandte ihr rosiges, etwas erhitztes Antlitz nach ihm und nickte ihm vergnügt zu. Die vielen Menschen, der Wein, die Lichterhelle hatten sie belebt. Sie war sehr guter Dinge und sah ungewöhnlich hübsch aus.
»Na, Männe ...« sagte sie versöhnlich. »Amüsierst dich? Was machst du denn für ein komisches Gesicht?«
»Siehst du die blonde Dame dort in Weiß – die, die dir bei Tisch gegenübersaß?«
Sie schaute harmlos in der von ihm bezeichneten Richtung.
»Ach die!« meinte sie lebhaft. »Du – Georgche – die is zu nett! Mit der hab' ich mich ausgezeichnet unterhalten!«
Noch einmal blickte sie hin. Sie war an sich ein herzensguter Kerl und neidloser Anerkennung fähig.
»Eine wunderschöne Frau!« sagte sie. »Findest du nicht? ... Der alte Baron kann sich gratulieren, der sie kriegt!«
»Kennst du sie denn?«
»Nein!«
Er neigte seinen Kopf etwas zu ihrem Ohr und versetzte: »Nun schrei nicht und mach keine Geschichten über das, was ich dir jetzt sage: Das ist Frau von Vogt!«
»Sie ...?«
Im ersten Augenblick wurde für Frau Otti Gisbert die Überraschung, die Bestürzung und alles durch den tiefen Eindruck verdrängt, sie – die andere – ihre Vorgängerin – einmal leibhaft vor sich zu sehen! Sie ließ die Augen nicht von Veras hoher, schlanker Gestalt, die, scheinbar durchaus unbefangen, im Gespräch mit ein paar Offizieren am Fenster stand, und wiederholte, noch halb ungläubig: »Sie?«
»Ja.«
Und nun erst fand sie die Frage, die jedem heute zunächstlag: »Ja – wie kommt die denn hierher?«
Er zuckte die Achseln.
»Pech der Gastgeber! Da ist nichts zu machen!«
Otti Gisbert wandte zögernd den Kopf von der anderen weg. Sie hatte sich an ihr satt gesehen, förmlich ihr Bild in sich hineingetrunken. Sie war ganz blaß geworden und atmete unregelmäßig, mit einem sonderbar starren Ausdruck auf den Zügen. Und ihr Mann merkte: Etwas von der sinnlosen, nachträglichen Eifersucht, die er bei der Begegnung mit dem dicken, behaglichen Herrn von Ulerici empfunden, das lebte in seiner sonst so oberflächlich heiteren und gutherzigen jungen Frau auch beim Anblick der ersten, und sie sagte mit gepreßter Stimme: »Komm!«
»Wohin?«
»Ja, fort! Natürlich!«
»Wir werden nicht fortgehen, sondern bleiben – so lange, als das höflich und notwendig ist!«
Er sprach das sehr entschieden. Sie schaute ihn fassungslos an.
»Bleiben? Hier im selben Zimmer? ... Georgche. – bist du denn bei Trost!... Das muß dir selber doch am schrecklichsten sein!«
»Natürlich ist mir's gräßlich! ... Das muß eben ausgehalten werden!«
»Ach was! ... Ich geh!«
Sie sah wirklich aus, als ob sie ihre Drohung wahrmachen wollte. Er stand vor ihr und sagte zwischen den Zähnen, mit jenem unangenehm ruhigen Ton, vor dem sie immer am meisten Angst hatte: »Du wirst nicht tun, was du willst! Du bist nicht mehr in Worms. Du bist preußische Offiziersdame und hast dich so zu verhalten, wie das bei uns Brauch ist. Und das erste bei uns heißt: Nie einen Skandal! ... Also sei so gut und setze dich ruhig zu den anderen Damen ...«
»... wo sie dabei ist!«
»Sie wird dich schon nicht beißen!« sagte er in seinem Zorn und hätte beinahe hinzugefügt: ›Lerne lieber von ihr Haltung – in solch einer Situation!‹ ... Aber er begnügte sich, ihr noch einmal ermutigend zuzunicken: »Otti, sei vernünftig! In einer halben Stunde ist's ja vorüber ...«
Er ging hinüber in das Rauchzimmer zu den anderen Herren. Dort saß der Major von Ulerici auf dem Kanapee. Aus der Nähe sah er jünger aus, als ihn sonst seine grauen Haare erscheinen ließen. Er mochte doch wohl kaum fünfzig zählen. Zu seinen frischen, roten Gesichtsfarben paßte der Zwicker auf der Nase kaum, durch den die kleinen, ganz hellblauen Augen so wohlwollend schauten. Er trug als einziger der Herren vom Zivil eine blendend weiße Weste über dem stattlich gewölbten Leib. Ein feiner Hauch von Kölnischwasser, Zigaretten, Stall – man wußte selbst nicht recht, was, ging von ihm aus. In seiner ganzen Art war doch etwas sehr Vornehmes.
»Nee, wissen Sie, die Jagden um Berlin herum ...« sagte er zu dem neben ihm sitzenden Abgeordneten von Allmerode – »Früher haben sie hier die Föhren geschlagen, um Kartoffeln zu pflanzen. Jetzt forsten sie wieder auf wegen der Jagdpacht ... so 'n Berliner läßt sich's ja heutzutage den Deubel kosten, wenn er mit seiner Schrotspritze ...«
Er unterbrach sich. Er hatte den Hauptmann Gisbert gesehen. Schwerfällig stand er auf und verbeugte sich: »von Ulerici.«
»Gisbert.«
Einen Augenblick war allseitiges Schweigen. Die Havannawolken brauten durch das stille Zimmer. Dann brach Herr von Allmerode die kurze Pause der Beklommenheit, indem er ziemlich unvermittelt meinte: »Überhaupt ... in Mecklenburg zum Beispiel – da hat es noch einen Rehstand, unglaublich,« und so floß das Jagdgespräch weiter, als wäre nichts geschehen. Georg Gisbert setzte sich etwas abseits. Nach kurzem erschien auch sein Bruder, der Spandauer Artilleriehauptmann, von drüben, nahm neben ihm Platz und sagte gedämpft: »Das kommt nun von diesen verfluchten Berliner Abfütterungen! Da trommeln die guten Muthardts blindlings alles zusammen, was Beine hat, und wundern sich dann, wenn ... Die Weiber sitzen drüben beisammen, wie die Hühner, wenn's donnert! Die einzige, die wirklich über der Situation steht, ist deine Gewesene! Die spricht mit ein paar alten Damen ganz unbefangen über Bayreuth oder solchen Zauber und zuckt nicht mit der Wimper.«
Sein Bruder nickte seltsam lächelnd vor sich hin. Die Türe zum Salon stand offen. Man hörte von da die hellen Damenstimmen, man sah die bunten Kleider. Nur Vera konnte er nicht erblicken. Dafür hatte er den Major von Ulerici dicht neben sich. Und er schaute im Zimmer umher und dachte sich: Die Muthardts sind reich. Solche Bronzen und Perserteppiche und Ölgemälde hab' ich daheim in der Meinekestraße auch. Ich bin auch wohlhabend. Ich hab' mich verkauft. Und du da drüben tust es jetzt auch! ... Es ist nicht ewig Sonntag in der Welt! ... Man kann nicht immer die Schwingen breiten und stiegen. Irgendwo da unten wartet schon ein Ulerici oder die Firma Dörsam und Fröhlich ...
Der junge Hausherr war erschienen. Er hatte jetzt auch einen roten Kopf. Die ganze Zeit hatte er gedämpft mit dem Freiherrn von Ulerici gesprochen, der begütigend nickte, ein wenig paschahaft, schien es Georg Gisbert, so wie einer, der seiner Sache ja schließlich doch ganz sicher ist – dann trat der Leutnant von Muthardt unauffällig zu dem andern und murmelte betreten: »Lieber verehrter Herr Hauptmann ... ich bitte Sie, seien Sie mir nicht böse! Es wird mir für die Zukunft eine Lehre sein. Und meiner Frau auch. Vorläufig schluckt sie im Hintergrund Antipyrin vor Aufregung. Morgen blüht uns die schönste Migräne! Kenne ich schon! ... Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll! Es ist mir so gräßlich, daß wir uns da so elend vergaloppiert haben ...«
Georg Gisbert war aufgestanden.
»Was ist denn daran, lieber Herr von Muthardt!« sagte er. »Man lebt doch in der Welt! Wir können es nicht vermeiden, meine frühere Frau und ich, daß wir uns einmal durch Zufall irgendwo treffen. Daran muß man sich gewöhnen. Erlauben Sie uns jetzt nur, daß wir uns auf Französisch drücken! Sie begreifen, daß ich mich nicht gerne noch einmal unnötig drüben zeige! Wenn Sie vielleicht meine bessere Hälfte benachrichtigen wollten ...«
»Jawohl! Jawohl!« Der Leutnant eilte davon. Eine Minute später trafen sich die beiden Gatten auf dem Flur. Einen Augenblick hatte der Hauptmann Gisbert noch, als die Türe zum Salon aufging, drinnen Veras blondes Haupt gesehen, dann half er seiner Frau in ihre Sachen und stieg mit ihr die Treppe hinunter bis auf die Straße.
Kalte Vorfrühlingsluft umfing sie draußen. Vor ihnen lag schwer und schwarz der breite Spiegel der Spree. Es herrschte tiefe Stille in dieser Gegend Berlins. Nur die Züge der Stadtbahn dröhnten in der Ferne. Georg Gisbert und seine Frau gingen mechanisch auf die zu, in der Richtung nach dem Lehrter Bahnhof. So kamen sie am schnellsten nach Hause. Sie schwiegen beide, in einer nachträglichen Verblüffung. Wie er jetzt über das nachdachte, was er in den letzten Stunden erlebt, kam es ihm ganz unwahrscheinlich vor, gleich einem Traum. Er fühlte, er war Otti etwas schuldig – keine Erklärung – sie wußte ja alles – nein – einen Blick nur, einen Händedruck – etwas, das von Herz zu Herzen ging. Er sah ja, wie erregt sie war, beinahe noch erregter als er, der sich mehr beherrschte. Und mitten auf der Brücke, an einer Stelle, wo kein Mensch weit und breit zu sehen war, blieb sie plötzlich stehen und brach in heiße Tranen aus.
Er wußte nicht recht, was das eigentlich war. Er legte den Arm um sie – er wollte sie beruhigen – aber sie schluchzte nur immer herzbrechender, und endlich stieß sie leidenschaftlich, mit nassen Augen, hervor und zerbiß dabei ihr Taschentuch zwischen den Zähnen: »So – jetzt is sie glücklich da!«
»Aber ... Otti ...«
Sie schüttelte den Kopf und stampfte mit dem Fuß auf den Boden: »Ich hab's ja komme sehe! ...Auf einmal is sie wieder da!«
»Für die paar Stunden, Otti, und nie wieder...«
Sie fuhr auf. Ihr Kindergesicht war unter dem schneeweißen Kopftuch ganz blaß geworden.
»Nie wieder? ... ach, liebes Georgche...: sie war ja immer da!«
»Was?«
»Sie war nie ganz weg! ... Meinst denn, ich wäre so dumm und hätt' das nicht gemerkt? Ich bin dir gut genug fürs Haus und für die Kinder ... Aber an wen du dabei immer gedacht hast, das weiß ich! ... Jesus Maria – wodurch verdien' ich das nur?«
Wie stets, wenn sie in Aufregung geriet, verfiel Frau Otti immer mehr in ihr heimatliches Wormser Deutsch. Sie weinte wieder laut und preßte ihr Tuch an die Augen. Ihr Mann sah sie ganz erschrocken an. Was hatte sie da gesagt? herausgeplappert eigentlich nur? Er biß die Lippen zusammen und frug: »Sag, Otti – hab' ich dir je Grund für diese Behauptungen gegeben?«
»Nix! Nix!« Sie schüttelte den Kopf und schaute an ihm vorbei hinunter in das Dunkel der Spree.
»Nun also!«
»Aber sie is doch da! ... Ich hab' sie doch immer gefühlt, in meinem eigenen Haus! Das ist's ja, was mir all die Jahre fast das Herz abgedrückt hat!«
»Herrgott ... du bist doch meine Frau! ... Ich und jene – wir sind doch geschieden ... auf meinen eigenen Antrag ... sie hat mich doch verlassen und ihr Kind dazu, – und wollte doch um keinen Preis zu mir zurück! Wir konnten doch nicht miteinander auskommen! Glaubst du denn, ich hätte davon nicht genug, bis in alle Ewigkeit?... Ich bin doch beinahe zugrunde gegangen bei der Geschichte. Erst mit dir und unseren Kindern bin ich doch wieder ein Mensch wie andere geworden! Das weißt du doch! Das weiß jeder, der mich kennt. Also was soll denn das alles, um Gottes willen?«
Ein wenig hatten seine Worte sie beruhigt. An Stelle der Aufregung trat bei ihr jetzt Traurigkeit, und so sagte sie, während beide langsam weitergingen: »Georgche, ich hab' dich arg lieb! Aber du hast mich nicht so lieb. Ach, red nit! Ich weiß, was ich dir bin und was dir die andere war! Die hast du geliebt. Mich hast du ganz gern und hast mich genommen, weil dir das gerad' so in den Kram gepaßt hat und weil ...« wieder kamen die Tränen. »Ich kann doch nix dafür, daß ich ein vermögend Mädche war! ... Jetzt guckt ihr mich über die Achsel an, weil mein Vater Wein verkauft! Das is jetzt der Dank dafür, daß ich dir die Händ' unter die Füß' legen möcht', um dir das Leben leicht zu mache ...«
»Ja was ist denn eigentlich geschehen? Was hab' ich denn verbrochen?«
Auf diese Frage fand Frau Otti nicht gleich eine Antwort. Sie war etwas verdutzt, und er fügte hinzu: »Ich kann doch nichts für den Fauxpas der Muthardts! Es war eine einmalige Begegnung!«
»Du kannst an jeder Straßenecke wieder auf sie stoßen!« sagte seine Frau erbittert. »Sie wohnt gar nit so arg weit von uns, in einem Pensionat am Lützowplatz. Das hat mir meine liebe Schwägerin, die Klothilde, gesteckt. Der haben's die anderen Damen erzählt. Sie ist extra im vorigen Herbst vom Gut von ihrem Vater herein nach Berlin gezogen, um sich wieder zu verheiraten, weil ihr die Mutter im vorigen Jahr gestorben ist und es ihr zu öde geworden ist da draußen mit dem Alten. Da hat sie dann im Winter ihren dicken Baron eingefangen!... Herrgott, ja ... hätten wir nur heute abgesagt ... bei den Muthardts!«
Sie waren am Bahnhof. Auf der Fahrt sprachen sie nicht viel miteinander, der Leute wegen. Erst als sie am Zoologischen Garten wieder ausgestiegen waren und den Kurfürstendamm entlang ihrer Wohnung zuschritten, begann Georg Gisbert in einem weichen Ton: »Sieh mal, Otti: du mußt das alles vernünftiger auffassen und mit der Wirklichkeit der Dinge rechnen! Wir hoffen doch noch ein langes Leben miteinander zu führen, Otti, wir wollen unsere Kinder gut erziehen, wir wollen es selbst zu etwas bringen und ein friedliches Alter haben – dazu müssen wir Hand in Hand gehen und tapfer sein, mein armes Kerlchen, und uns einer in den andern schicken, weil wir uns lieb haben, nicht wahr?«
Die kleine Frau erwiderte nichts. Sie hatte wieder still zu weinen angefangen. Aber sie strebte nicht mehr von ihm fort. Sie schmiegte sich an ihn. Er fühlte an dem Arm, an dem er sie führte, den bangen, schutzsuchenden Druck des ihren.
»Sag mir nur das eine!« versetzte sie gepreßt, als sie vor ihrem Hause standen.
»Ja.«
»Hab' ich mich wirklich getäuscht? Ist das, was du je gegen ... gegen die andere empfunden hast, ganz in dir ausgelöscht – so, als wenn es nie gewesen wäre?«
»Vergessen kann man das nicht, Otti! Wo Wunden waren, da bleiben Narben zurück!«
»Sind das nur noch Narben?«
»Ich werde dir die Antwort oben geben!« sagte er. Dort öffnete er stumm die Türe links zum Kinderzimmer. Der Raum war matt durch ein Nachtlämpchen erhellt. Friedlich schlafend lagen die beiden Kleinen in ihrem Bettchen. Und nun versetzte er einfach: »Du bist meine Frau! Du bist die Mutter meiner Kinder! Euch gehöre ich! Und jeder Gedanke, der sich anderswohin verirrt, wäre ein Verrat und gehört ausgetilgt! Das schwöre ich dir!«
Er zog sie an sich. Sie küßten sich schweigend und lange. Dann setzte sie sich tief aufatmend wie ein Mensch, der von einer schweren Last erlöst ist, an dem Bettchen nieder. Und so murmelte sie, noch mit Tränen in den Augen und mit einem letzten Aufflackern von innerem Widerstand: »Ja – die Mutter deiner Kinder ... aber du hast noch ein Kind!«
Er beugte sich von hinten über ihren Stuhl. »Otti,« sagte er, » das Kind, das nimmt dir nichts! ... weil es für mich gar nicht dort hinüber zu der andern gehört, sondern mir, mir ganz allein. Es wird ja auch bei meiner Mutter erzogen. Sie hat keinen Anteil daran! Sie sieht es nur ein paarmal im Jahr. Du kannst mir das ruhig lassen, Otti – das einzige, was ich aus dem Schiffbruch meines ersten Lebens gerettet hab'!«
Sie weinte wieder leise. Aber sie faßte nach seiner Hand und hielt sie krampfhaft fest. Ein schwaches glückliches Lächeln überlief ihr blasses Gesichtchen. So saßen sie eng aneinander gedrückt und stumm in dem dämmerigen Zimmer und hörten andächtig auf die leisen Atemzüge aus dem Bettchen vor ihnen.
II.
Am nächsten Morgen war ein Sonntag. Der Hauptmann Georg Gisbert stand in seiner Hausjoppe, die Frühstückszigarre noch in der Hand, am Fenster seines Arbeitszimmers und schaute hinunter auf die tote Straße. Nebenan saß seine Frau im Morgenrock und nähte etwas. Die Märzsonne schien hell in die hohen, reich ausgestatteten Räume der Berliner Mietswohnung. Aus der Ferne scholl dumpf und dröhnend ein tiefer Klang, und Frau Otti sagte, ihre Arbeit sinken lassend: »Das muß eine große Hochzeit sein in der Kaiser-Wilhelmkirche, daß sie die Extraglocke läute lasse! Die ist doch so arg teuer.«
Er nickte. Sie stichelte an ihrem Saum weiter. Beide schwiegen. Aber sie fühlten sich dabei ganz einig. Sie sprachen wie durch ein gegenseitiges Einverständnis nicht mehr von gestern abend. So sank der ganze unheimliche Zwischenfall am raschesten in sein Nichts zurück. Und seltsam – wenn Georg Gisbert jetzt daran zurückdachte, so stand ihm immer wieder weniger seine frühere Frau vor Augen, als ihrer beider Kind, die kleine Karla, die bei seiner Mutter in Schlesien in Pflege war.
Sie war dort gut aufgehoben – gerade ein so kränkliches und schwächliches Dingchen wie sie – es war kein Grund, sich plötzlich um sie zu sorgen. Trotzdem erwog er auf einmal den Gedanken, bei Gelegenheit hinüber zu fahren und nach ihr zu sehen. Er sagte sich selbst, daß es gar nicht nötig sei. Er hatte dort weiter nichts zu suchen. Aber die sonderbare dumpfe Vorstellung, daß er doch hin müsse, blieb bestehen und verließ ihn den ganzen Vormittag nicht, während er an seinem Schreibtisch die dienstlichen Rückstände der Woche aufarbeitete. Es blieb ihm für nichts anderes Zeit, als für den Dienst und allenfalls einmal hinaus auf die Jagd oder im Sattel in den Grunewald und des Abends in eine Gesellschaft. Die ruhigen Stunden der Einkehr fehlten. Dort an der Wand hing die Geige. Es war sonst seine Lieblingsbeschäftigung gewesen, sie am Sonntag vormittag zur Hand zu nehmen und zu phantasieren, selbst zu komponieren, wenn ihm im Träumen der Töne eine kleine eigene Melodie aufzusteigen schien. Und neben der Geige schimmerten Aquarelle und Kreidezeichnungen von seiner eigenen Hand – Skizzen – von draußen, aus der weiten Welt, die Reissümpfe Chinas in blutrotem Sonnenuntergang, sonderbare Glockentürme und Pagoden, die Reede von Dar-es-Salam, die Steppen des Kilimandscharo – es war in diesem Zimmer alles vermieden, was direkt an den Offizier erinnerte. Und wer aus dem Bücherschrank des Hauptmanns Gisbert wahllos ein paar Bände herausgegriffen hätte, der hätte allerhand gefunden, was im geistigen Haushalt eines Militärs nicht nötig, kaum nützlich war. Aber seine Pflicht vernachlässigte der, der diese Räume bewohnte, deswegen trotzdem nicht. Gegen gefährliche Erinnerungen aller Art – und eine darunter, die gestrige, war die gefährlichste – gab es nur ein Mittel: Arbeiten! Arbeiten! Arbeiten! und er setzte sich, schob sich seine Papiere zurecht und rief laut und aufgeräumt: »Otti!«
»Ja, Georgche!«
»Tür zu! ... Ruhe! ... Kinder nach hinten! ... Wenn Besuch kommt, 'raus! ... Oder wenigstens 'rüber in die gute Stube, daß man das Gekolke hier nicht hört. Ich hab' bis zum Mittagessen zu schuften!«
Der Bursche mußte ein paarmal klopfen und melden, daß angerichtet sei, bis Georg Gisbert nach vierstündiger Arbeit mit heißem Kopf vom Schreibtisch aufstand und in das Eßzimmer hinüberging, wo alles schon versammelt war. Sonntags gab es immer Gäste. Wer von ledigen Mitgliedern der Familie Gisbert gerade in Berlin stand, oder dorthin kommandiert war, war ein für allemal geladen. So war da Georgs jüngster Bruder Albert vom 300. Infanterieregiment in Westfalen, der, wie er selber vor zehn Jahren, die Kriegsakademie besuchte – ein junger, stiller und kluger, ihm ähnlicher Mensch, nur noch brünetter und schmächtig, wohl einen Kopf kleiner, dann ein Pionierfähnrich von der Potsdamer Kriegsschule, ein Sohn von Georgs einziger Schwester Franziska, die einen Amtsrichter in Magdeburg, einen der wenigen Zivilisten in der Familie, geheiratet hatte. Georgs ältester Bruder war als Major gestorben. Dessen beide Jungen hatte man unter die Kadetten in das Vorkorps in Potsdam gesteckt. Von da waren die zwei bunten Knirpse, die »Freßbüble«, wie Frau Otti sie nannte, herübergefahren und hieben ein wie die Wölfe, und um sie ging das Gespräch der Erwachsenen seinen Gang – daß Leopold und seine Frau hätten nach Berlin kommen wollen, aber es mache sich nicht mit dem Urlaub, er führe für den erkrankten Major das Bataillon –, und Karl sei Regimentsadjutant geworden – es sei dem armen Kerl wahrhaftig zu gönnen, – und welch ein Glück, daß Ludwigs sich mit dem neuen Oberst und seiner Frau so nett einlebten, und Eduard hoffe doch nun einmal von Posen wegzukommen – Henriette träume schon von der Garde oder mindestens so was zwischen Neunundachtzigern und Fünfundneunzigern – natürlich – die! – Aber das Militärkabinett werde da wohl noch reichlich Wasser in den Wein gießen ... Es waren die stehenden, alten Themata, in denen nur die Namen sich änderten. Die Dinge blieben dieselben: Versetzung, Beförderung, Abschied in ewigem Kreislauf.
Nach Tisch erschien auch der dritte Bruder Gisberts, der rötlich-joviale, schlau zwinkernde Spandauer Artillerist, und seine lange, magere, ewig schweigsame und verschüchterte blonde Frau Klothilde. Die Neugier, zu sehen, was aus der gestrigen Überraschung geworden, trieb das Ehepaar her. Und Georg Gisbert, der bis dahin im Kreise der halben und ganzen Kinder am Tische sehr einsilbig gewesen war, wurde jetzt lebhafter und sagte, während er allein mit dem Bruder Richard im Rauchzimmer saß: »Weißt du, es ist doch merkwürdig, wie viel in einem selber vorgeht, ohne daß man sich recht darüber klar wird ...«
»Zum Beispiel ...?«
»Zum Beispiel: Heute den ganzen Morgen geht mir meine Karla im Kopf herum – nicht die Mutter, verstehst du – sondern sie, die Kleine! Ist das nicht eine sonderbare Nachwirkung des gestrigen Zusammentreffens?«
»Sie ist eben das einzige, was du von früher noch übrig hast!«
Der Hauptmann Gisbert sann nach: »Nun ja! Aber das weiß ich doch! Das ist mir nicht neu. Warum hab' ich nur jetzt auf einmal eine solche Sorge um das Mädel? Eine Unruhe, als ob ihr etwas passieren könnte? Es ändert sich doch auch eigentlich so manches dadurch, daß sie – meine frühere Frau, wieder heiratet! Am liebsten würde ich die Karla nun überhaupt zu mir nehmen. Es ist ja lächerlich: Vater und Mutter haben nun bald jedes ihren eigenen Hausstand, und die Kleine sitzt ferne unter Verwandten ...«
»So tu's doch!«
»Ich kann nicht!« Er warf einen Blick in das Nebenzimmer, wo seine Frau zwischen den Gästen saß. »Ich will dir mal was verraten, Richard! Otti ist auf das Kind eifersüchtig! Direkt eifersüchtig! Ich darf gar nicht viel von ihm reden, sonst verdunkelt sich der Horizont. Das macht es mir so schwer. Ich muß alles bei mir behalten, was ich in der Hinsicht hoffe ... oder auch manchmal fürchte! Die Kleine ist so zart. Sie braucht so gute Pflege!«
»Die hat sie doch bei Mama!«
»Mama ist bald siebzig. So ein kleines Ding will doch auch ein bißchen Leben um sich haben! ... Jetzt habe ich sie ja nahe ... Aber wenn ich mal versetzt werde und wieder durch halb Deutschland reisen muß, um meine eigene Tochter zu sehen ...«
Er brach ab. Sie wurden durch den Leutnant und den Fähnrich gestört, die zu ihnen hereintraten, und er kam den ganzen Nachmittag, bis alle gingen, nicht mehr darauf zurück.
Und ebenso stumm blieb er die ganze folgende Woche. Der Zwischenfall an dem Gesellschaftsabend neulich schlief ein. Er und Otti hüteten sich, ihn wieder zu erwecken. Sie sprachen kein Wort mehr darüber. Das Leben verlief wie immer. Nur zuweilen, wenn der Hauptmann Gisbert von seinem Arbeitstisch aus durch das Fenster hinaussah und sein Blick den hohen Himmel, die fern hinziehenden Wolken streifte, dann wunderte er sich, wie ihm die Frau, die ihm einst so nahe im Leben gestanden, nun wieder als Fremde räumlich nahe sei. Das war die einzige Vorsichtsmaßregel, die er ergriff: er mied den Umkreis des Lützowplatzes, wo er ihr möglicherweise begegnen konnte. Sein Weg führte ihn ja ohnedies auf der Stadtbahn bis in die Nähe der Kriegsakademie. Als ihn Otti einmal dort abholte, begegnete ihnen Unter den Linden der Major a. D. Freiherr von Ulerici. Der ehemalige Kürassier kam vom Pariser Platz, vom Hause der Kasinogesellschaft. Er trug einen hechtgrauen Zylinder und einen kurzen, kakifarbenen Sportpaletot – zwei andere Herren mit Monokeln begleiteten ihn. Er grüßte das Ehepaar nach kurzem Stutzen sehr höflich. Georg verspürte diesmal, während er die Hand an die Mütze legte, keine Regung von Eifersucht mehr. Der ältliche Herr kam ihm jetzt ein bißchen komisch vor. Er wußte selbst nicht, warum.
Am nächsten Sonnabend abend aber sagte er beiläufig zu seiner Frau: »Otti – ich rutsche morgen in aller Herrgottsfrühe mal nach Schlesien hinüber und schau', was Karla macht! Der Doktor ist doch immer mit ihr so bedenklich! Was meinst du?«
»Tu's nur!« versetzte Frau Otti, die frisch und rosig, das Jüngste auf dem Arm, vor ihm stand. Sie war immer sehr einsilbig, wenn die Rede auf die Stieftochter kam.
Er gab ihr einen Kuß und fuhr am Sonntag im ersten Dämmern ab. Beinahe zehn Jahre waren es, daß sein Vater als Generalleutnant und Divisionskommandeur, eben im Begriff, sein Pferd zu besteigen, vor seinem Haustor vom Schlag gerührt worden war. Seitdem hatte die Mutter in dem stillen schlesischen Städtchen ihren Wohnsitz genommen. Ihr Sohn schritt durch die holprigen Gassen, bog in den Markt ein und trat gleich dahinter in eines der niederen altmodischen Häuser. Exzellenz sei ausgegangen, meldete ihm das Mädchen. Aber die kleine Karla spiele in ihrem Zimmer.
Da ging er hinein zu seinem Kinde, küßte es, nahm es auf den Schoß und sah ihm in das zarte nervöse Gesichtchen. Es hatte die Augen der Mutter, das war kein Zweifel. Dies tiefe fragende Graublau. Von ihrer Schönheit besaß es sonst eigentlich nichts. Sein Antlitz war spitz und bleich. Es war ein rechtes Angst- und Sorgenkind. Aber es war doch sein. Er ließ sich von Karla erzählen, – daß sie nun auch schon die lateinischen großen Buchstaben schreiben könne und daß der große Hund vom Schlächter sie neulich habe beißen wollen und daß gestern Puppentaufe gewesen sei. Dabei hielt sie die schöne neue Puppe, die der Papa ihr mitgebracht, in Händen. Aber ihr Blick hing doch mit einem innigen Ernst an einem hart mitgenommenen, kaum noch zusammenhängenden Lederbalg am Boden. Das war die Trude, ihr leidenschaftlicher Liebling, von dem sie sich selbst im Schlaf nicht trennte. Und der Vater sah das und dachte sich: Sind wir denn anders? Mir hat das Schicksal viel gegeben. Ich habe andere, blühendere Kinder daheim. Aber an diesem armen, kranken Wesen hängt mein Herz ...
Und eine Ahnung, die ihm kam, erschreckte ihn. Dies Kind hier war das einzige Bindeglied zwischen ihm und seiner ehemaligen Frau. Sollte er deswegen hierhergefahren sein, deswegen sein Töchterchen an sich ziehen und halten, weil er damit auch etwas von ihr umfaßte? War das immer noch so stark – stärker noch seit der Begegnung neulich – stärker, als er selbst es wußte? Die Worte Ottis fielen ihm ein: »Sie war nie ganz weg!« Kam sie nun näher, immer näher wieder heran, aus den Nebeln der Jahre, schattenhaft, in ihrer siegenden blonden Schönheit – streckte sie wieder die Arme nach ihm aus? Er stand auf und stellte die Kleine auf die Füße und schüttelte heftig den Kopf: Ach was – das gab es nicht mehr! Dazu war man ein Mann und blieb es. Und damit war für ihn dieser seltsame Schrecken überwunden, von dem ihm noch nachträglich die Hände zitterten, und er richtete sich auf und ging hinüber zu seiner inzwischen zurückgekehrten Mutter.
Wie heimelig waren diese stillen Stübchen der alten Exzellenz! Jedesmal, wenn er, mit seinem stattlichen Wuchs fast bis an die Decke reichend, sie betrat, fühlte er es aufs neue: Hier war die Zeit still gestanden. Das war noch das Preußen der sechziger und siebziger Jahre, der Geist Wilhelms des Ersten. Die Photographien der vielen Generale und Stabsoffiziere an den Wänden trugen seine Barttracht. Die Nummern seiner alten Infanterieregimenter standen auf den Epauletten, die zwischen Helmen und Degen in den Ecken prangten, als Abzeichen der Truppenteile, deren Uniform der General Gisbert in seiner langen Dienstzeit getragen. Da ein durchschossener französischer Küraß vom Schlachtfeld von Wörth, ein Stahlstich: »Die 25. Infanteriedivision vor dem Bois de la Cusse am 18. August 1870«, hier lebte noch die Zeit der großen Kriege fort und spann sich weiter bis in die Gegenwart, von der die überall herumstehenden Photographien von Hauptleuten, Leutnants, Fähnrichen, Kadetten und jungen Offiziersfrauen zeugten. Drei Söhne und eine Tochter hatte die alte Exzellenz in die Welt hinausgegeben. Die hatten selber meistens schon wieder Kinder. Und was vom Mannesstamm war, das trug ausnahmslos den Rock des Königs. Seit den Freiheitskriegen, wo Georgs Großvater seinerzeit als freiwilliger Jäger schwer verwundet worden war, hatte die Familie, obwohl noch bürgerlich und erst in einer Seitenlinie geadelt, so gut auf allen preußischen Schlachtfeldern mitgefochten wie die Kleist oder die Arnim.
Die Generalin ging ihrem Sohn entgegen. Sie war klein und zitterig. Ihr runzliges Angesicht unter dem weißen Häubchen war streng. Sie liebte es nicht, Gemütsbewegungen zu zeigen, hatte es nie geliebt und bei ihren Kindern, die sie spartanisch erzogen, nie geduldet. Aber er sah doch den Schimmer der Liebe in ihren alten Augen und war dankbar dafür, gerade jetzt, wo etwas in ihm aufschrie: Nur vor einer Liebe bewahre mich ... vor der verbotenen ... vor der unheilvollen ... vor der Liebe zu meiner ersten Frau ...
Seine Augen waren feucht. Die alte Dame sah das, während er ihr Hand und Wange küßte, mit Verwunderung. Das war sonst nicht seine Art, und er sagte rauh: »Es nimmt mich immer so mit, wenn ich die Karla sehe, den armen, schwächlichen, kleinen Spatz! ... Es ist, als ob sie nicht leben und nicht sterben könnte! Natürlich – wenn ein Kind keine Mutter hat ...«
Und plötzlich war er froh, eine Gelegenheit gefunden zu haben, in Haß und Bitterkeit von seiner früheren Frau sprechen zu dürfen. Er redete sich förmlich gewaltsam in seine Rachsucht hinein.
»Siehst du, Mama!« sagte er. »Das ist doch der Prüfstein für einen Menschen und vor allem für eine Frau! Daß sie mich verlassen hat – nun gut! Aber daß sie auch imstande war, ihr Kind zu verlassen, sich gar nicht mehr darum zu kümmern, das gibt mir nachträglich so recht ... Ich glaube, wenn sie sich zweimal im Jahr dazu aufrafft, es zu besuchen, ist es viel!«
Er lachte bitter. Die alte Exzellenz schüttelte den Kopf.
»Früher ja!« sagte sie. »Wie du da draußen in China und Ostafrika warst und sie auch nie kam, da hab' ich mir oft gedacht: Der arme Wurm ist schlimmer dran als eine Waise. Hat Vater und Mutter und doch keine. Aber in letzter Zeit ist Vera doch immer öfter gekommen. Diesen Winter, von Berlin aus, war sie alle Augenblicke da! Ich wollte dir bloß nicht davon anfangen, weil du doch sonst selber nie von deiner früheren Frau sprichst ...!«
Er blickte finster auf.
»Das hättest du mir aber sagen müssen, Mama! Das hättest du nicht dulden dürfen!«
»Nein, mein Sohn! Ich liebe diese Frau weiß Gott nicht! Diese Gesinnung ist dir bekannt. Aber ich habe selbst vier Kinder und zwei begraben. Ich kann einer Mutter den Zutritt zu ihrem einzigen nicht verwehren! Das bringe ich nicht fertig!«
»Aber wodurch kommt denn diese Änderung bei ihr?«
»Sie hat dich zu sehr geliebt,« sagte die alte Exzellenz. »Und nachher hat sie dich zu sehr gehaßt. Und alles, was von dir kam und mit dir zusammenhing. Sie wollte nichts mehr davon sehen und hören – selbst von ihrem eigenen Fleisch und Blut nicht!«
»Und woher weißt du, daß das der Grund ist, Mama?«
»Sie hat es mir selbst einmal gesagt, hier im Zimmer, bald nachdem du über See warst ...«
Es war ein kurzes Schweigen. Dann fuhr die alte Exzellenz fort: »Allmählich hat sie nun wohl mehr Ruhe gefunden, in den letzten Jahren, und damit auch das Gleichgewicht gegenüber ihrem Kind. Deswegen hat sie es nun immer häufiger besucht ...«
»Das heißt, sie hat die Kraft, mich zu hassen, verloren!« sagte Georg Gisbert mit einem bitteren Lächeln.
»Ich hoffe es, daß sie endlich mit dir fertig ist, wie du längst mit ihr ... Das war doch kein Leben für sie, wie sie sich seit sechs Jahren auf dem Land bei ihren Eltern vergraben und vergrämt hat.«
»Sie ist ja nun verlobt!«
»Ist sie's? Sie hat mir schon vor vier Wochen, als sie das letzte Mal hier war, so etwas angedeutet. Gut, daß es so gekommen ist: Jetzt könnt ihr wirklich alle beide sagen: ›Gott sei Dank, es ist überwunden‹ ...«
Er sah zur Seite. Ja, wenn alles so wäre! Wenn alles in der Welt nach der Meinung der Mütter ginge! Da wäre viel Güte und Stille hienieden. Da brauste kein Sturm mehr über Feld. Nur linde Lüfte wehten. Kein Mann härtete mehr sein Herz und sich selber in der Not.
Dann wieder schämte er sich. Da ihm gegenüber saß die Liebe, die einzige, ganz selbstlose Liebe, die ihm gehörte – denn Otti und die Kinder, die hingen an ihm – das war etwas anderes, viel Last und Begehr – und er legte die Hände ineinander und hörte geduldig, wie die alte Exzellenz weiter sprach: »Schau, ich hab' oft darüber nachgedacht: Du stammst nicht aus einer Familie, wo man sich viel aus dem Gelde gemacht hat. Weder dein Vater noch ich! Ich hab' mein Leben lang kein warmes Abendbrot in meinem Hause geduldet und so auch euch Jungens erzogen – aber du bist nun einmal anders! Ich glaube, wenn du und Vera eine Viertelmillion gehabt hättet, ihr wäret jetzt noch beisammen!«
Er zuckte die Achseln und schwieg. Die greise kleine Dame nahm ihre Häkelei vor, nickte wie im Selbstgespräch und fuhr fort: »In einem hab' ich ihr unrecht getan! Ich hab' geglaubt, ich würde sie schon im nächsten Jahr am Arm von irgend einem anderen sehen. Aber sie hat doch eurem Unglück beinahe die biblischen sieben Jahre Treue gehalten. Das ist das einzige, was mir an ihr gefällt! Dadurch erklärt sich nachträglich so manches an ihr. Sie war eben zu verstiegen in ihren Ideen. So furchtbar stürmisch. Sie erwartete sich Gott weiß was alles vom Leben. Und nun als Leutnantsfrau in einer kleinen Garnison – du nichts – sie wenig, ja, und ein Wunder wollte sie doch vom Schicksal haben! Also mußtest du das Wunder sein! ... Und daß du nur ein Mensch warst und kein Gott, das konnte sie dir nun mal nicht verzeihen!«
Die Generalin seufzte.
»Ich hab's neulich erst der alten tauben Adelung ins Ohr geschrien, wie die mich frug, warum denn eure Ehe geschieden worden wäre: ›Aus Mißverständnissen, meine Liebste! Kein Schatten von einem Dritten! Nur tausend Mißverständnisse hintereinander.‹ – Bei dir erst recht! Du hast damals noch ganz anders verträumte Augen gehabt als jetzt. Weiß der liebe Gott, was du in der Vera gesehen hast, statt einem Frauenzimmer von Fleisch und Blut! Ein Engel vom Himmel – das war ja noch nichts dagegen ... Ja – ihr guten Kinder ... das sind harte Lehren! Jetzt habt ihr ja auch seitdem beide eure Ansprüche an eure Mitmenschen recht herabgeschraubt. Und würdet euch gegenseitig viel, viel nachsichtiger beurteilen, wenn ihr euch jetzt erst kennen lerntet ...«
Die alte Exzellenz verstummte und handhabte emsig ihre Häkelnadeln. Der Sohn neben ihr seufzte. Die gute Mutter – die hatte es leicht, von unglücklichen Ehen zu reden, wo sie selber eine so beispiellos glückliche geführt hatte. Georg sah seinen Vater vor sich, den stattlichen, schlank gewachsenen Mann, wie er bis zu seinen letzten Tagen voll von ritterlicher Ehrerbietung und heiterer Zärtlichkeit gegenüber seiner getreuen Lebensgefährtin gewesen. Von ihm hatten die Söhne Respekt vor den Frauen gelernt. Sie hatten angefangen zu ahnen, daß etwas von Ehrfurcht in der Liebe sein müsse ... Georg vor allem, der damals, ein junger Offizier in eintönigem Dienst, überall in unbestimmter Weise eine Verklärung seines Alltags suchte ...
Ja – die Mutterweisheit an seiner Seite hatte schon recht! ... ›Es waren zwei Königskinder ...‹ das alte Lied klang trüb – zwei Menschenkinder, die da glaubten, daß sie heimlich Kronen trügen – und eben das, daß das Wasser nicht zu tief war, daß sie zusammenkommen durften und der Zauber verblaßte, das war ihr Unglück gewesen. Und urplötzlich stand vor seinen Augen wieder die Stunde, da er Vera von Vogt zum ersten Male gesehen, ein heißer Manövertag im Herbst drüben in der Altmark, in der Bismarckschen Gegend an der Elbe, Erinnerungen an den Gewaltigen überall, Schönhausen in nächster Nähe – da war er als Einquartierung des Mittags vor das Herrenhaus in Reetzow getreten und in den Kreis der Gäste geführt worden, die sich drüben im Park mit Pistolenschießen vergnügten, sie lachend mitten darunter, groß, schlank, blond, in ihrem weißen Kleide weithin leuchtend. Die Kavallerieleutnants waren um sie her. Aber am Abend, als sie und Georg Gisbert schon gut Freund miteinander geworden waren und am Elbufer auf und nieder wandelten, sagte sie: »Ich hab' die Dragoner gewarnt. Ich habe ihnen zweimal laut erklärt: ›wenn noch eine Stunde ausschließlich von Rebhühnern, Vorstehhunden und Fasanen geredet wird, stehe ich auf und gehe! –‹ Und hab's getan! Und da bin ich!«
Von da ab war es zwischen ihnen im Sturm gegangen. Der alte von Vogt auf Reetzow freilich hatte den Kopf geschüttelt. Der bürgerliche Linieninfanterist ohne Vermögen ... ach nee – lieber nicht! Aber immerhin – der Vater Divisionskommandeur – das wirkte doch mit, als die ordenübersäte Gestalt des preußischen Generals als Brautwerber ganz kurz vor seinem Tode auf dem Gutshof erschien, und der alte Krautjunker hatte schließlich ehrlich gesagt: »Wissen Sie, Exzellenz – das Mädel ist derart dickköpfig – geb' ich nicht nach, so behalte ich sie schließlich womöglich überhaupt auf dem Halse, so schön sie ist ... was tu ich dann? ... Also denn in Gottes Namen ...«
Vorbei ... vorbei ... verweht und verflogen, wie damals die mahnenden Herbstzeitfäden in der sonnengoldenen Flur. In dem Stübchen war es still geworden. Der Hauptmann Gisbert stand auf und nahm Mütze und Säbel und ging, um vor seiner Abreise noch einmal mit dem Doktor wegen seines kränklichen Töchterchens zu sprechen. Es schien ihm, er müsse es tun, damit seine Fahrt hierher irgend einen Sinn und Zweck habe. Das redete er sich ein, obwohl er ja wußte: er erfuhr von dem Hausarzt nichts Neues. Und der machte denn auch sein gewohntes, bedenkliches Gesicht – ein Achselzucken: – ja, die Symptome mit dem Herzen seien ja nicht ganz unverdächtig. Am besten wäre es, das Kind einmal drei oder vier Wochen lang in Berlin unter die Beobachtung eines tüchtigen Spezialisten zu stellen ... Der Doktor brach ab. Er sah den finsteren Ausdruck auf dem Gesicht des anderen. Einigermaßen kannte er ja auch die Verhältnisse und wußte: die kleine Stieftochter war dort kein willkommener Gast. »Ja, aber eine alleinige Verantwortung möchte ich auf die Dauer nicht übernehmen!« sagte er, Georg Gisbert hinausgeleitend, und der lachte zornig auf, als er wieder in das Zimmer der alten Exzellenz trat.
»Ist das nicht närrisch? Da hat die Karla nun zwei Mütter – sozusagen – und schwebt doch in Lebensgefahr, weil ihr eigener Vater sie in seinem Hause nicht aufnehmen darf ... möchte man da nicht mit der Faust dreinschlagen und sich sein Recht erzwingen?«
»Ja – willst du nicht doch einmal mit Otti darüber reden?«
Er wehrte nervös ab.
»Nein – nein – Mama! ... das kann ich nicht! Bitten kann ich nicht – um mein eigenes Kind! Das entwürdigt mich! ... Ich will um Gottes willen nichts in unsere Ehe tragen, was unser Verhältnis zueinander ändern könnte!«
»Wieso?« sagte die Greisin verwundert. »Ihr lebt doch so harmonisch zusammen!«
»Und ein ›Nein‹ Ottis bei solcher Gelegenheit bringt das Kartenhaus ins Schwanken! Nein – erschrick nicht ... ›Kartenhaus‹, das ist natürlich nur eine verrückte Übertreibung. Ich wollt' auch nur sagen: Die Ehe zwischen Otti und mir – das ist ein tadellos hergestelltes Gleichgewicht. Man darf das nur nicht auf einer Seite zu sehr belasten, sonst ... Mama ... ich hab' eine Todesangst, was sich dann ereignen könnte ...«
»Von Otti aus?«
»Nein. Von mir aus!«
»Ich versteh' dich nicht, Kind!«
»Ich mich auch nicht, Mama! Lassen wir's! Es muß nun schon alles so bleiben, wie es ist! ... Vielleicht sieht der Doktor auch nur Gespenster, und die Karla kriegt von selber wieder rote Backen!«