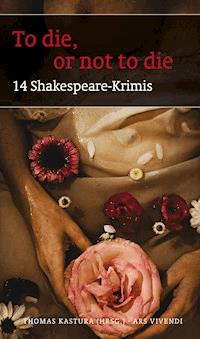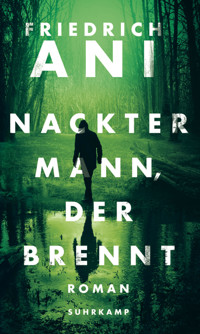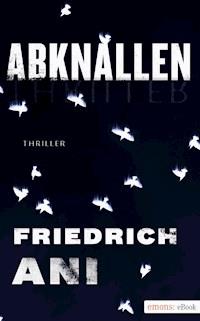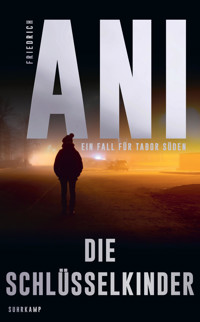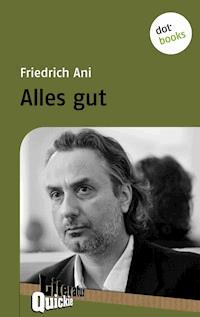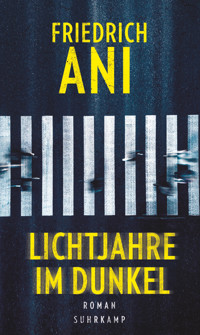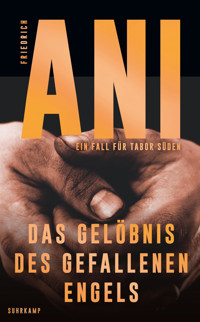6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Fall für Tabor Süden
- Sprache: Deutsch
Christoph Arano, vor über 30 Jahren als Kind aus Nigeria nach Deutschland gekommen und Mitinhaber einer kleinen Installationsfirma, kommt mit seiner Tochter Lucy nicht mehr klar: Seit dem Tod ihrer Mutter wird das Strafregister der Vierzehnjährigen ständig länger. Da entführt eine rechtsradikale Gruppe die deutsche Verlobte Aranos, Natalia Horn, um die sofortige Abschiebung von Vater und Tochter zu erzwingen. Die Diskussion um die erpresste Ausreise spaltet Polizei, Justiz und Öffentlichkeit in zwei Lager, ein Medienrummel ohnegleichen mobilisiert die Bevölkerung. Auf der Strecke bleiben Anstand, Vernunft und Menschenwürde, und Natalias Suche nach der absoluten Liebe nimmt ein jähes Ende. Was jeden Tag passiert oder passieren kann, zeigt Friedrich Ani in seinem spannenden Thriller - ein ungeschminktes Bild unserer Gegenwart, eine aufschlussreiche Darstellung der dubiosen Angst vor dem Fremden, eine hervorragend recherchierte, unter die Haut gehende Geschichte mit einprägsamen Charakteren und einem atmosphärischen Sog, dem man sich nicht entziehen kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 696
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Friedrich Ani
German Angst
Knaur e-books
Für Gerda Marko
Erster Teil
STADT AM POL
»Sie hat sich wärmen wollen!«, sagte man.
Hans Christian Andersen
Manchmal ging ich durch die Straßen und
empfand Mitleid mit den Menschen, denen
ich begegnete.
Es mag absurd klingen, aber sie taten mir Leid,
weil sie nur ein einziges Leben hatten.
Juan Carlos Onetti
1
26. Juli
Etwas an ihm beunruhigte sie, und je länger er blieb und redete, desto nervöser wurde sie. Sie kannte ihn nicht, sie sah ihn heute zum ersten Mal. Eine Kundin, die sie seit acht Jahren behandelte, hatte ihm ihre Telefonnummer gegeben. Das war nichts Ungewöhnliches, es freute sie, wenn die Frauen zufrieden nach Hause gingen und ihren Freundinnen begeistert davon erzählten, wie jung und entspannt sich ihre Haut jetzt wieder anfühlte. Manchmal rief eine von ihnen noch am selben Tag bei ihr an, um einen Termin zu vereinbaren. Ohne die Werbung ihrer Stammkundinnen hätte sie ihr Studio wahrscheinlich schon längst schließen oder zumindest Ines, ihre Angestellte, entlassen müssen, die Teilzeit bei ihr arbeitete und eine Spezialistin für Fußreflexzonenmassage war. Allerdings gab es einige Frauen, die sich von Ines nicht anfassen ließen, weil sie behindert war. Nach einem Motorradunfall hatten die Ärzte ihr Augenlicht nicht mehr retten können, ihr Gesicht musste mehrmals operiert werden und sah nach einer Hauttransplantation wie eine verzerrte Maske aus. Zudem blieb ihr linkes Bein verkrüppelt. Doch ihre Hände verheilten vollständig. Und Natalia Horn, ihre Chefin, stellte sie sofort wieder ein.
Von den Kundinnen, die sich vor Ines ekelten, hätte sich Natalia am liebsten getrennt, aber das konnte sie sich nicht leisten. Und das ärgerte sie. Und sie schaffte es, zwei dieser Frauen mit unangenehmen Ölen so lange zu quälen, bis sie von sich aus wegblieben.
»Das brennt etwas«, sagte der Mann, der vor ihr auf der Liege lag.
»Entspannen Sie sich!«
Er hatte darauf bestanden, sich unter das Vapazone-Gerät zu legen und den Dampf einzuatmen, dem sie Limonengrasöl beigemischt hatte. So wie er es verlangt hatte. Dann hatte sie ihn gefragt, ob sie sein Gesicht abtupfen und eingetrockneten Talg entfernen solle. Nein, hatte er gesagt, ohne die Augen zu öffnen. Sie sah ihn wieder an und etwas an ihm versetzte sie in Unruhe, etwas, das sie nicht benennen konnte.
Er hieß Josef Rossi und war Verkäufer in einem Möbelhaus. Das hatte er ihr erzählt, während er seine braunen Halbschuhe und seine weißen Socken auszog und sich mit einer Selbstverständlichkeit auf der weißen Liege ausstreckte, als käme er regelmäßig her. Sie schaltete die Lupenleuchte ein, um sein Hautbild besser zu erkennen, und er schloss die Augen und machte sie nicht mehr auf. Sie stellte ihm einige Fragen zu seiner Gesundheit, die er knapp beantwortete, und dann legte er los, ihr seinen Beruf zu erklären.
Er trug eine braune Stoffhose mit Bügelfalten und ein schwarzes Hemd, das er bis zum letzten Knopf zugeknöpft hatte. Am Telefon hatte er gesagt, er wolle sich pediküren und maniküren lassen, und mit denselben Worten hatte er sie an der Tür begrüßt.
Und vom ersten Augenblick an hatte Natalia in seiner Gegenwart ein unangenehmes Gefühl.
Seiner Freundlichkeit misstraute sie, ohne zu wissen, warum.
»Das ist alles sehr sauber hier«, sagte er und ließ den Blick kreisen. »Meine Bekannte schwärmt von Ihnen, wissen Sie das? Sie sagt, durch Sie sei sie wie neugeboren. Entschuldigen Sie bitte, ich finde das übertrieben, neugeboren! Das klingt mir zu religiös. Ich mag das nicht, ich will Ihnen nicht zu nahe treten …«
Das ist gut so, dachte sie, treten Sie mir nicht zu nahe …
»Aber die Leute suchen Ausflüchte für alles – soll ich mich hier hinlegen? Ich zieh meine Schuhe aus, ist Ihnen das recht?«
Sie kam nicht dazu zu antworten, er tat, was er gesagt hatte, und redete einfach weiter. Sie machte ihm ein Fußbad, schnitt und feilte seine Fuß- und Fingernägel, massierte seine Zehen, die verspannt und kalt waren, besprühte sie mit Kiefernspray und sah mehrmals auf die Uhr. Die Stunde, die sie vereinbart hatten, schien wie in Zeitlupe zu vergehen.
»Ich hör genau zu, wenn meine Kunden was sagen«, sagte er und sie bemerkte seine schmalen Lippen und die Verkrustungen unterhalb der Nase, Abschürfungen und Rötungen, als würde er sich ständig schnäuzen. »Die bringen ja ihre Lebensphilosophie mit, wenn sie Möbel bei mir kaufen. Die wollen Harmonie, Zufriedenheit, und das kriegen sie nicht nur durch einen Schrank, den sie sich hinstellen, oder durch ein Bett, sie müssen was dafür tun, verstehen Sie das, Frau Horn?«
Es passte ihr nicht, dass er sie bei ihrem Namen nannte. Was sollte er sonst tun? Langsam kam sie sich lächerlich vor. Was hatte sie gegen diesen Mann, der ihr von einer ihrer treuesten Kundinnen empfohlen worden war? Er war höflich, er war nicht aufdringlich wie einige der anderen Männer, die zu ihr kamen, er redete, das war alles. Jeder, der auf dieser Liege lag, redete. Das war ihr Job, das war eine ihrer Hauptfunktionen: zuhören, widerspruchslos zuhören. Manche Frauen fingen bei der ersten Berührung zu weinen an, andere schienen überhaupt nur zu kommen, um sich auszukotzen. Sie hatte kein anderes Wort dafür. Sie war Kosmetikerin, aber sie war genauso ein Gefäß für Müll und Trauer, für die ewigen Monologe der Einsamkeit und des Alters, für den verbalen Abfall, den die Ehefrauen, Mütter, Witwen oder Zwangs-Singles wochenlang ansammelten und den sie nirgends loswurden außer in der Gutenbergstraße in Nettys Studio. Netty, so wurde sie von allen genannt und das war sie auch: nett.
Manchmal war sie nahe daran, auch sich auszukotzen und laut zu schreien und das Gegenteil von nett zu sein. So wie jetzt. Wie gerne hätte sie das Dampfgerät abgeschaltet und die Behandlung beendet. Rabiat. Ohne Erklärungen. Sie hatte nämlich andere Sorgen als zuzuhören, wie ein Möbelverkäufer sich sein Berufsethos zusammenzimmerte.
Schon seit einer halben Stunde wollte sie telefonieren. Sie musste endlich Gewissheit haben und wenn sie die nicht bekäme, würde sie zur Polizei gehen, ganz gleich, ob ihr Freund damit einverstanden war oder nicht. Natürlich wäre er nicht damit einverstanden. Sie würde es trotzdem tun. Sie hatte Angst, zornvolle Angst.
»Der Dampf beruhigt«, sagte Rossi. »Damit Sie mich richtig verstehen, selbstverständlich bezahle ich alles, obwohl ich das Gerät nur mal ausprobieren wollte und Frau Ries mir sagte, Sie würden einen Sonderpreis machen bei der ersten Behandlung.«
»Natürlich bekommen Sie …«
»Nein, das will ich nicht. Ich will keinen Sonderpreis, ich bezahle den normalen Tarif. Sie geben sich Mühe und das muss belohnt werden. Frau Ries hat mir erzählt, dass Sie dieses Studio ganz alleine aufgebaut haben, das beeindruckt mich, das ist eine Leistung. Mir imponiert, wenn jemand handelt, verstehen Sie das, wenn jemand nicht dasitzt und jammert, sondern handelt. Das spricht von Selbstbewusstsein und Kraft. Sie sind eine kraftvolle Frau, Frau Horn …«
»Ich schalte das Gerät jetzt ab, sonst trocknet Ihre Haut zu sehr aus.«
Sie wollte ihn so schnell wie möglich loswerden. Keinen Ton wollte sie mehr von ihm hören. Sowie er weg war, würde sie Helga Ries anrufen und sie fragen, was sie sich dabei gedacht hat, ihr diesen Kerl aufzudrängen. Was wollte der von ihr?
Plötzlich hielt sie seinen Wunsch nach Pediküre und Maniküre für einen Vorwand. Wofür? Was war seine Absicht? Was bezweckte er wirklich? Sie konnte nicht einmal behaupten, er wolle sie aushorchen. Hauptsächlich redete er von sich wie die meisten ihrer Kunden. Was also war das Beunruhigende, das Unheimliche an ihm?
Jetzt schlug er die Augen auf. Sie hatte das Gerät abgeschaltet und der Raum roch nach dem ätherischen Öl und dem Spray. Im Garten hörte sie die Vögel zwitschern und sie sah sich selbst, wie sie dastand, gleichsam festgebunden, reglos, gequält von wachsendem unerklärlichem Entsetzen.
»Ist was?«, fragte Rossi. Auf seiner Stirn glänzte Schweiß, seine Gesichtshaut war gerötet. Er ist schmerzempfindlich, dachte Natalia, wenn man ihn zu fest berührt, schreit er, er schreit und schlägt um sich.
»Wir sind so weit«, sagte sie und diese Bemerkung kam ihr sofort unwirklich vor, auch falsch, sie wusste selbst nicht genau, was sie damit meinte.
»Was meinen Sie damit?«, fragte er und schnellte in die Höhe. Erschrocken wich sie einen Schritt zurück, trat aus Versehen auf den Metallfuß der Trennwand und zuckte erneut zusammen.
»Bitte?«, stieß sie hervor. Sie war rot geworden, das spürte sie, ihr Herz schlug heftig und sie schämte sich dafür und im nächsten Moment war sie wütend. »Die Stunde ist um, Sie müssen jetzt gehen!«
Er starrte sie weiterhin an und seine Augen waren grau und klein. Dann schwang er sich von der Liege und bückte sich nach seinen Schuhen.
»Eine hübsche Bluse haben Sie unter dem Kittel an«, sagte er und streifte sich die Socken und die Schuhe über. »Ich mag weiße Blusen, sie sind fraulich, sie machen eine Frau fraulich, verstehen Sie das?«
Er hob den Kopf und sie riss ein Kleenextuch aus dem Karton, rieb sich die Hände ab und warf es in den Abfalleimer. Als sie sich ihm zuwandte, fixierte er sie immer noch. Diesmal irritierte sie der Blick nur eine Sekunde, dann drehte sie sich wortlos um und ging zur Tür.
»Ich fühle mich gut«, sagte er, stapfte mit den Schuhen zweimal laut auf den gefliesten Boden, als trage er Stiefel, in die er nur schwer hineinkam, und holte seinen Geldbeutel aus der Tasche.
Vor der Haustür gab er ihr die Hand und sie nahm sie widerstrebend.
»Ich möchte Sie noch etwas fragen«, begann er und ließ sie nicht zu Wort kommen. »Sind Sie eigentlich verheiratet?«
Es war der 11. August, und sie brachten Finsternis und Furcht in ihr Haus. Sie brachten den Geruch von Aftershave, Shampoo und Bier. Sie brachten ein Springmesser mit, eine Gartenschere und eine grüne Handsäge. Sie schlugen auf sie ein und sie fingen sie auf. Sie waren zu fünft und wir sind das Volk. Wir handeln im Auftrag des Schweigens der Regierung und des Oberbürgermeisters. Sie schnitten ihr mit der Gartenschere die Haare in Büscheln vom Kopf. Sie schoben ihr den Messergriff zwischen die Zähne. Und wenn sie sich bewegt, schnellt die Klinge heraus und durchbohrt ihren Rachen, das ist gewiss, sagt der Mann, den Daumen am Druckknopf, und seine Finger riechen nach Tabak. Sie schnitten ihre Kopfhaut blutig und zerrissen ihr gelbes Sommerkleid aus Freude über den Paragrafen für Zucht und Ordnung. Wir kommen als Abgesandte der Ordnung, der Zucht und des Gemeinwohls zu dir. Wir kommen als Hüter der allgemeinen Sicherheit und des Wohlstands in der Stadt und im ganzen Land. Wir kommen als Bürger, die Steuern zahlen, unrechtmäßig arbeitslos sind und nicht länger zuschauen wollen.
Sie gehörten zu den mittleren Millionen, die der Bauch, das Herz, die Physiognomie und die Psyche des Staates waren. Sie waren nur fünf, ein Lehrer, ein Automechaniker, ein Maler, ein Maurer und ein Versicherungsangestellter, aber sie waren sich sicher, die Speerspitze zu sein, die unerschrockene Vorhut, die Stimme der allgemeinen Stimmung. Sie redeten kaum ein Wort, sie handelten. Sie benutzten ihre Fäuste, ein olivgrünes Super-Automatic-Rostfrei-Messer, eine schwarze schnipp-schnapp-scharf-geschliffene Zangenschere, aber nicht die kleine grüne Säge, mit der fuchtelten sie ihr nur vor der Nase herum, was sie nicht sehen konnte.
Sie musste sich übergeben, direkt zwischen die staubigen, rissigen Stiefel des jungen Mannes vor ihr. Er sprang zur Seite und ein anderer schlug ihr so fest auf den Hinterkopf, dass sie hinfiel, mit dem Gesicht voran in ihr Erbrochenes. Sie hoben sie hoch und einer holte aus der Küche ein Geschirrtuch und scheuerte ihr damit die Wangen wund. Und einer goss ihr einen Topf kaltes Wasser ins Gesicht und ein anderer trocknete sie ab.
Und während der ganzen Zeit sah sie nur Funken in der Finsternis, denn sie hatten ihr mit einem breiten Band die Augen verklebt.
Wie ihnen befohlen worden war, fesselten sie der Frau die Hände auf dem Rücken, verknoteten Schnüre an ihren Füßen, stopften ihr ein Taschentuch in den Mund und verklebten ihn mit demselben braunen Paketband wie ihre Augen. Und der Befehl war gut und die Frau war schön.
Sie hatten ihr Kleid zerschnitten, ohne Auftrag, aus purem Übermut, und der mit der Schere hätte beinah etwas gesagt, doch der Älteste der fünf stieß einen bösen Laut aus und der andere spuckte auf den Boden. Im Wind der schnellen Stiefel fegten blonde Haare über den taubengrauen Teppich und die Blutstropfen waren deutlich zu sehen, aber niemand sah hin.
Sie beendeten ihre Aktion und wunderten sich ein wenig, wie einfach alles gewesen war und warum die Frau nicht geschrien und sich gewehrt hatte.
Sie wunderten und bewunderten sich, da lag die Frau schon im Kofferraum des frisch gewaschenen roten Nissan Primera, zusammengekrümmt und halb betäubt von einer milchigen Flüssigkeit, die einer der Männer ihr eingeflößt hatte, bevor er ihr von unten gegen das Kinn schlug, so dass sie sich verschluckte und husten musste und dafür noch einmal einen Hieb auf den Mund bekam.
»Entschuldigen Sie«, sagte er und erwiderte ihr Lächeln mit einem Grinsen. »Mir ist gerade eingefallen, dass Frau Ries mir erzählt hat, Sie seien so gut wie verlobt. Stimmt doch? So gut wie verlobt. Ihr zukünftiger Mann war ja schon in der Zeitung. Sein Name fällt mir jetzt nicht ein. Natürlich. Und Sie waren schon einmal verlobt, nicht wahr? Vor einigen Jahren. Entschuldigen Sie, Frau Ries und ich, wir reden manchmal lange zusammen …«
Abrupt hörte er auf zu sprechen. Er grinste nicht mehr. Er stand da und ließ sie nicht aus den Augen. Und während er in die Tasche seines braunen Sakkos griff und Natalia einen Schlüssel klirren hörte, radelten auf der Straße zwei Mädchen vorbei und eines klingelte und die Klingel schnarrte und das Mädchen rief hallo in Richtung Haus. Bevor Natalia sie überhaupt bemerkte, waren die beiden verschwunden und sie blickte an Rossi vorbei hinüber zum Nachbarhaus, in dessen Garten sattgrüne Sträucher wuchsen und rote Rosen blühten.
In der Sekunde, in der ihr auffiel, dass sie sinnlos dastand anstatt längst im Haus zu sein und ihren Freund anzurufen, zögerte sie. Noch einmal diesen Mann anzusehen hätte sie als Beleidigung ihres Stolzes empfunden. Auch wenn sie sich immer noch nicht erklären konnte, weshalb ihr dieser braun gekleidete, nach nichts riechende, rotgeäderte Fremde, dessen Name ihr nicht mehr einfiel, Magenkrämpfe und einen Schwindel im Kopf verursachte, spürte sie, dass sie ihn schleunigst loswerden musste, bevor sein blankes Schweigen sie krank machte.
Sie fröstelte, obwohl die Sonne schien. Ihre Knie fingen an zu zittern, ihre Hände waren kalt und sie vergrub sie in den Kitteltaschen. Sie hob den Kopf und streckte den Rücken.
»Wiedersehen!«, sagte sie, streifte seinen Blick und drehte sich um. Jetzt brauchte sie nur noch die Tür zuzumachen und der Spuk war vorbei.
»Überlegen Sie sich das noch mal!«, sagte Rossi.
Ein weiteres Mal schaffte er es, sie zu irritieren. Die Hand auf der Klinke, blieb sie stehen.
»Was?«
»Sie sind eine ausgezeichnete Frau, Sie sind selbstständig, Sie haben eine Tochter, die zuverlässig und arbeitswillig ist …«
Meine Tochter? Woher kennt er meine Tochter? Was will er von …
»Es ist oft nicht leicht, solche Entscheidungen allein zu treffen, ich weiß Bescheid, ich war auch verheiratet, sieben Jahre, die berühmten sieben Jahre. Meine Frau hat die Ehe nicht ausgehalten, so etwas kann man vorher nicht wissen, verstehen Sie das? Man kann nicht in einen Menschen hineinschauen, man kann ihn nur anschauen. Oft genügt es, wenn man einen Menschen lange genug anschaut. Nicht wahr, Frau Horn?«
Aus dem Flur wehte ihr ein Hauch Kiefernöl entgegen und sie atmete den Duft tief ein. Dahin musste sie, hinein in diesen Geruch, der sie umgab wie ein unzerstörbares heilendes Kleid.
»Verschwinden Sie!«, sagte sie, ohne sich umzudrehen, und machte wie jemand auf der Flucht einen Sprung über die blaue Fußmatte und knallte die Tür zu. Sie hätte abgesperrt, wenn der Schlüssel gesteckt hätte. Dass er nicht da war, versetzte sie sofort in Panik.
Sie stürzte ins Wohnzimmer, suchte auf dem Tisch zwischen den Modemagazinen, dann in der Küche, wo die Schale mit dem halb gegessenen Müsli stand, und ihr fiel ein, dass dieser Mann ihr Frühstück unterbrochen hatte, weil er zehn Minuten zu früh gekommen war. Anschließend suchte sie im Flur, in jeder Jacke, jedem Sakko, das an der Garderobe hing, und warf ständig einen Blick zur Tür, als würde jeden Moment der Fremde hereinkommen und über sie herfallen. Das war unmöglich, denn von außen konnte man die Tür nicht öffnen.
In einem Jutebeutel neben dem Telefon fand sie den Schlüssel. Hastig sperrte sie ab, atmete mit geschlossenen Augen mehrmals ein und aus und blickte dann durchs Guckloch. Und machte erschrocken einen Schritt zurück.
Zwei Meter vom Haus entfernt stand immer noch dieser Mann. Mindestens fünf Minuten musste er nun schon an derselben Stelle stehen. Er bewegte sich nicht.
Natalia legte die Hände an die Wangen und rieb sanft auf und ab. Tee, sie wollte einen Tee trinken, dann würde sie sich beruhigen, ganz bestimmt, frisch aufgebrühten Kamillentee. Schwitzend und zitternd stellte sie in der Küche den Wasserkessel auf den Herd, schüttete die getrockneten Blüten aus der Dose und wartete.
Durch das kleine Fenster sah sie in den Garten. Der Anblick des mächtigen, unerschütterlichen Apfelbaums beruhigte sie ein wenig. Und als sie die Schale mit dem gelben dampfenden Tee zwischen den Händen hielt und den ersten Schluck trank, entspannte sie sich allmählich. Sie setzte sich an den Holztisch, streckte die Beine aus und genoss den Duft der Kamillenblüten.
Doch die Worte des Mannes – Rossi! Jetzt fiel ihr sein Name wieder ein –, Rossis Worte steckten in ihrem Kopf wie Geschosse. Eine ausgezeichnete Frau … eine Tochter, die zuverlässig und arbeitswillig ist … weiße Blusen machen eine Frau fraulich …
Sie fuhren durch die Stadt, beseelt von ihrer Tat und dem lautlosen Beifall einer Mehrheit, aus deren Mitte sie stammten. Sie wussten, dass alle, die in nächster Zeit auf sie stolz sein würden, ihre Dankbarkeit nicht zeigen durften, weil das verpönt war in diesem Land. Doch das erfüllte sie nur mit noch mehr Erhabenheit.
Was wir uns trauen, traut sich sonst niemand. Was wir getan haben, ist beispiellos und ein Signal für die Zukunft. Sie waren nur fünf, aber sie wussten, sie waren viel mehr, nicht nur in dieser Stadt, sondern überall, wo Deutsche das Gekrieche vor den Besserwissern und Gewissensträgern, die jeden Tag hausieren gingen mit den Lügen der Vergangenheit, satt hatten. Wir fünf sind die Hand der Wahrheit und die Wahrheit kommt ans Licht, endlich, jetzt und unübersehbar.
Und dann hielt der Mann hinter dem Lenkrad, der Älteste, den Wagen an und schaltete den Motor aus. Es regnete in Strömen. Aus der Erde stieg wie ein kühles, unheimliches Gas Dunkelheit auf, breiige feuchte Dunkelheit, die keine Ähnlichkeit mit der Nacht hatte. Und als es finster war um halb ein Uhr mittags an diesem elften August, schauten die fünf Männer aus den Fenstern und bewegten sich nicht mehr. Hundertachtundzwanzig Sekunden lang. Danach, als würde sie von den Wolken gierig angesogen, verschwand die schwere Dunkelheit so plötzlich, wie sie entstanden war. Und die Männer lehnten sich zurück und stöhnten laut und zischten durch die geschlossenen Lippen. Der Fahrer erholte sich als Erster von dem Ereignis. Er klopfte mit beiden Zeigefingern an seine Nase, schnaubte und fuhr los.
Die Frau im Kofferraum fror. Sie musste an das Schauspiel am Himmel denken, denn sie hatte sich ein halbes Jahr lang darauf gefreut. So hoffte sie, dass wenigstens ihr Freund einen guten Platz zum Schauen hatte und dessen Tochter ebenso. Sie dachte an die beiden wie an Verwandte auf einem anderen Stern. Und sie dachte, ich seh euch nie wieder, ich seh euch beide nie wieder und sie werden euch vielleicht verjagen und ich kann euch nicht retten. Dann weinte sie. Aber die Tränen kamen nicht heraus aus ihren Augen, die fest zugeklebt waren. Und so weinte sie nach innen und es regnete in ihr wie draußen, wo die Vögel das zurückkehrende Licht besangen und sich wieder zu fliegen trauten.
Als der Schatten des Mondes die Stadt endgültig verließ und für Augenblicke die Sonne zwischen den Regenwolken unversehrt am Himmel zu sehen war, saßen vier der Männer aus dem roten Auto in ihren Wohnungen, jeder in seiner eigenen, und der fünfte, der Älteste, wartete in einem Hotelzimmer am Hauptbahnhof. Den Nissan hatte er in der Tiefgarage geparkt und der Frau im Kofferraum hatte er zugeflüstert, wenn dein Stecher brav ist, kommst du hier raus. Sie konnte seine Lippen an ihrem Ohr spüren, und seine Stimme kroch in ihren Kopf wie eine zischelnde Schlange.
Im sechsten Stock stand der Mann am Fenster, hielt die grüne Säge in der Hand und wartete auf den Anruf des Mannschaftsführers. Er glaubte nicht daran, dass der Stecher der Frau brav sein würde. Ich glaub nicht, dass solche wie der begreifen, was brav sein bedeutet, das haben die nicht in den Genen, dachte er, und dann klingelte das Telefon.
Er war bereit, zu allem bereit. Denn er war, wie schon sein Vater von sich gesagt hatte, ein Volksschullehrer, einer, der die Kinder unseres Volkes lehrte, wie man sich wusch, wenn man schmutzig geworden war. Und dazu brauchte er heute nicht einmal eine Anstellung beim Staat. Dazu genügte es, aufzustehen und vorzutreten. Und manche Kinder, sagte er sich, und das Telefon klingelte weiter und er legte die Säge daneben, manche wollen einfach nicht kapieren, die müssen dann bestraft werden, hart bestraft, sehr hart und gnadenlos, so lange, bis sie parieren.
»Ja!«, sagte er mit entschlossener Stimme in den Hörer und sah im Spiegel an der Wand seinen nackten, unbehaarten achtundvierzig Jahre alten grauen Körper und sein bleiches unerhebliches Gesicht, das übersät war von roten Flecken.
Töten wollte er jetzt, töten sägen töten und den Menschenbaum von seinen Geschwüren erlösen.
»Chris?« Mit dem schnurlosen Telefon ging Natalia im Wohnzimmer hin und her. »Wo bist du? Hast du was von Lucy gehört?«
»Nein. Bitte hör auf, dich zu sorgen, sie ist morgen wieder da, du kennst sie doch …«
»Wir müssen zur Polizei gehen.«
»Die lachen uns wieder aus.«
»Das werden sie sich nicht trauen. Ich hab Angst, Chris …«
»Was ist denn?«
»Nichts … Ich erzähls dir heut Abend.«
»Erzähls mir gleich, wir machen grade Pause.«
»Nein. Wo bist du?«
»In Pasing, war ein Notfall, die Wasserleitung in der Küche ist hier gebrochen. Ist eine uralte Wohnung. Aber der Besitzer hat beschlossen, alles komplett sanieren zu lassen, die Küche, das Bad. Wir haben ihm einen Kostenvoranschlag gemacht und er hat gesagt, er denkt drüber nach. Könnte ein ziemlich guter Auftrag werden, und so unerwartet.«
»Das ist toll.«
»Bist du traurig, Netty?«
»Ich bin … Glaubst du, Lucy ist weggelaufen, weil sie übermorgen Geburtstag hat? Sie ist ja schon mal einfach verschwunden, vor zwei Jahren, auch vor ihrem Geburtstag. Weil sie dachte, sie kriegt nichts geschenkt und dann hätten sie ihre Freunde alle ausgelacht.«
»Ja. Aber heuer gehts uns ja viel besser als vor zwei Jahren. Ich hab ihr die Klamotten versprochen, die sie möchte. Und das Handy auch.«
»Das Handy hättst du ihr nicht versprechen dürfen, das ist doch unsinnig in dem Alter.«
»Ihre Freundinnen haben alle eins.«
Auf dem antiken Schränkchen, das sie von ihrer Mutter geschenkt bekommen hatte, stand ein Farbfoto von Chris, seiner Tochter Lucy und ihr, sie sahen aus wie eine Familie, die einen fröhlichen Urlaub verbringt, mit Strohhüten auf dem Kopf und einem Eis in der Hand. Aber das Foto war an der Isar aufgenommen worden, am Flaucher in der Nähe des Tierparks, es war bisher das einzige Mal gewesen, dass sie gemeinsam ein paar Stunden verbracht hatten, zusammen verreist waren sie noch nie, wieso auch, dachte Natalia, wir sind keine Familie.
»Ich muss Schluss machen, Netty.«
»Wenn ich zur Polizei geh, musst du mitkommen.«
»Glaub mir, sie ist bei ihren Freunden und …«
»Sie ist seit vier Tagen weg! Und du kümmerst dich nicht um sie! Und wenn sie wieder irgendwo einbricht? Und wenn sie wieder in eine Schlägerei gerät? Und wenn sie wieder klaut und Leute überfällt?«
»Sie hat versprochen, dass sie das nie wieder tut.«
»Und du glaubst ihr?«, schrie sie und blieb mitten im Zimmer stehen. Die Sonne, die hereinschien, blendete sie, aber das war ihr gerade recht. Sie ging zum Fenster, schob die Gardine beiseite und machte das Fenster, das gekippt war, weit auf.
Sie beugte sich vor, um den Kiesweg, der von der Haustür zum Bürgersteig führte, genau sehen zu können. Rossi war verschwunden.
Die beiden Mädchen radelten wieder vorbei und die eine klingelte abermals schnarrend und rief hallo in Richtung Haus, mit derselben ruckartigen automatischen Kopfbewegung wie immer. Maja hieß sie und ihre Mutter kam regelmäßig zum Peeling zu Natalia.
»Was ist denn mit dir?«, fragte Chris ruhig. Manchmal war es seine Ruhe, die Natalia kaum aushielt.
»Deine Tochter ist unberechenbar«, sagte sie laut und die Sonne brannte ihr angenehm auf dem Gesicht. »Und sie schwänzt die Schule und dir ist das egal.«
»Die Noten stehen doch schon lang fest und ihre Klassenlehrerin hat sich ausnahmsweise nicht beschwert …«
»Natürlich nicht!«, unterbrach sie ihn heftig, drehte sich um und ließ sich den Rücken wärmen. »Weil die sich einen Dreck für deine Tochter interessiert! Die ist doch froh, wenn Lucy nicht da ist! Die sind doch alle froh, wenn sie mit diesem renitenten Kind nichts zu tun haben! Das juckt die doch nicht, was mit ihr ist, ob sie vor die Hunde geht oder im Gefängnis landet, das lässt doch diese Lehrer kalt!«
»Bitte, Netty … Sie wird vierzehn, sie ist aufgekratzt, sie … Ich muss jetzt aufhören, der Wohnungsbesitzer kommt gerade. Wir unterhalten uns heut Abend, bei dir, einverstanden?«
»Ich weiß nicht«, sagte sie und beendete das Gespräch.
Sie hatte sich nicht streiten wollen. Sie hatte nicht schon wieder damit anfangen wollen, wie sehr sie sich um Lucy sorgte und darunter litt, dass man mit dem Mädchen nicht reden konnte und dass es dauernd verschwand und sich mit älteren Jungs herumtrieb und Dinge anstellte und sich in Gefahr brachte. Sie wollte Chris nicht mit ihrer Fürsorglichkeit und ihren Bedenken belasten. Ich wollt dich nicht anschreien, ehrlich, das wollt ich wirklich nicht.
Eigentlich hatte sie vorgehabt ihn zu bitten, herzukommen und eine halbe Stunde bei ihr zu bleiben, sie in den Arm zu nehmen und ihr zuzuhören. Von diesem Mann, Josef Rossi – jetzt fiel ihr auch der Vorname wieder ein –, von seiner Art, die ihr unheimlich war, hätte sie gern gesprochen und Chris gefragt, was er davon hielt. Vermutlich hätte er sie in seiner grenzenlosen Sanftmut in wenigen Minuten vollkommen beschwichtigt. Aller Schrecken wäre von ihr abgefallen und sie hätte eingesehen, wie verrückt sie reagiert und wie lächerlich sie sich verhalten hatte.
Stattdessen hatte sie ihn beschimpft und ihm Vorhaltungen gemacht.
Verzeih mir, sagte sie zum Telefon, das sie noch immer in der Hand hielt.
Und dennoch …
Sie wählte von neuem. »Ich hätte gern Frau Ries gesprochen.«
»Einen Moment.«
Sie ging in die Küche, den Hörer zwischen Schulter und Kinn geklemmt, und goss sich ein Glas ungesüßten Traubensaft ein.
»Helga? Ich bins, Netty.«
»Hallo! Ich hab grad keine Zeit. Kann ich dich in zehn Minuten zurückrufen?«
»Nein«, sagte Natalia. Zurück im Behandlungsraum, öffnete sie das Fenster und betrachtete die nach hinten geklappte weiße Liege. »Du hast mir einen Kunden vermittelt, einen Mann namens Rossi, kennst du den?«
»Was? Wer? Rossi? Ja, er hat ein Konto bei uns, warum? Hör mal, Netty …«
»Was ist das für ein Kerl? Was macht der?«
»Er ist Verkäufer, er verkauft …«
»Das weiß ich, was macht er sonst? Wieso hast du den zu mir geschickt?«
»Was ist denn los mit dir? Ist er dir an die Wäsche oder was? Wir waren ein paar Mal was trinken, er ist in Ordnung, er redet ein bisschen viel, ja, meistens von seiner Arbeit, aber das tun wir ja alle, oder? Ich hab es gut gemeint, Netty, du hast mir gesagt, zur Zeit läufts nicht so gut in deinem Geschäft …«
»Ich will nicht, dass er wiederkommt.«
»Einen Moment …«
Mit zwei Kleenextüchern wischte Natalia die Liege ab, richtete sie auf und verließ das Zimmer.
»Netty? Meine Kunden werden ungeduldig. Tut mir Leid, wenn er dir nicht gefallen hat, ich mag ihn, er ist höflich und er kann Komplimente machen …«
»Ich hatte den Eindruck, er will sich gar nicht behandeln lassen …«
»Was denn sonst?«
»Das wollte ich dich fragen.«
»Ich kenn ihn doch nicht näher. Wir waren was trinken, er hat mich eingeladen. Er kennt übrigens Chris, er hat mir gesagt, er hat sein Bild in der Zeitung gesehen, in einem Artikel über Lucy, du weißt schon …«
»Hast du ihm erzählt, dass ich die Freundin von Chris bin und dass wir vielleicht heiraten wollen? Dass wir so gut wie verlobt sind? Das hat er nämlich behauptet, dass du gesagt hast, wir sind so gut wie verlobt.«
»Ich? Ja. Kann sein. Ist doch auch wahr. Du hast mir gesagt, Chris will dich heiraten, er traut sich bloß nicht, hast du gesagt, wörtlich. Oder habt ihr euch etwa getrennt?«
»Wieso sprichst du mit fremden Leuten über so private Dinge?«
»Er hat davon angefangen …«
»Womit hat er angefangen?«
»Mit dieser Geschichte aus der Zeitung, mit diesen Artikeln über Lucy, diesen ganzen Kram, dass sie dauernd was anstellt und so weiter und dass sie immer ausbüchst und klaut und so weiter … Er hat irgendwas dazu gesagt, keine Ahnung, was, ich habs vergessen. Und er hat sich an das Foto von Chris erinnert, er hat gesagt, dass er als Vater wahrscheinlich überfordert ist und dass man sich da was überlegen muss …«
»Was überlegen? Wer soll sich da was überlegen?« Natalias Stimme wurde laut und hart.
»Schrei mich nicht an! Ich muss jetzt weitermachen. Wir sehen uns, ruf mich noch mal an in dieser Woche …«
Natalia steckte das Telefon in die Box zurück und ließ sich auf die Couch fallen. Was ist los mit dir? Chris hatte sie das gefragt und Helga auch. Was los war? Wie sollte sie das erklären? Es war Montag, ein ganz normaler Montag. Nach einem ganz normalen Wochenende. Abgesehen davon, dass Chris am Samstag bis nachts um elf in seinem Büro gesessen und Kostenvoranschläge ausgetüftelt hatte und am Sonntagmorgen in Neuperlach eine Toilettenspülung reparieren und danach einige Dinge mit seinem Kompagnon Kriegel klären musste, der wieder einmal falsch abgerechnet hatte. Also war aus einem gemütlichen Frühstück nichts geworden. Aber das war ganz normal. Nichts Besonderes war geschehen. Lucy hatte nichts von sich hören lassen, das war alles. Was also war los mit ihr? Hatte dieser Rossi sie tatsächlich so aus dem Gleichgewicht gebracht, dass sie am Telefon herumschrie und ihre Freunde beschimpfte? Nein, er hatte nur etwas in ihr ausgelöst, das seit einiger Zeit in ihr gärte und rumorte, für das sie kein Ventil fand, das sie nicht benennen konnte, nicht aussprechen, nicht loswurde. Ein Gefühl ständiger Bedrohung, ein seismografisches Empfinden für Schwingungen, die immer stärker und unheilvoller wurden.
Sie dachte an die Zeitungsberichte über Lucy, in denen die Reporter sie als Zigeunerkind und Gangsterfratz bezeichneten und suggerierten, dieses dreizehnjährige Mädchen würde die öffentliche Sicherheit der Stadt gefährden, weil es nicht zu bändigen war und wie eine Räuberbraut raubte und brandschatzte. Sie dachte an Chris, der seiner Tochter immer wieder zuredete, Tag und Nacht, sofern sie ihm einmal zuhörte, und der in die Schule ging und versuchte, den Lehrern das Wesen seiner Tochter zu erklären und die Ursachen ihrer manchmal unbeherrschten Art. Er hatte die Geduld eines Engels, fand Natalia, aber diese Geduld half dem Mädchen nicht, sie half niemandem, ihr nicht, ihm nicht, den Lehrern nicht und nicht den Frauen, denen Lucy auf offener Straße die Tasche aus der Hand riss.
In den vergangenen zwölf Monaten war keine Woche verstrichen, in der die Polizei nicht ins Haus kam und Chris zur Rede stellte. Lucy war noch nicht strafmündig. Immer wieder drohte die Polizei damit, Lucy auf der Stelle zu verhaften, sobald sie vierzehn wurde und eine neue Straftat beging. Und Chris redete auf die Polizisten ein, mit der Geduld eines Engels. Ein paar Mal war Natalia dabei gewesen und sie hatte sofort gemerkt, dass die Beamten seine Erklärungen nicht akzeptierten, ihm vielmehr misstrauten und ihn für einen Versager hielten. Außerdem mochten sie ihn nicht. Sie behandelten ihn wie einen Untertanen, wie einen Gefangenen, wie einen Dummkopf, wie einen Aussätzigen. Sie sprangen mit ihm um wie früher die Kolonialisten mit den Negern.
Und Chris war ein Neger, er war schwarz und Lucy hatte ebenfalls eine dunkle Haut, nicht so schwarz wie die ihres Vaters, aber dunkel genug, um in einem Land verachtet zu werden, in dem Ausländer am helllichten Tag mitten in der Stadt unter dem Beifall von Zuschauern zu Tode gehetzt wurden.
In zwei Tagen wurde Lucy vierzehn und dann war sie nicht mehr unmündig, sondern verantwortlich für das, was sie anstellte. Von einem Tag auf den anderen durfte man sie einsperren. Obwohl sie dann immer noch ein verwundetes Kind war und Hilfe nötig hatte, nicht Strafe.
Vielleicht, dachte Natalia, wäre alles anders, wenn Lucys Mutter noch leben würde. Vielleicht, sagte sie sich, rührte daher ihr seelenschweres Unbehagen: Wenn sie Chris heiraten würde, wäre sie dann fähig, Lucy eine gute Mutter zu sein, eine echte Freundin, eine Vertrauensperson? Oder wäre all ihre Liebe nutzlos und das Mädchen trotz der neuen Nähe unerreichbar für sie?
Es klingelte an der Tür, ein Hund bellte. Natalia stand ruckartig auf und fuhr sich mit beiden Händen sanft über die Wangen. Dabei schloss sie die Augen und atmete tief ein und aus.
Vor der Tür stand eine junge Frau mit blauen Stoppelhaaren und sieben silbernen Knöpfen im linken Ohr. Sie hatte eine weite weiße Hose an, die ihre breiten Hüften eher ausstellte als verhüllte, und unter einer Jeansjacke voller Sicherheitsnadeln ein rotes T-Shirt. Sie trug eine schwarze Brille und auf dem Rücken einen winzigen schwarzen Rucksack mit einem runden gelben Button, der die ganze Fläche ausfüllte: BOING!
»Hallo Ines!«, sagte Natalia und streichelte den grauen Hund, der bellend an ihr hochsprang.
Es war ihre blinde Angestellte Ines Groß. Ihren Schäferhundmischling hatte sie aus dem Tierheim, er begleitete sie überall hin und nachts schlief er neben ihr im Bett.
»Hör jetzt auf, Dertutnix!«, rief Ines, weil der Hund anfing, Natalias Ohr abzuschlecken. »Sitz!«
Und brav hockte er sich zwischen die beiden Frauen, die sich umarmten und küssten, und beobachtete sie mit einem treuherzigen Jammerblick. Ines hatte ihn Dertutnix getauft, weil sie überzeugt war, dass der Name einen positiven Einfluss auf seinen Charakter ausübte. Und das stimmte. Natalia kannte keinen Hund, der zahmer war als Dertutnix.
»Ich hab eine Bitte«, sagte sie, als sie Ines eine Tasse roten Pu-Erh-Tee aufgoss. »Machst du mir eine Fußmassage? Ich brauch dringend Zärtlichkeit.«
»Klar«, sagte Ines. »Ich hab gleich gemerkt, dass du total verschwurbelt bist.«
Plötzlich fiel wieder dieser Schatten auf sie und drang in sie ein und verdunkelte die Welt in ihr. Und wie jedes Mal glaubte sie, sie würde verschwinden und sich auflösen wie die Nacht am Morgen oder lautlos in einen Abgrund stürzen, tausende von Metern tief.
Die Leute gafften sie an. Sie sah sie gaffen und war unfähig, ihnen ihr Gaffen mit einem gezielten Schlag auf die Nasenwurzel zu vergällen. Alles, was sie tun konnte, war sich auf den Boden zu setzen, mitten auf den Bürgersteig, die Hände über den Kopf zu legen und sich so tief wie möglich zu ducken. Das war das Letzte, was sie wollte, und doch war es das Einzige, wozu sie in solchen Momenten in der Lage war.
Und immer glaubte sie, sie würde sterben. Jetzt sterb ich, jetzt sterb ich und alle glotzen mich an und ich hab mich nicht mal von Papa verabschiedet.
Wenn der Schatten kam, kehrte Lucy Arano in eine Zeit zurück, in der sie auf dem Schoß ihres Vaters saß und er Geschichten aus seiner Heimat erzählte. Und ihre Mutter in einem roten, mit gelben Federn bestickten Kleid kochte Pfeffersuppe mit Hühnerfleisch und beim Essen schwitzten alle unheimlich.
Wenn der Schatten kam, unerwartet und unausweichlich, empfand Lucy Todesangst und Glück zugleich. Je mehr sie sich zusammenkauerte und je fester sie die Beine an den Körper presste und die Hände auf den Kopf drückte und den Nacken beugte, bis er wehtat, desto deutlicher sah sie das Zimmer mit den Holzfiguren, die ihr Vater geschnitzt hatte, und die farbenprächtigen Ketten und Gewänder ihrer Mutter. Das alles erschien ihr wie ein Film, der in rasender Geschwindigkeit vor ihr ablief, während sie kopfüber in die Hölle stürzte.
Wie in einem bösen Traum versuchte sie zu schreien und sich festzuhalten. Aber sie hatte keine Stimme mehr. Und die Dinge um sie herum waren nicht wirklich, sondern aus bemalter Luft.
Ihr war übel und ihr war kalt. Gerade hatte sie noch einen genauen Plan gehabt, wie sie in den Laden reingehen, sich lässig umschauen, ein paar Bücher durchblättern und dann in den ersten Stock zu den günstigen CDs hinaufschlendern wollte. Praktisch an diesen Buchhandlungen fand Lucy, dass die Frauen, die dort arbeiteten, tierisch verständnisvoll waren und offensichtlich besonders auf Jugendliche abfuhren, die sich für kulturelles Zeug interessierten, für Romane und Musik, und auch noch superschlaue Fragen stellten.
Lucys Lieblingsfrage lautete: »Und wo ist die aktuelle Relevanz dieses Buches?« Damit erntete sie oft Staunen, manchmal Bewunderung. Und niemand bemerkte die Scheiben, die sie in ihrer Bomberjacke gebunkert hatte, zwischen den zwei dünnen Metallplatten, die die Signalschranke am Ausgang außer Kraft setzten. In ihrem blauen dicken Daunenpanzer befanden sich eine Menge lebenswichtiger Dinge, die sie täglich brauchte, um sich durchzusetzen.
Wenn sie an den Cafétischen entlang der Leopoldstraße vorüberging, schauten ihr Männer genauso nach wie Frauen und sie erwiderte die Blicke mit dem Lächeln einer Fürstin. Sie hatte schwarzes krauses Haar mit zwei Zöpfen rechts und links, an denen bunte Steine und Ringe baumelten. Ihr Hals war kaum zu sehen vor lauter grünen, roten, gelben und weißen Ketten voller bunter Perlen und Kugeln aus Glas und Holz. An jedem Finger trug sie einen Ring, bizarre filigrane Kunstwerke, Geschenke ihrer Verehrer vom Flohmarkt an der Arnulfstraße. Die Nägel ihrer rechten Hand waren schwarz lackiert, die der linken blau. Auf ihrer roten ausgebleichten Jeans klebten Stoffwappen verschiedener Länder und ihre schwarzen schweren Schuhe hatten Stahlkappen, die in der Sonne glänzten. Sie war groß und stämmig für ihr Alter und wer ihr in die Augen sah, tauchte in ein schwarzes Feuer, das sie mit jedem ihrer Blicke noch mehr zu schüren schien. Wie eine Erscheinung starrten die Leute sie manchmal an und dann verlangsamte sie ihren Schritt, drehte sich um, als suche sie jemanden, lächelte oder machte einen Schmollmund oder leckte sich die schwarz umrandeten Lippen.
Sie war sich ihrer Wirkung bewusst und es war nur ein Spiel für sie. Wer ihr zu nahe kam, hatte Pech. Denn das konnte bedeuten: Krankenhaus. Oder zumindest ein paar Tage daheim auf dem Sofa Prellungen kurieren.
Nur wer ihre Bannmeile respektierte, hatte die Chance auf etwas Nähe und Kommunikation. Sie konnte sich einem zuwenden, aber sie hatte selten den Nerv dazu. Sie traute niemandem, nur ihrem Instinkt, und dem auch nur bedingt. Für sie war jeder Morgen der Beginn einer neuen Gefahr. Und sie wollte sich nicht fürchten. Sie wollte stark sein, sie wollte, dass die anderen es waren, die sich fürchteten, und zwar vor ihr. Und zwar vor mir, ihr dämlichen Gaffer. Denkst du, du Krawattenarsch, du kannst mich haben, nein, das denkst du nicht, du hast ja null Ahnung, was denken ist, weißt du, was passiert, wenn du mich noch länger anglotzt, frag den Wichser vom Café Münchner Freiheit, der braucht jetzt einen Spitzenzahnarzt, sonst wird das nichts mehr da drin in seinem vorlauten Maul!
Stumm und stolz stapfte sie mit ihren schweren, klackenden Schuhen an den voll besetzten Tischen vorbei, verfolgt von hundert Blicken, begleitet von Geflüster und unüberhörbaren Kommentaren. Im Stillen übte sie ihren Auftritt und überlegte, welche CDs sie benötigte für ihre Tauschgeschäfte, die Musik interessierte sie nicht, nur das, was sie dafür bekam.
Gerade als sie die amerikanische Eisdiele neben der Buchhandlung erreichte, knickten ihre Beine ein. Sie riss die Arme hoch und sackte zu Boden.
Auf den Knien rutschte sie zur Hauswand, wie immer, und der finstere fürchterliche Geist packte und verschluckte sie. Und sie wollte etwas sagen, etwas rufen, sie wollte sich aufrichten und festhalten. Und sie wollte, dass die Leute verschwanden und sie in Ruhe ließen, in Ruhe sterben ließen.
Sie drückte den Kopf zwischen die Knie, versteckte sich unter den Armen, die sie über sich hielt, als könne sie so den Horror daran hindern, in sie zu fahren und sie auszuhöhlen.
Der Boden, auf dem sie hockte, fühlte sich an wie Sand, der unter ihr wegsackte und vielleicht ins Innere der Erde sickerte und sie mitriss. Und begrub. Im elendsten Grab der Welt, in namenloser Vergessenheit.
Aber ich bin doch wer, hörte sie eine Stimme, ich bin doch auch wer, so wie ihr, so wie ihr.
Kälte kletterte an ihr hoch wie eine Krake, von den Zehen unter den Stahlkappen bis zu den blinkenden Perlen ihrer Haare. Den Rücken gekrümmt, drückte sie sich an die Hauswand, zwischen zwei Fahrrädern, die zwei blonden, braun gebrannten jungen Frauen gehörten, die ratlos im Angesicht des wimmernden Mädchens ihr Eis schleckten und erst mal ihre Ray-Ban-Brillen aufsetzten und abwarteten.
Passanten blieben stehen, schauten hin, schauten weg, gingen weiter. Andere beugten sich vor, horchten, nickten, weil sie Geräusche hörten und den Körper zucken sahen, und fingen an, miteinander zu reden.
»A Junkie, des Übliche.«
»Die ist doch höchstens zwölf.«
»Die schaut bloß so jung aus.«
»Die kenn ich.«
»Geh weida!«
»Die kenn ich.«
»Wen?«
»Die da.«
»Und? Wer ist die?«
»Weiß ich nicht. Aber ich kenn die.«
»A Junkie halt, selber schuld. Wissen Sie, wie viel Drogensüchtige es in dieser Stadt gibt? Zwanzigtausend! Und alle unter achtzehn. Zwanzigtausend. Mindestens. Lauter Gschwerl, die ghören alle nach Berlin oder nach Hamburg.«
»Das ist doch Unsinn, was Sie da reden!«
»Liebe Frau, was verstehen Sie von dem? Ich kenn mi aus, ich wohn da vorn, Giselastraß. Lauter Junkies. Mitten aufm Bürgersteig. GehenS doch vor, schauen Sie sichs an.«
»Ja. Und?«
»Ich bin kein Sozialarbeiter, gute Frau, ich find diese jungen Leut unangenehm und schädlich. Und schädlich.«
»Die schaden doch niemandem.«
»Ich kenn die. Das ist doch die aus der Zeitung.«
»Genau! Die von dem Schwarzen.«
»Die is selber schwarz, da schau! A Negerin!«
»Halten Sie doch den Mund.«
»Was isn los mit der?«
»Die ist drogensüchtig, sengS des net?«
»Jemand muss den Notarzt holen.«
»Für die? Für die an Notarzt? Wirklich net! Des ist doch sinnlos! Morgen hockt die wieder da. So sind die. Fürn Notarzt gibts wichtigere Leut, net solche, dies net verdient ham.«
»Sie sind ein Arschloch.«
»Was? Was? SagenS des noch mal! Los, sagenS des noch mal! Was bin i? Was bin i?«
»Maul halten, ihr blöden Ärsche!«
Unbemerkt von den Umstehenden hatte Lucy sich aufgerichtet und hingekniet. Die Hände in den Jackentaschen, sah sie jedem ins Gesicht und jedes einzelne Gesicht beleidigte ihren Schmerz.
Von dem Entsetzen, das sie heimgesucht hatte und dem sie zu ihrem Erstaunen wieder einmal im letzten Moment entkommen war, hatten die Gaffer alle keine Ahnung. Dass ich hier bin, ist bloß Spott für euch und dafür hass ich euch, jetzt und für immer und immer mehr!
Mit einem Satz sprang sie auf. Die älteren Frauen in der ersten Reihe wichen erschrocken zurück. Sie zog ein Butterflymesser aus der Tasche und schwenkte es hin und her.
»Ich habs gwusst, die is kriminell!« Der Mann, der Sandalen, braune Socken, eine kurze beigefarbene Hose und ein gemustertes Hemd trug, trat ein paar Schritte vor, holte aus und wollte zuschlagen. Aber er brauchte zu lange, um seinen Arm zu heben. Lucy drehte sich zur Seite und schubste ihn. Und er, mitten in der ausholenden Bewegung, taumelte, schlug ins Leere, verlor den Halt und stürzte auf eines der beiden Fahrräder, das scheppernd umfiel. Er plumpste obendrauf.
Jemand lachte. Die Blondine, der das Rad gehörte, ließ vor Schreck das Eis fallen und es platschte dem Mann genau aufs Knie.
»Du Sau!«, rief er und verfing sich mit den Fingern in den Speichen.
Immer mehr Neugierige blieben stehen. Lucy boxte sich den Weg frei. Als sie eine alte Frau mit einem grünen Hut, die sie festzuhalten versuchte, wegschob, versperrte ihr ein kräftiger Mann um die fünfzig den Weg.
»Ganz ruhig jetzt!«, sagte er und baute sich breitbeinig vor ihr auf. »Gib mir das Messer und mach keinen Quatsch! Ich helf dir, ich heiß Alfons, du kannst du zu mir sagen.«
Lucy umklammerte das Messer. Der Typ kam ihr bekannt vor, ein Bulle vielleicht, ein Bulle in Zivil. Er trug ein graues Blouson und eine schwarze Hose. Und auf einmal hatte er eine Pistole in der Hand.
»Gib mir das Messer!« Er schaute auf sie herunter. Sie war zwei Köpfe kleiner als er. Sie dachte gar nicht daran, seinen oder irgendeinen anderen Befehl zu befolgen. Was wollten sie alle von ihr? Wieso kesselten sie sie ein?
Tatsächlich bildeten die Leute einen Kreis um die beiden und Lucy war klar, dass sie sich beeilen musste, wenn sie hier unbehelligt rauskommen wollte. Und sie wollte so schnell wie möglich hier raus und weg. Was mach ich überhaupt noch hier? Und du, glaubst du, du kannst mich aufhalten, du Wicht?
»Okay«, sagte sie und hielt Alfons das Messer hin.
»Ich hab gewusst, du bist clever. Ich bin Detektiv drüben im Hertie, kann das sein, dass wir uns schon mal begegnet sind? Kommt mir so vor.«
»Kann sein.«
Er streckte die Hand nach dem Messer aus, bewegte sich lässig auf sie zu und das war der richtige Moment. Blitzschnell trat sie ihm zwischen die Beine und die Stahlkappe ihres rechten Schuhs erwischte zielsicher den Schritt. Den Anblick, wie Alfons gurgelte, glotzte und ihm die Augäpfel halb rauskippten, gönnte sie sich zwei Sekunden, dann lief sie los. Die Leopoldstraße Richtung Süden, rechts ab in die Hohenzollernstraße und dann geradeaus.
Alfons ging in die Hocke und schnappte nach Luft. Der Mann in den Sandalen wischte sich das Eis vom Bein und fluchte. Eine Frau rief laut nach der Polizei. Und zwei Taxifahrer verfolgten Lucy in ihren Autos.
An der Ecke Wilhelmstraße steuerte der eine Taxifahrer seinen Wagen auf den Gehsteig und sprang heraus.
»Bleib stehen, du!« Er beugte sich ins Auto und holte eine Pistole heraus. »Stehen bleiben oder ich schieße!«
Lucy rannte die Einbahnstraße hinunter und das zweite Taxi kam hinter ihr her. In der Ainmillerstraße zögerte sie einen Moment. Das Taxi raste direkt auf sie zu. Sie sah hin und war unfähig, einen Schritt zu tun. Schnurgerade brauste der Mercedes mit der roten Möbelhauswerbung auf sie zu. Wie paralysiert stand sie auf der Straße vor den renovierten Altbaufassaden, roch den Duft von frisch gekochtem Essen und hörte aus einem offenen Fenster leises Klavierspiel.
Und das Taxi hatte sie fast erreicht und der Fahrer schien immer noch mehr Gas zu geben.
Trotzdem hörte sie die melodischen Klänge des Klaviers. Das gefiel ihr. Dass irgendwo jemand schon jetzt ein Trauerlied spielte, extra für sie. Und sie durfte noch ein paar Töne selber mit anhören, was sonst nie passierte. Sonst ist man ja schon tot, wenn das gespielt wird, dachte sie.
Sie hob den Kopf. In ihrem Haar klimperten die Perlen und Ringe und der Himmel über den hohen bemalten Häusern war blau, blau wie die Bucht von Benin, von der ihr Vater oft erzählt hatte, und Möwen kreisten über ihr. Wo kommt ihr denn her?
Und während sie sich noch wunderte, wurde sie von zwei Händen gepackt, zu Boden geworfen und über die Straße geschleift. Und der Mercedes bretterte vorüber, sie sah den Mann hinter dem Lenkrad, ein entwischender Schatten. Und dann lag sie zwischen zwei geparkten Autos und hörte ihr Herz poltern.
Neben ihr saß ein Mann und wischte sich die Haare aus dem Gesicht. Dann holte er einen kleinen Block aus der Jackentasche und kritzelte etwas hinein. Ohne sie anzusehen. Steckte den Block wieder ein und schaute so gebannt die Straße hinunter, wo das Taxi verschwunden war, dass Lucy schon dachte, E. T. sei gelandet.
»Hey! Is was? Alles okay mit Ihnen?«
Irgendwie müde, fand sie, wandte er ihr den Kopf zu.
»Alles klar?«, sagte sie und zog die Augenbrauen hoch. Der Typ machte auf sie einen reichlich wirren Eindruck. Er hatte dunkelblonde schulterlange Haare, grüne Augen, wie Lucy noch selten welche gesehen hatte, und ein Gesicht, das, wie ihr sofort auffiel, nicht so aussah, als würde es viel Schlaf und Pflegecremes abkriegen. Dennoch machte er einen gesunden und coolen Eindruck auf sie, wie einer, den nicht so schnell was umhaute, auch wenn er jetzt auf dem Asphalt hockte und leicht daneben wirkte.
Dann fiel ihr die Kette auf, die er um den Hals trug, ein blauer Stein mit einem Tier. Sie konnte nicht erkennen, welches es war. Und er hatte Schuhe an, die wie halbhohe Stiefel aussahen, mit einer eigentümlichen Musterung, Schlangen oder Pflanzen.
»Lässig«, sagte Lucy.
»Was?«
»Alles.«
Er schwieg und sie wusste nicht genau, was sie davon halten sollte. Immerhin hatte er sie vor einem geisteskranken Taxifahrer gerettet, der sie glatt platt gemacht hätte.
Eine Minute lang hörte sie nervös seinem Schweigen zu, dann wuchtete sie sich in die Höhe, klopfte ihre Bomberjacke ab, in der es klirrte und klapperte, und lehnte sich an eines der geparkten Autos.
»Ich bin Lucy und Sie?«
Er blickte zu ihr hinauf und sie sah die vielen Stoppeln in seinem Gesicht und eine lange Narbe am Hals.
»Süden«, sagte er, »ich heiß Tabor Süden.«
»Warum nicht?«, sagte Lucy.
Er fing wieder an zu schweigen und das konnte sie jetzt nicht gebrauchen.
»Hey!«, rief sie, ging an ihm vorbei auf die Straße und drehte sich zu ihm um. »Danke. Ich war total weg. Ich wär jetzt tot ohne Sie, echt. So ein Wichser!«
»Ich hab mir die Autonummer aufgeschrieben«, sagte Süden.
»Ich war total weg«, sagte Lucy noch einmal und sah ihn mit ernster Miene an.
»Jetzt bist du ja wieder da.«
Verwundert sah sie ihn an. Seltsam: Er erinnerte sie an jemanden, dem sie nie begegnet war, an einen Mann aus dem Busch, von dem ihr Vater früher oft gesprochen hatte. Denn dieser Mann hatte ihrer Mutter nach einem Schlangenbiss im Regenwald das Leben gerettet und war dann nie wieder aufgetaucht. Auch er, hatte ihr Vater erzählt, trug ein blaues Amulett und hatte eine Narbe am Hals.
»Hey Süden!«, rief sie und streckte ihm die Hand hin. »Kommen Sie mit, was trinken. Ham Sie Zeit?«
»Ich bin Beamter, ich hab viel Zeit«, sagte er, packte ihre Hand und hätte Lucy beim Aufstehen beinah wieder zu Boden gerissen.
»Ganz schön schwer«, sagte sie.
»Du bist auch nicht gerade untergewichtig.«
»So was sagt man nicht.«
»Warum nicht?«
»Weil das eine Beleidigung ist für eine Frau, besonders für ein Kind«, sagte sie und meinte es ziemlich ernst.
»Entschuldigung«, sagte er.
»Is okay.«
Fürs Erste hatten sie sich nichts mehr zu sagen. Wortlos machten sie sich auf die Suche nach einem Lokal, das ihnen beiden gefiel und wo sie draußen in der Sonne sitzen konnten.
Zum ersten Mal seit langem fand in München wieder eine ordentliche Versammlung unseres Landesverbands statt und sie wurde ein großer Erfolg. Noch vor der Rede unseres Ortsvorsitzenden Norbert Scholze traten mehrere junge Männer und eine Frau neu in die Partei ein und wurden mit viel Beifall begrüßt. Anschließend spielte die Weilheimer Blaskapelle den Bayerischen Defiliermarsch und es gab wohl kaum jemanden im Saal, der nicht mitklatschte oder eine Fahne schwang. Im beliebten Löwenbräu-Keller am Stiglmaierplatz herrschte von Beginn an eine großartige Stimmung, die Wirtsleute hatten auf jeden Tisch Blumen gestellt und freundliche Bedienungen sorgten dafür, dass niemand lange vor einem leeren Glas ausharren musste. Es waren rund hundert Mitglieder und Freunde der Partei gekommen und Vorsitzender Scholze freute sich besonders, so viele junge Gesichter begrüßen zu dürfen.
»Wir sind eine starke Kraft und unsere Zukunft hat gerade erst begonnen.« Mit diesen Worten begann Scholze seine Rede, die immer wieder vom Beifall unterbrochen wurde. Er lobte die Disziplin der Parteimitglieder bei den vergangenen Wahlen und gratulierte den Kollegen in Ostdeutschland, speziell in Sachsen-Anhalt, für ihren großartigen Einsatz und ihre Arbeit in den Parlamenten, in die sie zu Recht gewählt worden waren. »SPD und CDU verraten unser Volk und die Wähler nehmen das nicht länger hin«, sagte Scholze. »Vor allem die Menschen im Osten haben begriffen, dass es nicht eine Bonner Republik sein kann, die ihnen ihre Sorgen und Ängste nimmt und neue solide Arbeitsplätze schafft, und auch nicht eine Berliner Republik, sondern nur eine Deutsche Republik!«
Dafür erntete Scholze begeisterten Jubel. Hermann Haberle, mit 88 Jahren das älteste Mitglied in der Bayerischen Sektion unserer Deutschen Republikaner, erhob sich von seinem Platz, klatschte minutenlang und streckte dann den Arm zum Gruß. Lächelnd rief ihm Scholze zu, dass man zum Glück ja unter sich sei, sonst würden alle Anwesenden womöglich noch eingesperrt werden, so seien die Gesetze in diesem Land. Wieder brandete so starker Beifall durch den Saal, dass die Bedienungen warten mussten, bis sie wieder in Ruhe das Bier servieren konnten.
Mit den Worten »Die Türken stehen nicht vor Wien, sondern mitten unter uns« ging Scholze auch auf die Ausländerfrage ein. Wer in Bayern ordentlich zum Wohlstand beitrage, der sei willkommen. Wer aber nur schmarotzen will, kriminelle Taten begehe und den Einheimischen Sozialwohnungen wegnehme, der habe hier nichts verloren. »Ausländer«, sagte Scholze, »sind von Haus aus eher kriminell, das liegt an ihrer Mentalität, das ist genetisch bedingt.« In dieser Einschätzung wisse er sich einig mit einer Reihe von Politikern aus der CSU, die man seinerzeit ja auch kräftig bei der Unterschriftensammlung gegen die doppelte Staatsbürgerschaft unterstützt habe. Ausländer, die eine Straftat begehen, sollten umgehend ausgewiesen werden, egal, welchen Alters. Scholze erwähnte in diesem Zusammenhang das dreizehnjährige Negermädchen Lucy, das seit einigen Jahren brandschatzend, raubend und schlägernd durch München ziehe, ohne dass die Stadt etwas dagegen unternimmt. »Dieses Kind ist eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit.« Scholze habe schon mit dem Kreisverwaltungsreferenten Grote gesprochen, und der habe ihm versichert, dass das Mädchen eingesperrt werde, sobald es vierzehn Jahre alt und strafmündig sei.
Hier meldete sich einer der jungen Männer, die zu Beginn der Veranstaltung in die Partei eingetreten waren. Der junge Mann bat ums Wort und Scholze erteilte es ihm.
Zuerst sagte der junge Mann seinen Namen: Florian Nolte. Durch seine Arbeit wisse er, dass besagtes Mädchen in wenigen Tagen vierzehn werde und dass man dann sofort hart durchgreifen werde. Er sei Kommissar bei der Münchner Kripo und verfolge die Karriere dieser schwer kriminellen Ausländerin mit Aufmerksamkeit. »Wir haben ihren Vater schon mehrmals vorgeladen«, sagte Nolte, »und er verspricht auch dauernd irgendwas, aber er ist ein Versager.« Der Mann stamme aus Nigeria und habe lediglich ein Bleiberecht. Dieses Recht könne ihm entzogen werden, wenn er seine Aufsichtspflichten grob vernachlässigt und sogar zulässt, dass deutsche Mitbürger durch seine Tochter zu Schaden kommen. Viel Beifall erhielt Nolte für den Satz: »An jeder Baustelle steht: Eltern haften für ihre Kinder. Und was bei Sachbeschädigung für alle Eltern eine Selbstverständlichkeit ist, sollte bei Körperverletzung, Raub, Erpressung und versuchtem Totschlag wohl auch gelten.« Nolte bezweifelte, dass der Vater, der verwitwet sei und offensichtlich bisher keine neue Frau gefunden habe, ein Interesse habe, sich und seine Tochter in unsere Gesellschaft zu integrieren. Andernfalls hätte er längst die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt. Nolte sagte: »Vielleicht wäre es ihm recht, wenn man ihn und seine kriminelle Tochter einfach ausweisen würde, zurück nach Nigeria. Dort ist es auch schön.«
Dann bedankte sich Nolte für die Aufmerksamkeit und setzte sich. Er erntete Beifall und Zuspruch. Mit der launigen Bemerkung »Manche schwarzen Ausländer in dieser Stadt haben mehr Schmuck um den Hals als meine Frau«, rief Scholze zu Solidarität und Widerstand unter uns Deutschen auf. Er ermutigte die Anwesenden, sich nicht einschüchtern zu lassen, sondern gerade im Alltag Stolz und Selbstbewusstsein zu zeigen und deutsche Interessen laut zu vertreten, wo immer es angebracht ist.
Die Weilheimer Blaskapelle spielte einen Marsch und anschließend wurden diverse Veranstaltungen geplant, um auch in den Gebieten, in denen unsere Partei bisher noch nicht so gut vertreten ist, Basisarbeit zu leisten und Menschen für unsere Ziele zu gewinnen.
Über die Termine im Einzelnen informieren wir im nächsten Heft der »Republikanischen Wochen-Zeitung«, die wie immer am Freitag erscheint.
Noch eine aktuelle Meldung aus der Mitgliederchronik: Unser langjähriges Mitglied Franz-Xaver Gruber, von Beruf Rechtsanwalt und Stadtrat a.D., ist im Alter von 84 Jahren verstorben. Den Deutschen Republikanern war er Vorbild und Mahner. Wir werden ihm ein würdiges Andenken bewahren.
Vom Himbeerkuchen hatte sie rote Zähne und sie fletschte sie und machte wilde Grimassen. Einige Gäste an den Nebentischen sahen her und sie reckte ihnen den Mittelfinger mit dem schwarzen Nagel entgegen.
Der Typ neben ihr ging ihr auf die Nerven. Er saß in der Sonne, trank Wasser und war anscheinend entweder bekifft oder einfach nur behämmert, sie kam nicht dahinter.
»Gibst du mir noch ’ne Cola aus? Hey!« Zum fünften oder sechsten Mal rempelte sie ihn von der Seite an, ohne dass er besonders darauf reagierte. Er wandte ihr den Kopf zu, immerhin, sie grinste und dachte, vielleicht steht er auf kleine Mädchen und überlegt sich gerade seine Strategie. Mit mir nicht, Alter, das würd extrem übel ausgehen für dich.
Tabor Süden winkte der Bedienung, die nicht viel zu tun hatte. In dem Café am Rand des Hohenzollernplatzes, wo sie eine Zeit lang ratlos herumgestanden hatten, ehe Süden auf das San Marco zeigte, saßen wenig Gäste. Lucy wollte nicht hin, hatte aber auch keine Lust länger herumzulaufen. Außerdem taten ihr die Beine weh, und daran war der Typ schuld, weil er sie bei seiner Heldenaktion brutal auf die Straße geschleudert hatte.
Wahrscheinlich wartet er drauf, dass ich vor Dankbarkeit auf die Knie fall oder sonst was mach. Da kannst du lange warten, Häuptling Stummfisch.
Schon die ganze Zeit, während sie durch die Straßen gegangen waren, kam er ihr wie ein verkappter Indianer vor, mit seiner braunen Lederhaut, den Lederklamotten, dem Amulett und dem schleichenden Gang. Ihr fiel auf, dass er beim Gehen kaum Geräusche machte. In sich versunken schlurfte er dahin, leicht nach vorn gebeugt, die Hände auf dem Rücken. Obwohl er Halbstiefel trug, bewegte er sich leise wie in Turnschuhen oder als wäre er barfuß.
Als sie ein paar Meter hinter ihm blieb, weil sie neben ihm eine Art Beklemmung verspürte, wandte er sich kein einziges Mal nach ihr um. Das ärgerte sie. Sie blieb stehen und wartete. Er ging einfach weiter. Dann brüllte sie: »Hey!«, und er hob den Kopf, blickte aber nicht in ihre Richtung, sondern weiter geradeaus und setzte seinen Weg fort, als habe er sich verhört. An der Kreuzung am Kurfürstenplatz holte sie ihn ein, stieß ihn in die Seite und schrie ihn an. Und er blieb stehen, endlich, sie dachte schon, er habe einen Defekt in den Gelenken, und sah ihr in die Augen. Das war auch wieder verkehrt, fand sie, aber jetzt war es zu spät. »Lass das!«, sagte er. Und ging weiter. Und sie stand da und konnte einfach nicht glauben, was passierte.
Sie kannte die irrsten Typen und ihre Meinung über Tabor Süden wechselte alle fünf Minuten. Manchmal mochte sie ihn, dann wieder nicht. Einmal hielt sie ihn für einen Trottel und einmal für einen Psychopathen. Und wenn sie an ihre Begegnungen in letzter Zeit dachte, dann war die Wahrscheinlichkeit, dass er einer von der besonders abgedrehten Sorte war, ziemlich hoch. In den Kneipen und auf den Plätzen, wo sie sich gewöhnlich herumtrieb, zählte diese Kategorie von Männern zu den Normalos. Sie hatte sich an sie gewöhnt und wusste, was sie wollten und wie sie mit ihnen umspringen musste, damit sie nicht ausrasteten. Und wenn doch, hatte sie genügend Gegenmittel in ihrer Jacke, und die halfen immer.
»Die Cola.« Die Bedienung stellte das Glas auf den Tisch.
»Zitrone will ich keine«, sagte Lucy.
»Dann nimm sie halt raus.«
»Ja klar.«
Lucy fingerte die Zitronenscheibe heraus und warf sie auf den Boden.
»Heb das auf!«, sagte die Bedienung. Zwei ältere Damen schauten von ihrem mit Sahne überhäuften Cappuccino auf. Die eine machte einen derart angewiderten Eindruck, dass Lucy sofort begeistert war.
»Hey!«, rief sie hinüber. »Braucht ihr Vitamine? Ich hab welche.« Sie hob die Zitronenscheibe auf, schnellte aus dem Stuhl hoch, war mit drei großen Schritten bei ihnen und tunkte die Scheibe in die Tasse derjenigen, die sie so ablehnend angeschaut hatte.
»Is total viel gesünder als Sahne, echt!«
Die Zitrone versank in der Sahne. Lucy wischte sich die Hände an der Papierserviette ab, die auf einem der leer gegessenen Kuchenteller lag. Die Bedienung kam näher und stellte sich zwischen zwei Tische, direkt vor Lucy.