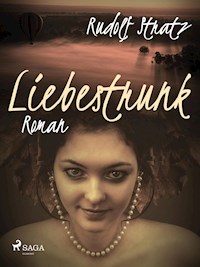Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
In Rudolf Stratz' 'Gesammelte Werke: Historische Romane, Kriminalromane, Erzählungen & Essays' tauchen die Leser in eine facettenreiche Welt voller spannender Geschichten ein. Mit einem einzigartigen literarischen Stil entführt der Autor seine Leser in historische Epochen und mysteriöse Kriminalfälle. Seine Erzählungen zeichnen sich durch eine präzise und detaillierte Beschreibung der Charaktere und Handlungen aus, die den Leser mitten ins Geschehen versetzen. Stratz' Werke sind Teil des literarischen Kontextes des frühen 20. Jahrhunderts, in dem realistische Darstellungen und fesselnde Geschichten beliebt waren. Der Autor zeigt in seinen Werken eine unvergleichliche Meisterschaft im Erzählen und Entwickeln von fesselnden Plots.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 9903
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gesammelte Werke: Historische Romane, Kriminalromane, Erzählungen & Essays
Inhaltsverzeichnis
Romane
Unter den Linden!
I
Renntag in Charlottenburg! ...
Die blauen Fähnchen wehen von den Cigarren- und Friseurläden, wo man die Tribünenplätze verkauft, an den Litfaß-Säulen prangen die großen blauen Plakate des Vereins für Hindernis-Rennen, ›Unter den Linden‹ und auf der Friedrichstraße halten die herumziehenden Händler die neueste Nummer der »Sportwelt« feil.
Es ist noch früh. Um zwölf Uhr fangen erst die Rennen an. Aber Berlin W beginnt sich bereits zu regen. Schon rollen vereinzelte Droschken die Charlottenburger Chaussee entlang und befördern Herren in grauen Hüten und gelben Paletots hinaus nach Westend. In immer kürzeren Abständen rollen die mächtigen Wagen der Pferdebahn und immer dichter wird das Gedränge auf ihrem leinwandüberspannten Deck. Die Stadtbahnzüge füllen sich mehr und mehr. Die schwarze Menschenwoge, die alle paar Minuten aus dem Westend-Bahnhof herausquillt, wächst mit jedem neuen Schub an Umfang. Auf der breiten Berliner Straße in Charlottenburg kommen die Leute aus den Häusern, um sich den altbekannten Corso anzuschauen und durch ihre gaffenden Gruppen drängen sich die rüstigen Wanderer, die zu Fuß bis zu dem Rennplatz pilgern.
Das ist ein weiter Weg, aber lohnend bei solchem Wetter. Noch prangt der Tiergarten in den grellen Farben des Septemberlaubes, ein buntes Treiben zieht sich vom Brandenburger Thor in langer Kette hinaus gen Westen und von dem blaßblauen Himmel lacht die Herbstsonne über Gerechte und Ungerechte.
Nicht überall dringen ihre Strahlen hin. Auf der Bühne des Edentheaters herrscht ein ungewisses Dämmerlicht. Grau in grau ist alles ringsum, die staubigen, in die Ecke gerückten Versatzstücke, die Leinwandmassen. die auf den Parkettbänken ruhen und gleich Trauerfahnen über die Logenbrüstungen herabhängen, die Luft selbst, die dumpf und stickig den Raum mit dem eigenartigen Theaterdunst erfüllt. Das hintere Ende des Zuschauer-Raumes verschwimmt völlig, in der Finsternis. Nach vorn wird es allmählich heller. Quer über die Bühne fällt aus einem erblindeten Fenster in der Hinterwand ein einziger schräger Lichtstreifen und malt goldene Kringel über Regietisch und Souffleurkasten.
Man probt da oben. Herren und Damen im Straßenkostüm stehen mit blauen Heften in der Hand herum, sie murmeln einander zu, gehen da und dorthin, blicken wieder in die Hefte und treten zu dem Tischchen, um Bleistiftnotizen in der Rolle anzubringen. Dann stockt die Probe einen Augenblick, die Herren schauen, die Hände in der Hosentasche, vor sich hin, die Damen heben gähnend die Hefte vor den Mund, der Regisseur am Tische aber sieht sich phlegmatisch die Gesellschaft an und wiederholt die stehenden Worte: »Die Kleinigkeit noch einmal!«
Es hat niemand mehr Freude an der Sache. Seit Wochen wird die Novität vorbereitet, das große Ausstattungs-Vaudeville, von dem man sich Wunder verspricht, und noch weiß kein Mensch, wann die Aufführung stattfinden soll. Es ist ein offenes Geheimnis, daß die neuen Kostüme nicht zu beschaffen sind! Die Ausstattung erfordert große Summen, die Lieferanten aber sind mißtrauisch geworden und weigern sich, Kredit zu geben. So spielt man Abend für Abend das alte Repertoirestück herunter. Im Publikum wundert man sich, daß die abgedroschene Burleske so gut geht. Der Kassierer aber weiß das besser. Sonnabend und Sonntag macht sich das Geschäft ja noch leidlich, in der Woche aber werden die Freibillets zu Hunderten versendet und doch ist das Haus kaum halbvoll zu bekommen.
Die Stimmung ist schwül in dem kleinen, schmucken Theater im äußersten Westen der Stadt. Der Direktor ist heute überhaupt noch nicht zur Probe erschienen. In großen Schritten geht er draußen in dem öden Foyer auf und ab, ein vierschrötiger, älterer Mann mit gebeugter Haltung und finsterem Blick. Halb ängstlich, halb erwartungsvoll blicken ihn aus der Entfernung die kleinen Choristinnen, die Theater-Arbeiter und Statisten an. Vorgestern war Gagetag. Ob es wirklich noch einmal Geld giebt? ...
Immerhin ist der Direktor noch da. Das ist doch ein Trost.
»Fräulein Ernesti, passen Sie bitte auf.« sagt der Regisseur drinnen auf der Bühne. »Ihre Sportzeitung können Sie nachher studieren ... Sie haben schon wieder Ihr Stichwort versäumt ... bei den Worten: ›wer klopft so spät ... Mensch oder Geist ... tritt ein!‹ haben Sie durch die Mitte zu erscheinen!«
»Ich finde das Stichwort nicht.« erwidert Fräulein Ernesti, verdrießlich in dem Buch blätternd .... »jeden Tag wird an der Rolle herum korrigiert und gestrichen .... kein Mensch kann daraus klug werden ...«
»Mein Gott ... zweites Bild ... siebente Szene,« sagt der Regisseur und reicht ihr einen Bleistift, »da ... notieren Sie es sich!«
»Wozu die Mühe?« bemerkt eine kleine Blondine schnippisch, die einen Pagen markierend dicht daneben steht, »gespielt wird's ja doch nicht ...«
Ringsum ein drohendes, beistimmendes Murmeln.
»Fräulein Schulz ... ich nehme Sie mit einer halben Monatsgage in Strafe, wenn ...«
»Erst die Gage sehen!« erwidert die Blondine gelassen. Ein stürmisches Gelächter folgt. Der Regisseur klopft wütend auf den Tisch. »Ich bitte um Ruhe ... die Kleinigkeit noch einmal ...«
Aber auf dieser verkrachenden Bühne ist die Disziplin schon seit Wochen erschüttert. Niemand scheint gesonnen, der Aufforderung nachzukommen. »Lassen's uns aus mit dem Schmarrn!« erklingt aus dem Hintergrund eine Stimme, die dem dicken Komiker angehört, »mir probier'n eh schon's zwanzigste Mal!«
»Nun denn ... so fahren wir fort!« ... sagt der Regisseur unsicher. »Fräulein Ernesti ... wenn ich bitten darf ...«
»Ach ... warum denn?«, sagt die Ernesti und klappt ihr Buch zu, »ich kann meine Rolle doch nicht ... «
»Ich auch nicht,« sekundiert die Blondine.
»Weiß der Himmel!« Der Regisseur steht erregt auf – »seit dreißig Jahren bin ich bei der Bühne ... aber dergleichen habe ich noch nicht erlebt ...«
»Wir auch nicht!«, ruft der gereizte Komiker ...
»Vorgestern war Gagetag!« bemerkt die Blondine. Sie weiß, daß diese Bemerkung einen Sturm entfesselt.
»Gagetag!«, tönt's von allen Seiten, – »unser Geld ...«
»Sie werden es bekommen ...«
»Aber wann ...?« viele Stimmen schreien durcheinander.
»Heut Abend streikt Chor und Comparserie,« verkündigt die schadenfrohe Blondine ... »uns gehts nicht besser!«
»Sie brauchen wohl die 75 Mark besonders dringend?« ruft hinter ihr eine spitze Frauenstimme ... »wenn man bloß dreitausend Mark Miete zahlt ...«
»Die Probe ist aufgehoben!« ... Der Regisseur giebt die Schlacht verloren. Er setzt seinen Hut auf und verläßt die Bühne.
Erna Ernesti hat den Skandal mit blassierter Ruhe angehört. Dergleichen kommt jetzt jeden Tag hier vor, aber ihr, dem Stern der Bühne, würde eine Einmischung nicht wohl ziemen. Immerhin ist sie froh, daß die Probe auf die Art ein Ende erreicht. So kommt sie doch noch rechtzeitig zum Rennen.
Draußen im Flur lehnt der Direktor am Fenster. Seine Leute gehen schweigend an ihm vorüber, die meisten, ohne zu grüßen. Er achtet nicht darauf. Angstvoll starrt er auf die kleine eiserne Bühnenthüre, bis endlich Fräulein Ernesti in ihr erscheint. Selbst in diesem Augenblick fällt es ihm wieder auf, wie hübsch sie ist! Eine schlanke, biegsame Gestalt über Mittelgröße, mit tadellosen Chic gekleidet, und dazu das richtige, blendende Bühnengesicht, scharf umrissene, kecke Züge, große sprechende Augen, schmale geschwungene Lippen und lässige Anmut in Haltung und Sprache.
»Liebste Ernesti,« der Direktor tritt flüsternd auf sie zu, »wie stehts? ... Haben Sie Ihren Grafen gesprochen?«
»Noch nicht,« sagt die junge Dame lakonisch, »warten Sie's nur ab!«
»Als ob Sie nicht wüßten, daß der Chor heute Abend streikt, wenn ich die Gage nicht auftreibe,« murmelt der Direktor verzweiflungsvoll ... »und ich kriege kein Geld mehr ... 's ist alles umsonst ...«
»Waren Sie schon bei Krakauer?«
»Giebt nichts ... keinen Groschen ... er läßt mich fallen ... wenn ich nur ein paar tausend Mark bekomme, um den Chor das Maul zu stopfen ...«
»Sie haben doch die Tageskasse ...«
»Ich hatte sie« ... der unglückliche Bühnenleiter sieht vorsichtig um sich ... »vorhin kam wieder der Gerichtsvollzieher ... ich mußte mein ganzes bares Geld hergeben ... wenn die Vorstellung heute Abend nicht stattfindet, kann ich nicht einmal die Billets zurückzahlen.«
»Na schön!« Die Ernesti blickt sinnend vor sich hin, »vor dem Rennen ist mit dem Grafen überhaupt nicht zu reden. Aber nachher, wenn er gewonnen hat ... thut er's schon ...«
»Wie heißt das Pferd?« fragt der Bühnenleiter beklommen.
»Satanella ... er hat es mir zu Ehren so getauft ... nach unserer großen Novität ...«
»Liebstes, bestes Fräulein!«, der Direktor drückt ihre sein behandschuhte Hand, »sehen Sie zu, was Sie machen können ...«
»Es wird schon gehen,« meint die Schauspielerin, »aber Sie wissen ... ich kriege dafür die guten Rollen ...«
»Aussuchen dürfen sie sich, was Sie wollen ... aber schaffen Sie Geld ... so viel Sie können ... «
»Um halb sechs bin ich hier.« Mit flüchtigem Kopfnicken trennt sich Fräulein Ernesti von ihrem Direktor.
Zu diesem sind inzwischen ein paar Männer herangetreten, Abgeordnete des Chors und der Theater-Arbeiter. Die Hüte in der Hand sehen sie den Direktor unsicher an, der sich mit einem plötzlichen Ruck aufrichtet.
»Ich weiß schon, was Sie wollen, meine Herren,« sagte er rasch und leutselig; »noch heute Abend wird die Gage ausgezahlt!«
»Vor der Vorstellung.«
»Vor der Vorstellung. Es ist alles in Ordnung.«
Er glaubt das in diesem Augenblick wirklich, und auch die andern glauben ihm. Gehören sie doch nicht umsonst der Bühnenwelt an, der Welt des Optimismus und des Leichtsinns. Rasch dringt die frohe Kunde durch alle Räume. »Heute Abend«, heißt es überall, »giebts Geld wie Heu!« Wo es herkommen soll, weiß keiner so recht, und das ist gut. Denn bange Zweifel würden doch so manchen beschleichen, wenn er sähe, wie das Schicksal dieser kleinen Welt an den Hufen eines Rennpferdes hängt, einer schmächtigen Stute, die jetzt eben, in Decken gehüllt und sorglich vom Stallburschen geführt, in dem steifen, stelzenden Gang des Vollbluts den Stall ihres Trainers zu Westend verläßt ...
Die paar biederen Leute, die sich an der Vormittags-Kasse ihre Billete holen, schauen scheu und bewundernd Fräulein Ernesti nach, während sie rasch durch den Vorraum hinaus auf die Straße schreitet. Wie geheimnisvoll und romantisch erscheint ihnen die Bühne, wie glücklich die begnadeten Geschöpfe, denen es vergönnt ist, auf den weltbedeutenden Brettern zu wirken!
»Na, Kind ... was machen Sie denn für ein Gesicht?« sagte die hübsche Schauspielerin draußen zu einer Kollegin, die da anscheinend sehr niedergeschlagen auf die Pferdebahn wartet. Sie ist eine recht angenehme Erscheinung, aber ihre blassen Züge sind zu weich für die Bühne und ihr Auftreten ist befangen, fast ängstlich.
»Ach,« seufzte Käthe Krauß, »wäre ich nur am Hof-Theater in Grünstett geblieben! Ich hab' eine Wut auf den Agenten, der mich hierher gebracht hat. Was hilft mir nun die hohe Gage, wenn ich sie nicht bekomme?«
Die andere schaut sie mitleidig, und dabei ein wenig verlegen an. Es ist bekannt, daß die Krauß durchaus solide lebt! Sie haust mit ihrer Mutter, einer verwitweten Steuerrätin oder dergleichen, zusammen in einer bescheidenen Gartenwohnung. Dort kochen sie sich selbst ihr Essen auf dem Ofen, nähen die halben Nächte durch an den Kostümen und während die Rätin morgens das Zimmer fegt, lernt Käthe mit rührendem Eifer an der kleinen läppischen Rolle, die sie in dem neuen Ausstattungsstück spielen soll. Für Erna Ernesti ist dergleichen ein Rätsel. Wenig Talent, gar kein Toupet, dabei noch solide – und das geht zur Bühne! Und sie ist die einzige nicht. Sie hat mehr Leidensgefährtinnen, als man im Publikum glaubt.
»Hören Sie mal, Krauß,« sagte ihre glänzende Kollegin etwas zögernd, »Sie sind ganz gewiß in Geldklemme ... ich sehe es Ihnen an ... da ... ich leih' Ihnen eine Kleinigkeit... geben Sie mir's wieder, wann Sie wollen ...«
Damit drückt sie der andern ein Zwanzigmarkstück in die Hand, die ein abgetragener, an den Nähten mit Tinte gefärbter schwarzer Glace bekleidet und dann setzt sie, als sie bemerkt, wie die Krauß unwillkürlich zusammenzuckt, halb spöttisch dazu: »Nehmen Sie's nur ... ich kann's mir ja von meiner Gage zurückgelegt haben ...«
Ihr Gegenüber weiß natürlich, daß das Geld von dem Grafen Parsenow stammt, dem bekannten Lebemann, der schon Unsummen auf die Ernesti verschwendet hat. Aber sie will sie nicht kränken und dann ... sie braucht es wirklich so nötig. Mit niedergeschlagenen Augen, als schäme sie sich für die andere, steckt sie das Darlehen in das Portemonnaie.
»Na ... Adieu!« sagt die Ernesti. »ich muß jetzt zum Rennen!«
Mit leichten, wiegenden Schritten geht sie ein kurzes Ende die Straße hinunter bis zur nächsten Ecke. Dort hält eine kleine, elegante Equipage, glatt lackiert, mit blankem Geschirr und einem ernsthaften Kutscher, ganz wie es sich gehört. Sie steigt ein. Der Kutscher dreht sich um und faßt an den Hut. »Nach Charlottenburg ... aber schnell!«
Von dem Perron des vorbeifahrenden Pferdewagens sieht ihr Käthe Krauß gedankenvoll nach. Es muß doch wunderbar sein, solch einen eigenen Wagen zu besitzen! Wenn sie einen hätte, müßten aber Gummiräder daran sein ... und der Kutscher müßte eine große schwarze Pellerine tragen. Vielleicht könnte auch noch ein Diener daneben sitzen und herabspringen, um mit abgenommenem Hut den Wagenschlag aufzureißen. Freilich gehörte auch für sie eine entsprechende Toilette dazu. In Gedanken verloren fängt sie an sich ein reizendes Herbstkostüm zu komoniren, bis ihr plötzlich der vor ihr lehnende und sie unverwandt anstarrende Student eine dicke Tabackwolke ins Gesicht bläst, daß sie erschrocken zusammenfährt ...
Erna liebt es, schnell zu fahren. Auf das Pferd kommt es nicht weiter an. Schlimmstenfalls kauft ihr Parsenow ein neues. Blitzschnell rollt der Wagen durch die breiten Avenuen des Westens, über die Friedrich-Wilhelm-Straße hinein in den Tiergarten. Eine herbe frische Luft weht ihr entgegen, die Sonne flimmert in dem bunten Laub und schläfrig lehnt sich die Schauspielerin in die Kissen zurück. Komisch, wie Erinnerungen zuweilen so ganz unvermittelt auftauchen ... die Begegnung mit der Krauß muß sie darauf gebracht haben. Sie sieht wieder eine finstere Hofwohnung vor sich, weit draußen in einer Mietskaserne der Rosenthaler-Vorstadt, sie hört wieder die heisere Stimme des Vaters, wenn er betrunken des Abends heimkehrte, das Keifen der Mutter, das Wimmern der kleinen Geschwister. Und dann das öde Passementerie-Geschäft, in dem sie zehn Stunden täglich hinter dem Laden stand und die Kunden bediente und auf der Leiter auf und nieder stieg. Sie sieht auch den bebrillten, magern Studenten vor sich, mit dem sie ihr erstes Verhältnis hatte. Gott – war das ein Rauhbein! Unwillkürlich muß sie lächeln bei dem Gedanken, wie vergnügt sie beide waren, wenn sie im Qualm des American-Theaters saßen oder beim Eierhäuschen gondelten, um dann mit der Stadtbahn dritter Klasse zurückzukehren ...
Doch da: ein Rasseln um sie her ... Stimmengewirr ... Menschen ringsum. Sie sind am großen Stern angelangt und schwenken in die Wagenreihe ein, die jetzt in ununterbrochenem Zuge, von einem Wald von wehenden Peitschen überragt, die Charlottenburger Chaussee dahinrollt. Ein Hornstoß ertönt hinter ihr. Ein Viererzug rollt vorbei. Auf dem Deck der Mail-Coach flimmern Uniformen und helle Herrenmäntel. Mit verbindlichem Lächeln grüßen einige der Insassen zu ihr herunter, die andern folgen ihrem Beispiel, und mit anmutiger Kopfneigung dankt die Schauspielerin auf den Gruß, den ihr die Vertreter des Hochadels und der Hochfinanz bieten ...
»Kennst Du die Dame, Kurt?« fragt in der daneben fahrenden Droschke Frau von Braneck ihren Bruder, der schräg auf dem kleinen Klappsitz vor ihr sitzt, mit schimmernder, ganz neuer Ulanen-Uniform angethan und mühsam ein Monocle in dem blutjungen, bartlosen Angesicht balancierend. Der Leutnant blickt seine schöne Schwester etwas verlegen an ... aber schließlich ... sie ist ja Witwe .... schon seit fünfviertel Jahren ... warum soll er es ihr nicht eingestehen, daß er Fräulein Ernesti vom Eden-Theater allerdings kenne! ...
»Oh ... eine Schauspielerin!« sagt Frau Hilda gelangweilt. Ihr Interesse scheint erloschen.
»Ja ... sie ist auch Schauspielerin ...« meint der Leutnant etwas boshaft. Über ihre Beziehungen zu Parsenow schweigt er wohlweislich. Der Graf macht Frau von Braneck schon seit längerer Zeit den Hof, und er, Kurt, der es aufrichtig ehrlich mit seiner Schwester meint, will sie von der Partie nicht abschrecken. Es ist ja wahr ... Parsenow ist ein Roué, dabei aber ein tadelloser Gentleman und ein glänzender Kavalier. Wird er wirklich einmal solide, was vorderhand allerdings keiner seiner Bekannten für möglich hält, so giebt er den besten Ehemann unter der Sonne.
»Ist das eine Welt!« Knurrig schaut der alte Major von Döbeln seine neben ihm sitzende Tochter an, »was sagst Du dazu, Hilda? ... wir rumpeln hier im Mietsfuhrwerk und diese Theaterprinzessinnen fahren in eigenen Equipagen an uns vorbei!«
Hilda erwidert nichts. »Wenn Sie erst wüßte, wer die Equipage gezahlt hat,« denkt Kurt bei sich. Auch der Alte schweigt ergrimmt. Er haßt Berlin! Was er hier sieht und hört, ist ihm ein Greuel. Wie still und gemütlich ist es auf seinem pommerschen Gut, das er sonst jahrelang nicht verläßt, nachdem er den bunten Rock ausgezogen. Wie schön wäre dort jetzt eine Hühnerjagd auf den weiten, trockenen Stoppelfeldern !
Aber er begreift ja selbst, daß es nicht anders geht. Ein Jahr lang hat Hilda nach dem Tode ihres Mannes auf dem einsamen Edelhof mit ihm gelebt und, wie es Brauch, ihre Trauerzeit in voller Zurückgezogenheit verbracht. Die Welt verlangt es nun einmal so, mochte die junge Witwe auch in Wirklichkeit ihrem Gemahl nur spärliche Thränen nachweinen. Denn glücklich war ihre Ehe nie. Die beiden verstanden sich nicht und lebten kinderlos, unfroh neben einander her, bis der kränkliche Herr von Braneck den einzigen gescheidten Einfall seines Lebens, – nach Ansicht seines Schwiegervaters – bekam und alsbald ausführte. Er legte sich hin und starb. Seiner Frau hinterließ er ein schönes Vermögen, das sicher in einer Berliner Bank ruhte, und die goldene Freiheit.
Die Freiheit ist doppelt kostbar, wenn man dazu die Jugend hat, sie zu genießen. Hilda von Braneck war jetzt 27 Jahre alt; aber sie sah jünger aus, eine große, schlanke Blondine mit übermütigen Zügen, mit großen, wissenden Augen und doch ein fragendes Lächeln um die aufgeworfenen Lippen, halb mädchenhaft in ihren Bewegungen, halb frauenhaft gemessen.
Sie liebte Parsenow. Das wußte sie selbst so gut wie jeder andere, den es anging. Daß sie dem Grafen nicht gleichgültig, war ebenso Thatsache. Seit Wochen sahen sie sich jetzt in Berlin auf dem Rennplatz, in Theatern und Gesellschaften. In nächster Zeit mußte die Entscheidung fallen.
So dachte wenigstens der Major. Der Berliner Aufenthalt war ihm nachgerade unerträglich. Unwirsch saß der kleine Herr, wie gewöhnlich kerzengerade aufgerichtet in dem Wagen. Zornig blitzten seine Augen aus dem kupferbraungebeizten Gesicht, der schlohweiße, aufgedrehte Schnurrbart wehte im Winde. Nach seiner Überzeugung war Berlin überhaupt nur von Juden und Demokraten bevölkert, in jedem Begegnenden sah er seinen persönlichen Feind, der bei den nächsten Wahlen ihm zum Tort Bebel oder Richter in den Reichstag entsenden würde.
»Du, Kurt« ... sagt er endlich etwas milder werdend, »wo ist denn das Theater, in dem die Dingsda ... diese Donna von vorhin auftritt ...?«
»Am Nollendorfplatz ... dies Frühjahr eröffnet ...«
»So ... ist das Stück denn hübsch das sie da spielen? ...«
»Gott! ... Tricotsache ...« meint der Leutnant achselzuckend, ... »wem's Spaß macht.«
»Nun ... ansehen könnte man sich schon mal dergleichen ...« der Major wendet sich ernst zu Hilda. »was denkst Du darüber, Kind ...«
Ein flüchtiges Lächeln huscht über Frau von Branecks Lippen. »Gewiß, Papa ... gehen wir hin! Wir haben ja nichts vor heute Abend ...«
Dann blättert sie in der Sportwelt, die ihr Bruder von einem, sich auf das Wagenbrett schwingenden Händler erstanden hat. Mit vielsagendem Lächeln zeigt er ihr eine Stelle unter den Pferdenennungen. Da prangt Satanella: Graf Parsenows dunkelbraune Stute vom Geheimrat aus der Miß Hellyett, 4 Jahre alt, mit 61 1/2 Kilo gehandicapt.
»Oh!«, sagt Frau Hilda »meinst Du, daß sie gewinnen wird?«
»Favorit ist natürlich ›Floßhilde‹, erwidert ihr Bruder, »aber da vorn an der Spitze des Blattes findest Du einen äußerst scharfsinnigen Artikel über die Chancen der einzelnen Gäule.«
»Du ... das verstehe ich nicht«, erklärt nach kurzer Lektüre Frau von Braneck, »was soll denn das um Gotteswillen heißen: ,... so fassen wir doch unser Urteil dahin zusammen, daß, wenn auch ›Floßhilde‹ bei ihrem enormen Stehvermögen sicher die zehntausend Mark landen wird, doch ›Satanella‹ die einzige sein dürfte, die vielleicht auf der Heimreise im Kielwasser der Stute zu leben vermag ... ?‹ Ist das nicht Unsinn?«
»Keineswegs!«, unterbricht sie der Major gereizt, »das heißt: es kann die ›Floßhilde‹ gewinnen oder die ›Satanella‹ oder sonst ein Pferd. Um uns das zu sagen, brauchen die Sportsleute nu mal dreifach so viel Worte wie 'n gewöhnlicher Mensch ...«
»Das stimmt«, meint der Leutnant, »aber es macht sich schön!«
»Satanella muß gewinnen« entscheidet die schöne Frau den Fall, »ich setze zehn Mark auf sie ...«
Zwei starkknochige Orloff-Traber mit fußlang flatternden Schweifen reißen, pfeilschnell die Vorderbeine herausschnellend, im Sturm eine leichte Carosse hinter sich her. An der Reihe der Mietsdroschken vorbei geht die sausende Fahrt, die Equipagen werden überholt und bewundernde Blicke richten sich auf das prachtvolle Gespann.
Ein müder Mann sitzt in dem Wagen; kaum Ende der Dreißiger, aber abgelebt und mit stark gelichtetem Haar. Ohne rechts und links zu schauen lehnt er teilnahmslos da. Es ist, als ob sein Gesicht, seine ganze Gestalt in der Haltung weltmännischer Erschlaffung erstarrt sei. Das ist die wahre, echte Blasiertheit! Manche der jungen, lebenslustigen Leutnants scheinen das bei seinem Anblick zu fühlen. Sie lassen die Monocles fallen und geben die Miene erzwungener Gleichgültigkeit auf.
Plötzlich kommt Leben in den steinernen Gast. Er beugt sich im Wagen vor und lüftet höflich seinen grauen Cylinder. Dann saust die Carosse vorbei.
»Wer grüßte Dich denn eben, Papa?« fragt Frau Hilde neugierig.
»Das« ... der Major streicht sich den weißen Schnurrbart auf, »das ist Dein Bankier, mein Kind, oder vielmehr der Deines Mannes, der Dir Dein Erbe verwaltet ... unter meiner Aufsicht natürlich ... wir hatten erst gestern eine Conferenz ... Er schlug vor, Dir Disconto-Commandit zu kaufen ... was meinst Du?«
»Ach ... davon verstehe ich doch nichts,« Frau von Braneck macht ein etwas gedrücktes Gesicht, »aber – weißt Du – sehr vertrauenerweckend sieht er mir eigentlich nicht aus.«
»Das mag schon sein, Kind,« sagt der Major, »aber es ist eine gute Bank. Harwitz hat sein Geld dort, die Mundlingens, selbst der alte Fuchs, der Graf Rönneburg ...«
» – Ja – weil man da höhere Prozente kriegt« bemerkt Kurt. »Aber wie Du willst,« fährt der Major fort »heben wir das Geld ab ... tragen wirs wo anders hin ... meinetwegen in die deutsche Bank...«
»Ihr müßt das besser wissen.« Hilda sieht immer noch etwas besorgt aus, »... es ist nur so ein Gefühl von mir.«
»Ich werde mich erkundigen« beschwichtigt sie ihr Vater, »ein Vierteljahr muß es ja doch noch liegen bleiben.«
Inzwischen haben sie Charlottenburg hinter sich gelassen und fahren den Berg empor. Immer toller wird das Gedränge um sie, berittene Schutzleute fluchen hinein und fern über dem niedrigen Laubwald zeigen weithin flatternde Fahnen und windverwehte Musik den Rennplatz an.
Wagen auf Wagen rollt da vor. Offiziere mit ihren Damen, Sportfreunde in Massen, Börsianer, denen das Rennprogramm eine noch willkommenere Aufregung bietet als der Courszettel, Buchmacher mit tadellosen Gaunergesichtern, zwerghafte Jockeys, Kriminalbeamte in Civil, staunende Fremde aus der Provinz, Taschendiebe, ein buntes Gewirr in allen Schattirungen von der großen Welt herab bis zur Halbwelt, die in zahlreichen, extravagant gekleideten Vertreterinnen den Platz belebt.
Es leuchtet und flimmert um die hochaufragenden Tribünen. Die bunten Uniformen blitzen, die hellen Damenkleider schimmern auf dem lichtgrünen Plan. Ein leichter Wind spielt mit den vielfarbigen Fahnen, an dem blaßblauen Himmel ziehen kleine weiße Wölkchen schwarze Menschenmassen wogen und pilgern über das Feld zu den billigen Plätzen, weithin bis dort wo die Ebene in violettem Dunst mit dem Horizont verschwimmt. Aus dem Musiktempel klingen die Töne des Intermezzos aus der »Cavalleria« und verklingen klagend und jauchzend über dem wimmelnden Gewühl.
Da zuckt es kurz und rasselnd in dem umzäunten Schalter-Viereck hinter der Tribüne auf. Einmal, zweimal, dann immer häufiger, fast ununterbrochen wie das Feuer einer Schützenlinie. Der Totalisator wird lebendig. Sein Stampfen verschlingt das Intermezzo, es läßt das harmlose Geplauder verstummen und zieht in Hoffnung und Aufregung alles zu sich heran. Die professionellen Sportfreunde drängen sich, ihre Vereins-Karte oder das Totalisatorticket vorweisend, massenhaft durch die Drehgitter. Es ist ein Gewühl, wie um einen Bienenstock am Frühlingsmorgen, wie um ein brennendes Licht, das in der Sommernacht die Motten anlockt.
Und was sind es mehr als thörichte Motten, die Unerfahrenen alle, die hier in den verzehrenden Glanz hineinflattern! Für die paar Sachverständigen eine ernste Spekulation, für die Mehrzahl des Publikums ein aufregendes, kleines Vergnügen, ist der Gang zum Totalisator für manchen andern ein Schritt auf Tod und Leben. Hier versucht der verschuldete Kaufmann, sich noch einmal herauszureißen, der Defraudant, mit einem kecken Entschluß die Unterschleife zu decken. Hier setzt der übernächtige Caféhauskellner seine Trinkgelder ein, der Commis verspielt seinen Gehalt, der Leutnant opfert seine Gage, der Referendar seinen Wechsel und der Himmel mag wissen, wie beide den Rest des Monats durchkommen werden, wenn ihren kühnen Berechnungen fehlschlagen. Und immer wieder rasselt der Totalisator und immer neue Scharen strömen herzu.
Schon hat in Westend das erste Hürdenrennen mit dem Sieg der rotgelben Streifen des » Captain Black« geendet, schon liegt die Charlottenburger Chaussee wieder verödet da, nur durch langsam knarrende Lastfuhrwerke und die Wagen der Pferdebahn belebt, da fährt noch ein Nachzügler durch den Tiergarten den Höhen zu.
Eine hohe, geschmeidige Gestalt, Mitte der Dreißiger, sehnig gebaut, mit einem langen, schwarzen Schnurrbart in dem gebräunten Gesicht, über dem die selbstbewußte Langeweile der high-life wie eingemeißelt liegt. Eine Cigarette qualmt zwischen den Lippen, die lebhaften, scharf blinkenden Augen starren ziellos in das Leere. Graf Parsenow ist offenbar in tiefe Gedanken versunken.
Er hat auch allen Grund dazu ... schon seit mehr als Jahresfrist. Da stellten sich bei ihm die ersten Anzeichen ein, daß er auf der Kippe stehe. Im Leben eines jeden vom Schlage Parsenow kommt dieser kritische Moment. Die Gäule fraßen ihn nach wie vor in ihren Winterquartieren arm, Erna schickte ihm mit gewohnter Gewissenhaftigkeit ihre Rechnungen zu, die Gläubiger legten denselben Wert auf pünktliche Zahlung der Saldis wie sonst, – aber die Einnahmen blieben aus. Das Spielglück hatte sich von ihm gewandt. Er war zu klug, es erzwingen zu wollen, aber er spielte doch und spielte, und zu Ende des Winters war der größere Rest seines schon ohnedies stark zusammengeschmolzenen Vermögens dahin.
In der Renn-Campagne des Frühjahrs blieb der ersehnte Umschwung aus. Wo er seine Pferde laufen ließ, kauerte hinter dem Jokey der Mißerfolg im Sattel. Und mehr und mehr schwand das Geld.
Als er zur Zerstreuung mit Erna um Pfingsten nach Paris fuhr, hatte er noch etwa fünfzigtausend Mark. Das war alles.
Zu spielen wagte er jetzt nicht mehr. In einer Nacht kann man solch eine Summe und mit ihr das Betriebskapital, die Waffe im Kampf ums Dasein, verlieren. Eine Weile vermochte er sich ja noch zu halten, aber wenn er an den lauen Juni-Abenden über die Boulevards schlenderte, schien ihm seine Lage wie die eines Mannes, dem man die Wahl frei läßt, ob er lieber langsam im Sumpfe untergehen oder rasch von den Wogen verschlungen werden will.
Er entschied sich für das letztere. Es war da bei einem französischen Züchter für einen hohen Preis ein prächtiger Steepler zu verkaufen. Ihm vertraute er sein Glück an. Er importierte ihn, er meldete ihn bei den großen Herbstrennen an und schloß Wetten auf ihn ab, so hoch er konnte. Er bekam lange Odds; denn das Pferd war auf deutschen Bahnen noch unbekannt, seine Abstammung nicht die beste. Rechtfertigte die Stute das Vertrauen, das er in sie setzte, so mußte sie ihn jetzt im Laufe des September und Oktober retten. Er ging dann mit einem neuen Vermögen in die Karten-Campagne des Winters.
Heute sollte ›Satanella‹ zum ersten Male in dem großen Jagdrennen laufen, und ihr Besitzer – Parsenow mußte es sich mit Beschämung eingestehen – war geradezu erregt, beim Gedanken an die kommenden Ereignisse. So vornehm kühl auch sein Gesicht blieb, innerlich wogten Hoffnung und Zweifel peinvoll auf und nieder. Merken würde das niemand – dazu war er seiner jahrelang geübten Selbstbeherrschung zu sicher – aber unangenehm war diese ganze Lage. Noch hielt ihn alle Welt für gut fundirt, niemand ahnte, daß er niederbrechen könne und er – er mußte beinahe selbst lachen, so komisch erschien ihm die Sache – er trug noch 210 Mark und 50 Pfennige bei sich. Mehr besaß er nicht. Er hatte sich vorhin, in einer Anwandlung dumpfen Erstaunens die Summe auf dem Schreibtisch vorgezählt.
Nun ... in einer Stunde konnte Satanella die zehntausend Mark gewonnen haben. Ebensoviel hatte er auf sie an verschiedenen Stellen gewettet – mit eins zu vier. Dann hatte er fünfzigtausend Mark ... immerhin ein Anfang.
Und sein Gesicht hellt sich allmählich wieder auf. Der Wagen hielt. Graf Parsenow sprang elastisch heraus und schritt an der Tribüne vorbei quer über den Sattelplatz zu den Ställen.
»Satanella da?« fing er hastig beim Eintreten.
» All right, sir!« antwortete aus dem dunkeln Innern die heisere Stimme der Trainers.
II
Frau von Braneck blickt suchend umher auf dem weiten, menschenwimmelnden Plan. Wo nur Parsenow bleibt? Eine wahrhaft unerträgliche Ungeduld hat sich ihrer bemächtigt. Am Ende ist er erkrankt oder seinem Pferde etwas zugestoßen ...
Da ... endlich! Die hohe, straffe Gestalt des Grafen nähert sich von dem Sattelplatz her der Tribünenpromenade. Auf der einen Seite schreitet neben ihm der Trainer, ein magerer, alter Engländer mit mißvergnügtem Gesicht, auf der andern ein junger, schmächtiger Husar, Leutnant von Wendlau. Er soll Satanella, die beim Handicap gut weggekommen ist, steuern. Parsenow vertraut ihm unbedingt. Er sitzt vorzüglich zu Pferd, hat, trotzdem er in diesem Jahr zum ersten Male reitet, schon drei Rennen gewonnen und besitzt das Geheimnis, die widerspenstige und nervöse Satanella ruhig unter seiner leichten Faust gehen zu lassen. Das ist sehr wichtig. Denn Satanella bekundet durch tausend Unarten ihre Abstammung von den ältesten Adelsgeschlechtern der Pferdewelt. Sie bricht vom Start weg, sie hat eine offene Abneigung gegen Wassergräben und springt dafür die Hürden so leichtsinnig, daß sie oft beinahe mit den Vorderbeinen hängen bleibt, kurz, sie erfordert Ruhe und Geduld in hohem Maße.
Parsenow trennt sich von seinen beiden Begleitern, die, eifrig diskutierend zum Stall zurückkehren, und blickt suchend um sich. Einen Augenblick verschwindet er in dem Gewühl, dann taucht er wieder auf und mit einem eifersüchtigen Schrecken sieht Frau von Braneck, daß eine Dame neben ihm steht. Sie kehrt ihr den Rücken zu. Aber sie erkennt sofort an der Toilette, daß es die Schauspielerin von vorhin ist.
Was mögen die beiden nur miteinander haben? ... aber schließlich ... Frau Hilda beruhigt sich wieder. Sie weiß ja doch, daß Parsenow kein Tugendspiegel ist, sondern es erst unter ihrem sanften Einfluß werden soll. Nein ... ihr erster Gatte, der ewig Kränkelnde und Hüstelnde, hat sie nicht glücklich gemacht trotz seines peinlich moralischen Lebenswandels ... man darf nun einmal von den Männern nicht allzuviel verlangen – wenigstens vor der Ehe ...
»Was hast Du denn?« sagt inzwischen Parsenow sehr kurz zu Erna, »Du weißt doch, daß ich das nicht liebe ...«
»Aber es ist dringend, Konrad,« erwidert die Schauspielerin und ein Rot des Unmuts zieht über ihr hübsches Gesicht.
»Was ist dringend? Geld natürlich ...«
»Ja ... aber nicht für mich ... wir müssen ...«
»Nach dem Rennen! ... jetzt habe ich keinen Groschen ...«
»Wo treffe ich Dich, wenn das Rennen gewonnen ist?«
»Ich hole Dich zum Theater ab ... nach fünf...«
»Und wenn Du verlierst?«
»Dann bin ich nicht zu sprechen,« sagt der Graf ruhig, »merk' es Dir bitte ... absolut nicht zu sprechen.«
»... als ob es mir Spaß machte, dann Deine schlechte Laune auszuhalten!« Erna wendet sich trotzig ab, »also viel Glück!«
Auch noch Glück wünscht ihm das unvernünftige Mädchen! Wäre Parsenow abergläubischer, so könnte ihn das wirklich verstimmen. Aber auch so schreitet er mit ziemlich umwölktem Gesicht auf Frau von Braneck zu.
»Ich komme nur auf einen Augenblick, verehrte Frau, um mich vorzustellen ...«
»Bitte ... lassen Sie sich nicht stören, Graf.« sagt die schöne Frau unmutig, »ich sehe, Sie haben da unten Bekanntschaften ...«
».... Denen man nun einmal in Berlin nicht entgehen kann,« erwidert Parsenow gelassen ... »sollte ich wirklich so glücklich sein, damit Ihren Unmut hervorgerufen zu haben?«
»Ich bin gar nicht eifersüchtig.« sagt Frau Hilda vorschnell und errötet gleich darauf lebhaft. Parsenow lächelt leise, der Major schmunzelt vor sich hin, das Eis ist gebrochen und eine lebhafte Unterhaltung gerät in Fluß. Natürlich dreht sie sich um Satanella. Frau von Braneck hat bereits ihren Bruder beauftragt, zehn Mark auf sie zu setzen und ist in großer Erregung über den Ausgang der Finanzoperation. Endlich verabschiedet Parsenow. Es ist die höchste Zeit. Nach dem Rennen verspricht er bestimmt, sich noch einmal zu zeigen, und schreitet dann schnell durch die zerstreuten Gruppen zum Sattelplatz. Sein Herz pocht hörbar und er muß unterwegs stehen bleiben, um sich den Schweiß von der Stirne zu wischen.
Das erste Glockenzeichen!
Das große Ereignis naht. Geschäftig trotten, Programm und Bleistift in der Hand, die Sportfreunde zu dem Nummerpfahl, in dessen breite Scheibe die Beamten eben die Ziffern einfügen. Wenige Schritte davon stehen die dichten Klumpen der Buchmacher und ihrer Kundschaft. Es raunt und krächzt und wispert in diesem heiligen Kreise. Ein zischelndes Stimmengewirr steigt daraus hervor, die Namen Floßhilde und Satanella schlagen immer wieder an das Ohr.
Ah! Endlich geht die Zifferntafel in die Höhe. Die Bleistifte geraten in Thätigkeit. Man notiert die Namen der laufenden Pferde und der Reiter, man prüft noch einmal das Gewicht, man schwankt und überlegt, man zieht Freunde zu Rat und sucht Brocken aus der Unterhaltung der Buchmacher aufzuschnappen und endlich beginnt das Rasseln und wird immer stärker und stärker. Der Totalisator gerät in Thätigkeit.
Frau von Braneck findet es zwar außerordentlich ungalant, daß den Damen der Eintritt in das umzäunte Viereck mit seinen langen Schalterreihen verboten ist, aber es interessiert sie doch, sich von außen das Getriebe anzusehen. Es herrscht innen ein Getümmel, daß man kaum mehr vorwärts kann. Die Drehthüren der schmalen Pforten sind in unaufhörlicher Bewegung. Eine Masse Menschen laufen da aus und ein, verhandeln aufgeregt wispernd mit außen stehenden Genossen, gestikulieren über dem zerknitterten Rennprogramm und stürzen endlich, die Börse in der Hand, zu einem der Schalter, an denen die Einsätze zu zehn, zwanzig und fünfzig Mark entgegengenommen werden. Immer wilder wird das Stimmengewirr; es übertönt selbst die Wettmaschine und immer wieder schallen aus dem Trubel die Ziffern sieben und elf... andere Zahlen dazwischen ... dann abermals sieben und elf ... und elf und sieben ...
Sieben ist die Nummer Floßhildes, der heißen Favoritin. Elf trägt Parsenows Satanella. Ihr wendet sich das Interesse des Publikums mehr zu, als den einzelnen Wettern lieb ist. Man weiß, daß man auf die unbesiegliche Floßhilde so gut wie nichts herausbekommt – 12 zu 10 gab es das letzte Mal – und so wagt man einen Coup mit dem importierten Pferd, der für den Fall seines Sieges den Anhängern reichen Lohn verspricht.
»Satanella gewinnt ganz gewiß. Alle Welt setzt auf sie,« sagte Hilda zuversichtlich zu ihrem Bruder, der sie und ihrem Vater hundert Schritte weiter nach hinten zu den Sattelplatz führt.
Dort reiten die Teilnehmer des Rennens in langer Reihe hintereinander auf dem länglichen Zirkel. Einzelne Pferde kommen noch in langsamem Schritt dazu, von Stallburschen geführt, die Reiter lässig in den Sätteln, mit dem Zaumzeug beschäftigt oder mit erzwungener und wirklicher Gleichgültigkeit um sich blickend. Es sind fast nur Offiziere. Kavalleristen aller Art, ein Feldartillerist, zwei Herrenreiter vom Civil im Dreß. Ein oder zwei haben stark gefrühstückt, ein paar andere sehen etwas blaß aus. Fast alle verhalten sich schweigsam, winken da und dort einem Bekannten zu, klopfen dem Pferde auf den Hals oder murmeln ein paar Worte zu dem nebenher gehenden Trainer. Auch in dem Kreise der gedrängt umher stehenden Sportfreunde herrscht andachtsvolles Schweigen. Eine Unterhaltung wird nur an wenigen Stellen und auch da im Flüsterton geführt.
Das zweite Glockenzeichen ... gewaltige Aufregung auf dem ganzen Platz. Der Totalisator arbeitet mit Hochdruck, seine Stempelmaschinen rasseln. »Eins auf die elf! ... Eins auf die sieben!« tönt es immer wieder aus den Schaltern, und heiseres Gemurmel klingt aus der Ecke links hinten an der Tribüne, dicht bei der Restauration, wo die Buchmacher ihr ständiges Hauptquartier besitzen. Bleistift und Notizbuch sind da in fieberhafter Bewegung, in den gekrümmten Handflächen klirren die Gold- und Silberstücke, die Banknoten rascheln zwischen plumpen Fingern ... das ist der Augenblick, wo die eigentlichen großen Geschäfte gemacht werden! In diesem Moment, wo die große Masse der Wettlustigen bereits ihr Geld gesetzt hat und eine Verkürzung der Odds nicht mehr möglich ist, fliegt häufig erst der Tip des Tages in pfeilschnellem Laufe, in geheimnisvollem Geflüster von Ohr zu Ohr durch die Reihen der Eingeweihten, die nun eben noch Zeit haben, hastig die Combination auszunutzen, sei es durch Privatwetten, sei es am Totalisator, der bis zum Starten der Pferde Einsätze entgegennimmt.
Aber heute ereignet sich nichts dergleichen. Es giebt keine Stallgeheimnisse zu verraten oder sie werden gut gewahrt. Die Crême des Rennplatzes, der Unionklub, der mit seinen Damen auf der abgesonderten Tribüne thront, und der Bodensatz, die fragwürdige Gilde der Buchmacher und ihrer Hintermänner, sie haben diesmal beide nichts voraus von der großen urteilslosen Masse, die nach den Voraussagen der Sportzeitungen, nach zufällig erhaschten Äußerungen eines vorübergehenden Offiziers oder Jockeys, selbst nach der Farbe und dem Namen des Pferdes, der Uniform seines Reiters wettet. Das Rennen liegt zwischen Floßhilde und Satanella ... das ist auch ihre Weisheit. Auf das erstere Pferd nehmen die Buchmacher überhaupt keine Einsätze mehr an, auf Satanella sind sie schwierig geworden. Die Odds gehen von 4 bis auf 3 ... selbst bis auf 2½ zu eins, soweit man sich nicht auf die Berechnung des Totalisators einigt.
Inzwischen stelzen die Pferde in langem Zuge vom Sattelplatz nach der Bahn. Voraus tänzelt, ungeduldig in die Doppeltrense beißend, ein schmächtiger schwarzer Hengst. Er ist nervös wie gewöhnlich. Sein Reiter, ein blutjunger Ulan, hat alle Mühe, ihn im Schritt zu halten, obwohl der Stallbursche an der Seite führt. Der Hengst ist unbekannt. Von den Fachleuten achtet niemand sonderlich auf das »dunkle« Pferd; auch die nächsten zwei, drei Rosse finden wenig Aufmerksamkeit ... aller Augen wenden sich der Heldin des Tages zu, die ihm folgt. Die weiß-rote Mütze eines Garde du Corps leuchtet über der Menge auf ... da und dort tönt ein Zuruf ... ein Hut wird gelüftet, während »Floßhilde«, die unbesiegte Wunderstute, durch das enge Menschenspalier schreitet. Ein kleines, schwarzbraunes Geschöpf, aber mit Sehnen von Stahl und einem Brustkasten, der, mehr einer unermüdlichen Dampfmaschine als dem Lungenbehältnis eines lebenden Wesens gleicht.
Unmittelbar darauf aber lichtet sich das Spalier von selbst. Die Damen kreischen auf und flüchten, selbst die Herren treten unwillkürlich einen Schritt zurück, man hört die warnenden Zurufe des Stalljungen, einen unterdrückten Fluch des Reiters ... natürlich ... das ist sie... »Satanella« ... verrückt und unbändig wie immer. Sie wiehert laut auf ... ihr Kopf schlägt ununterbrochen an dem straffen Martingal in die Höhe, daß die weißen Schaumflocken spritzten, mit dem Hinterhufen keilt sie rings im Kreise aus oder schlägt nach den Steigbügeln, um den lästigen Reiter zu entfernen ... es ist ein wahres Wunder, daß man sie glücklich in die Bahn bringt und der Husar mit ihr aufkantern kann.
Graf Parsenow lehnt einsam und sinnend an der Barrière und sieht zu, wie sein Gaul in langen Galoppsprüngen an den Tribünen vorbei zum fernen Start segelt. Es ist ein schönes Bild. Der geschmeidige Körper der Stute reckt und streckt sich in federnder Kraft, der kleine Husar kauert, die Füße bis zum Absatz in die Steigbügel geschoben, mit gekrümmten. Rücken katzengleich auf ihr ... ein beifälliges Gemurmel wird da und dort laut.
» Well«, sagt ein hagerer Jockey neben Parsenow, » I say ... it's a good thing for Satanella ...«
»Wenn das Luder man nich' so n' verfluchtes Temperament hätte...« brummt sein Begleiter, ein Buchmacher vom Rosenthaler Thor, verdrießlich vor sich hin.
Parsenow hört nichts von dem Gespräch. Er ist zu erregt. In der Herzgegend, in den Schläfen, selbst in den Augen hört er das rasche taktmäßige Hämmern des Blutes und ein merkwürdig quälendes Gefühl regt sich ihm im Magen, steigt langsam aufwärts und schnürt seine Kehle zusammen, so daß er heftig schluckt und hinter dem vorgehaltenen Wettbuch zu gähnen beginnt. Gleich darauf schämt er sich seiner Schwachheit ... die verwünschten Nerven ... was macht es ihm denn schließlich aus, wenn er auch diesmal nicht gewinnt? Er weiß es ja, daß Floßhilde kaum zu schlagen ist, daß er vernünftiger Weise nur auf den zweiten Platz rechnen kann ... und wenn es nicht heute glückt ... so am nächsten Mittwoch ... es ist ja noch nicht aller Tage Abend ...
Das sagt er sich, während er zur Restauration eilt, um noch rasch ein Glas Sekt hinunterzustürzen.
Eben hat er das Spitzglas geleert, da dringt ein helles Glockenzeichen und Stimmengewirr an seine Ohren. Der Start hat begonnen. Die Pferde sind unterwegs. Graf Parsenow stellt das Glas auf den Tisch, wischt sich mechanisch den dunklen Schnurrbart und starrt einen Augenblick vor sich nieder. Der Kellner, der ihn bedient, sieht ihn über das Büffet her müßig blinzelnd an. Solche Szenen sind hier nicht selten ...
Als fern am andern Ende der Rennbahn die rote Flagge des Starters fiel, hatte Satanella bereits auf eigene Faust einen Galoppsprung unternommen und lag so von vornherein etwa zwei Längen vor den andern! Einen Augenblick fürchtet ihr Reiter, es möchte ein falscher Ablauf gewesen sein ... aber der Starter ist froh, das Feld ziemlich geschlossen entlassen zu haben und im Sturmwind geht die Reise zwischen den Flaggen dahin nach dem fünftausend Meter entlegenen Ziel ...
Nun kann man an der Barrière nichts rechtes mehr unterscheiden. Ärgerlich läßt Parsenow sein Glas sinken. Er hat die Tribüne nicht bestiegen, um dem Gedränge zu entgehen. Auf dem Rasen stehend, späht er nach der fernen Hügelkette, hinter der die Pferde fast völlig verschwunden sind. Nur die Mützen der Reiter sieht man ... einen bunten, flimmernden Klumpen, der geschäftig und schnell an dem gelblichen, scharf abgegrenzten Hügelland dahingleitet. Über das breite Feld hin ziehen in dunklen, riesigen Schwärmen die Besucher des dritten und vierten Platzes, denen ihre große Weiße mit Strippe oder ihr Fünfzigpfennigstück ein ebenso wertvoller Wetteinsatz ist als den Tribünen-Inhabern des Zehnmark-Ticket. Schreiend und johlend strömen sie der Stelle zu, wo die Reiter auftauchen müssen, um quer über die Bahn zum ersten Tribünensprung zu jagen.
Da kommen sie ... noch immer in dichter Masse ... Floßhilde und Satanella mitten zwischen den andern ... ein Herr in rotgelbem Jockeydreß führt als Pacemacher die Gesellschaft. Schon ist er an der Tribünenhürde und schießt in langem Satz hinüber, vier, fünf andere Pferde strecken sich fast gleichzeitig zum Sprung ... die Reiter biegen sich elastisch in den Sätteln, ein kurzer Peitschenhieb klatscht ... ein Pferdehuf – es ist der Satanellas, die wieder beinahe zu kurz über das Hindernis gehuscht, schlägt krachend an das Holz, ein paar Splitter stiegen auf ... schon geht die Fahrt weiter und hinter den federnden Hufen sausen die Rasenstücke durch den leicht aufwirbelnden Staub ...
»Fellin reitet!« ... irgend wo dringt aus der Tribüne der Ruf: »Fellin reitet ...« viele Stimmen bestätigen die Neuigkeit. In der That ... das pacemachende Pferd hat seine Schuldigkeit gethan ... Vergeblich muntert es der im rotgelben Dreß auf ... es verliert den Atem und fällt in den Haufen der anderen zurück. Und schon beginnen zwei, drei Nachzügler mit ihm in das Hintertreffen zu geraten. Pferde, die dem rasenden Tempo nicht gewachsen sind in dem die Matadore des Felds dahinfegen.
Nun kommt die Steinmauer mit dem Graben. Ein jäher plötzlicher Aufschrei aus tausend Kehlen. Parsenow schließt die Augen. Er weiß, was das bedeutet.
Halb zögernd blickt er wieder auf die Bahn. Das erste, was er sieht, ist der rote Husar, unter dem Satanella unverzagt weiter stürmt ... Gott sei Dank ... also sie war es nicht ... nein ... ein braunes Pferd liegt dort am Boden ... neben ihm ... halb kauernd der Feldartillerist ... er scheint verletzt ... aber wer kann jetzt daran denken ... Unverwandt folgt Parsenow dem Pferdetrupp, der sich jetzt dem Koppelrick nähert. Er ist viel zuversichtlicher geworden. Er weiß es selbst nicht, warum, aber als von neuem ein geller Schrei über den Tribünenplatz tönt, da schließt er nicht die Augen, sondern konstatiert kaltblütig die Thatsache, daß der Herrenreiter Mr. Cook dort bewegungslos auf dem Rücken liegt, während der reiterlose Gaul in vollstem Eifer noch eine Weile mitläuft, um dann abschwenkend in kurzem Galopp dem Stall am Sattelplatz zuzusteuern.
Jetzt wird die Sache ernst. Auf der Tribüne wächst die Erregung. Das Stimmengewirr beginnt sich brausend zu steigern, während die Pferde in die Schlucht hinabschießen, die Reiter mit vorgestreckten Beinen und langen festen Zügeln fast auf der Croupe liegend, um sich dann wieder beinahe auf den Hals des Pferdes zu werfen, sobald dieses im Galopp den jenseitigen Abhang erklimmt. Geschrei, Jubel, Zurufe begrüßen das Feld, das zum zweiten Mal an den Tribünen vorbei schießt.
» Go on, Satanella!« brüllt eine heisere Stimme. » Go on, Floßhilde,« tönt es von allen Seiten dagegen » Go on!« Ein Lärmen, aus Lachen und Rufen der Enttäuschung gemischt, erschüttert die Luft! Das Langerwartete geschieht! Floßhilde beginnt sich unter der Meisterhand ihres Reiters zu strecken und dem Felde davonzulaufen. In langen, gleichmäßigen Sprüngen zieht sie los, unermüdlich und unerschütterlich wie eine wohlgeheizte Maschine. Immer größer wird der Abstand zwischen ihr und dem Gros, das sich langsam in eine endlose, schwerfällig galoppierende Reihe auseinander zieht. Nur zwei oder drei Pferde halten sich noch in ihrer Nähe und unter ihnen ... – Parsenow zerreißt mechanisch seinen Handschuh zwischen den Fingern – unter ihnen Satanella. Und mehr als das! Das scharfe Auge ihres Besitzers erkennt sofort, daß die Stute noch keineswegs ausgepumpt ist. Ihr Reiter sitzt tief im Sattel zurück ... die Zügel stehen elastisch an den fest an den Leib gelegten, Armen – es ist kein Zweifel, daß Wendlau das Pferd noch zurückhält und ihm den Kopf nur so weit freigiebt, um Floßhilde auf den Hufen zu folgen.
Das Wäldchen nimmt sie auf. Wenn sie da herauskommt beginnt auf der Geraden das Endgefecht. Die Entscheidung naht.
Parsenow legt sich mit äußerster Anstrengung die Gesichtszüge in ruhige Falten ... wenn er gewönne! ... aber nein ... nur keine Aufregung ... Niemand darf ihm ...
Ein Tosen bricht auf den Tribünen los. Sie kommen! sie kommen! Eine rotweiße Mütze taucht aus dem Wäldchen auf ... Floßhilde führt und nährt sich in unheimlichen Sätzen ... sie ist also noch die erste ... da einige Längen hinter ihr ein zweites Pferd ... der schwarze Hengst mit dem jungen Ulanen darauf ... dann ein Kürassier auf einem Rappen, der von Schaumspritzern wie weißgefleckt aussieht ... und dann ... nichts mehr! ... Parsenow reibt sich die Augen ... das ist ja gar nicht möglich ... wo bleibt denn Satanella?
Vor ihm erscheint alles wie in einem Dämmerschein. Er achtet nicht auf das grandiose Endgefecht des Kampfs. Auf den Tribünen donnert und wogt es wie von einem Sturm ... Alles heult und schreit durcheinander, während der Ulan auf dem verachteten schwarzen Außenseiter in einem verblüffenden Finish Floßhilde zu überrumpeln, sie im Ziele abzufangen sucht! Sein Gaul schießt geradezu nach vorn ... die Doppeltrense in dem bluttriefenden Maule wirbelnd, die Sporen in den blutbedeckten Flanken drehend, ununterbrochen mit der Peitsche niederklatschend nimmt der Reiter das Äußerste aus dem wie toll losbrechenden Pferd und krampft selbst jede Faser seines Körpers zusammen. Schon ist er auf ein paar Längen an Floßhilde heran ... Da wendet deren Reiter unter dem markerschütternden Lärmen der Tribüne den Kopf ... im nächsten Augenblick geht eine leichte Bewegung durch ihn und das Pferd ... Floßhilde wird länger und länger ... sie läuft nicht mehr ... sie beginnt beinahe zu fliegen ... fünfzig, sechzig, hundert Schritte Boden schießen im Momente unter ihr hinweg ... es ist, wie wenn eine unsichtbare Macht sie nach vorne reißt. Und das ist das Ziel... in ruhigen Sprüngen galoppiert die Wunderstute hindurch, taumelnd folgt ihr auf zehn, zwölf Längen das schwarze Pferd mit seinem gleichfalls völlig erschöpften, aber doch von allen Seiten beglückwünschten Reiter.
Und dann der Kürassier auf seinem Rappen ... nach einer Weile noch andere Pferde ... von Satanella nichts zu sehen.
Parsenow ist wie vor den Kopf geschlagen. Er steht noch immer auf derselben Stelle. Er hört das Hurrahgeschreih der Menge, die Klänge des Torero-Marsches aus dem Musiktempel, und heftet den Blick unverwandt nach dem blaßblauen Horizont, wo dicht am Koppelrick, eine lange Scheibenstange hastig hin und her geschwenkt wird, das Signal, Arzt und Tragbahre zu schicken. Mr. Cook scheint also schwer verletzt. Aber Parsenow ist das jetzt gleich. Er hat nur für den einen Gedanken Raum: was ist mit Santanella geschehn? An den Reiter denkt er eigentlich weniger.
Er könnte ja gehen und fragen. Oben von der Tribüne hat man die Sache wohl gesehen. Aber ihm graut vor der Gewißheit. Ziellos schlendert er über den Platz hinter der Tribüne. Da und dort schlägt das Wort »Satanella« an sein Ohr ... dann etwas von dem Wäldchen ... ein Ausruf des Bedauerns aus Frauenmund ... ein kräftiger, männlicher Fluch ...
Und wieder bleibt er stehen ... wahrscheinlich ist das Tier ausgebrochen und entlaufen ... natürlich entlaufen ... ein Gaul braucht doch nicht gleich zu stürzen! Man fängt sie ein ... das nächste Mal. siegt sie ... du lieber Gott ... dergleichen kommt ja vor ...
»Eine böse Sache, Herr!« sagt plötzlich eine Stimme neben ihm. Da steht sein Trainer, einen Kasten unter dem Arm.
»Ah ... Sie ... was ist ...?« Parsenow fühlt plötzlich einen unerträglichen Krampf in der Herzgegend ... ein Gefühl, wie wenn alles in ihm kalt würde ...
»Ich wollte nur fragen ...«, der Trainer sieht auf den Pistolenkasten, » ... wollen Sie selbst oder soll ich ...«
»Satanella erschießen« ... der Graf lacht geradezu herzlich auf ...
Sein Trainer sieht ihn etwas verwundert an. »Es ist doch das linke Vorderbein entzwei, Herr Graf« ... sagte er zögernd ... »Der Roßarzt hält es für eine unnütze Quälerei, wenn ...«
»Wo wars,« unterbricht ihn Parsenow rauh... »in dem Wäldchen ... nicht wahr ...?«
»Bei der vorletzten Hürde ... Sie sprang wieder wie gewöhnlich zu kurz ... Ein Wunder, daß sich der Leutnant von Wendlau nichts gethan hat.«
»Gar nichts?«
»Ein paar Kontusionen. Ich glaube, er hat keine Schuld an der Geschichte.«
»Schießen Sie den Gaul tot,« sagt Parsenow, steckt sich eine Cigarrette an und geht wieder zur Tribüne.
Eigentlich ist ihm jetzt wohl zu Mut. Seit langen Jahren ist er zum ersten Mal in einer ganz klaren und bestimmten Lage. Er ist ruiniert ... einfach ruiniert ... das ist kein Spaß, aber man weiß doch wenigstens woran man ist.
Die Erregung von vorhin ist bis auf die letzte Spur geschwunden. Er nimmt gleichmütig da und dort die Kondolenzen in Empfang, er wechselt leutselig einige Worte mit der Tip-Tante, jener bekannten Verkäuferin der Voraussagungen für die Rennen, er erwidert mit besonderer Nachlässigkeit den ironisch-höflichen Gruß des Herrn Krakauer, seines Geschäftsfreundes, der wie gewöhnlich prachtvolle Diamantenknöpfe auf einer schmutzigen Hemdbrust trägt, ein schönes auffallendes gekleidetes Mädchen, der er kaum bis zur Schulter reicht, am Arm mit sich herumschleppt, und mit gleichgültigem, beinahe matten Blick die Schar seiner Opfer in Civil und Uniform ringsum mustert. Er ist kein Wucherer, bewahre, ein einfacher »Geldmann« und doch bricht im Leben der Weltstadt sein Einfluß zuweilen an Stellen hervor, wo man es nicht für möglich halten sollte.
Der Graf weiß, daß er sehnsüchtig erwartet wird. Und als er sich Frau von Braneck nähert, sieht sein geübtes Auge mit einer gewissen Genugthuung, daß die schöne Frau geweint hat! Sie selbst giebt es errötend zu. Das Mitgefühl mit seinem Pech, das Erbarmen mit dem armen Pferd, die Trauer um das Zehnmarkstück, der Schrecken über den Sturz, das alles ist ihr in eine unbestimmte Empfindung von etwas sehr Traurigem und Widerwärtigem zusammengeflossen, und um so lebhafter äußert sich nun ihre Freude, ihr geradezu kindliches Staunen, als sie Parsenow wider alles Erwarten so gefaßt, ja geradezu heiter sieht. Er imponiert ihr dadurch noch mehr. Sie blickt bewundernd zu ihm auf.
»Na ja ... so ist's recht, lieber Graf,« sagt auch der Major und klopft ihm auf die Schulter, »immer den Kopf hoch ... gefällt mir ... denken Sie nicht weiter an die Geschichte ... wir bleiben den Abend beisammen und muntern Sie auf ... was?«
»Gern!« Parsenow ist mit allem einverstanden. Er muß selbst innerlich über seine Ruhe lachen. Ein komisches Gefühl, ruiniert zu sein, ... ein ganz neues Gefühl ... das ist's ... das regt ihn, den blasierten Lebemann, so angenehm an ... ein totaler Zusammenbruch ... das hat er noch nicht durchgemacht! Er ist geradezu gespannt, wie die Geschichte enden wird ...
Inzwischen sind die letzten Rennen gelaufen. Man drängt zum Aufbruch. Parsenow bietet den Herrschaften seinen Wagen zur Heimfahrt an und bald rollen sie die Chaussee dahin, der Major und Hilda auf dem Rücksitz, vor ihnen Parsenow und der Leutnant. Rings um sie setzt sich die Wagenburg in Bewegung. In endlosen schwarzen Reihen rollt es den Hügel hinab, der dunkle Strom der Fußgänger quillt zu beiden Seiten, die Colosse der Pferdebahn gleiten langsam durch das Gedränge, mit Hornstößen bahnen sich die Viererzüge den Weg, durch die zahllosen Droschken erster Klasse schlüpfen die Gigs und Dogcarts, schaukeln behäbige Equipagen mit würdevollen Kutschern ... dazwischen da und dort ein schmutzstarrendes Arbeitsfuhrwerk mit einem höhnisch grinsenden Fuhrmann, vorsündflutliche Kremser, Tandems mit vor einander gespannten, kunstvoll gelenkten Pferden. Und in den buntscheckigen Fahrzeugen die buntscheckige Menge, Mitglieder des Unionklubs, Buchmacher, Taschendiebe, Offiziere, Damen der großen Welt, Hochstapler, die Halbwelt aller Grade, Kriminalbeamte, Schlächtermeister und Zahlkellner, alles, alles, rollt einträchtiglich durch den Tiergarten dahin.
Der aber glänzt in seinem buntscheckigen Laube, ein würzigen Hauch weht durch die Stämme, die Räder rasseln, die Peitschen wehen und von dem blaßblauen Herbsthimmel lacht die Sonne über Gerechte und Ungerechte.
III
Eine Stunde darauf sitzen Graf Parsenow mit dem Major und den Seinen ganz gemütlich in einem der vornehmen Lindenrestaurants. Sie haben soeben zu Mittag gespeist – allerhand Firlefanz und Kinkerlitzchen, wie es der Alte knurrig nennt. Keine Spur von einem vernünftigen Stück Fleisch oder einem ordentlichen Teller Gemüse ... nur allerhand lächerlicher Imbiß ... ein Rebhuhnflügel ... ein paar Spargelstangen ... ein fingerlanges Stückchen filet de sole ... ein winziges Häufchen Sauerkraut, melancholisch von ein paar gebackenen Austern gekrönt ... ein thörichter Artischocken-Boden, und der Himmel weiß was noch. Gott sei Dank ... in Pommern speist man solider. Der Major wird beinahe wehmütig bei dem Gedanken, wie schön und ungestört man dort jetzt leben, essen, trinken und schlafen könnte.
Sonst gefällt es ihm in dem Lokal ganz gut. Ein traulicher Raum mit weichen Bodenteppichen, über die geräuschlos die Tritte der Kellner gleiten, mit langen Spiegeln in denen sich flimmernd der bläuliche Schein der birnenförmigen Glühlichtlampen bricht. Es herrscht eine angenehme Ruhe ... die Kellner verkehren nur im Flüstertone ... die Gäste murmeln mit einander an den weitabstehenden Tischen ... an den Fenstern dämpfen schwere Vorhänge das Geräusch der Straße ... kurz ... wenn man schon verurteilt ist, sich in Berlin aufzuhalten, mag es hier noch am ersten gehen. Herr von Döbeln hat sich eine Cigarre angesteckt und sieht behaglich zu, wie der bläuliche Rauch das Sektglas umspielt, von dessen Boden, im Kerzenlicht flimmernd, ununterbrochen eine Säule von perlenden Bläschen emporsteigt. Halb neugierig, halb mißfällig sieht er dem glattrasierten Kellner zu, der discret das Tischtuch abfegt und in braunem Porzellangeschirr den Kaffee und die Liqueure serviert. Es ist, als ob er etwas erwarte ...
Und richtig ... da tritt ein Ausläufer des Restaurants ein, wird an den Tisch des Majors gewiesen und nähert sich ihm mit abgezogener Mütze. Er legt vier Theaterbillete vor den Alten hin, der sie schmunzelnd in Empfang nimmt und ihn mit einem Trinkgeld entläßt.
»Was hast Du denn da, Papa?« fragt Frau Hilda über den Tisch hinüber.
»... oh ... das ... die Billete ...«, der Major scheint etwas verlegen, »Du wolltest doch heute Abend durchaus ins Eden-Theater gehen! Erinnerst Du Dich nicht mehr, mein Kind?«
»... und das Fräulein Ernst oder wie sie heißt, bewundern.« Die schöne Frau lacht heiter auf, »... ja, Papa ... wenn Du soviel Selbstüberwindung besitzest, mich dahin zu führen, dann gern ... aber ich weiß ja ... dergleichen Dinge sind Dir ein Greuel ...«
»Na wenn schon,« brummt der Major unwirsch, »gehen wir schon hin! Sie begleiten uns doch, Graf ...«
Ins Edentheater! Parsenow kommt der Gedanke so komisch vor, daß er Mühe hat, nicht laut aufzulachen. Ins Edentheater ... da kann es nett werden, heute Abend, wenn sich der Direktor nicht doch noch irgendwoher Geld verschafft hat. Und dann die Ernesti... Verstohlen blickt er auf Hilda, die ganz unbefangen dasitzt. Sie hat ihn heute gesehen, wie er mit der Schauspielerin sprach. Aber schließlich ... die Ernesti ist hübsch, sehr hübsch, in Civil wie auf der Bühne und ein bißchen Eifersucht schadet nie. Das weiß der Graf am besten.
»Ob ich mitkomme?«, wendet er sich zu dem Major, »aber mit dem größten Vergnügen, wenn es die gnädige Frau gestattet?«
»Warum nicht?«, sagt Hilda harmlos. »Es wird mich freuen. Sie sind dort gewiß wie zu Hause und können uns allerhand erzählen.«
»Ich könnte wohl, Gnädigste ... aber ich werde es nicht thun!«
»Sie mögen wohl Ihre Gründe haben,« meint die schöne Frau gelassen und sieht ihn erwartungsvoll an. Aber der Major unterbricht sie: »Na ... nu los, Kinder ... es ist schon fünf Minuten nach sieben ... Gut, daß wir schon Plätze haben ... es wird gewiß ganz voll werden ... nicht wahr, lieber Graf ... die Ernesti ist ja, wie ich höre, eine sehr tüchtige Schauspielerin?«
»Gewiß«, bestätigt Parsenow mit ernstem Gesichte, »außerordentlich tüchtig!«
Mit verheißungsvollem Glanze strahlen die großen Lampen, an der Rampe des Edentheaters in die klare Herbstnacht hinaus. Von allen Seiten naht das Publikum, in langer Reihe fahren die Wagen vor. Die Kutschenschläge klappen .. ein Lichtstrahl flimmert auf dem Helm eines berittenen Schutzmanns und beleuchtet ein nickendes Pferdehaupt, die heiseren Stimmen der Theaterzettel-Verkäuferinnen tönen von der Straße und in den Ecken treibt der lichtscheue Schwarm der Billethändler sein Wesen.
Betritt man den Vorflur, in dessen Mitte ein tadellos majestätischer Portier in Dreimaster und langem Mantel, eine Silberkeule in der Hand, unbeweglich prangt, dann freilich könnte dem Eingeweihten auffallen, daß der Theaterkassirer durchaus nicht soviel zu thun hat, als man nach dem Andrang vermuten sollte. Ab und zu tritt jemand an die Kasse. Aber auch dann sieht man meistens kein Geld. Ein Kopfnicken, das Murmeln eines Namens, die Vorzeigung eines Bons genügt zumeist, um eine Einlaßkarte herbeizuzaubern. Ab und zu freilich zahlen auch harmlose Menschen, die sich heute, am Sonnabend, die Freude des Theaterbesuchs gönnen. Und um ihretwillen ist eigentlich das ganze Heer der »Beisitzer«, der Freibillet-Inhaber, zunächst aufgeboten.