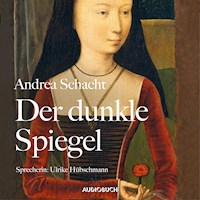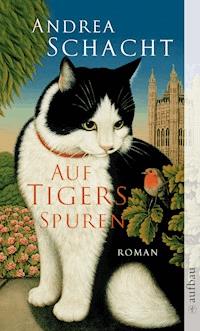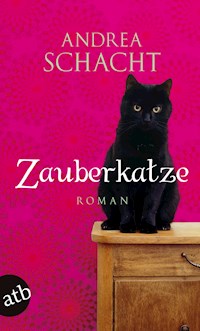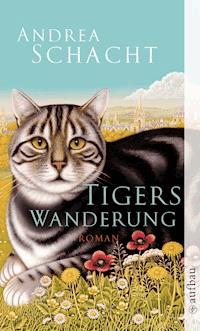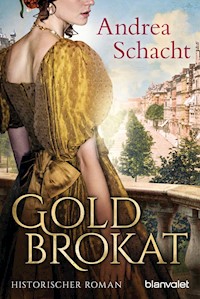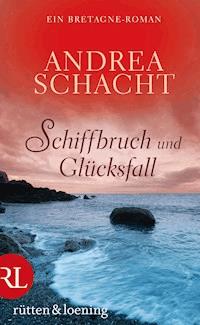Andrea Schacht
Göttertrank
Historischer Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
© 2008 by Blanvalet Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Covermotiv: © Johannes Wiebel | punchdesign,
unter Verwendung eines Motivs von Bridgeman Art Library
ISBN 978-3-641-01808-5
V003
www.blanvalet.de
Inhaltsverzeichnis
Danksagung
Lob
ERSTER TEIL – Der Duft
Ein Baum wächst im Wald
Vor jeder Zeitrechnung, Mexiko
Bittere Erkenntnis
Das Ende aller Dinge
Süßer Trost
Heißer Kakao
Die Kunst des Überlebens
Abschied und Neubeginn
Entscheidung zwischen Kaffee und Kuchen
Bruchstücke
Zuckerstücke
Der Flügelschlag des Schmetterlings
Mit Volldampf voraus
Geheime Leidenschaften
Kein Zuckerschlecken
Der exotische Onkel
ZWEITER TEIL – Die Bitternis
Ein Trank für die Götter – Vor jeder Zeitrechnung, Mexiko
Wind und Wellen
Eis und Feuer
Trautes Heim
Ein hoffnungsloser Fall
Junge Lieben
Bittere und andere Wahrheiten
Dae daylite come an we wanna go home
Ein Hang zum Küchenpersonal
Aus der Festungszeit
Rolling home
Kaffeeklatsch
Trügerische Hoffnung
Ein offensichtlicher Mord
DRITTER TEIL – Der Trost
Wie man die Melancholia heilt
16. Jahrhundert, spanischer Hof
Pechsträhne
Ein Häuschen auf dem Lande
Ein möblierter Herr mit Wintergarten
Eine einsame Entscheidung
Die schöne Fassade
Ein konstruktives Besäufnis
Gutbürgerliche Küche
Anrecht auf den Sohn und Erben
Gemeinsame Wurzeln
Ein gemästetes Kalb
Die Macht der Lettern
Kekse für das Proletariat
Private Club und Irish Pub
Zarte Creme und harte Worte
Überraschender Besuch
Küchengeheimnisse
Des Schnitters Ernte
VIERTER TEIL – Die Süße
Botanische Götterspeise
1753, Stockholm
Karriere in Trümmern
Spukhaus
Feuerzangenbowle
Julias Erzählungen
Zartbittere Versuchung
Witwenkuren
Der Lohn der Bitternis
Eine Idee wird geboren
Süßer Schlaf und bitteres Ende
Pavane für eine tote Prinzessin
Ein trauriger Fall
Aufklärung
Fernweh
Tochter aus Elysium
Die Begleichung einer alten Schuld
Durch den Kakao gezogen
Auf der Schokoladenseite
Nachwort
Dramatis Personae
Für Berit, die für dieses Buch das Kindermädchen spielte und daher auch darin diese Aufgabe übernimmt. Danke
Eigentlich ist es ein Glück, ein Leben lang an einer Sehnsucht zu lutschen.
Theodor Fontane
ERSTER TEIL
Der Duft
Ein Baum wächst im Wald
Vermildernd schien das helle AbendrotAuf dieses Urwalds grauenvolle Stätte,Wo ungestört das Leben mit dem TodJahrtausendlang gekämpft die ernste Wette.
Der Urwald, Lenau
Vor jeder Zeitrechnung, Mexiko
Im schwülen Dämmerlicht der Geschichte wuchs unter dem weit ausladenden Geäst der uralten belaubten Riesen ein schlanker Baum empor. Sein Stamm und einige dicke Äste waren über und über mit Büscheln kleiner weißer Blüten besetzt, umschwebt von winzigen Mücken, die sich an ihrem Nektar labten. Dazwischen hingen längliche Früchte in allen Stadien der Reife. Waren sie schwer von Saft und Süße, lösten sie sich vom Stamm und landeten mit einem leisen Plopp auf der Erde.
Tropfende Blätter nässten den Boden des Waldes. Faulendes Laub, verwesendes Aas, schleimiges Gewürm und jahrtausendealter Humus bildeten ein nahrhaftes Gemisch, in dem die Keimlinge zum Leben erwachen könnten.
Wenn sich denn nur die harte Schale der herabgefallenen goldenen Frucht öffnete und die darin enthaltenen Samen sich verstreuten.
Doch der Baum – eine recht anspruchsvolle Diva unter den Gewächsen – brauchte Geburtshilfe. Es waren die Affen, die schließlich eingriffen und zu seiner Vermehrung beitrugen. Angezogen von dem süßen Duft der Frucht machten sie sich daran, die zähe Schale mit Fingern und Zähnen zu öffnen, schlürften mit Behagen das helle, saftige Fleisch und spuckten angewidert die darin eingebetteten Kerne aus. Sie schmeckten unerträglich bitter.
Aber genau das war die Absicht des Baumes. Die verschmähten Bohnen fielen auf den modrigen, aufgeweichten Grund. Und die immer gleichbleibende, unbewegliche, von tausend Gerüchen durchzogene Luft sorgte für das einzigartige Klima, in dem es dem Samen möglich war zu keimen. Nur hier, im halbdunklen, feuchtwarmen Mutterleib des tropischen Urwaldes, gedieh der Kakaobaum, hier pflanzte er sich fort, blühte, bildete Fruchtstände und wieder Früchte. Er wuchs und starb und bildete Nährboden und Nahrung für kommende Generationen von Affen und Mücken und manch anderem Getier.
Bittere Erkenntnis
Düfte haben mehr als eine Ähnlichkeit mit der Liebe, und manche Leute glauben sogar, die Liebe sei selbst nur ein Duft.
Alfred de Musset
Es gab in meiner Kindheit eine Begebenheit, an die ich mich wohl immer erinnern werde und die mir so deutlich wie an jenem Tag vor Augen steht. Ihr Auslöser war ein köstlicher Duft.
Dieser Duft war so wundervoll, so warm, so tröstlich. Er hüllte mich ein, er beruhigte mich, er füllte meine Nächte mit friedlichen Kinderträumen. Dieser Wohlgeruch und sanfte Wiegenlieder begleiteten mich seit den ersten Monaten meines Lebens. Allgegenwärtig schien er zu sein, Tag und Nacht umgab er mich wie ein schützender Kokon – der zarte Duft von Kakao.
Im Laufe der Zeit spürte ich die Quelle auf. Es waren die Hände meiner Mama, die nach Kakao rochen, und wenn ich nachts neben ihr im Bett lag, fest in ihre Arme gekuschelt, dann wurden mütterliche Liebe und Schokoladenduft eins.
Sie riefen mich Amara, und ich wuchs heran zu einem wissbegierigen, zufriedenen Kind. Im Frühling, als ich anderthalb Jahre alt war, durfte ich tagsüber in der Küche sitzen, in einem Gitterställchen, in dem ein weiches Kissen, eine Schmusedecke zum Ruhen sowie ein paar Bauklötzchen und eine Lumpenpuppe zum Spielen einluden. Weder die eine noch die andere Einladung nahm ich jedoch an, viel zu interessant war es, das geschäftige Treiben der dicken Köchin am Herd zu beobachten und Mama zuzuschauen, die ihr zur Hand ging. Mama war für die Süßspeisen zuständig, sie buk Kuchen und Plätzchen, rührte Puddings und Cremes, und vor allem bereitete sie den Kakao für die Herrschaften zu. Jeden Morgen zerbrach sie eines der dunkelbraunen Täfelchen in kleine Stücke, zerrieb ein Klümpchen Zucker im Mörser zu feinem Pulver, füllte alles in die Porzellankanne und übergoss es mit kochendem Wasser. Dann stellte sie den Quirl in die Kanne, schob den Stiel durch das Loch im Deckel und drückte diesen fest zu. Mit geschickten Bewegungen drehte sie den Quirl zwischen den Handflächen, und nach einer Weile goss sie einen Teil der Flüssigkeit in eine Schale. Den Schaum, der sich darauf gebildet hatte, schöpfte sie sorgsam ab. Das war der Augenblick, an dem ich immer zu betteln begann. Lächelnd reichte Mama mir dann den Topf mit der cremigen Masse, damit ich mich an den in allen Farben schillernden Bläschen erfreuen und mich am Duft sattriechen konnte. Viel zu schnell aber wurde mir die Köstlichkeit wieder entzogen.
»Die Kakaobutter brauche ich noch, Amara, damit darfst du nicht spielen«, erklärte mir Mama. Tatsächlich verwendete sie die fettige Creme, um abends ihre von der Arbeit rauen Hände einzureiben, manchmal auch ihre Lippen und vor allem die wund geriebenen Stellen meiner zarten Kinderhaut. Doch wenn ich von dem dunkelbraunen Getränk etwas haben wollte, hieß es: »Das ist der Kakao für die Frau Gräfin, Amara. Kleinen Kindern schmeckt er nicht.« Was ich mich weigerte zu glauben. Nichts, was derart gut roch, konnte schlecht schmecken.
Ich quengelte nicht, ich maulte nicht, aber ich war schon damals ein zielstrebiges Geschöpf und verlor mein Ansinnen nicht aus den Augen. Die Gelegenheit bot sich im Juni. Die Herrschaften waren verreist, in der Küche gab es wenig zu tun. Die Köchin sorgte lediglich für die Mahlzeiten für die verbliebene Dienerschaft, Kakao wurde nun morgens nicht zubereitet. Da auch die beiden jungen Söhne die Eltern begleiteten, hatte Nanny viel Zeit, sich um mich zu kümmern, und der Gitterstall in der Küche wurde weggeräumt. Ich liebte Nanny fast so sehr wie Mama, obwohl sie schon ziemlich alt war und nach Pfefferminze und nicht nach Kakao roch. Sie sprach auch irgendwie anders, was mich aber nicht störte. Ich verstand sie sehr gut, und manche Liedchen von ihr konnte ich sogar schon mitsingen. Sie kannte unzählige Spiele und wundervolle Geschichten, nahm mich oft an die Hand, um mir im Garten die Blumen und die Schmetterlinge zu zeigen, konnte Eichhörnchen mit Nüssen locken und lehrte mich, die zutrauliche alte Stallkatze zu streicheln.
Aber dann kam der regnerische Nachmittag im Juni, an dem die Köchin frei hatte, Mama zur Meierei gegangen war und Nanny, mit der ich auf dem Küchentisch die Holzfigürchen einer Arche Noah aufgebaut hatte, von einem fahrenden Händler an die Tür gerufen worden war.
Ich saß ganz alleine in der Küche.
Und auf der Anrichte stand die Dose mit dem verlockenden Kakao.
Noch reichte ich mit der Nase kaum bis an die Schubladen, aber die Kraft, einen der Stühle näher an die Anrichte zu schieben, brachte ich schon auf. Ich kletterte hinauf, musste mich ein bisschen recken und zerrte dann an der Keramikdose. Mit beiden Händen hob ich den Deckel und schnüffelte beglückt den verlockenden Duft. Stolz auf mich selbst fischte ich eines der in Pergamentpapier eingewickelten Täfelchen heraus. Meine ungeduldigen Finger hatten Mühe, die Verpackung aufzureißen, aber dann lag das unregelmäßig geformte Rechteck aus reiner Kakaomasse vor mir. Ich hielt nichts von halben Sachen, ich stopfte es mir gierig in den Mund.
Als Mama kurz darauf in die Küche zurückkehrte, fand sie mich heulend auf dem Boden sitzen, den Mund und die Finger von Kakao verschmiert, das ausgespuckte Täfelchen am Boden.
»Bitter!«, jammerte ich und rieb mir wieder und wieder über die Lippen. »So bitter.«
Mama füllte umgehend einen Becher mit Milch und Honig, verrührte beides schnell, nahm mich auf den Schoß und flößte mir das süße Getränk ein.
»Eine bittere Erkenntnis, was, mein Schatz?«, fragte sie mich ohne Vorwurf in der Stimme. »Das Bittere, kleine Amara, schmeckt nur dann, wenn es mit Mildem und Süßem ergänzt wird. Die Bitternis erträgt man nur als Teil einer wohlausgewogenen Mischung.«
Was sie damit meinte, verstand ich nicht, aber weil sie nicht böse mit mir war und der scheußliche Geschmack allmählich von meiner Zunge wich, trockneten die Tränen auf meinen Wangen, und getröstet lehnte ich meinen Kopf an Mamas Schulter.
Nie wieder würde ich diesen widerlichen Kakao anrühren. Nie! Ganz bestimmt nicht! So lange nicht, bis er endlich genauso gut schmeckte, wie er roch.
Das hatte er davon!
So.
Das Ende aller Dinge
Ein Posten ist vakant! – Die Wunden klaffen -Der eine fällt, die Andern rücken nach -Doch fall ich unbesiegt, und meine WaffenSind nicht gebrochen – Nur mein Herze brach.
Enfant perdu, Heine
Am selben Tag, an dem Amara auf Evasruh, dem mecklenburgischen Landgut der Grafen von Massow, ihre bittere Erfahrung machte, traf auch einen neunjährigen Jungen ein bitteres Schicksal. Er erwachte mit höllischen Kopfschmerzen, und als seine Sicht sich allmählich klärte, schloss er voller Entsetzen wieder die Augen. Er befand sich, das war das Einzige, was er denken konnte, inmitten eines Meeres von Grauen. Neben ihm stöhnte ein Mann, hinter ihm röchelte ein anderer. Jemand schrie gepeinigt auf, und eine warme Flüssigkeit tropfte auf sein Gesicht. Es stank erbärmlich nach Erbrochenem und anderen Widerwärtigkeiten, nach Blut und Angst. Fort von hier, dachte er, doch als er sich vorsichtig aufsetzen wollte, sah er einen Mann mit einem halb abgerissenen Arm neben sich liegen. Es würgte ihn in seiner Kehle, und der Schmerz aus der Brandwunde an seinem Arm zuckte auf wie eine Stichflamme.
In diesem Moment ging die Tür der Scheune auf. Zwei Männer trugen einen dritten herein, schoben mit den Stiefeln zwei leblose Gestalten zur Seite und legten den blutenden Körper ab. Der eine, ein rotberockter Hüne, sah sich im Halbdunkel um, und sein Blick blieb an dem würgenden Jungen in den abgerissenen Kleidern hängen. Er sagte etwas zu seinem Begleiter, und kurz darauf erschien ein müder Offizier, der sich über ihn beugte.
»Bist du verwundet, Bursche?«, fragte er, und der Junge tastete mit der Hand nach der Beule an der linken Seite seines Kopfes.
»Ah, verdammtes Glück gehabt. Wie heißt du?«
Der Junge überlegte. Das war eine schwierige Frage, aber irgendetwas dämmerte durch die roten Schmerznebel in seinem Kopf. Wie hatten sie ihn immer gerufen?
»Master«, stammelte er. »Master... Alexander.«
»Mhm«, meinte der Offizier im roten Rock. »Kannst du mit Pferden umgehen?«
»Ja, Sir.«
»Gut, dann komm hier raus. Die Franzosen haben das Hasenpanier ergriffen, im Augenblick ist alles ruhig.«
Er half dem schwankenden Jungen auf die Beine und führte ihn aus der Scheuer. Doch der Anblick draußen war nicht viel besser. Rund um das Gehöft lagen die Leichen Gefallener, stöhnten die Verwundeten und Sterbenden. Verendete Pferde streckten ihre Beine in die pulverrauchgeschwängerte Luft, vereinzelt fielen noch Schüsse. Doch die Kanonen schwiegen.
Es war Abend geworden, ein trüber, wolkenverhangener Abend, dessen Dunkelheit sich gnädig über das Grauen einer großen, blutigen Schlacht senkte. Einer Schlacht, die das Schicksal des Kaisers der Franzosen endgültig besiegelte und der Weltgeschichte eine neue Wendung gab. Waterloo hieß der Ort, zu dem der Offiziersbursche von Captain Finley den Jungen brachte. Hier lag das Hauptquartier der englischen Armee.
Noch immer halb benommen, mit Schmerzen in Kopf und Gliedern und den Bildern des Schreckens vor Augen trottete Alexander zu der ihm angewiesenen Unterkunft in einem geräumigen Stall und rollte sich auf einem Strohsack zusammen.
In den ersten Tagen ließen sie ihn in Ruhe. Ein Pferdeknecht brachte ihm dann und wann etwas zu essen und später ein paar einigermaßen saubere Kleider. Von dem hektischen Geschehen rund um ihn herum bekam Alexander wenig mit. Sein wunder Körper erholte sich allmählich von den vergangenen Strapazen, die Brandwunden verheilten, die Kopfschmerzen verloren an Heftigkeit. Manchmal wurde ihm noch schwindelig, aber nach vier Tagen war er in der Lage, zum Brunnen zu gehen und sich mit dem kalten Wasser zu waschen. Es hatte ihn niemand dazu angehalten, aber auf eine unklare Weise erinnerte er sich daran, dass man sich sauber zu halten hatte. Überhaupt schien sein Geist beschlossen zu haben, so gründlich wie möglich alles zu vergessen, was die Vergangenheit betraf. Nur die Gegenwart zählte, und in der musste er sich irgendwie zurechtfinden. Er befand sich an einem ihm unbekannten Ort, doch das Gewimmel von Uniformen war ihm vertraut. Auch die Pferde machten ihm keine Angst, und willig übernahm er die Aufgabe, sie zu füttern, zu striegeln und das Lederzeug zu putzen. Drei weitere Jungen, etwas älter als er, hatten ihre Bleibe in dem Pferdestall und kümmerten sich ebenfalls um die Tiere. Er sprach kaum mit ihnen, weil er sie schlecht verstand. Englisch war ihm zwar geläufig, nicht aber der breite Dialekt und die derben Ausdrücke, die sie verwendeten. Er erhielt bald den Spitznamen Donnow – »Don’t know« -, weil das seine ständige Antwort auf ihre Fragen war.
Er passte zu ihm, denn Alexander wusste vieles wirklich nicht. Aber als der Offizier, in dessen Dienst er zufällig geraten war, einen Monat später seinen Leuten erklärte, sie würden die Heimreise nach Colchester antreten, musste Alexander sich wenigstens einige Antworten auf die wesentlichen Fragen überlegen.
»Junge, ich habe dich zwar aus dem Durcheinander bei Plancenoit geklaubt, weil ich dich da nicht verrecken lassen wollte. Aber wie bist du eigentlich dahingekommen?«, wollte Captain Finley von ihm wissen und hielt ihn damit zurück, den anderen Stallburschen zu folgen.
»Ich fürchte, ich hab es vergessen, Sir.«
»Du fürchtest. Aha. Wer sind deine Eltern?«
»Sie sind tot, Sir.«
Das war die einzige Möglichkeit, das entsetzliche Gefühl zu ertragen, das sich jedes Mal in ihm breitmachte, wenn er wagte, sich dieser Frage zu stellen.
»Gott, ja, das sind heutzutage viele«, seufzte der Captain und nickte dann. »Mein Pferdeknecht sagt, du bist ganz anstellig. Wenn du willst, kannst du mitkommen. Hab schließlich zwei meiner Jungen hier verloren.«
Alexander nickte, und so betrat er im Herbst desselben Jahres englischen Boden. Die Männer der 30. Battery Royal Artillery – gemeinhin »Rogers Company« genannt – stammten überwiegend aus Colchester, und hier bezog auch Captain Finley Quartier.
In den folgenden zwei Jahren kümmerte sich Alexander in den Baracken der Garnisonsstadt um Finleys Pferde, dafür erhielt er ein Bett über den Ställen, täglich zwei Mahlzeiten, Weihnachten und Ostern neue Kleider und hin und wieder einen Shilling. Die Arbeit verlangte viel Zeit und Aufmerksamkeit, und er wuchs zu einem zähen, mageren Jungen heran. Die Brandwunde an seinem Arm war zu einer roten Narbe verwachsen und störte ihn nicht mehr, auch seine Kopfverletzung war vollständig verheilt, zurückgeblieben aber war eine Strähne weißen Haars an seiner linken Schläfe, die sich durch die hellbraunen Locken zog. Zwar blieb er weiterhin wortkarg, aber mit Jimmy und Wally, den beiden anderen Stalljungen, mit denen er die Unterkunft teilte, freundete er sich allmählich an. Sie saßen, wenn es nichts zu tun gab, bei einem Knobelspiel zusammen, das ihm nicht unvertraut erschien. Die Kartenspiele jedoch kannte er nicht, erwarb jedoch eine gewisse Geschicklichkeit darin. Lieber aber streunte er durch die Gegend, stibitzte von den Feldern schon mal ein paar Erdbeeren oder im Herbst den einen oder anderen Apfel. Mit dieser Beute saß er gerne am Ufer des Colne und sah den sich behäbig drehenden Wasserrädern der Mühlen zu. Hätte er seine Arbeit nicht so ordentlich und zuverlässig getan, hätte man ihn, den jungen Einzelgänger, der mit abwesendem Blick stundenlang an einer Stelle sitzen konnte, wohl für zurückgeblieben gehalten. Doch es war nicht geistige Stumpfheit, die ihn die Einsamkeit suchen ließ. Es war Trauer, eine ungewisse Art von Schuld, die er verspürte, die nicht fassbare Erinnerung an ein furchtbares Ereignis. Manchmal träumte er von den Schlachtfeldern, dann wachte er schreiend auf. Gelegentlich aber träumte er auch von einer Frau, die ihn liebevoll in den Arm nahm, und einem starken, großen Mann, zu dem er voller Bewunderung aufsah. Sie waren gesichtslos, namenlos, und wenn er aus diesen Träumen erwachte, waren seine Wangen nass von Tränen.
1817 wurde beschlossen, die Garnison in Colchester drastisch zu verkleinern. Die französische Bedrohung war endgültig verschwunden, die Soldaten wollten zurück zu ihren Familien. Captain Finley hatte um seine Entlassung gebeten und teilte das auch seinen drei Pferdeburschen mit. Er war ein fairer Mann, aber einen großen Stall zu halten, konnte er sich privat nicht leisten. Darum drückte er jedem der drei eine gut gefüllte Börse in die Hand und überließ es dem vierzehnjährigen Jimmy, dem dreizehnjährigen Wally und dem elfjährigen Alexander, sich zukünftig auf eigene Faust durchzuschlagen.
Süßer Trost
Sie ist ein reizendes Geschöpfchen,Mit allen Wassern wohl gewaschen;Sie kennt die süßen SündentöpfchenUnd liebt es, häufig draus zu naschen.
Die Schändliche, Busch
Anders als der magere, zähe Junge in England hatte es die pummelige Baroness von Briesnitz nicht schwer, sich durchs Leben zu schlagen. Zumindest hätte ein Außenstehender so geurteilt. Mit ihren drei Jahren war Dorothea, die sich selbst der Einfachheit halber Dotty nannte, ein zauberhaftes kleines Mädchen, das den Besucherinnen ihrer Mutter, der Baronin Eugenia, oft den Ausruf: »Was für ein süßes Zuckerpüppchen!« entlockte. Worauf die Baronin eine kontrapunktisch säuerliche Miene zeigte. Sie schätzte es überhaupt nicht, dass ihr Gatte eine ordinäre Rübenzuckerfabrik auf seinem Gut Rosian bei Magdeburg betrieb, und betonte bei jeder Teestunde, in ihrer Küche habe sie persönlich die Anweisung erteilt, ausschließlich importierten Rohrzucker zu verwenden. Dieser Anweisung wurde selbstredend nicht Folge geleistet, Rohrzucker aus den Kolonien war bei Weitem zu teuer für die sorgsam bedeckt gehaltenen Vermögensverhältnisse derer von Briesnitz.
Nichtsdestotrotz war Baronesschen Dotty ein lieblicher Anblick. Ihr rosiges, rundes Gesicht wies zwei schelmische Grübchen auf, wenn sie lächelte, ihre schokoladenbraunen Augen konnte sie schon mit drei Jahren neckisch aufschlagen, und wie gesponnene Zuckerwatte fielen ihre silberblonden, feinen Haare über ihren Rücken.
Nicht ganz so lieblich wie ihr Anblick zeigte sich indessen ihr Benehmen. Vor allem dann, wenn etwas nicht nach ihren Wünschen lief. In solchen Situationen konnte sie eine ganze Klaviatur unangenehmer Reaktionen bespielen. Die mildeste Form war ein demonstratives Schmollen, eine Steigerung ein störrisches Trotzen, verbunden mit energischem Aufstampfen der Füße. Half das nicht zu erreichen, was sie sich vorgenommen hatte, kamen Tränen, gefolgt von Schreikrämpfen hinzu, weshalb sich ihre Kinderfrau einmal zu einem Klaps auf den rüschenbedeckten Hintern hinreißen ließ, wodurch jedoch keine Besserung des Verhaltens eintrat, sondern ein hysterischer Anfall ausgelöst wurde, bei dem sich das Kind wie toll auf dem Boden wälzte und mit hochrotem Gesicht so lange brüllte, bis man einen Erstickungsanfall befürchten musste.
Die Amme fand schließlich eine Lösung – sie steckte in das zum Getöse aufgerissene Mäulchen der Kleinen ein Klümpchen Zucker. Dotty klappte den Mund zu, schnaufte ein paar Mal und lutschte dann den süßen Trost zufrieden auf.
Die Familie gewöhnte sich daran, für derartige Anfälle immer einige Zuckerstückchen oder Karamellen in erreichbarer Nähe zu haben. Zwar konnte man das Kind damit beruhigen, aber sie beseitigten nicht den Unmut und die Unzufriedenheit, die Dorothea allzu oft packten. Vor allem, seit ihr kleines Brüderchen Maximilian auf die Welt gekommen war, quengelte sie immer häufiger. Inzwischen war Max ein Jahr alt, ein genügsamer kleiner Kerl mit wachen Augen, von dem sein Vater voller Stolz nur als sein Sohn und Erbe sprach. Dotty verspürte giftige Eifersucht. Ihr sehnlichster Wunsch war, Maximilian möge ganz einfach wieder in dem Froschteich verschwinden, aus dem der Klapperstorch ihn angeblich geholt hatte.
Wo dieser Teich war, das wusste sie ganz genau. Man hatte nämlich, um genügend Wasser für die Zuckerproduktion weiter draußen auf den Ländereien zur Verfügung zu haben, ein kleines Flüsschen aufgestaut, das nun einen hübschen, von Büschen umstandenen Tümpel bildete. Ein schmaler Holzsteg war hineingebaut, auf dem der Baron gerne an warmen Sommerabenden saß, um Forellen zu angeln. An den Nachmittagen jedoch führte das Kindermädchen häufig ihre beiden Schützlinge dort hin, nicht unbedingt, um sich mit ihnen am Ufer zu ergehen, sondern um sich heimlich in dem sorgsam beschnittenen Gehölz mit dem Gärtner zu treffen. Klein Maximilian legte sie dann auf eine Decke ins Gras, drückte Dorothea einen Stoffhasen in die Hand und wies sie an, auf ihr Brüderchen aufzupassen.
Die Idee reifte langsam und gründlich in Dotty heran, und als das Kindermädchen sich wieder einmal in den raschelnden Büschen vergnügte, begann sie, zielstrebig an einem Deckenzipfel zu ziehen. Maximilian gefiel das Spiel, und er ließ sich kichernd und glucksend von seiner Schwester weiter und weiter schleifen. Er jammerte noch nicht einmal, als sie ihn über die holperige Schwelle auf den Steg zerrte. Mit rotem, verschwitztem Gesicht mühte sich Dorothea ab, bis die Decke schließlich ganz vorne angekommen war. Dort, wo das Wasser so tief war, dass man den Boden nicht mehr erkennen konnte.
Mit grimmiger Genugtuung kroch sie zu ihrem Bruder und schubste ihn vom Steg. Das kalte Wasser erschreckte ihn so, dass er sogar vergaß zu schreien. Zufrieden sah seine Schwester zu, wie er in dem trüben Wasser versank.
Lediglich das schnelle Eingreifen des Gärtners, der, noch mit offener Hose, in den Teich sprang, rettete dem Erben derer von Briesnitz das Leben.
Das Kindermädchen wurde entlassen. Dorothea musste eine strenge Strafpredigt über sich ergehen lassen, zudem wurde über sie eine harte Strafe verhängt – eine Woche lang keine Süßigkeiten. Das aber führte zu einem derartigen Tobsuchtsanfall, dass man schnellstens von der Durchführung der Strafmaßnahme Abstand nahm.
Und so lutschte Dotty zufrieden ihre Bonbons, ignorierte fürderhin ihren Bruder und träumte sich ein Leben als Zuckerprinzesschen zurecht.
Heißer Kakao
Erfahrung ist die Mutter der Wissenschaft.
Sprichwort
Jan Martin träumte auch – von fernen Ländern, was nahelag. Denn sein Vater betrieb einen florierenden Kolonialwarenhandel, und seit die napoleonischen Repressalien ein Ende gefunden hatten, blühte sein Geschäft noch weiter auf. In den schwarz gebundenen Auftragsbüchern im Kontor summierten sich die Zahlen zu ansehnlichen Beträgen, vor den Speichern warteten Schlangen von Frachtkarren, buckelten Lagerarbeiter Säcke und Kisten. Von den Schiffen, die die Weser hinauf bis in den Hafen von Vegesack segelten, wurden die wundervollsten Dinge herbeigebracht. Doch nicht schillernde chinesische Seiden oder grellfarbige Federn exotischer Vögel machten Jantzens Geschäft aus, sondern Säcke voll Kaffeebohnen, Kisten schwarzer Vanilleschoten, aromatische Zimtrinden und andere seltene Gewürze aus Übersee. Und in diesem Jahr hatte die Firma Jantzen ein neues Produkt eingekauft. Vorsichtig disponiert zunächst, denn man war auf Solidität bedacht und scheute Experimente. Immerhin eine ganze Schiffsladung Kakaobohnen war aus Venezuela eingetroffen, und Jan Martin freute sich, dass sein Vater ihm angeboten hatte, ihn zum Hafen zu begleiten, um die Ladung in Empfang zu nehmen.
Der dreimastige Segler lag am Pier vertäut, und sorgsam auf seine Schritte achtend folgte Jan Martin seinem Vater und dessen Prokuristen über die schmale Planke auf das sanft schaukelnde Schiff. Sie wurden vom Kapitän mit Würde begrüßt und erhielten die Auskunft, die sechswöchige Reise sei ohne große Probleme verlaufen. Allerdings, so bemerkte der Kapitän schmunzelnd, sei es diesen Sommer in Bremen fast so heiß wie in den Tropen.
Damit hatte er recht, das Quecksilber des Thermometers an der hölzernen Wand des Ruderhauses zeigte fünfunddreißig Grad an diesem Nachmittag. Nichtsdestotrotz bat der Kapitän seine Gäste in die Kajüte, um bei kühlen Getränken die Formalitäten abzuwickeln. Jan Martin erhielt jedoch die Erlaubnis, auf dem Schiff umherzustreifen, sofern er es dabei vermied, über Bord zu gehen. Erleichtert nahm der Junge die Gelegenheit wahr, aus der stickigen Kajüte zu entkommen.
Die Mannschaft hatte bis auf einen kleinen Rest Landgang, das Deck war sauber geschrubbt und leer, das Tauwerk ordentlich aufgerollt. Nur an der Reling standen zwei ins Gespräch vertiefte Männer. Der eine war ein rotbärtiger Tallymann1 in Gehrock und Melone, doch ohne die zu seinem Stand gehörige Messlatte. Der andere schien, seiner eleganten Kleidung zufolge, ein Passagier zu sein, der aus den südlichen Ländern kam, denn seine Haut war tief gebräunt. Jan Martin machte sich klein, um nicht entdeckt zu werden. Er war zwar schon zwölf Jahre alt, aber überaus schüchtern, obwohl es eigentlich keinen Grund dafür gab. Immerhin war er der einzige Sohn eines sehr wohlhabenden Bremer Kaufmanns. Aber seine Mutter war bei seiner Geburt fast gestorben, weitere Geschwister folgten ihm nicht. In seinen ersten Lebensjahren kränkelte er häufig und wurde entsprechend gehätschelt. Statt eine Schule zu besuchen, kamen Lehrer ins Haus, und wenn seine Cousins und Cousinen zu Besuch waren, zog er sich meist zurück, denn diese lebensstrotzende Rasselbande zog ihn zu gerne mit seiner rundlichen Figur und seiner Ungeschicklichkeit auf. Folglich mied er menschlichen Kontakt, so gut es ging, war aber in seiner stillen Art ein überaus wissbegieriger Junge und steckte seine Nase häufig tief in alle mögliche Bücher. Seine Lehrer äußerten sich voll des Lobes über seinen Verstand und seine rasche Auffassungsgabe. Insbesondere alles, was mit den Naturwissenschaften zu tun hatte, saugte er förmlich auf.
Hier auf dem Schiff wollte er nun unbedingt die Ladung begutachten. Kakaobohnen hatte er bisher nur im gerösteten Zustand in der Küche gesehen, und angeblich hatte der Kapitän sogar einige Kakaopflanzen mitgebracht, die Doktor Roth für seine botanischen Studien geordert hatte.
Jan Martin war schon häufiger auf vergleichbaren Schiffen gewesen und wusste, wo er zu suchen hatte. Er machte sich also daran, den Niedergang zu den Laderäumen hinabzusteigen und bemerkte dabei nicht den aufmerksamen Blick, mit dem ihn der Rotbärtige verfolgte.
Unten im Bauch des Schiffes war es dunkel, nur spärlich fiel das Licht durch das salzverkrustete Glas der Luken. Die Luft war noch dumpfer als an Deck und voller Gerüche der unterschiedlichsten Art. Holz, Teer, Schweiß, der typisch fischige Gestank von langsam verrottenden Algen und Muscheln – und die eigenartige Ausdünstung der Ladung. Nicht so aromatisch wie gerösteter Kakao roch sie – mit der Schokolade, die Jan Martin als Getränk kannte, hatten die getrockneten Bohnen noch wenig gemein. Aufmerksam registrierte Jan Martin diesen Umstand. Um sich ein noch genaueres Bild zu machen, wandte er sich den unteren Gefilden zu, wo die prall gefüllten Jutesäcke darauf warteten, entladen zu werden. Zwar hätte er jederzeit um eine Handvoll Bohnen bitten können, schließlich gehörte die Lieferung seinem Vater, doch sein Wissensdurst wollte sofort gestillt werden. Daher zerrte er an einem der vorderen Säcke. Sie waren schwer, und nach einem ganz bestimmten Prinzip gestapelt, um ein schnelles Entladen zu ermöglichen. Das aber erkannte Jan Martin nicht, und deshalb passierte das Unglück. Der Sack löste sich aus dem Verbund der anderen, sie kippten um, einige platzten auf und übergossen ihn mit einem Schwall prasselnder Kakaobohnen.
Alles das wäre vermutlich nicht so schlimm gewesen, hätte nicht die Sommerhitze während der Überfahrt in einem der Säcke einen Schwelbrand verursacht. Der flammte nun schlagartig auf, und der Kakao begann zu brennen.
Jan Martin schrie, als die glühenden Bohnen ihn trafen.
Polternd näherten sich Schritte, und laut fluchend kämpften sich der Rotbärtige und der Passagier mit bloßen Händen durch den Kakao, um den Jungen aus der entzündeten Ladung zu ziehen. Gerade noch rechtzeitig, um Schlimmeres zu verhindern. Jan Martins Kleider waren versengt, brannten zum Glück aber nicht, doch sein rechtes Ohr und die Wange waren in Kontakt mit der Glut gekommen.
Fassungslos vor Entsetzen über den Unfall, brachte Vater Jantzen seinen Sohn zusammen mit dem Passagier, der sich als Lothar de Haye vorstellte, zum Arzt der Familie, der sich des Notfalls sofort annahm.
»Eine üble Angelegenheit«, knurrte Jantzen, während Doktor Roth vorsichtig die versengten Kleider entfernte und die Brandwunden des Jungen reinigte. »Wie konnte das nur passieren?«
Lothar de Haye, der mitgeholfen hatte, Jan Martin zu bergen, zuckte mit den Schultern und erklärte: »Der Tallymann sagt, Kakao neige unerklärlicherweise manchmal zur Selbstentzündung. Ein schwieriges Handelsgut, wenn Sie mich fragen. Kaffee ist leichter zu transportieren.«
»Ich hätte die Finger davon lassen sollen. Ein Drittel der Ladung ist verloren.«
»Ein Risiko, sicher. Aber man kann gute Gewinne damit machen. Kakao ist ein rares Gut in unseren Breiten. Und wird doch sehr geschätzt«, meinte der Arzt, während er eine kühlende Salbe auf Jan Martins Wange auftrug.
»Ich trinke lieber Tee«, murrte Jantzen. »Aber meine Frau schätzt ihre heiße Schokolade am Morgen. In den Cafés wird sie auch immer beliebter, habe ich mir sagen lassen. Darum dachte ich ja... Na, vergessen wir es. Wie sieht es aus mit meinem Jungen, Albrecht?«
Jan Martin hatte die schmerzhafte Behandlung fast ohne Jammern über sich ergehen lassen und saß nun mit einem dicken Salbenverband im Gesicht und schuldbewusster Miene auf den Behandlungsstuhl.
»Er wird’s überleben. Eine Narbe wird wohl bleiben. Aber keine Angst, mein Junge, wenn die Zeit kommt, dass sich die Mädchen nach dir umdrehen, dann wird sie allmählich verblasst sein.«
Ob diese Zeit jemals kommen würde, bezweifelte Jan Martin im Augenblick jedoch. Trotz Schreck, Schmerzen und Beschämung drängte sich ihm die Frage über die Lippen, die er ihn die ganze Zeit bewegte.
»Herr Doktor Roth, wieso kann sich trockener Kakao von selbst entzünden?«
Doch obwohl der Arzt selbst auch ein leidenschaftlicher Botaniker war, hatte er darauf keine Antwort.
Die Kunst des Überlebens
Wie Splitter brach das Gebälk entzwei.Tand, Tandist das Gebilde von Menschenhand.
Die Brück’ am Tay, Fontane
Als Alexander das erste Mal die Fabrik betrat, blieb ihm buchstäblich der Mund offen stehen. Erst der derbe Stoß des Vorarbeiters brachte ihn wieder zur Besinnung. Diesem Knuff und der barschen Anweisung, sich zu den anderen Jungen zu gesellen, folgte er sofort. Dennoch blieb er beeindruckt. Unter dem Dach, über die ganze Länge der Halle hinweg, verliefen zwei Eisenstangen, an denen in unregelmäßigen Abständen Scheiben angebracht waren, die wiederum mit breiten Lederriemen mit den Antriebsrädern der Webstühle verbunden waren. Noch drehte sich die Welle nicht, ruhten die Schützen, standen die Schäfte still, doch irgendwo am Ende der Fabrik hörte man bereits das rhythmische Pochen der Dampfmaschine, die den Holzboden vibrieren ließ.
Alexander war mit Wally von Colchester aus nach London ins East End gezogen, wo dessen Angehörige lebten. Nach der ersten Faszination, die die übervölkerte, laute, quirlige Stadt mit ihren hohen Häusern, belebten Gassen und verrauchten Kneipen auf ihn ausübte, war recht schnell Ernüchterung eingetreten. Die Familie seines Freundes bewohnte zwei stickige, schmutzige Räume und eine verqualmte Küche, die zum Hinterhof hinausgingen. Diese Enge teilten sich Wallys Eltern, seine achtzehnjährige Schwester Jenny und drei jüngere Kinder, eines davon noch ein Säugling. Der heimgekehrte Sohn wurde nicht gerade mit Jubel begrüßt, noch weniger sein Begleiter. Zwei Esser mehr konnte man sich nicht leisten. Dennoch erlaubte der Skipper, wie Wallys Vater gerufen wurde, beiden Jungen, sich ein Deckenlager neben dem Küchenherd zu richten.
»Wennste bleiben willst, musste arbeiten«, erklärte Skipper, ein Veteran, der seinen rechten Arm bei Trafalgar gelassen hatte, Alexander ohne jede Freundlichkeit. »Hab gehört, in der Weberei suchen sie noch Hilfskräfte. Du gehst auch!«, befahl er seinem Sohn.
Am folgenden Tag sprachen sie in der Fabrik vor und wurden ohne große Umstände eingestellt.
Um sechs Uhr morgens begann die Arbeit. Die Einweisung war denkbar kurz und kaum hilfreich. Alexander wurde angewiesen, die leeren Garnspulen einzusammeln und den Frauen, die an den Webstühlen arbeiteten, die neuen zuzureichen. Es erschien ihm eine leichte Tätigkeit.
Bis zu dem Augenblick, als die Maschinen zum Leben erwachten.
Das Stampfen der Dampfmaschine wurde schneller, und mit einem Krachen setzten sich die beiden Transmissionswellen unter der Decke in Bewegung. Die Antriebsriemen surrten. Ein Webstuhl nach dem anderen wurde angekuppelt, und ein ohrenbetäubender Lärm erfüllte die Halle. Rasselnd, klappernd, kreischend schossen die Weberschiffchen hin und her, knallten die Rahmen auf und ab, ratterten die eisernen Gestänge. Am liebsten hätte Alexander sich die Ohren zugehalten, aber schon schubste ihn wieder jemand an, und er folgte einem der Jungen, um zu lernen, wie man die Garnrollen austauschte. Er musste sich die Handgriffe vom Zusehen aneignen, eine andere Verständigung war bei dem Getöse in der Fabrikhalle nicht möglich.
Als um zwölf die Glocke zur Pause läutete, war Alexander halb taub, und in seinen Ohren klingelte es. Zusammen mit den anderen Arbeiterinnen und Arbeitern schleppte er sich in den Aufenthaltsraum und packte das grobe Brot aus, das Jenny ihm dünn mit Schmalz bestrichen hatte. Hungrig war er nach dem Verzehr noch immer, aber mehr noch übermannte ihn die Müdigkeit. Wie alle anderen auch versank er in einen unruhigen, kurzen Schlummer, aus dem ihn unbarmherzig die Glocke weckte. Fünf weitere Stunden in der tobenden, feuchtwarmen, staubigen Hölle standen ihm bevor.
Vollkommen erschöpft wankte er neben Wally am Abend durch den aufsteigenden Nebel nach Hause.
»Ich halte das nicht aus«, murmelte er, als Jenny einen Teller Suppe vor ihn stellte.
»Dann gibt’s auch nix zu fressen.«
»Kann ich nicht etwas anderes machen?«
Die Alternativen, die ihm auf eindeutige Art aufgezeigt wurden, erschienen Alexander nicht erwägenswert, und so stand er am nächsten Morgen schlaftrunken auf, um einen neuen Tag in der Hölle zu verbringen.
Nach zwei Wochen hatte er sich einigermaßen an den eintönigen Tagesablauf gewöhnt und sich einen stumpfen Gleichmut zugelegt. Er aß, was er kriegen konnte, schlief, wann immer er Gelegenheit dazu fand, tat, was man ihm auftrug. Manchmal sehnte er sich nach den Pferdeställen zurück, nach dem Geruch von Stroh und Heu und warmen Tieren. Doch meistens wünschte er sich nur, aus der Fabrikhalle ins Freie zu entkommen. Dann wanderte er zu den Docks, wo die Fernsegler lagen, und atmete den rauchigen, feuchten Themsedunst ein, der ihm gegen die staubige, ölstinkende Fabrik und der nach menschlichen Ausdünstungen und faulendem Kohl riechenden Hinterhofwohnung geradezu elysisch vorkam.
Als es Winter wurde, musste er diese Ausflüge einstellen, es fehlte ihm an warmer Kleidung. Was den nun Zwölfjährigen zu einigen Überlegungen veranlasste.
Bisher hatte er den Lohn seiner Gastfamilie abgeliefert, wie sie sagten, als Miete und Kostgeld. Das musste anders werden. In den wenigen Monaten in London hatte er erkannt, wie hart es war zu überleben. Geradezu verwöhnt worden war er die beiden Jahre im Dienst von Captain Finley, gestand er sich jetzt ein. Er hatte diese Zeit zwar in einem geregelten, von militärischer Disziplin geprägten Tagesablauf verbracht, aber immerhin sorgte man für tägliche Mahlzeiten und zweimal im Jahr für neue Kleider. Nun aber war er auf sich selbst gestellt. Sein Verdienst reichte nicht, um sich eine eigene Unterkunft zu suchen, also musste er zumindest den Winter über bei Wallys Familie bleiben. Er brauchte mehr Geld, wenn er von ihnen loskommen wollte. Das war die ganz einfache Konsequenz. Geld bekam man durch Arbeit oder auf unlautere Weise.
Alexander hatte Taschendiebe bei der Arbeit gesehen. Er hatte auch gesehen, wie sie bestraft wurden. Das kam nicht infrage. Die Arbeit an den Docks wurde besser bezahlt als die Fabrikarbeit, hieß es. Aber auch wenn er ein hoch aufgeschossener, zäher Junge war, dem Lastenschleppen war er noch nicht gewachsen. Jenny und ihre Mutter gingen nicht in die Fabrik, sondern arbeiteten zu Hause, was ihn zunächst gewundert hatte. Aber die Erklärung dafür erhielt er, als er einmal das Mädchen ohne Haube gesehen hatte. Ihr fehlte die Hälfte der Kopfhaut – ein Unfall an einer Bandflechtmaschine, bei der ihre Haare in das Getriebe geraten waren, war die Ursache. Seither traute sie sich nicht mehr außer Haus. Sie nähte grobe Hemden für einen Armeelieferanten. Doch erstens konnte Alexander nicht nähen, und zweitens war der Lohn auch nicht höher. Wally, zwei Jahre älter als er, bekam, seit er im Maschinenhaus Kohle schippte, ein paar Pennys mehr. Aber dort ließen sie ihn noch nicht arbeiten. Er hielt also weiter die Augen offen und fand in den nächsten Tagen wirklich eine weitere Verdienstmöglichkeit. Es bedeutete zwar, dass er noch zwei Stunden länger in der Fabrik bleiben musste, aber wenigstens schwiegen die Maschinen in dieser Zeit.
Der Vorarbeiter war einverstanden, als er darum bat, die unbeliebte Tätigkeit des Maschinenschmierens übernehmen zu dürfen, und so lernte er in den nächsten Tagen, unter den Webstühlen herumzukriechen, um die Maschinenteile von dem beständig anfallenden Baumwollstaub, abgerissenen Fäden und Fasern zu reinigen und die Wellen, Zahnräder und Gestänge zu schmieren. Es war eine schmutzige, klebrige Beschäftigung, die ihn immer wieder zum Husten brachte. Doch er fand zu seiner Überraschung sogar Gefallen daran. Die Funktionsweise der Kraftübertragung belebte seine abgestumpfte Phantasie, und er stellte manche technischen Überlegungen an, ohne indessen mit jemandem darüber sprechen zu können. Die anderen Kinder, die für die Schmierarbeiten eingesetzt waren, interessierte es nicht, was sie da putzten und ölten. Der Vorarbeiter betrachtete sie als lästige Arbeitstiere, die gefälligst genauso zu funktionieren hatten wie die Webstühle. Die Maschinisten oder gar der leitende Ingenieur übersahen sie dagegen vollständig.
Das Geld, das er für seine zusätzliche Arbeit bekam, behielt er für sich. Weder der Skipper noch seine Frau fragten je nach mehr, und nur Jenny sah ihn misstrauisch an, als er mit ein paar abgetretenen, aber noch halbwegs brauchbaren Stiefeln erschien.
Alexander überlebte den Winter in London, wurde unbemerkt dreizehn und hätte, wenn man ihn das Zeichnen gelehrt hätte, inzwischen recht akkurat Kupplungen, Getriebe und einfache mechanische Steuerungen konstruieren können. Das Wesen der Maschinen war ihm vertraut geworden. Manchmal schlich er sich sogar in die Halle, in der die Dampfmaschine ihren Dienst tat, und betrachtete intensiv das gewaltige Schwungrad, das von dem Kolben angetrieben wurde. Dieses Rad leitete die Kraft der Maschine – sage und schreibe fünfunddreißig Pferdestärken – über komplizierte Zahnkränze und -räder an die Transmissionswellen in den Fabrikhallen weiter. Was Pferde zu leisten in der Lage waren, das hatte Alexander in den Ställen der Garnison gelernt, und er fragte sich, auf welche Weise ein so verhältnismäßig kleiner Apparat eine solche Arbeit verrichten konnte.
Er war sich jedoch auch der Gefahren bewusst, die sich hinter der geballten Kraft der Maschinen verbargen. Es verging kaum eine Woche, in der nicht irgendein Unfall passierte. Er hatte mitbekommen, wie Finger zwischen Kupplungen abgequetscht, wie herumfliegende Garnrollen zu tödlichen Geschossen wurden, wie heißes Maschinenöl Kleider entflammte und wie eine lose Metallbuchse einem Arbeiter ins Auge flog.
Er hatte Respekt vor der Technik und wurde achtsam.
Darum bemerkte er auch die sich lösenden Metallklammern, die die Enden des Lederriemens miteinander verbanden, der den großen Jacquard-Webstuhl antrieb. Er wies einen Arbeiter darauf hin, aber der grunzte nur, er solle die Klappe halten. Doch Alexander ließ der Anblick keine Ruhe. Die Welle drehte sich mit großer Geschwindigkeit, dreihundert Umdrehungen pro Minute, hatte er einmal den Ingenieur sagen hören. Wenn das Band riss, würde es mit großer Wucht durch die Halle fliegen. Den Schaden, den es dabei bei Mensch und Material anrichten konnte, wagte er sich nicht vorzustellen. Er suchte in der Mittagspause den Vorarbeiter auf und wies ihn auf den gefährlichen Zustand hin.
»Vorlauter Bengel! Willst du mir erklären, wie ich meine Arbeit zu tun habe?«, war die unwirsche Antwort, verbunden mit einer schallenden Ohrfeige.
Alexander resignierte. Er konnte nichts weiter unternehmen, als dem Schicksal seinen Lauf zu lassen. Doch er blieb weiter achtsam. Nur darum konnte er am späten Nachmittag, als sich die Klammern mehr und mehr lösten, gerade noch im rechten Augenblick aus dem Gefahrenbereich springen. Dabei riss er eines der kleinen Mädchen mit zu Boden und stieß eine junge Frau, die gerade die Spulen wechselte, zur Seite. Dann kam es zu einem lauten Knall, der sogar das Maschinengetöse übertönte, und der breite Antriebsriemen peitschte wild durch die Luft. Er traf den Vorarbeiter, riss ihm die linke Hand vom Arm, schlug einem Arbeiter ins Gesicht, der blutüberströmt zu Boden ging, und flog dann in einen Webstuhl, der sich kreischend festfuhr.
Der Vorarbeiter starrte noch fassungslos auf seinen Armstumpf und brach dann zusammen.
Das Mädchen, das Alexander zu Boden geworfen hatte, heulte und trat nach ihm, die junge Frau klammerte sich mit Entsetzen an seinem Hosenbein fest.
Irgendjemand brüllte einen Befehl, und die Maschinen wurden langsamer, blieben schließlich stehen. Die beiden großen Antriebswellen ruhten, und in der unerwarteten Stille hörte man ängstliches Geflüster. Doch niemand bewegte sich von seinem Platz, um den Verwundeten zu helfen. Der Ingenieur kam in die Halle gepoltert, gefolgt von dem Fabrikanten.
»Was ist hier los?«, fragte der aufgebracht in die Menge. »Warum wurden die Maschinen gestoppt?«
Alexander rappelte sich auf, und da kein anderer gewillt war, Auskunft zu geben, erklärte er: »Der Riemen ist gerissen, Sir«, und wies auf die leere Antriebsscheibe.
»Verdammt, Harvest, was ist das für eine beschissene Konstruktion«, fauchte der Fabrikant den Ingenieur an. Die Verletzten ignorierte auch er.
»Das liegt nicht an der Maschine, sondern an der Wartung.« Er schaute auf den blutenden, besinnungslosen Vorarbeiter.
Alexander folgte seinem Blick und begann zu würgen. Plötzlich war die Erinnerung an das Grauen auf dem Schlachtfeld wieder da. Ihm wurde schwindelig, und seine Beine wollten nachgeben. Das Mädchen neben ihm fing an zu plärren: »Der hat mich zu Boden gestoßen!« und zerrte an seiner Jacke. Da riss sich die junge Frau neben ihm zusammen und sagte mit heiserer Stimme: »Der Junge hat ihm gesagt, er geht kaputt. Hat er. Heut Mittag. Und mir und Meg, der blöden Gans, hat er das Leben gerettet.«
Der Ingenieur betrachtete den blassen Alexander mit gewissem Interesse.
»Wie heißt du, Junge?«
»Alexander Masters, Sir.«
»Stimmt das, was die Frau sagt?«
»Ja, Sir.«
»Er hat ihm’ne Ohrfeige dafür verpasst, der Idiot von Vorarbeiter«, mischte sich die Frau wieder ein.
»Wir unterhalten uns noch, Masters. Geh rüber ins Maschinenhaus und warte dort auf mich.«
»Wie Sie wünschen, Sir.«
Noch etwas wackelig von dem Schock stolperte Alexander vorbei an den beiden Verwundeten, doch er war heilfroh, dem Anblick zu entkommen.
Thornton Harvest war besessen von technischen Konstruktionen und mechanischen Abläufen. Er war Ingenieur mit Leib und Seele, die Menschen interessierten ihn gewöhnlich selten. Er war außerdem ein eingefleischter Junggeselle von knapp vierzig Jahren, von gepflegtem britischem Stoizismus und, obwohl er gut verdiente, ein unprätentiöser Mensch. Das Einzige, was er wirklich hasste, war, wenn aus Schlampigkeit etwas schiefging.
Alexander hatte seine Aufmerksamkeit geweckt, und in dem nachfolgenden Gespräch fand er heraus, dass der Junge seine Leidenschaft teilte. Tatsächlich überraschte ihn das profunde Verständnis, das er, wenn auch nicht mit dem richtigen technischen Vokabular ausgedrückt, von den Arbeitsvorgängen in der Fabrik hatte. In einer spontanen Anwandlung, die ihn selbst überraschte, bot Harvest ihm nach einer halben Stunde eingehender Befragung an, ihn zu seinem Assistenten auszubilden.
»Versteh mich richtig, Masters. Bezahlen kann ich dir nicht viel mehr als das, was du hier bekommst. Aber ich biete dir eine eigene Kammer, drei Mahlzeiten täglich und – mhm – notwendigerweise wohl auch eine Garnitur sauberer Kleider.«
Lange brauchte Alexander wirklich nicht zu überlegen. Das war seine Chance, dem stinkenden Hinterhof zu entkommen, Wallys ewig nörgelnder Familie, der Hölle der Fabrikhalle und dem ewigen Hunger.
»Sir, gerne. Ich kann arbeiten, Sir. Was immer Sie wollen.«
»Gut. Ich regle das mit dem Chef. Du holst deine Habseligkeiten, und um fünf treffen wir uns am Fabriktor.«
In der Wohnung fand Alexander den Skipper vor. Der einarmige Veteran konnte nur einfache Arbeiten verrichten, aber die beiden Frauen saßen schweigend am Fenster und nähten. Ohne große Erklärungen packte Alexander seine wenigen Sachen in ein Tuch und schnürte es zu einem Bündel zusammen. Dann kramte er ein paar Münzen hervor und legte sie auf den Tisch.
»Ich zieh zu Mister Harvest. Der ist der Ingenieur.«
»Ach, jetzt wird Mister Masters was Besseres, hä?«, giftete Jenny, und ihr Vater schnaubte. »Wird sich’nen wunden Arsch holen. Aber manche mögen das ja.«
Alexander sparte sich eine Antwort. Was der Einarmige damit gemeint hatte, war ihm in den vergangenen Monaten auf unangenehmste Weise deutlich gezeigt worden. Es war die Ursache dafür, dass seine freundschaftliche Beziehung zu Wally bis zum Gefrierpunkt abgekühlt war. Ein Grund mehr, der Enge der Strohmatratze am Küchenherd zu entfliehen.
Es begann für ihn tatsächlich eine bessere Zeit, auch wenn ihn die ersten Nächte wieder furchtbare Albträume plagten, in denen er über blutende Leichen auf einem Schlachtfeld steigen musste. Er wusste, er musste unbedingt jemanden erreichen, musste ihn dringend warnen. Doch immer mehr Tote und Verwundete türmten sich vor ihm auf, schrien vor Schmerzen, röchelten im Todeskampf, bluteten aus klaffenden Wunden. Und der, zu dem er gelangen wollte, rückte in immer weitere Ferne. Wenn Alexander erwachte, war sein Kopfkissen feucht von Tränen. Doch er schwieg darüber und verbannte rigoros die Erinnerungen an den Krieg und auch die an die schmutzige Hinterhofwohnung aus seinem Denken. Es half ihm, dass Harvest keine Bedenken kannte, seinen jungen Adlatus alle möglichen Arbeiten verrichten zu lassen, ob Stiefelputzen, Wohnung fegen, Hemden bügeln, kochen oder Einkäufe machen – das alles nahm Alexander gerne in Kauf. Dafür durfte er nämlich eine winzige Mansardenkammer sein Eigen nennen, besaß neue, anständige Kleider und wurde vor allem in die Geheimnisse der Maschinentechnik eingeweiht. Er trottete beständig mit einem Klemmbrett und Stift hinter dem Ingenieur her, reichte ihm, wenn notwendig, Werkzeuge zu, durfte später selbst kleinere Reparaturen ausführen. Harvest verhielt sich üblicherweise wortkarg, doch Alexanders Fragen beantwortete er ausführlich. Der Junge ahmte ihn in vielem nach, und allmählich verschwand auch der üble Dialekt aus seiner Sprache, den er sich im Zusammensein mit Wally und seinen Leuten angewöhnt hatte.
Zwei Jahre ging das Zusammenleben gut. Alexander war inzwischen fünfzehn und zu einem kräftigen jungen Mann mit klarem Gesicht und ruhigem Auftreten herangewachsen. Er hatte seine Aufgabe und Bestimmung gefunden und erwog, als Lehrling in eines der großen Maschinenbau-Unternehmen einzutreten. Harvest reagierte zurückhaltend, als er diesen Vorschlag machte, und war drei Tage lang noch wortkarger als sonst.
Alexander wurde ungeduldig. Er sagte sich, dass der Ingenieur vermutlich überlegte, wie er ihn von dem Vorhaben abbringen konnte. Denn schließlich war er nicht nur sein technischer Assistent und Handlanger, sondern auch Kammerdiener und Hausknecht in einem. Er nahm sich vor, sollte Harvest sich weiter in Schweigen hüllen, seine Vorstellungen am kommenden Sonntag sehr deutlich zu machen, obwohl die Unterstützung eines gestandenen Ingenieurs seinem Vorhaben nützlich wäre – schließlich konnte er ihm mit seinem Renommee als Techniker Türen öffnen, an die er ohne Hilfe vergebens klopfen würde. Aber wenn es hart auf hart ging, würde er auch einen anderen Weg finden.
Am Samstagmorgen wanderten die beiden schweigend durch den Frühnebel zur Weberei, als Harvest plötzlich stehen blieb und Alexander die Hand auf die Schulter legte.
»Ja, Junge. Es ist an der Zeit. Ich will sehen, was ich für dich tun kann. Halten kann ich dich ja nicht.«
Verdutzt über diese letzte Formulierung und erleichtert, ohne Konflikt sein Ziel erreicht zu haben, nickte Alexander und folgte dem Ingenieur schweigend zum Maschinenhaus.
Hier herrschte rege Betriebsamkeit, die Kohleschipper schaufelten kräftig Brennstoff in den Ofen, um das Wasser im Kessel auf Betriebstemperatur zu bringen, damit der Dampf anschließend in den Zylinder strömen konnte.
Alexander bemerkte als Erstes die große Lache unter dem Dampfkessel. Ein Blick bestätigte seine Befürchtung – der Füllstandsanzeiger am Kessel war bedrohlich abgesunken. Er wollte sich zu Harvest umwenden, um ihn zu informieren.
In diesem Augenblick begann einer der Maschinisten, Wasser in den Kessel zu pumpen.
»Nicht, du Idiot!«, schrie Alexander auf und hechtete im letzten Moment zur Tür hinaus.
Kaltes Wasser traf auf rotglühendes Eisen.
Der Dampf dehnte sich schlagartig aus.
Die Detonation vernichtete die gesamte Umgebung. Metallstücke, Mauerbrocken, brennende Kohle, Glasscherben, Papierfetzen und gesplittertes Holz flogen wie Geschosse durch die Gegend. Sie bohrten sich in Balken und Ziegel und menschliches Fleisch. In der Rückwand des Maschinenhauses entstand ein langer Riss. Mit einem Krachen stürzte das Dach ein.
Unter den Trümmern fand Alexander später seinen Lehrer und Freund. Er erkannte ihn nur noch an den Stiefeln, die er am Abend zuvor eigenhändig geputzt hatte.
Einer seiner Albträume war Wirklichkeit geworden.
Abschied und Neubeginn
Das hat mein jung HerzeleinSo frühzeitig traurig gemacht.Morgen muß ich fort von hierUnd muß Abschied nehmen.
Clemens Brentano
Ich verlebte eine glückliche Kindheit auf Gut Evasruh im Mecklenburgischen. Als ich dem Gängelband entwachsen war und auf eigenen Füßen laufen, hopsen und klettern konnte, erkundete ich die Gärten und Ställe zusammen mit den anderen Kindern der Bediensteten. Manchmal gesellte sich uns auch der Sohn des Grafen hinzu. Julius war zwar sechs Jahre älter als ich, aber er hatte durchaus seinen Spaß daran, mit uns Kleineren Verstecken, Haschen oder Ball zu spielen. Ich sah bewundernd zu ihm auf, und er betrachtete mich, wie mir schien, mit nachsichtiger Belustigung. Vor allem meine Weigerung, Kakao zu trinken – ein seltener Genuss, den die anderen an Ostern oder Weihnachten immer mit lautem Jubel begrüßten -, nahm er zum Anlass, mich liebevoll zu necken. Dann aber verschwand er aus meinem Leben, zumindest für die meiste Zeit, denn er besuchte, als er neun wurde, ein Knabeninternat in Berlin. Nur zu den Ferien erschien er auf dem Gut, und dann wurde er oft von seinen Eltern in Beschlag genommen. Viel Zeit für ausgelassene Spiele blieb ihm somit nicht mehr.
Doch auch meine Tage unbeschwerten Nichtstuns waren vorüber. Ab meinem fünften Lebensjahr besuchte ich mit den Dorfkindern die kleine Schule und lernte das Geheimnis des Abc kennen. Ich fand es lustig und freute mich darüber, dass die Frau Gräfin mir, als sie mich an einem Nachmittag auf meiner Schiefertafel Wörter malen sah, ein paar alte Fibeln brachte, die zuvor Julius benutzt hatte. Begeistert buchstabierte ich darin herum.
Die gnädige Frau, Besucher nannten sie achtungsvoll Lady Henrietta, denn ihre Eltern stammten aus einem anderen Land, genau wie Nanny auch, war eine schöne Dame. Ganz anders als Mama, obwohl ich die auch sehr hübsch fand. Bei Lady Henrietta lag es nicht nur an den eleganten Kleidern und dem sorgfältig frisierten Haar, sondern auch in ihren ruhigen, würdevollen Bewegungen. Nie sprach sie laut, sondern immer in warmer, sanft modulierter Stimme, selbst wenn sie den Leuten Anweisungen erteilte. Nie ließ sie es dabei an einem Bitte oder Danke fehlen, und meist begleitete ihre Worte ein leichtes Lächeln. Sie war lange nicht so hochnäsig wie die Haushälterin oder so steif wie der Majordomus. Ich verehrte sie, und Lady Henrietta schien mich ebenfalls zu mögen. Sie arbeitete gerne in dem Blumengarten hinter dem Haus, und wenn sie mich sah, rief sie mich zu sich und zeigte mir, wie man Unkraut zwischen den Levkojen zu zupfen hatte oder verblühte Blüten aus den Rosen entfernte. Dabei hörte sie aufmerksam meinen Erlebnissen zu, über die ich mit ihr freimütig zu plappern pflegte. Wenn sie mit der Gartenarbeit fertig war, nahm die Gräfin mich an die Hand und lieferte mich eigenhändig in der Küche ab. Oft sagte sie zu meiner Mutter solche Dinge wie: »Birte, Ihre kleine Tochter ist ein wahrer Sonnenschein.«
Mama knickste dann und mahnte: »Verwöhnen Sie das Kind nicht zu sehr, gnädige Frau.«
Aber verwöhnt war ich nicht. Ich übernahm, wenn ich nicht lernen musste, schon eine ganze Reihe von Aufgaben unter Aufsicht meiner Mutter. Teller abtrocknen, Kupferpfannen polieren, Kräuter zupfen, Beeren verlesen und derartige Handreichungen beherrschte ich schon selbstständig. Besonders gerne aber bereitete ich den Zucker für die Süßspeisen vor. Dazu bearbeitete zuerst meine Mutter den Zuckerhut, ein festes, weißes Gebilde von fast einer Elle Höhe, mit einem besonders dafür vorgesehenen Werkzeug – einer runden Zange, um ihn festzuhalten, und einer Hacke, um Stücke daraus zu brechen. Diese Brocken zerkleinerte ich dann weiter mit einem Zuckerhämmerchen zu winzigen Stücken. Brauchten wir Puderzucker, kamen Mörser und Pistill zum Einsatz, dessen Handhabung ich nach anfänglichen Schwierigkeiten schließlich auch meisterte. Am Herd durfte ich, als ich groß genug war, um ungefährdet mit den Töpfen zu hantieren, ebenfalls mithelfen und lernte, Apfelmus, Puddings und den Frühstücksbrei sorgfältig zu rühren, damit sie nicht anbrannten, Pfannkuchen backen, Würste braten und Milchsuppe kochen.
Doch es blieb auch Zeit für kindliche Beschäftigungen. Im Sommer spielte ich weiter mit den anderen Kindern draußen auf dem Hof, im Herbst, wenn die Stürme über das Land pfiffen, und vor allem im Winter, wenn die frühe Dämmerung hereinbrach und der eisige Hauch aus dem weiten Osten die Natur erstarren ließ, suchte ich gerne die alte Nanny auf, um bei ihr am Feuer zu sitzen. Die Kinderfrau hatte schon Lady Henrietta großgezogen und war später zu ihrer engen Vertrauten geworden. Als sie den Grafen von Massow heiratete, hatte sie Nanny gebeten, sie zu begleiten und auch ihre Kinder zu betreuen. Doch nur Julius bedurfte in den ersten Jahren ihrer Aufsicht und Erziehung. Inzwischen war auch er ein Schuljunge und im Internat untergebracht. Nanny hingegen – ihren richtigen Namen hatte sie wohl selbst schon vergessen – war mit ihren sechzig Jahren noch immer eine agile Frau, auch wenn ihr inzwischen ein Hüftleiden einen Stock aufzwang. Sie kümmerte sich gerne um uns Kinder auf dem Gut, und in mir fand sie eine begeisterte Zuhörerin all ihrer vielen Märchen, Gedichtchen und Lieder. Als ich noch klein war, hatte ich gar nicht gemerkt, dass Nanny Englisch mit mir sprach, ich lernte die Worte, die sie verwendete, genauso rasch wie die deutschen meiner Mutter. Mit sieben Jahren konnte ich die beiden Sprachen sehr wohl unterscheiden, doch war die eine mir so geläufig wie die andere. Wenn draußen der Winterwind an den Läden rüttelte, lauschte ich hingebungsvoll den phantastischen Abenteuern von König Arthurs Rittern, den Geschichten von Feen, Banshees und Leprechauns, von Seehundmännern, die ihren Pelz, und Schwanenfrauen, die ihr Federkleid verloren, von tanzenden Steinen und magischen Schwertern.
Was ich in diesen von flackerndem Kaminfeuer erhellten und von dem süß duftenden Bienenwachs der Kerzen durchzogenen Stunden lernte, war viel mehr als das Einmaleins, das der pedantische Dorfschullehrer mir beibrachte. Es lehrte mich den Glauben an Wunder und die Macht der Träume. Nanny fügte ihre eigene Prise Weisheit hinzu und weckte in mir das Vertrauen darauf, dass in mir selbst der Zauber schlummerte, der Wünsche wahr werden ließ.
Einmal, kurz vor Weihnachten war es, da traute ich mich, der gütigen alten Frau die Frage zu stellen, die mich schon lange bewegte. Denn ich war damals, wie viele Kinder, in der Lage, hinter die Masken der Erwachsenen zu blicken. Und Lady Henriettas stets gleichbleibende Heiterkeit schien mir oft von Kummer durchzogen.
»Nanny, warum lächelt Lady Henrietta nie mit den Augen? Ist sie traurig?«
»Ja, Kind, sie ist traurig«, antwortete Nanny, die auf meine Frage nicht besonders überrascht reagierte. »Wir sprechen nie darüber, aber du hast es dennoch bemerkt, und darum schulde ich dir wohl eine Erklärung. Vor einigen Jahren hat Lady Henrietta einen großen Verlust erlitten. Ihr ältester Sohn ist gestorben, und das hat sie – und auch der Herr Graf – nie ganz verwunden. Um diese Wunde nicht ständig wieder aufzureißen, schweigen wir alle darüber.«
Große Verluste hatte ich bis dahin noch nicht erlebt, doch ich erinnerte mich daran, wie leid es mir jedes Mal tat, wenn Julius nach den Ferien wieder abreiste. Also nickte ich und verstand ein bisschen mehr als zuvor die stille Würde der Gräfin.
Dann aber kam ein Abschied, der auch mich mit tiefer Traurigkeit erfüllte.
Wir verließen Evasruh und zogen im Herbst, der sich an einen wie mit Gold durchwebten Sommer anschloss, nach Berlin um, da der Graf in der Hauptstadt unabkömmlich war und Präsentationsaufgaben wahrzunehmen hatte.
Obwohl die große Stadt, das schöne Haus, die neue Schule meine Begeisterung weckten, vermisste ich doch schmerzlich das freie Leben auf dem Gut in Mecklenburg und vor allem Nanny mit ihren Liedern und Geschichten.
Im Stadtdomizil beschäftigten die Massows natürlich die Berliner Dienerschaft, die Bediensteten von Evasruh blieben, bis auf Lady Henriettas Zofe und dem Leibdiener des Grafen, auf dem Gut. Nur meine Mutter hatte die gnädige Frau gebeten, mit in die Stadt zu kommen. Ihre Backkünste und Fertigkeiten in der Herstellung von Süßspeisen, so behauptete sie, überträfen alles, was der Koch in der Leipziger Straße zu bieten hatte.
»Ich werde dafür sorgen, dass Ihre Tochter eine gute Ausbildung erhält«, hatte Lady Henrietta hinzugefügt, was meine Mutter dankbar annahm. Ich besuchte also den Unterricht in einer Schule in der Markgrafenstraße, die vor gut zehn Jahren auf Wunsch der hochverehrten, viel zu früh verstorbenen Königin Luise von Preußen gestiftet worden war. Es war keine höhere Bildungsanstalt wie jene privaten Mädchenschulen, in denen den Elevinnen Konversation, gesellschaftlicher Schliff und feine Handarbeiten vermittelt wurden, sondern eine Gesindeschule, in der wir Mädchen handfeste Hauswirtschaft beigebracht bekamen und auf den späteren Beruf vorbereitet wurden. Ich lernte gerne, und nach dem Unterricht nahm ich weiter Aufgaben in der Küche wahr. Leider hatte es dort gleich von Beginn an Reibereien mit dem regierenden Herrscher in diesem Reich gegeben. Der französische Koch wollte niemanden an seiner Seite gelten lassen, und es bedurfte tatsächlich eines Machtworts seitens der Gräfin, dem er zunächst mit der Androhung seiner fristlosen Kündigung, dann mit märtyrerhafter Resignation begegnete. Doch das Arbeitsklima blieb eisig, und möglicherweise war das der Grund, warum meine Mutter oft mit dem Zuckerbäcker Fritz Wolking plauderte, der den Haushalt bei großen Festen mit seinen exquisiten Torten belieferte. Ich bemerkte bald, dass ihre Wangen eine rosige Färbung annahmen, wenn sie wieder einmal mit Fritz »Rezepte ausgetauscht« hatte, wie sie ihre Tändelei fröhlich umschrieb. Auch ich mochte den rundlichen Mann, der süßen Duft ebenso wie achtbare Gediegenheit verbreitete.
Die Dinge hätten sich vielleicht anders entwickelt, wenn die Massows im darauffolgenden Sommer wieder auf das Gut zurückgekehrt wären. Aber kurz vor Pfingsten fand sich Lady Henrietta unerwartet in der Küche ein. Wir waren allein, der Koch hatte seinen freien Tag, und höflich knicksten wir beide, als sich die Gräfin ohne Umschweife an den sauber geschrubbten Arbeitstisch setzte.
»Ich muss mit Ihnen reden, Birte.«
»Amara, geh bitte in unser Zimmer«, forderte meine Mutter mich auf, aber Lady Henrietta schüttelte den Kopf. »Sie sollte dabei sein. Sie ist ja schon ein großes Mädchen.«
Beklommen hockte ich mich auf die Stuhlkante und faltete brav die Hände im Schoß. Obwohl ich erst neun Jahre alt war, verstand ich sehr wohl die äußerst ungewöhnliche Situation. Meine Mutter sah ebenfalls aus, als ob sie sich nicht recht wohl in ihrer Haut fühlte.
»Das, was ich zu sagen habe, unterliegt allerstrengster Vertraulichkeit. Ich bitte dringend darum, dass alles absolut unter uns bleibt.«
»Selbstverständlich, gnädige Frau.«
»Ganz bestimmt, gnädige Frau!«
»Ich weiß, ihr seid keine Schwatzbasen. Nun, es hat sich ergeben, dass der General einen bisher noch nicht öffentlich bekannten Ruf nach London erhalten hat, dem er beschlossen hat zu folgen. Er wird eine wichtige diplomatische Aufgabe übernehmen, die für das Vaterland von äußerster Wichtigkeit ist. Wie ihr wisst, lebt meine Familie in England, und ich möchte die Gelegenheit nutzen und ihn begleiten. Auf diese Weise werde ich auch meine Verwandten wiedertreffen und alte Bande neu knüpfen. Wir werden voraussichtlich zwei oder drei Jahre bleiben.«
Ich hatte einen Kloß im Hals. Meine Mutter strich sich die Schürze glatt und schaute auf ihre Hände. Mit belegter Stimme fragte sie: »Sie... Sie kündigen mir, gnädige Frau?«
»Nein, Birte, das war nicht der Zweck dieser Unterredung. Dafür schätze ich Sie viel zu sehr. Ich wollte Sie nur frühzeitig genug auf die kommenden Ereignisse vorbereiten, damit Sie Ihre Entscheidung treffen können. Sie haben nämlich mehrere Möglichkeiten.«
Ich hörte meine Mutter leise seufzen. Dann sah ich in Lady Henriettas Augenwinkeln ein winziges Lächeln zwinkern, und plötzlich löste sich die leise Anspannung.
»Höchst interessante Möglichkeiten, Birte.«
Mit Verwunderung bemerkte ich, wie sich die Wangen meiner Mutter tiefer röteten.
»Habe ich die?«
»Nun, zum einen könnten Sie hierbleiben und in dem frostigen Klima der Küche weiterarbeiten. In dieses Haus hier werden zwei verwitwete Cousinen des Grafen einziehen. Sie sind, wenn ich es recht verstanden habe, verhältnismäßig anspruchslos.«
»Ja, gnädige Frau?«