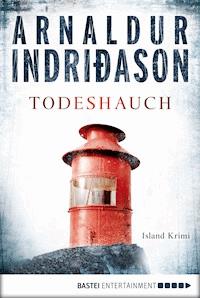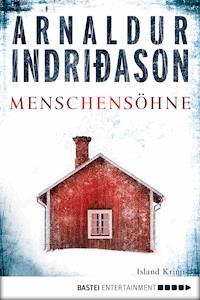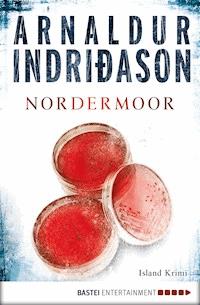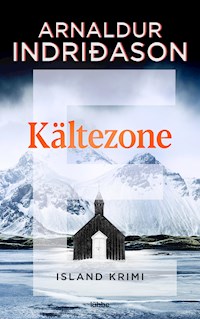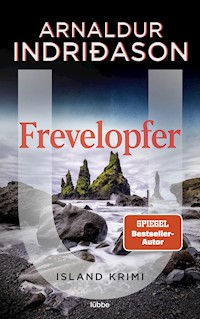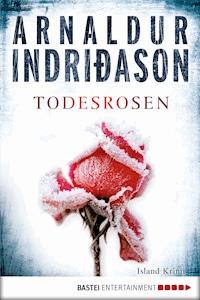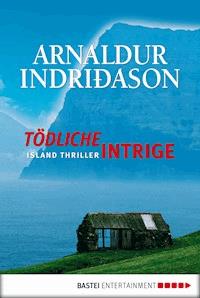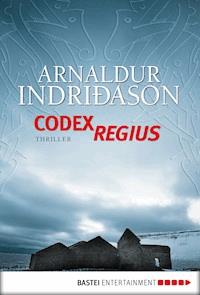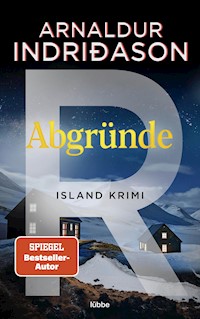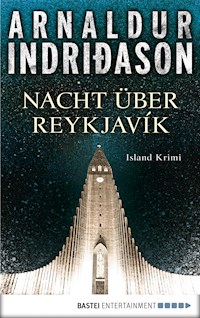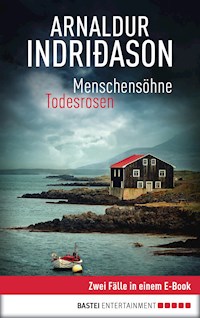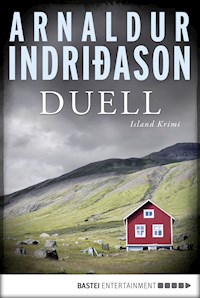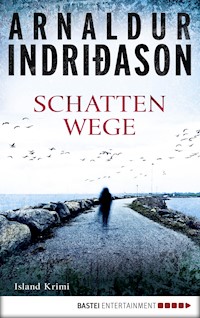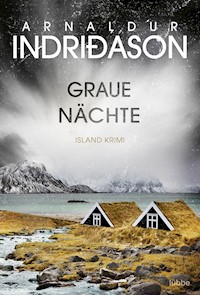
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Krimi
- Serie: Flovent-Thorson-Krimis
- Sprache: Deutsch
Frühling 1943. In Reykjavik ist die Lage angespannt, Island ist von den Amerikanern besetzt. In diesen unruhigen Zeiten wird eine Leiche an einem Strand, nahe des Stadtzentrums, entdeckt. Der Mann, ein Soldat, wurde offenbar ermordet. Ein weiterer Fall beschäftigt Kommissar Flóvent und seinen Kollegen Thorson von der Militärpolizei: Eine Frau, die oft mit Soldaten gesehen wurde, verschwindet spurlos. Stehen der Mord und das Verschwinden der Frau im Zusammenhang? Die Kommissare ermitteln in einem heiklen Umfeld ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 430
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Über dieses Buch
BuchFrühling 1943. In Reykjavik ist die Lage angespannt, Island ist von den Amerikanern besetzt. In diesen unruhigen Zeiten wird eine Leiche an einem Strand, nahe des Stadtzentrums, entdeckt. Der Mann, ein Sol-dat, wurde offenbar ermordet. Ein weiterer Fall beschäftigt Kommissar Flóvent und seinen Kollegen Thorson von der Militärpolizei: Eine Frau, die oft mit Soldaten gesehen wurde, verschwindet spurlos. Stehen der Mord und das Verschwinden der Frau im Zusammenhang? Die Kom-missare ermitteln in einem heiklen Umfeld …
Über den Autor
Arnaldur Indriðason, 1961 geboren, graduierte 1996 in Geschichte an der University of Iceland und war Journalist sowie Filmkritiker bei Islands größter Tageszeitung Morgunbladid.
Heute lebt er als freier Autor mit seiner Familie in Reykjavik und veröffentlicht mit sensationellem Erfolg seine Romane. Arnaldur Indriðasons Vater war ebenfalls Schriftsteller.
1995 begann er mit Erlendurs erstem Fall, weil er herausfinden wollte, ob er überhaupt ein Buch schreiben könnte. Seine Krimis belegen allesamt seit Jahren die oberen Ränge der Bestsellerlisten. Seine Kriminalromane »Nordermoor« und »Todeshauch« wurden mit dem »Nordic Crime Novel’s Award« ausgezeichnet, darüber hinaus erhielt der meistverkaufte isländische Autor für »Todeshauch« 2005 den begehrten »Golden Dagger Award« sowie für »Engelsstimme« den »Martin-Beck-Award«, für den besten ausländischen Kriminalroman in Schweden.
Arnaldur Indriðason ist heute der erfolgreichste Krimiautor Islands. Seine Romane werden in einer Vielzahl von Sprachen übersetzt. Mit ihm hat Island somit einen prominenten Platz auf der europäischen Krimilandkarte eingenommen.
Arnaldur Indriðason
Graue Nächte
Island Krimi
Übersetzt aus dem Isländischenvon Anika Wolff
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Die Arbeit der Übersetzerin am vorliegenden Text wurde vom Deutschen Übersetzerfond gefördert.
Titel der isländischen Originalausgabe:
»Petsamo«
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2016 by Arnaldur Indriðason
Published by arrangement with Forlagið, www.forlagid.is
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Anja Lademacher, Bonn
Umschlaggestaltung: Jeannine Schmelzer unter Verwendung von Motiven von © JLBvdWOLF/Alamy Stock Foto ; © Tanach Tam/shutterstock ; © David Khondiashvili/shutterstock ; © Andrey Yurlov/shutterstock
eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7325-6067-7
www.luebbe.de
www.lesejury.de
Eins
Über Umwege lief er nach Hause, doch als er es bis zum Kongens Nytorv geschafft hatte, ließ ihn das Gefühl nicht mehr los, dass er verfolgt wurde. Er sah sich um, konnte jedoch nichts Ungewöhnliches entdecken, nur Leute auf dem Heimweg von der Arbeit. Auf der Strøget hatte er einige deutsche Soldaten gesehen und es vermieden, ihnen über den Weg zu laufen. Er eilte über den Platz. Eine Straßenbahn hielt an, ließ Fahrgäste aussteigen und zuckelte wieder los. Seine Angst hatte im Laufe des Tages zugenommen. Ihm war zu Ohren gekommen, dass die Deutschen Christian verhaftet hatten. Er wusste es nicht sicher, hatte es in der Unibibliothek aufgeschnappt und sich nichts anmerken lassen. Als ginge es ihn nichts an. Zwei Medizinstudenten hatten beteuert, die deutsche Sicherheitspolizei hätte Christian im Morgengrauen zu Hause überrascht und mitgenommen.
Am Theater blieb er stehen, zündete sich eine Zigarette an und blickte über den Platz. Er war unruhig – wenn sie Christian verhaftet hatten, wussten sie sehr wahrscheinlich auch von ihm. Den ganzen Tag hatte er darauf gewartet, ihre Absätze knallen zu hören, während er sich in der Bibliothek zum Lesen gezwungen hatte, so getan hatte, als wäre nichts geschehen. Aber er hatte sich nicht konzentrieren können, und jetzt traute er sich kaum nach Hause in sein Zimmer, das er in Christianshavn gemietet hatte.
Er trat die Zigarette aus und ging weiter, über die Knippelsbro, durch Seitenstraßen und stille Gassen, und war erleichtert, als er feststellte, dass ihm niemand folgte. Er sah ständig Christian vor sich, in den Händen der Nazis, und konnte sich gut vorstellen, wie es ihm jetzt ging, falls an dem Gerücht etwas dran sein sollte. Sie hatten beide gewusst, welches Risiko sie eingingen, kannten Geschichten von Verhaftungen und Verhören, versuchten, nicht zu viel darüber nachzudenken, und hofften, dass der Tag nie kommen würde, an dem man auf sie aufmerksam würde. Jetzt war es geschehen. Er hatte in der Bibliothek gesessen und überlegt, wie das passieren konnte, aber er hatte keine Antwort darauf. Er war nicht mit besonderem Heldenmut gesegnet, fasste es aber als seine Pflicht auf, seinen Teil beizutragen, und hatte nicht zweimal nachdenken müssen, als Christian ihn um Hilfe gebeten hatte.
Er hatte sich bei einem älteren Ehepaar eingemietet. Als er sich dem Haus näherte, wurde er langsamer, blieb an der Straßenecke stehen und beobachtete den Verkehr. Sein Zimmer lag im zweiten Stock, zur Straße hin. Er wusste nicht, wohin er sonst sollte. An den Ort, wo sie sich normalerweise heimlich trafen, traute er sich nicht, denn er wusste nicht, über welche Informationen die Nazis verfügten. Seine Freunde wollte er nicht aufsuchen, um sie nicht auch noch in diesen Horror hineinzuziehen. Er und Christian hatten noch nicht darüber geredet, was sie tun sollten, falls ihre Aktivitäten auffliegen würden. Sie hatten keinen Plan ausgearbeitet. Nicht über mögliche Fluchtwege gesprochen. Das alles war immer noch so neu und fremd. Es war erst wenige Monate her, dass die Nazis das Land besetzt hatten, und der Widerstand steckte noch in den Kinderschuhen. Christian war der Anführer, und jetzt, wo er nicht mehr da war, fühlte es sich an, als wäre er ganz allein auf der Welt. Er stand da und blickte zu seinem Fenster hinauf, seine Gedanken schweiften zu Familie und Freunden in Island, und er spürte, dass ihm das alles über den Kopf wuchs.
Es schien, als ginge das Leben auch in dieser Straße seinen gewohnten Gang. Leute kamen von der Arbeit nach Hause, und Geschäfte wurden geschlossen. Er kannte den Buchantiquar, der ihn jeden Morgen grüßte, den jungen Studenten auf dem Weg zur Uni. Der Metzger hatte ihm erzählt, dass er eine Verwandte in Island habe, und etwas Köstlicheres als beim Bäcker gegenüber hatte er noch nie gegessen. Manchmal wachte er morgens vom Duft des Gebäcks auf, der über die Straße in sein Zimmer zog und einen weiteren duftenden Sonnentag in Kopenhagen verhieß. Er hatte sich vom ersten Moment an wohl in dieser Stadt gefühlt. Doch jetzt, wo der Abend kam und sich die von den Nazis angeordnete Verdunkelung über die Stadt legte, war das Grauen des Kriegs beinahe mit Händen greifbar. In diesen Momenten war es, als verwandelte sich die Stadt mit ihren finsteren Gebäuden und den tiefen Schattenwegen in ein Gefängnis.
Er zündete sich noch eine Zigarette an und dachte an die, die er liebte, und sehnte sich mehr denn je nach ihr. Wenn er es zur Gruppe schaffte, konnte er sich möglicherweise retten. Er hatte sich auf die Passagierliste geschrieben, wie er es ihr versprochen hatte. Die Isländer würden am nächsten Tag aufbrechen, von der Havnegade, und immer wieder kam ihm der scheußliche Gedanke, dass Christian dem Verhör vielleicht über die Abreise hinaus standhalten würde. Er wusste, dass dieser Gedanke nicht gerade ehrenhaft war, und er schämte sich dafür, doch jetzt musste jeder versuchen, seine eigene Haut zu retten.
Er wartete noch einen Moment, dann trat er auf die Straße, und im selben Moment hörte er hinter sich auf einmal Schritte.
Zwei
Die Reisebusse tauchten einer nach dem anderen auf und kamen langsam zum Hafen heruntergerollt, der ein kleines Stück außerhalb des Ortes lag. Die meisten hatten eine schwierige Reise hinter sich, von Dänemark hinüber nach Schweden und von dort aus gen Norden über die Landesgrenze nach Finnland. Auf der letzten Strecke bis nach Petsamo waren die Busse über schlechte Straßen durch Gebiete gekrochen, in denen sich Russen und Finnen bekämpft hatten. Die Zerstörung war überall zu sehen, zerschossene Häuser und Bombenkrater auf den Feldern. Die Gruppe war zunächst mit Fähren und auf Viehwaggons gereist, und für diese letzte Etappe waren sie in Busse verfrachtet worden und von Rovaniemi nach Petsamo am Nördlichen Eismeer gefahren, wo das Passagierschiff Esja am Kai lag und darauf wartete, die Menschen nach Hause zu bringen. Die Gruppe war groß: Um die 260 Passagiere stiegen in den ruhig fallenden Schnee hinaus, als die Fahrzeuge schließlich am Hafen hielten, und streckten ihre Glieder, bevor sie nach ihren Taschen, Koffern und Bündeln sahen und sie zum Schiff brachten. Sie waren heilfroh, die Esja zu sehen, und fühlten sich schon beinahe wie zu Hause, als sie endlich an Bord gehen konnten.
Sie stand an der Gangway und beobachtete, wie die Leute aus den Bussen strömten – voll freudiger Erwartung, ihn endlich wiederzusehen, nach monatelangem Briefwechsel und einem einzigen Telefonat, bei dem sie ihn kaum verstanden hatte. Sie war einen Tag zuvor mit anderen Isländern nach Petsamo gekommen, die in Schweden gearbeitet hatten und nun mit der Esja nach Hause fahren wollten. Sie hatte sich über die Nachricht gefreut, dass das deutsche Oberkommando in Norwegen und Dänemark die Reise erlaubt hatte. Dass alle isländischen Staatsbürger, die das wollten, nach Hause reisen durften, dass ein Schiff geschickt werden würde, um sie abzuholen. Sie glaubte, dass dieser entlegene Ort gewählt worden war, weil er außerhalb der Kampfzonen lag und der Weg über neutrales Land führte. Sie hatte nicht zweimal darüber nachdenken müssen. Wollte in diesen unruhigen Zeiten nirgendwo anders sein als in Island und hatte ihn gedrängt, auch mit diesem Schiff zu reisen. In seinem letzten Brief hatte er geschrieben, dass er sich in die Liste eintragen wolle. Sie war erleichtert und freute sich, dass ihr Wiedersehen an Bord eines Schiffes auf dem Weg nach Island stattfinden würde. Sie musste eine Weile mit ihm allein sein.
Als sie ihn nirgends entdeckte, schob sie sich vorsichtig in das Gedränge, das am Kai entstanden war, und hielt besorgt nach ihm Ausschau. Sie stieg in einen Bus nach dem anderen und suchte sie erfolglos ab, bis sie einen seiner Kommilitonen aus dem Medizinstudium entdeckte. Ihr Herz machte einen Satz: Sie mussten gemeinsam hergekommen sein. Sie ging zu dem Mann, der sich über seine Reisetasche beugte, und begrüßte ihn. Er erkannte sie sofort, und – warum auch immer – sie umarmten sich wie alte Freunde, vielleicht weil sie an einem fremden Ufer standen und auf dem Weg nach Hause waren. Sie sah ihm sofort an, dass irgendetwas nicht stimmte.
»Ist er nicht mitgekommen?«, fragte sie.
Der Mann sah sich betreten um.
»Eigentlich wollte er, aber …«
»Aber was …?«
»Ich weiß es nicht. Ich habe auf ihn gewartet, aber er ist nicht gekommen. Leider. Hast du nichts von ihm gehört?«
»Nein«, antwortete sie. »Nur, dass er mit euch reisen und wir gemeinsam nach Hause fahren wollten.«
Der Mann nahm sie beiseite.
»Ich weiß nicht, was da dran ist, aber … Weißt du, was er in Kopenhagen gemacht hat?«, flüsterte er.
»Gemacht? Dasselbe wie du!«
»Ja, sicher, das schon, aber … ich weiß nicht, ob da etwas dran ist, aber ich habe gehört, dass er verhaftet wurde.«
»Verhaftet?!«
»Dass sie ihn festgenommen haben. Die Nazis.«
Drei
Thorson eilte durch den engen Krankenhausflur. Man hatte ihm gesagt, dass nur wenig Zeit bleibe. Der junge Mann sei sofort ins Militärkrankenhaus im Camp Laugarnes gebracht worden, er befinde sich in einem kritischen Zustand – es sei nicht sicher, ob er die Nacht überleben werde. Der Chirurg habe sein Bestes getan, doch der Mann habe viel Blut verloren, und die inneren Blutungen hätten nicht gestoppt werden können. Auf dem Flur begegnete Thorson einem katholischen Militärseelsorger, der schon darauf wartete, dem Opfer des Angriffs das letzte Sakrament zu spenden. Er schickte Thorson weiter zum Operationssaal.
Der Mann lag noch auf dem Operationstisch. Der Militärarzt stand vor ihm und trocknete sich die Hände, als Thorson hereinkam. Sie begrüßten sich, und der Arzt erklärte ihm, man habe dem Mann ein starkes schmerzstillendes Medikament gegeben. Dem qualvollen Stöhnen des Mannes nach zu urteilen, half es nur bedingt. Der Militärarzt meinte, er schwebe bereits irgendwo an der Grenze zwischen Leben und Tod. Es seien zu viele und zu tiefe Einstiche, außerdem seien wichtige Organe schwer verletzt worden. Mit einer kaputten Flasche sei er angegriffen worden. In einem Auge habe sich ein Glassplitter gefunden.
»Wir haben alles versucht, was in unserer Macht steht«, sagte er. »Einen solchen Überfall sieht man nicht alle Tage … diese Brutalität ist … das ist nicht nachvollziehbar.« Er nahm eine Morphiumspritze, drückte ein paar Tropfen aus der Nadel, damit die Luft entwich, und stach sie vorsichtig in den Arm des Mannes.
»Hat er irgendetwas gesagt?«
»Nein, er konnte uns nichts über den Angriff sagen und auch nichts darüber, wer ihn so zugerichtet hat.«
Der Verletzte stöhnte laut auf und schien wieder zu Bewusstsein zu kommen. Er hatte einen Verband um den Kopf, an manchen Stellen blutdurchtränkt, nur Nase und Mund waren noch zu sehen. Der Mann streckte suchend eine Hand aus, fand Thorson, der sich zu ihm herunterbeugte, und hielt ihn fest.
»…fa…«
»Ja?«
»…kon…«
Der Mann konnte nicht weitersprechen. Er ließ Thorson los, und seine Hand fiel kraftlos herunter. Thorson sah den Arzt an.
»Er ist im Delirium. Ich glaube, er hat auch versucht, uns etwas zu sagen, bevor wir ihn operiert haben, aber das war völlig unverständlich. Das Sprechen fällt ihm sehr schwer.«
»Ja, natürlich.«
Der Arzt zuckte mit den Schultern.
»Es ist nur eine Frage der Zeit, wann er …«
Die Tür schwang auf, und zwei Soldaten schoben ein Bett an den Operationstisch, um den Verletzten auf ein Zimmer zu bringen.
»Wissen Sie, ob es Zeugen gab, die den Angriff beobachtet haben?«, fragte Thorson.
»Nein, nicht dass ich wüsste«, antwortete der Arzt. »Der Soldat, der ihn gefunden hat, ist mit dem Krankenwagen hergekommen und sitzt jetzt in meinem Büro. Er sagt, er habe den oder die Angreifer nicht gesehen, vielleicht waren es mehr als einer. Der arme Junge hat versucht, die Hand über seinen Kopf zu halten, hat Schnitte an den Unterarmen und in den Handflächen. Es ist offensichtlich, dass …«
»Ja?«
»Er sollte das nicht überleben«, sagte der Arzt, »und das wird er auch kaum. Das war ein Mordversuch. Keine Frage.«
»War er unbewaffnet?«
»Ja, soweit ich weiß.«
Der Pfarrer folgte den Soldaten mit dem Krankenbett den Flur entlang, und der Arzt führte Thorson in sein Büro. Der Soldat sprang sofort auf, als er sie sah, und salutierte. Der Arzt sagte, er werde sie nun allein lassen, er wolle sich nach Hause aufmachen. Dann zog er die blutige Schürze aus und legte den Arztkittel ab. Thorson musterte den Soldaten. Seiner Uniform nach gehörte er zur Infanterie, war ein einfacher Gefreiter, kaum über zwanzig. Er fragte sofort nach dem Zustand des Opfers. Der Vorfall hatte ihn offenbar tief getroffen, und er versuchte, die Fassung zu wahren.
»Das war wohl kein schöner Anblick«, sagte Thorson und gab ihm ein Zeichen, sich zu setzen.
»Furchtbar, Sir«, sagte der Soldat.
»Können Sie mir sagen, was passiert ist? Waren Sie allein unterwegs?«
»Ja, ich kam gerade aus der Stadt, als ich etwas hörte, eine Katze, schien mir, so ähnlich klang dieses Jaulen jedenfalls, ich wusste nicht, was es war. Das war nicht weit von diesem Club, dem Piccadilly, da lag der Mann auf der Wiese, direkt vor dem kleinen Gebüsch. Ich rannte in den Club und ließ einen Krankenwagen rufen und … das war … überall war Blut, und er sah schrecklich aus.«
»Hat er irgendetwas darüber gesagt, was passiert ist?«
»Nein, er hat kein Wort herausgebracht, und dann ist er ohnmächtig geworden.«
»Und Sie kennen ihn nicht?«
»Nein.«
»Darf ich mal Ihre Hände sehen?«, fragte Thorson.
»Ich habe ihm das nicht angetan«, sagte der Soldat und streckte seine Hände aus, um zu zeigen, dass sie nicht zerkratzt oder blutig von einer Schlägerei waren. »Ich habe ihm geholfen.«
»Und Sie haben niemanden in der Nähe gesehen, der ihm das angetan haben könnte?«
»Nein, er lag dort ganz allein.«
»Hatten Sie den Eindruck, dass er aus dem Piccadilly kam?«
»Das kann ich nicht sagen.«
In diesem Moment erschien der Arzt in der Tür und sah Thorson ernst an.
»Jetzt ist es wirklich etwas anderes, Schwerwiegenderes als Körperverletzung«, sagte er. »Ich habe ja schon vermutet, dass er es nicht überleben wird.«
»Er ist also tot?«
»Ja, er ist tot. Wir hatten keine Chance, ihn zu retten.«
Vier
Die Frau sagte, sie heiße Guðmunda und wohne im Bjarnaborg-Haus. Sie wisse nicht, wo ihre Freundin sei, und wolle die Polizei darüber informieren, da ihr möglicherweise etwas zugestoßen sein könnte. Es sei gewiss nichts Neues, dass sie manchmal für einige Zeit verschwinde, aber so lange sei sie noch nie weg gewesen, sie mache sich Sorgen. Nicht zuletzt, weil ihre Freundin sich manchmal mit den Soldaten herumtreibe und vielleicht nicht ganz so … wählerisch sei, was das angehe. Die Frau brauchte einige Zeit, die richtigen Worte zu finden, und betonte sie dann so nachdrücklich, dass man meinen konnte, das sei das wichtigste Merkmal ihrer Freundin: nicht wählerisch. Flóvent hörte ruhig zu. Man hatte sie zu seinem Büro am Fríkirkjuvegur geschickt, als sie mit ihrem Anliegen auf die Wache in der Pósthússtræti gekommen war. »Das ist was für die Kriminalpolizei«, hatten sie ihr gesagt und kein allzu großes Interesse gezeigt, ihr weiterzuhelfen.
Flóvent telefonierte gerade wegen des Mordes am Piccadilly mit Thorson, als Guðmunda in seiner Tür erschien. Sie war um die fünfzig, hatte ihren besseren Hut aufgesetzt und den einzigen Mantel angezogen, den sie besaß. Während sie sprach, blickte sie mehr auf Flóvents Schreibtisch, als dass sie ihn ansah. Sie wirkte ziemlich scheu gegenüber der Obrigkeit und entschuldigte sich gleich zweimal dafür, dass sie ihn wegen einer solchen Lappalie störe, er habe sicher genug zu tun. Ihr Haar, das schon grau wurde, lugte struppig unter dem Hut hervor, und in der Hand hielt sie ein kleines Taschentuch, mit dem sie sich laufend die Nase wischte, da sie sich bei diesem unbeständigen Wetter erkältet hatte. Das Bjarnaborg-Haus halte weder Wasser noch Wind ab, erklärte sie, als Flóvent sich nach ihrer Gesundheit erkundigte.
»Und woher kennst du diese Frau?«, fragte Flóvent, nachdem er ihr gesagt hatte, dass sie sich gerne duzen könnten.
»Ellý? Sie durfte ein paarmal bei mir unterschlüpfen«, antwortete Guðmunda, »sich in einem Kämmerchen bei mir ausruhen, die Arme. Ansonsten kennen wir uns kaum.«
»Und zahlt sie dir etwas dafür?«, fragte Flóvent.
»Nein«, antwortete die Frau, »jedenfalls nichts, was der Rede wert wäre, ein paar Kronen.«
»Schuldet sie dir was?«
»Ja, das tut sie tatsächlich, wo du schon danach fragst, daher … es wäre mir lieb, wenn ihr sie finden würdet, damit … nein, damit ich weiß, dass alles in Ordnung ist.«
»Ist sie vielleicht einfach zurück nach Hause gegangen? Sagtest du nicht, sie sei aus Akranes?«
»Ja …, nein, das glaube ich nicht. Sie meinte, dass sie nie wieder dorthin zurückwolle.«
»Du hast es aber nicht nachgeprüft?«
Die Frau schüttelte den Kopf. Sie sah blass aus, hatte Tränensäcke unter den Augen, eine große, dicke Nase und hängende Mundwinkel, die ihr einen dumpfen, erschöpften Gesichtsausdruck verliehen.
»Wie meintest du das mit den Soldaten – dass sie sich mit ihnen herumtreibt?«
Guðmunda räusperte sich, rückte ihren Hut zurecht und berichtete Flóvent, dass die Vermisste ihr zum ersten Mal Ende des letzten Winters begegnet sei, ohne Dach über dem Kopf und ziemlich verloren. Im Grunde habe sie in der Gosse gelegen, und Guðmunda hatte sie aus Mitleid mit zu sich genommen. Eine andere Zuflucht habe die Frau nicht gehabt, sie sei trunksüchtig und ständig auf Achse, und sie schien ein kleines Einkommen dadurch zu erzielen, dass sie mit Soldaten schlief. Sie nehme alles mit, was die Ausländer an Vergnügungen, Alkohol und Tabak zu bieten hätten. Manchmal habe sie auch ihr etwas mitgebracht, Speck zum Beispiel oder Konserven. Manches sei richtig gut. Anderes weniger, wie die gekochten Bohnen in Tomatensauce – der reinste Fraß. Es sei zwecklos, sie davon abbringen zu wollen. Inzwischen habe Guðmunda es aufgegeben, auch wenn sie sich natürlich manchmal um sie sorge – und sie frage, ob sie denn gar keine Angst vor den Soldaten habe oder davor, sich in Gefahr zu bringen, wenn sie so allein und schutzlos unterwegs sei.
»Hast du früher schon einmal solche Frauen bei dir aufgenommen?«, fragte Flóvent. »Ihnen Unterschlupf gewährt?«
»Herumhurende Frauen, meinst du?«, sagte Guðmunda und rieb sich die Nase. »Nein, das mache ich normalerweise nicht. Ich bin nicht die Heilsarmee. Ich hatte einfach Mitleid mit ihr, und jetzt habe ich sie schon längere Zeit nicht mehr gesehen und mache mir Sorgen. Vielleicht müsste ich das nicht. Sie kann schon selbst für sich sorgen. Und ich denke dabei auch nicht an das Geld, das sie mir schuldet. Ich habe Angst um sie. Vielleicht ist ihr etwas zugestoßen, und ich dachte, ihr könntet sie irgendwie ausfindig machen.«
»Hat sie Soldaten mit zu dir nach Hause gebracht?«, fragte Flóvent.
»Nein, das hat sie nie getan, das habe ich ihr auch verboten. Das will ich nicht. Ich will nichts davon mitkriegen.«
»Als du gesagt hast, sie wäre nicht wählerisch«, hob Flóvent an, als das Telefon auf seinem Tisch zu klingeln begann. »Was meintest du damit?«
Er legte die Hand auf den Hörer, wollte aber mit dem Abheben noch warten, bis Guðmunda ihm geantwortet hatte. Doch als sie das nicht tat, entschuldigte er sich und ging ran. Es war ein Polizist von der Wache an der Pósthússtræti.
»Ja, Flóvent, also … er scheint aufgetaucht zu sein, der Mann, den wir gesucht haben«, sagte der Polizist. »In der Nauthólsvík, der Bucht da unten. Dort wurde eine Leiche am Strand gefunden.«
»Ach ja?«
»Sie glauben, dass er es ist. Es ist ein Mann, und sie glauben, dass er ertrunken ist. Die Beschreibung passt: blond, Tweedjacke.«
»Sag ihnen, dass sie nichts anfassen sollen.«
»Soll ich die Angehörigen informieren?«
»Ich spreche mit seiner Frau«, sagte Flóvent. »Sobald wir mehr wissen.«
Flóvent legte den Hörer auf, erhob sich und nahm seinen Mantel. Guðmunda saß wie angewurzelt da. Flóvent erklärte ihr, dass er leider sofort los müsse.
»Sie sagt, sie habe nur zwei- oder dreimal mit hohen Tieren aus der Armee geschlafen. Ansonsten waren das alles einfache Soldaten, und manche von ihnen waren nicht gerade angenehm. Eine Klemensína steckt da auch mit drin. Aus der Pólarnir-Siedlung.«
»Sie waren nicht angenehm?«
»Nein, und manchmal waren es sogar zwei oder drei auf einmal«, sagte Guðmunda und zog die Nase hoch. »Das muss man Ellý lassen, der guten Seele: Sie macht keinen Unterschied zwischen den Menschen.«
Fünf
Südlich des neuen Flughafens, den die Briten in der Vatnsmýri-Gegend eingerichtet hatten, war ein schöner Sandstrand. Dort gab es einen Hafen für die Wasserflugzeuge, die trocken und geschützt in Erdbuchten standen, die man in den Hang oberhalb des Strandes gegraben hatte. Wenn das Wetter gut war und die Sonne schien, sah man manchmal Leute auf Decken im Sand liegen, mit Sonnenhüten und Picknickkörben. Doch heute war ein kühler Apriltag und außer den Polizisten kaum jemand dort. Flóvent stellte das Auto ab und stieg zum Strand hinunter. Drei uniformierte Polizisten standen bei einer Leiche, die offensichtlich an den Strand getrieben worden war. Etwas abseits warteten zwei weitere Männer, die Wollmützen, hohe Gummistiefel und Fischerpullover trugen. Sie rauchten und unterhielten sich, doch als Flóvent näher kam, schauten sie auf und beobachteten, wie er die Polizisten begrüßte und sich neben die Leiche kniete. Sie lag auf dem Bauch, das Gesicht im Sand.
Wenig später hielt ein weiteres Fahrzeug oberhalb des Strandes, und ein Mann im Mantel und mit Schiebermütze machte sich daran, ein Stativ und einen großen Fotoapparat zum Strand herunterzuschleppen. Er stellte die Kamera neben der Leiche auf und schoss zwei Bilder, dann verrückte er das Stativ, legte eine neue Filmkassette ein und machte noch ein Bild. Flóvent hatte ihn gebeten, den Fundort abzulichten. Der Wasserpegel stieg bereits, bald würde der Bereich wieder geflutet sein. Noch ein weiterer Mann kam dazu, dick und Pfeife rauchend. Es war der Bezirksarzt von Reykjavík, der den Mann offiziell für tot erklärte – wahrscheinliche Todesursache: Ertrinken.
»Ich meine, das liegt auf der Hand«, sagte er und schob sich die Pfeife in den Mund.
Erst als der Fotograf noch einige weitere Bilder von der Leiche in ihrer jetzigen Position gemacht hatte, drehte Flóvent sie auf den Rücken. Der Körper hatte so lange im Meer getrieben, dass das Gesicht übel entstellt war und kaum noch zu erkennen. Der Mann trug eine Tweedjacke und ein aufgeknöpftes weißes Hemd und nur noch einen Schuh. Die Kleidung passte zur Beschreibung des vermissten Mannes. Algenfetzen hatten sich in seinem blonden Haar verfangen. Der Fotograf machte noch zwei Fotos, dann klappte er das Stativ zusammen.
»Heute Abend sind sie fertig«, versprach er im Gehen, wortkarg wie immer. Flóvent war es wichtig, dass schwerwiegendere Vorkommnisse fotografisch festgehalten wurden, und so verfügte die Kriminalpolizei inzwischen über ein kleines Archiv an Fotos, von Kriminellen und von Orten, an denen es in größerem Stil gebrannt oder sich eines der wenigen Kapitalverbrechen zugetragen hatte, die auf der Insel begangen wurden. Flóvent kontrollierte die Taschen des Mannes und fand drei Schlüssel an einem Bund, eine Geldbörse, ein Taschentuch und ein Feuerzeug. In der Börse war ein Foto, auf dem seine Ehefrau zu erkennen war, die ihn als vermisst gemeldet hatte.
»Kannst du abschätzen, wie lange er im Meer gewesen ist?«, fragte er den Arzt. »Gemeldet wurde sein Verschwinden vor … wie lange ist das jetzt her? Etwa zwei Wochen?«
»Ja, das kommt hin«, antwortete der Bezirksarzt. »Du müsstest das besser wissen als ich. Er sieht ziemlich übel aus. Dieser Zeitraum könnte passen.«
Flóvent sah sich den Strand und den Sand an. Alles deutete darauf hin, dass der Mann ertrunken war, entweder handelte es sich um einen Unfall, oder er war selbst ins Meer gegangen. Das musste nicht unbedingt hier in dieser Bucht passiert sein. Die Leiche war einige Zeit im Meer getrieben, möglicherweise war sie mit der letzten Flut in die Bucht gespült worden. Auf jeden Fall hatte sie hier nicht lange gelegen. Sie wäre auf alle Fälle bemerkt worden, entweder von den britischen Fliegern oder anderen Leuten, die in die Bucht kamen. Flóvent nahm etwas Sand in die Hand und ließ ihn sich durch die Finger rieseln. Der Mann in der Tweedjacke hatte keinerlei Verbindung zu irgendetwas dort am Strand, der Bucht, der Militäranlage, dem Meer und den düsteren Wolken. Es war, als wäre er vom Himmel gefallen.
»Sie werden langsam unruhig, wollen wieder los«, raunte einer der Polizisten Flóvent zu und machte eine Kopfbewegung in Richtung der Männer in den hohen Stiefeln, die ein Stück abseits am Strand standen und rauchten. Flóvent nickte, ging zu ihnen und begrüßte sie.
»Ihr habt also die Leiche gefunden«, sagte er und hielt es für unnötig, die Fischer zu siezen. »Habt sie vom Wasser aus entdeckt?«
»Etwas lag am Ufer«, sagte einer der Männer, »und Haukur hier hatte sein Fernglas dabei und meinte sofort, dass das ein Mensch sein könnte, und als wir näher kamen, da … also … ja, da war es leider wirklich so.«
»Ist das euer Boot?«, fragte Flóvent und zeigte auf ein hübsches Ruderboot, das auf den Strand gezogen worden war.
»Wir werfen hier manchmal unser Netz aus«, sagte der, der Haukur hieß, und kratzte sich unter der Wollmütze. Das Fernglas hing an einem Band um seinen Hals.
Ein britisches Militärflugzeug setzte über ihren Köpfen zur Landung an, und sie warteten, bis der donnernde Lärm oberhalb des Strandes verstummte. Die Männer erzählten, dass sie von dem kleinen Naturhafen Grímsstaðarvör im Westen kämen und in der Nähe des Flughafens schon mal Probleme wegen des Fernglases bekommen hätten.
»Als wären wir verdammte Spione«, sagte Haukur. »Die waren vielleicht schlecht drauf, die Briten. Sahen das Glas aufblitzen und fuhren sofort zu uns raus und wollten mir das Fernglas wegnehmen.«
»Und was hast du ihnen gesagt?«
»Dass ich das Fernglas wegen der Vögel dabeihabe«, erklärte Haukur. »Dass sie das nichts angeht.«
»Er interessiert sich für Vögel«, ergänzte sein Kamerad.
»Verstehe«, sagte Flóvent und blickte zur Halbinsel Kársnes jenseits der Bucht hinüber, überlegte, ob die Leiche vielleicht von dort herübergetrieben war und ob es nicht sinnvoll sein könnte, sich das Wetter der letzten Tage genauer anzusehen, die Windrichtungen und Strömungen. »Ihr habt ihn nicht bewegt, oder?«, fragte er.
»Nein, wir haben ihn nicht angerührt. Sind zur Baracke dort oben gerannt und durften euch anrufen.«
»Habt ihr Personen in der Nähe der Leiche beobachtet?«
»Nein. Niemanden. Warum? Ist der Mann nicht einfach nur ertrunken?«
»Doch, wahrscheinlich schon.«
»Glaubst du, jemand hat ihn angegriffen?«
»Nein, darauf gibt es keine Hinweise«, sagte Flóvent. »Wir wissen nicht, ob der Mann hier oder irgendwo anders an der Küste ins Wasser gegangen ist. Ihr könnt das wahrscheinlich besser einschätzen als ich, die Strömungen und Gezeiten.«
»Seit einigen Tagen geht die Strömung in südwestliche Richtung«, sagte Haukur, »da wird hier aller möglicher Müll aus der Faxaflói angeschwemmt – mit Verlaub«, fügte er hinzu und sah zu den Männern hinüber, die sich daranmachten, die Leiche auf eine Krankenbahre zu legen.
Flóvent notierte sich die Namen der Fischer, dankte ihnen und sah zu, wie sie das Boot ins Wasser schoben und auf die Bucht hinausruderten. Einige Soldaten hatten sich am Ufer versammelt und beobachteten, was am Strand vor sich ging. Es waren Briten, und sie gehörten der Luftwaffe an, die in den Baracken an der Nauthólsvík untergebracht war. Flóvent musste daran denken, wie Winston Churchill Island zwei Jahre zuvor einen kurzen, überraschenden Besuch abgestattet hatte. Er hatte sich mit dem amerikanischen Präsidenten Roosevelt vor Neufundland getroffen und auf dem Heimweg in Island Station gemacht, um sich ein Bild von den militärischen Aktivitäten zu machen, insbesondere vom Flottenstützpunkt im Hvalfjörður. Flóvent hatte ihn auf den Balkon des Parlamentsgebäudes treten sehen, wie er blass und mit seinem großen Kopf der Menschenmenge zuwinkte, die sich auf dem Austurvöllur versammelt hatte.
»Können sie ihn jetzt mitnehmen?« Einer der Polizisten versuchte, Flóvents Aufmerksamkeit zu gewinnen. Er zeigte in Richtung der Sanitäter.
Flóvent schreckte aus seinen Gedanken auf. »Ja«, antwortete er. »Bringt ihn ins Leichenhaus des Universitätsklinikums.«
Er sah zu, wie sie die Leiche das Ufer hinauftrugen, wo der Krankenwagen wartete, und dachte an die Fischer, die Vogelbeobachtung und daran, wie groß die Angst vor Spionage an diesem und anderen militärisch wichtigen Orten auf der Insel war. Er wusste nicht, ob den toten Mann sein Schicksal hier am Strand ereilt hatte oder ob ihn Wind und Strömung hergetragen hatten. Wusste nur, dass es an der Zeit war, die Witwe zu treffen und ihr die Nachricht zu überbringen.
Sechs
Wie vom Donner gerührt stand sie am Kai dieses entlegenen, kalten finnischen Orts am nördlichen Eismeer und konnte nicht glauben, was der Mann ihr gerade gesagt hatte. Vielleicht hatte sie ihn inmitten des Lärms, der von den vielen Menschen hier ausging, nicht richtig verstanden.
Die Ankömmlinge aus den Reisebussen hatten begonnen, ihr Gepäck an Bord der Esja zu bringen. Man hatte ihnen gesagt, das Schiff werde nicht länger als unbedingt notwendig in Petsamo bleiben und ablegen, sobald alle Passagiere an Bord seien – sie sollten sich beeilen. Auf dem Weg nach Finnland hatte das Schiff bereits einige Passagiere aus Trondheim aufgenommen und war im Vestfjord in Norwegen in Schwierigkeiten geraten, als deutsche Kampfflugzeuge ihm den Weg versperrt hatten und es mit Waffengewalt in einen Hafen gezwungen worden war. Sie hatten dem Schiff knapp vor den Bug gefeuert und die Besatzung in Angst und Schrecken versetzt. Vier Tage lang stritt sich der Kapitän mit den Deutschen, bis sie ihren Fehler eingestanden und die Esja ihren Weg gen Norden fortsetzen ließen, in Richtung Finnland. Hier wartete das Schiff bereits seit einigen Tagen auf die Passagiere. Niemand wollte noch länger in Petsamo bleiben, sondern so schnell wie möglich gen Island fahren.
Die Besatzung half den Neuankömmlingen, ihre Plätze zu finden, und führte sie durch die schmalen Gänge zu den Kajüten und Frachträumen des Schiffs. Es war sehr eng an Bord – jeder freie Quadratmeter wurde zur Unterbringung der Passagiere genutzt. Nicht nur die wenigen Kajüten waren überbelegt, auch in den Frachträumen, auf den Gängen und sogar im Speisesaal hatte man Schlafplätze eingerichtet. Während die Passagiere an Bord gingen, wurden neue Vorräte aufs Schiff gebracht. Zollbeamte guckten in alle Taschen und Bündel und kontrollierten die Reisepapiere.
»Was meinst du damit?«, fragte sie ihn, immer noch ein Stückchen abseits vom Getümmel. »Warum sagst du das … dass die Nazis ihn festgenommen haben? Warum zur Hölle …?«
Der Mann, der ihr diese Nachricht über ihren Liebsten in Kopenhagen überbracht hatte, schüttelte den Kopf, als wäre es auch ihm unbegreiflich.
»Soweit ich gehört habe, wurden zwei Medizinstudenten verhört: Christian Steenstrup und Ósvaldur. Mehr weiß ich auch nicht. Das habe ich in der medizinischen Fakultät aufgeschnappt. Erst wurde Christian verhaftet, und dann haben sie sich Ósvaldur geholt, vielleicht auch noch andere. Das ist alles, was ich weiß. Das habe ich am Tag unserer Abreise aus Kopenhagen gehört. Ich habe niemandem etwas gesagt, weil … weil ich ja gar nicht weiß, was da dran ist, abgesehen natürlich davon, dass Ósvaldur nicht aufgetaucht ist …«
»Er wollte zusammen mit der Gruppe hierherkommen.«
»Ja. Ich weiß. Tut mir leid, ich wusste nicht, dass du hier sein würdest. Ich habe nicht damit gerechnet, dir diese Nachricht überbringen zu müssen.«
Sie starrte ihn an.
»Glaubst du, dass es so war?«, fragte sie. »Dass sie ihn verhaftet haben?«
Der Mann zuckte mit den Schultern, wie um zu betonen, dass er ihr alles gesagt hatte, was er wusste. Sie erinnerte sich daran, ihn in der medizinischen Fakultät gesehen zu haben, er war sicher schon am Ende seines Studiums, vielleicht zwei Jahre älter als Ósvaldur. Jetzt erinnerte sie sich auch dunkel wieder an seinen Namen. Valdimar – oder Ingimar, eins von beidem. Sie waren sich auf Treffen der Isländer in Kopenhagen begegnet, einmal als die Studentenverbindung eine Lesung aus neu erschienenen isländischen Büchern organisiert hatte, und einmal bei der Weihnachtsfeier der medizinischen Fakultät. Beide Male war sie mit Ósvaldur dort gewesen, und er hatte ihn einen feinen Kerl genannt.
»Wie kann ich es herausfinden?«, fragte sie. Aber als sie zur Kommandobrücke der Esja hinaufblickte, wusste sie plötzlich, was zu tun war.
Sie eilte in Richtung Gangway, zwängte sich durch die Menge. An Bord sah sie einen Matrosen und bat darum, den Kapitän sprechen zu dürfen. Es sei dringend. Der Matrose sagte, sie solle mitkommen, und sie folgte ihm durch den Speisesaal und hinauf auf die Brücke. Es hieß, der Kapitän sei in seiner Kajüte, und der Matrose erklärte ihr, wie sie dorthin komme, am Funkraum vorbei und dann rechts den Flur entlang. Sie folgte seiner Wegbeschreibung und traf auf den Kapitän, als der gerade aus seiner Kajüte kam. Sie stellte sich vor, und er merkte gleich, dass sie etwas auf dem Herzen hatte. Sie schilderte ihm die Situation, dass einer der Passagiere, ihr Freund, nicht in Petsamo angekommen sei – sie habe gehört, dass er möglicherweise in Kopenhagen verhaftet worden sei und sich nun in der Gewalt der Nazis befinde. Der Kapitän verstand sofort ihre Sorge und bat sie, ihm zu folgen. Kurz darauf hatte er den Funker ausfindig gemacht. Gemeinsam gingen sie zum Funkraum. Auf dem Weg dorthin versuchte sie, die Frage gedanklich so zu formulieren, dass sie unmissverständlich war, doch sie tat sich schwer damit. Wie konnte sie bloß herausfinden, ob ihr Liebster wirklich von den Nazis verhaftet worden war? Der Kapitän half ihr, und gemeinsam verfassten sie eine Nachricht an die isländische Botschaft in Kopenhagen:
PASSAGIER VERMISST. ÓSVALDUR M. IN KOPENHAGEN VERHAFTET? BITTE BESTÄTIGEN. ESJA. PETSAMO.
»Es sollte nicht lange dauern, bis sie antworten«, sagte der Kapitän tröstend. »Ich bin mir sicher, dass alles in Ordnung ist. Machen Sie sich keine unnötigen Sorgen. Wir werden sehen, was sie antworten.«
Sie versuchte zu lächeln, war froh, dass der Kapitän sofort reagiert hatte und ihr helfen wollte. Es war tröstlich, sich auf die Unterstützung der Landsleute verlassen zu können. Erst nachdem der Kapitän die Nachricht gefunkt hatte, erkundigte er sich vorsichtig nach Ósvaldur und ihrem Verhältnis zueinander. Sie sagte ihm, dass sie verlobt seien und sie zu einer weiterführenden Schwesternausbildung von Kopenhagen nach Schweden gegangen sei. Zu diesem Zeitpunkt hätten die Nazis Dänemark bereits besetzt, und sie sei nicht zurückgekehrt, in erster Linie, weil er sie inständig darum gebeten habe, in Schweden zu bleiben.
Mehr brauchte sie dem Kapitän nicht zu erklären. Angesichts der Besetzung Dänemarks durch die Deutschen erklärte sich Ósvaldurs Wunsch von selbst. Sie hatten sich am Kopenhagener Rigshospitalet kennengelernt, er Medizinstudent, sie werdende Krankenschwester. Ihr war aufgefallen, wie er mit den Patienten sprach, als seien sie ihm nicht gleichgültig, als liege ihm ihre Gesundheit wirklich am Herzen. Sie bekam mit, wie er sich ihre Sorgen und Nöte anhörte und versuchte, ihnen die Furcht zu nehmen. Seine Kommilitonen zeigten nicht annähernd so viel Feingefühl und Verständnis, nicht annähernd so viel Reife im Umgang mit denjenigen, die einen Verlust zu beklagen hatten. Ja, sie zeigten generell keine Reife. Ósvaldur war ernst und besonnen, sie konnte sich gut vorstellen, dass er bei älteren Menschen aufgewachsen war. Sie bekam mit, dass er das Reykjavíker Gymnasium besucht hatte, und fragte ihn eines Abends, als sie gemeinsam Schicht hatten, ob seine Eltern in Reykjavík lebten. Wie sich herausstellte, stammte er ursprünglich aus Ísafjörður, war aber größtenteils bei seinen Großeltern am Breiðafjörður aufgewachsen. Nach und nach bekam sie heraus, dass seine Mutter gestorben war, als er noch keine zehn Jahre alt gewesen war, sein Vater, Seemann, ihn zu seinen Eltern geschickt hatte, und er erst nach Reykjavík gekommen war, als er aufs Gymnasium gehen sollte. Er wollte sich auf Augenheilkunde spezialisieren. »Die Augen untersuchen – die Spiegel der Seele«, sagte er und lächelte schüchtern. Sie mochte diese schüchterne Art, weil sie bei ihm nicht von zu wenig Selbstvertrauen herzurühren schien, sondern eher daher, dass er es nicht gewohnt war, dass sich eine Frau für ihn interessierte.
Sie standen noch vor dem Funkraum, der Kapitän versuchte, sie zu trösten, als der Funker sie bat, kurz zu warten, da er soeben eine Antwort von der isländischen Botschaft in Kopenhagen erhalte. Er kritzelte etwas auf einen Zettel und gab ihn dem Kapitän, der ihn überflog und ihr weiterreichte:
BESTÄTIGUNG. ISLÄNDER VERHAFTET. UMSTÄNDE UNKLAR. WARTEN AUF NÄHERE INFOS.
»Dann stimmt es also?«, flüsterte sie.
»Das muss ein Missverständnis sein, das die isländische Botschaft ausräumen wird«, versuchte der Kapitän sie zu beruhigen, als er merkte, wie sehr ihr diese Nachricht zusetzte.
»Nein«, widersprach sie, war sich ihrer Sache ganz sicher. »Das ist kein Missverständnis. Leider. Die wissen genau, was sie tun. Sie haben ihn gefasst.«
»Ihn gefasst?«
Sie erklärte ihre Worte nicht weiter, und der Kapitän setzte sie auch nicht unter Druck.
»Ich befürchte, wir können hier nichts mehr für Sie tun«, sagte er. »Das Schiff ist bereit zur Abfahrt. Wir informieren Sie selbstverständlich, wenn wir noch einmal von der Botschaft hören.«
»Ja, natürlich«, sagte sie geistesabwesend, faltete den Zettel zusammen und steckte ihn in ihre Tasche. »Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen vielmals.«
Trotz allem sah sie keine andere Möglichkeit, als nach Hause zu reisen, und so saß sie mit dem Zettel in der Hand in ihrer Kajüte, als sie merkte, dass die Maschinen des Schiffes lauter stampften. Langsam entfernte die Esja sich vom Kai und glitt durch die Hafeneinfahrt. Sie wollte nicht zusehen, wie das Schiff den Hafen verließ, im Gegensatz zu vielen Mitreisenden, die im eisigen Wind an Deck standen und das Land langsam im nördlichen Eismeer versinken sahen. Sie schliefen zu mehreren in der Kajüte, doch sie hatte noch keine ihrer Kajütengenossinnen gesehen und ging davon aus, dass sie an Deck waren. Wieder und wieder las sie die Nachricht, dachte an Ósvaldur und überlegte, wo er wohl war und wie es ihm ging. Sie hätten gemeinsam an Bord sein sollen. Sie hatte sich so sehr darauf gefreut, ihn endlich wiederzusehen. Sie mussten über so vieles reden. Einander so viel erzählen. Die Sehnsucht nach ihm war beinahe unerträglich, und nur die Gewissheit, dass sie in Kürze zusammen nach Hause reisen würden, hatte dieses Gefühl abmildern können. Jetzt aber gab es nichts mehr, das ihre Sehnsucht lindern konnte, die Schwere, die sich auf ihr Herz legte, die Furcht, die sich in ihr ausbreitete.
Ihr blieben nur noch die Erinnerungen. Einst so greifbar und süß. Jetzt so fern und bitter.
Sie hatte ihm zum Abschied ein Geschenk gekauft, am Tag vor ihrem Aufbruch nach Schweden. Sie waren an einem kleinen Tabakladen in der Sankt-Peders-Stræde vorbeigekommen – ganz in der Nähe der Stelle, wo der isländische Dichter Jónas Hallgrímsson nach einem schweren Treppensturz so gefasst im Sterben gelegen hatte. Ósvaldur zeigte auf das Dachgeschoss und sagte, Jónas habe gewusst, dass er jung sterben würde, daher habe sich der Dichter mit seinem Schicksal abfinden können.
Er bat sie, kurz zu warten, und ging hinein, um Tabak zu kaufen, hatte als Gymnasiast mit dem Rauchen angefangen. Irgendwann wurde ihr das Warten langweilig, und sie betrat den Laden, als er gerade bedient wurde. Er drehte sich um, lächelte ihr zu und versuchte, sie unauffällig auf den Tabakverkäufer aufmerksam zu machen, der einen winzigen Kopf hatte, aber den größten Oberlippenbart, den sie je gesehen hatte. Sie freute sich über seinen Übermut und wollte ihm irgendetwas zur Erinnerung an diesen Tag und die gemeinsame Zeit in Dänemark kaufen. Vielleicht weil sie von Gewissensbissen geplagt wurde. Sie hatten nicht viel Geld, und nach kurzer Überlegung fiel ihr ein, dass ihm ständig Streichhölzer fehlten, daher kaufte sie ihm ein billiges, mit dem dänischen Wappen verziertes Feuerzeug.
»Das werde ich nie tun«, sagte Ósvaldur und schlang seine Arme um sie, als sie den Laden verließen.
»Was meinst du?«, fragte sie.
»Mich mit dem Tod abfinden.«
Sieben
Die Ehefrau reagierte gefasst, als Flóvent mit bekümmerter Miene von der Nauthólsvík-Bucht zu ihr nach Hause kam. Sie schien sich mit dem Unvermeidlichen abgefunden zu haben.
Er musste nichts sagen.
»Er wurde also gefunden?«, fragte sie an der Tür, als hätte sie seinen Besuch erwartet, wenn nicht heute, dann morgen. Wenn nicht diese Woche, dann in der nächsten.
Flóvent nickte.
Sie bat ihn herein, und er setzte sich ins Wohnzimmer, wo er schon einmal gesessen hatte. Diesmal war sie Flóvent in erster Linie dankbar. Sie war allen dankbar, die an der Suche teilgenommen hatten, den Polizisten, den Pfadfindern, der Bevölkerung und allen, die mitgefühlt und sie unterstützt hatten, seit sie einen halben Monat zuvor auf der Wache in der Pósthússtræti gemeldet hatte, dass ihr Mann nicht nach Hause gekommen war.
»Gut, dass er gefunden wurde«, sagte sie, als Flóvent schon eine Weile dort gesessen und ihr berichtet hatte, dass zwei Männer von einem Boot aus die auf dem Bauch liegende Leiche am Strand der Nauthólsvík gesehen und die Polizei informiert hätten. Das lange Treiben im Meer hatte den Körper verunstaltet, aber Verletzungen, die auf eine Gewalttat hindeuteten, waren nicht zu sehen. Wahrscheinlich sei er ins Meer gegangen, wie sie schon vermutet hatten. Die Strände seien abgesucht und die Küstenlinie von Reykjavík mit Booten abgefahren worden.
Als sie auf die Wache gekommen war, um ihren Mann vermisst zu melden, hatte sie ihn schon drei Tage nicht mehr gesehen und gesagt, dass sie sich große Sorgen mache, dass sie nicht länger abwarten könne. Ihr Mann hieß Manfreð und war zur Arbeit gegangen, wie jeden Morgen. Sie war mit dem Schiff nach Akranes gefahren, wo sie einmal im Monat beruflich zu tun hatte. Als sie zwei Tage später zurückkam, war er nicht zu Hause gewesen. Er arbeitete bei einer Versicherungsgesellschaft und machte normalerweise zwischen fünf und sechs Uhr Feierabend. Der Abend verging, ohne dass er auftauchte, und gegen acht machte sie sich ganz verunsichert zur Nachtschicht auf, ohne von ihm gehört zu haben. Sie arbeitete als Krankenschwester bei den Nonnen im Landakot-Spital. Sie sorgte sich inzwischen sehr, so etwas war noch nie vorgekommen. Als sie am nächsten Morgen nach Hause kam, begann sie, sich bei seinen Arbeitskollegen zu erkundigen, bei Freunden und Bekannten, jedoch möglichst unauffällig, ohne sich zu besorgt zu zeigen. Flóvent gegenüber sagte sie später, sie habe dadurch verhindern wollen, dass die Leute denken, mit ihrer Ehe sei irgendetwas nicht in Ordnung, denn das sei nicht der Fall.
Gegen Mittag war sie mit ihrem Latein am Ende und konnte es nicht länger hinauszögern, mit der Polizei zu sprechen. Die Suche nach dem Mann wurde sofort begonnen. Fotos von ihm erschienen in den Zeitungen. Er wurde übers Radio gesucht. Auch seine Kollegen wussten nicht, wo er war. Sie hatten gedacht, er sei krank, und wunderten sich, dass er das nicht gemeldet hatte. Das hat er wohl versäumt, dachten sie und fanden, dass ihm das gar nicht ähnlich sehe, so pünktlich, strebsam und verlässlich, wie er sonst sei.
Nein, es habe keine besonderen Schwierigkeiten zwischen ihnen gegeben, sagte sie zu Flóvent, der den Fall übernommen hatte und versuchte, mehr herauszukriegen. Sie waren schnell zum Du übergegangen. »Ich hoffe, du denkst nicht …«
Flóvent verstand sofort und bat um Entschuldigung für den Fall, dass er sie verletzt haben sollte, das sei nicht seine Absicht gewesen. »Für die Angehörigen ist eine solche Situation natürlich besonders schwierig«, hatte er gesagt, »und ich wollte nichts andeuten, was … was dich verletzen könnte.«
»Es ist so hart«, hatte sie gesagt, als die Suche keinen Erfolg zeigte. »Nichts zu wissen.«
Jetzt wusste sie es, und sie kam ihm sehr ruhig und beherrscht vor, als sie sich hier im Wohnzimmer seinen Bericht von der Nauthólsvík anhörte. Obwohl man ihr die Erschöpfung und den Kummer der letzten Tage ansah, fand er, dass sie Würde ausstrahlte, als sie sich dankbar darüber äußerte, dass er endlich gefunden worden war.
»Ja, diese Gewissheit ist bestimmt eine Erleichterung«, sagte Flóvent. »Die Leiche wurde zur Obduktion ins Universitätsklinikum gebracht, wie üblich bei solchen Fällen. Ich informiere dich, sobald sie fertig sind, das wird sicher nicht lange dauern. Daher kannst du ruhig schon mit den Vorbereitungen für die Beerdigung beginnen. Aber wir wären dir dankbar, wenn du ihn dir anschauen und identifizieren könntest, auch wenn das natürlich nicht leicht für dich sein wird. Wenn du möchtest, begleite ich dich.«
Sie war wenige Jahre jünger als er, um die dreißig, und hieß Agneta. Sie hatte diese schwierige Zeit so tapfer durchgestanden, dafür bewunderte er sie. Sie war für jede Hilfe dankbar, beschwerte sich nie, verfolgte alles genau, hatte sich intensiv an der Suche beteiligt und sogar auf eigene Faust weitergeforscht, als die Suche offiziell eingestellt worden war. Diese Ausdauer bewunderte er.
»Das hier haben wir in seinen Taschen gefunden«, sagte Flóvent und legte das Feuerzeug, die Geldbörse, den Schlüsselbund und das Taschentuch vor ihr auf den Tisch. Das Tuch war noch feucht und die Geldbörse nass. »Das Geld war noch drin«, sagte er.
»Ja«, antwortete sie geistesabwesend, »das heißt …?«
»Er wurde nicht ausgeraubt«, antwortete Flóvent. »Alle Indizien weisen in dieselbe Richtung. Alles deutet darauf hin, dass es ein furchtbarer Unfall oder Selbstmord war. Es tut mir sehr leid.«
»Danke«, sagte sie. »Vielen Dank für alles.«
»Es kann sein, dass er ins Hafenbecken oder irgendwo an der Küste ins Meer gestürzt ist. Weißt du, ob er am Hafen gewesen sein könnte? Oder hat er Spaziergänge an der Küste gemacht?«
»Ja, das hat er manchmal, und wir zusammen natürlich auch. Wir sind zum Beispiel in den Westen zur Insel Grótta gefahren und dort spazieren gegangen, aber ich wüsste nicht, dass er etwas am Hafen zu tun gehabt hätte. Ich wüsste nicht, was das gewesen sein sollte.«
»Du sagtest, es habe keine Anzeichen dafür gegeben, dass er sich etwas antun wollte. Abgesehen davon, dass er vielleicht manchmal schweigsam war und sich zurückgezogen hat, aber immer nur kurz. Auf der Arbeit habe er sich wohlgefühlt.«
»Ich dachte nicht, dass das etwas Ernsthaftes wäre«, sagte sie, »aber dann blickt man zurück, in all seinem Kummer, und sieht die Dinge vielleicht doch ein bisschen anders. Anzeichen, die einem entgangen sind. Die damals undeutlich waren, aber heute vielleicht ein bisschen klarer erscheinen, wenn du verstehst, was ich meine.«
»Manchmal stehen die Angehörigen nach solch einem tragischen Ereignis völlig fassungslos da, weil sie nicht die geringste Ahnung hatten, dass es so kommen würde. Solche Gedanken liegen tief in den Menschen verborgen. Selbstmordgedanken, auch ganz ohne Vorgeschichte. Das ist sehr unterschiedlich. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass ein Selbstmord die Angehörigen völlig überrumpeln kann.«
Flóvent hatte bereits mit einigen solcher Fälle bei der Polizei zu tun gehabt und die Angehörigen mit ähnlichen Worten getröstet. Und er wusste auch, dass sie sich schnell Selbstvorwürfe machten, die aber in den seltensten Fällen gerechtfertigt waren.
Er blieb noch eine Weile bei der Frau sitzen, bevor er aufstand und ihr sagte, dass sie nicht zögern solle, sich zu melden, wenn er irgendetwas für sie tun könne. Sie begleitete ihn zur Tür, und er legte ihr nahe, rasch ihre Familie zu informieren, sie bei sich zu haben und über das zu reden, was geschehen war. Vielleicht einen Pfarrer zu rufen, wenn sie glaube, das könne ihr guttun. Sie gaben sich die Hand und sie dankte ihm noch einmal für die Fürsorglichkeit und den Zuspruch.
Acht
Am Rauðarárstígur gab es ein schäbiges Lokal, in dem einfaches Essen angeboten wurde. Es roch dort nach einer Mischung aus gekochtem Fisch und Wurst, Zigarettenrauch und Muff. Ein Sammelsurium an Stühlen und Bänken war noch von der letzten Nacht kreuz und quer im Raum verteilt. Kurz nach der Ankunft der Briten drei Jahre zuvor war diese Spelunke in einem alten Pferdestall eingerichtet worden. Ein leichter Pferdemistgeruch lag noch in der Luft, und die alten Klepper, die auf dem Klambratún standen – der großen Wiese hinter der Kneipe –, zog es manchmal immer noch dorthin. Doch das Gebäude war inzwischen sehr viel wohnlicher: Die Wände waren verkleidet worden, das Dach verstärkt, ein neuer Holzboden gelegt und alles mit einer seltsam farblosen, von einer britischen Fregatte gestohlenen Farbe gestrichen worden. Der Name, Piccadilly, der schnell über die Eingangstür gepinselt worden war, sollte wohl das Heimweh der jungen Soldaten lindern, die diesen Ort aufsuchten. Der Name blieb, auch als die meisten Briten das Land bereits verlassen hatten, und die Amerikaner übernahmen. Das Piccadilly – die Amerikaner nannten es bald Pick-a-dolly – wurde vor allem von den einfachen Soldaten besucht, und mitunter ging es dort abends recht lebhaft zu, dann schallte es über die Wiese und durchs ganze Nordermoor-Viertel. Die nötige Erlaubnis hatte sich der Eigentümer über einen Verwandten in der Kommunalpolitik beschafft. Alkohol bezog er in rauen Mengen über die Soldaten, außerdem brannte sein Bruder guten Schnaps, der den Gästen des Etablissements geschmeidig die Kehle hinunterrann.
Kaschemmen wie das Piccadilly schossen rund um die Barackensiedlungen des Militärs wie Pilze aus dem Boden, und nicht alle machten sich die Mühe, eine entsprechende Genehmigung einzuholen. Manchmal kam es an diesen Orten zu Schlägereien zwischen Soldaten und den Einwohnern der Stadt. In solchen Fällen wurde sowohl die Militärpolizei als auch die isländische Polizei eingeschaltet, die die Leute nach Nationalität sortierten und zum Ausnüchtern in Zellen brachten – die Soldaten in ein Militärgefängnis am Kirkjusandur und die Isländer meist in den Keller der Polizeiwache in der Pósthússtræti. Zu dieser Art von Auseinandersetzungen wurde auch der Fall des Soldaten gezählt, der völlig zerschunden ins Krankenhaus von Camp Laugarnes eingeliefert worden war. Es habe eine Schlägerei gegeben, wahrscheinlich wegen irgendeines Mädchens. Das nächtliche Treiben in der Bar war beendet, und alle Gäste, die noch greifbar waren, wurden verhört. Aber die meisten hatten sich sofort in die Nacht verabschiedet, als sich herumsprach, was passiert war. Niemand schien etwas von einer Schlägerei oder einem Angriff zu wissen. Als Flóvent an den Ort des Geschehens kam, erfassten die Polizisten gerade die Namen aller noch anwesenden Kneipenbesucher, bevor sie sie nach Hause schickten. Sie hatten den Soldaten, so zugerichtet wie er war, noch nicht identifizieren können, zumal auch die Erkennungsmarke, die die Soldaten normalerweise um den Hals trugen, nicht aufzufinden war.