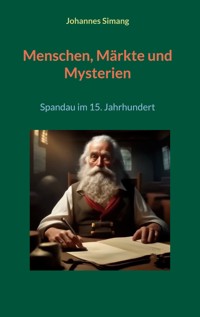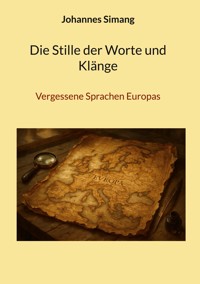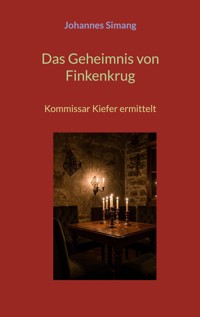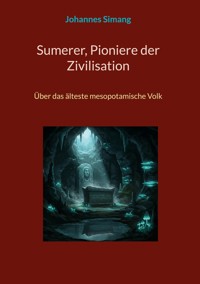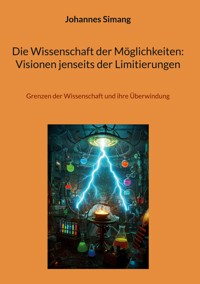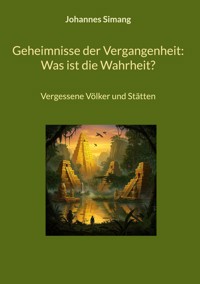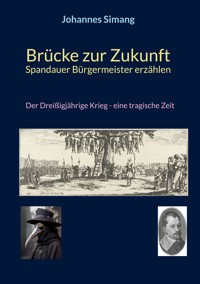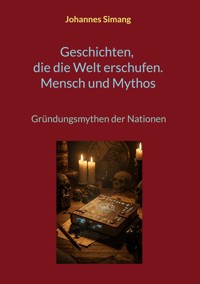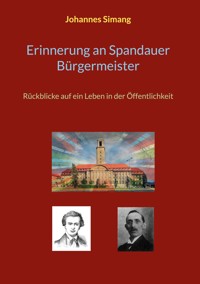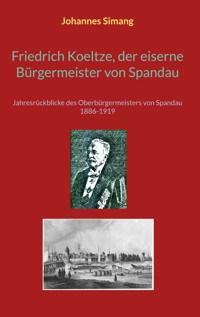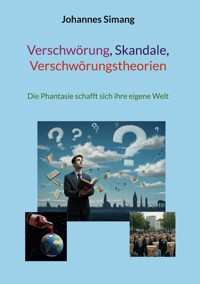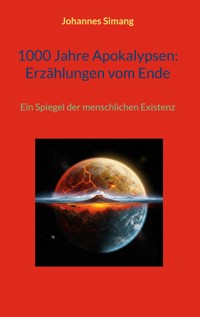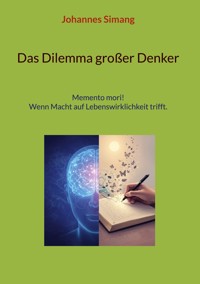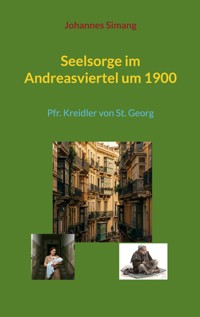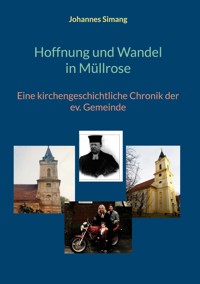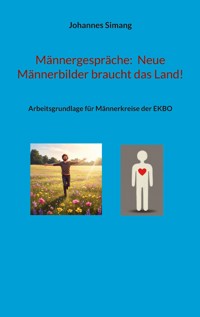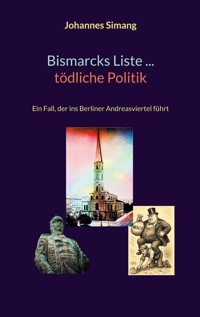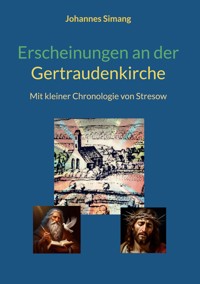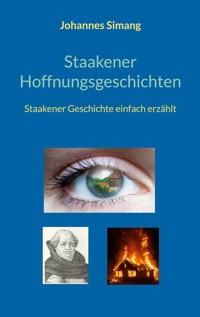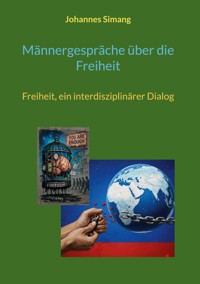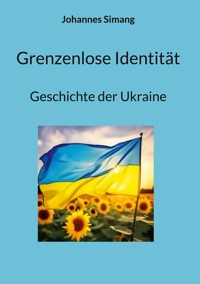
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Entdecken Sie 'Grenzenlose Identität'. Die fesselnde Geschichte der Ukraine. Tauchen Sie ein in die facettenreiche Welt der Ukraine mit dem neuen Buch 'Grenzenlose Identität'. Dieses Werk erzählt nicht nur die bewegte Geschichte eines Landes, das sich zwischen Tradition und Moderne, Ost und West, Identität und Wandel bewegt, sondern beleuchtet auch die Seele eines Volkes, das unermüdlich für seine Freiheit und Selbstbestimmung gekämpft hat und noch kämpft. Von den Wurzeln der Kiewer Rus bis hin zu den Herausforderungen der Gegenwart. 'Grenzenlose Identität' nimmt Sie mit auf eine Reise durch die Jahrhunderte. Erleben Sie die prägenden Ereignisse, die kulturellen Schätze und die inspirierenden Persönlichkeiten, die die Ukraine zu dem gemacht haben, was sie heute ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 264
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gewidmet:
Den vielen Gästen aus der Ukraine, die vor dem Krieg eines gnadenlosen Imperialisten und Kriegsverbrechers, gegen den ein internationaler Haftbefehl ausgestellt worden ist, geflüchtet sind.
Inhalt
Geschichte der Ukraine
Kap. I Ur- und Frühgeschichte der Ukraine Kulturen nach der Steinzeit … bis zur atl. Zeit
Kap. II Die Völkerwanderung Hunnen, Ostgoten, Chasaren, Slawen
Kap. III Das Mittelalter
Kap. IV. Entwicklung des Metropolitentums in Kiew
Der Begriff ‚Grenzland‘ (=ukraina)
Kap. V Die Entstehung der Nationalbewegung
Kap. VI Unabhängigkeitsversuche der Ukraine
Kap. VII Die Sowjetzeit und die Ukraine
Kap. VIII Der II. Weltkrieg und die Ukraine
Kap. IX Die Nachkriegszeit und die Ukraine
Kap. X Die ukrainische Nationalbewegung (ab 1950)
Kap. XI Die Auflösung der Sowjetunion
Kap. XII Marktwirtschaft in der Ukraine
Kap. XIII Sicherheitspolitik in der unabhäng. Ukraine
Kap. XIV Orangene Revolution
Kap. XV Die Putin-Ära
Kap. XVI Erinnerungen eines Kriegsverbrechers
Nachwort
Vorwort
Dieses Buch ist ein Lesebuch. In diesen herausfordernden Zeiten, in denen die Ukraine von einem brutalen Übergriff heimgesucht wird, ist es unerlässlich, die Wurzeln und die Identität dieses Landes zu verstehen. Der Krieg hat nicht nur die geopolitischen Landschaften Europas verändert, sondern auch das Bewusstsein für die kulturellen und historischen Errungenschaften der Ukraine geschärft. Die Flucht von fast einer Million Frauen und Kindern nach Deutschland ist ein eindringliches Zeichen für das Leid und die Hoffnung, die in den Herzen der Menschen wohnen, die ihre Heimat verlassen mussten.
Unsere Begegnungen mit den ukrainischen Flüchtlingen haben uns tief berührt und uns dazu angeregt, mehr über die Geschichte und Kultur der Ukraine zu lernen. Wir haben erkannt, dass die Ukraine nicht nur ein geopolitisches Terrain ist, sondern ein Land mit einer reichen Geschichte, vielfältigen Traditionen und einer lebendigen Kultur, die es wert ist, gewürdigt und verstanden zu werden.
Die Behauptungen des russischen Präsidenten, dass er im historischen Recht sei, sind nicht nur irreführend, sondern auch eine verzerrte Sicht auf die komplexe Geschichte der Region. Wladimir d. Große, der als eine Schlüsselfigur in der Geschichte der Kiewer Rus gilt, ist ein Symbol für die kulturelle und religiöse Entwicklung, die die Ukraine, Russland und Weißrussland geprägt hat. Doch die Geschichte ist nie einseitig; sie ist ein Mosaik aus verschiedenen Perspektiven, und es ist an der Zeit, die Stimme der Ukraine in diesem Diskurs zu verstärken.
In diesem Lesebuch möchten wir die verschiedenen Facetten der ukrainischen Geschichte beleuchten – von den Anfängen über die Kiewer Rus und die Herausforderungen der Jahrhunderte bis hin zu den modernen Entwicklungen, die die Ukraine zu dem gemacht haben, was sie heute ist. Wir wollen die Geschichten der Menschen erzählen, die in dieser Zeit des Wandels leben, und die kulturellen Errungenschaften würdigen, die trotz aller Widrigkeiten floriert sind.
Wir laden Sie ein, mit uns auf eine Reise durch die Geschichte der Ukraine zu gehen. Lassen Sie uns gemeinsam die Schönheit und den Reichtum der ukrainischen Kultur entdecken und die Stimmen der Menschen hören, die für ihre Freiheit und Identität kämpfen. Möge dieses Werk dazu beitragen, das Verständnis und die Solidarität mit der Ukraine zu fördern und die Hoffnung auf Frieden und Gerechtigkeit zu stärken.
Es bleiben noch Themen offen: Die Geschichte der Russlanddeutschen ist auch eine Geschichte von Ukrainern. Wie bei den Türken, denn viele waren Kurden … was weiß man schon in Deutschland. Die Geschichte der Russlanddeutschen, die oft Ukrainer sind, wäre auch noch einmal eine spannende Geschichte.
Johannes Simang
Kap. I Ur- und Frühgeschichte
Das Gebiet der heutigen Ukraine wurde schon während des Paläolithikums besiedelt.
Während der Jungsteinzeit bestand in der Südukraine von etwa 6500 bis 5000 v. Chr. die Bug-Dnister-Kultur.
Die Bug-Dnister-Kultur
Ein Blick in das Neolithikum der südlichen Ukraine und Moldawiens
Die Bug-Dnister-Kultur, die zwischen ca. 6500 und 5000 v. Chr. in den heutigen Gebieten Moldawiens und der Ukraine entlang der Flüsse Dnister und südlicher Bug existierte, stellt eine bedeutende Phase in der archäologischen Geschichte des Neolithikums dar. Diese Kultur ist nicht nur ein Zeugnis für die Entwicklung menschlicher Lebensweisen in dieser Region, sondern auch ein faszinierendes Beispiel für den kulturellen und technologischen Wandel, der über Jahrtausende hinweg stattfand.
Frühphase: Präkeramisches Neolithikum
In der Frühphase der Bug-Dnister-Kultur, die oft als präkeramisches Neolithikum bezeichnet wird, lebten die Menschen überwiegend als Jäger und Sammler. Diese Phase ist geprägt von einer tiefen Verbundenheit mit der Natur, die sich in der Jagd auf Tiere wie Auerochsen, Rothirsche und Wildschweine sowie in der Fischerei an den reichhaltigen Gewässern der Region widerspiegelt. Die Nahrungsaufnahme war vielfältig, jedoch gibt es bislang keine Belege für landwirtschaftliche Praktiken in dieser frühen Phase. Dies lässt darauf schließen, dass die Menschen weiterhin stark auf die natürlichen Ressourcen angewiesen waren und ein nomadisches oder seminomadisches Leben führten.
Übergang zur Keramikproduktion
Ein entscheidender Wendepunkt in der Entwicklung der Bug-Dnister-Kultur war die Einführung der Keramik, die ab etwa 6200 v. Chr. nachweisbar ist. Die ersten keramischen Funde, die überwiegend flach- oder spitzbödige Kannen mit dekorativen Wellenlinien umfassen, markieren den Beginn eines neuen kulturellen Ausdrucks. Diese Veränderungen sind nicht nur technologischer Natur, sondern reflektieren auch einen Wandel im Lebensstil der Menschen, der möglicherweise mit der allmählichen Entwicklung von sesshaften Lebensweisen und einer stärkeren Einbindung in die Landwirtschaft verbunden ist. Radiokarbondaten, die von D. Gaskevych (2014) bereitgestellt wurden, zeigen, dass die Keramikproduktion in einen Zeitraum zwischen ca. 6356 und 4585 v. Chr. datiert werden kann.
Einfluss der Starčevo-Kultur
Ab etwa 5800 v. Chr. sind signifikante Einflüsse der benachbarten Starčevo-Kultur zu verzeichnen. Diese Einflüsse äußern sich sowohl im Stil der Keramik als auch in der landwirtschaftlichen Praxis, die den Anbau von Einkorn, Emmer und Dinkel einführte. Dieser Übergang zeigt die zunehmende Integration von Ackerbau in den Lebensstil der Menschen und die damit verbundene Veränderung der sozialen Strukturen. Die Menschen begannen, sich stärker auf die Kultivierung von Pflanzen zu konzentrieren, was zu einer stabileren Nahrungsversorgung führte und möglicherweise die Grundlage für das Aufblühen weiterer kultureller Entwicklungen legte.
Transformation zur Linearbandkeramik
Um 5500 v. Chr. vollzog sich ein weiterer bedeutender Wandel, als der Stil der Keramik sich der Linearbandkeramik (LBK) annäherte. Diese Entwicklung wird häufig mit der Migration von Gruppen aus dem Oberen Dnister in die Region in Verbindung gebracht, die bis zur unteren Donau vordrangen. Die Einführung von Langhäusern und die Errichtung von Grubenhäusern zeigen eine zunehmende Stabilität und Sesshaftigkeit in der Lebensweise der Menschen. Die Veränderungen in der Architektur und der Keramikproduktion sind Indikatoren für eine komplexere soziale Organisation und die Entstehung von Gemeinschaften.
Die Notenkopfkeramik und kulturelle Verbreitung
Ein weiterer markanter Stil, der um 5270 v. Chr. in der Linienbandkeramik in Österreich entstand, war die Notenkopfkeramik. Diese neue Form der Dekoration, die unterbrochene Ritzlinien und eingestochene Punkte umfasst, fand schnell Verbreitung über die Slowakei nach Polen und entlang der Dnister und Pruth in die Ukraine und nach Rumänien. Diese kulturelle Diffusion zeigt nicht nur die Mobilität der Menschen, sondern auch den Austausch von Ideen und Techniken zwischen verschiedenen Gruppen, was zu einer dynamischen kulturellen Landschaft beitrug.
Der Übergang zur Cucuteni-Tripolje-Kultur
Die Bug-Dnister-Kultur stellte schließlich die Grundlage für die nachfolgende Cucuteni-Tripolje-Kultur dar, die als eine der fortschrittlichsten neolithischen Kulturen in Europa gilt. Der Übergang zwischen diesen beiden Kulturen ist ein Beispiel für den kontinuierlichen Wandel und die Anpassungsfähigkeit menschlicher Gesellschaften an sich verändernde Umweltbedingungen und soziale Strukturen.
Die Bug-Dnister-Kultur ist ein wichtiges Kapitel in der Geschichte des Neolithikums, das die Entwicklung von Jäger- und Sammlergesellschaften hin zu sesshaften agrarischen Gemeinschaften dokumentiert. Ihre komplexe soziale Struktur, ihre technologischen Innovationen und der kulturelle Austausch mit benachbarten Kulturen verdeutlichen die Dynamik menschlichen Lebens in dieser Region. Indem wir die Bug-Dnister-Kultur studieren, gewinnen wir wertvolle Einblicke in die frühen Phasen menschlicher Zivilisation und die Wurzeln unserer gegenwärtigen Gesellschaften.
Ihr folgte die Dnepr-Don-Kultur bis 4000 v.Chr. Darauf folgte die Sredny-Stog-Kultur von 4500 bis 3500 v. Chr. Derijiwka, einer der bekanntesten mit dieser Kultur in Verbindung gebrachten Ausgrabungsorte, liegt in der zentralukrainischen Oblast Kirowohrad. Am Übergang von der Jungsteinzeit zur Kupfersteinzeit gehörte die heutige Ukraine zu den Ursprungsregionen der vermutlich halbnomadischen Kurgankultur, die auf die Zeit von 4400 v. Chr. bis 4300 v. Chr. geschätzt wird.
Die Kurgankultur wurde in der späten Kupfersteinzeit/frühen Bronzezeit von der Jamnaja-Kultur abgelöst bzw. ist in ihr aufgegangen. In der Nähe von Dnipro gibt es den „Storoschowa mohyla“-Kurgan in dem A.I. Terenozhkin Reste eines Karrens ausgegraben hat. Aus dieser Zeit stammen vermutlich auch die Stein-Babas – deren größte Sammlung innerhalb der Ukraine sich in Dnipro (siehe Stein-Babas von Dnipro-Petrowsk, befindet – durch ihre über 3000-jährige Geschichte sind sie sicherlich nicht nur das Produkt eines Volkes; die frühesten werden jedoch mit der Jamnaja-Kultur, die eisenzeitlichen Exemplare mit den Skythen und die mittelalterlichen mit verschiedenen Turkvölkern in Verbindung gebracht.
Der Jamnaja-Kultur folgte in der Bronzezeit etwa von 2800/2500 bis 2000 v. Chr. die Katakombengrab-Kultur die ihren Namen von den von ihnen angelegten Katakomben hat, deren unterirdischer Teil am ehesten mit den ägyptischen Mastabas vergleichbar sind. In der Spätbronzezeit folgte die Srubna-Kultur im 20. bis 12. vorchristlichen Jh. (2000–1200 v. Chr.). Im 5. Jh. v. Chr. siedelten sich an der ukrainischen Schwarzmeerküste und insbesondere der Krim pontische Griechen an und gründeten Kolonien. Sie sind es auch, die vom Volk der Taurer – woher auch der Name Taurien für die Krim abgeleitet wurde – berichten, die sie als ein Volk von Hirten beschreiben.
An der Straße von Kertsch – in antiken griechischen Quellen „Kimmerischer Bosporus“ genannt – lebte um 1300 v. Chr. das Volk der Kimmerer, bis es von den Skythen in Richtung Kaukasus verdrängt wurden. Das Steppengebiet im Süden der Ukraine war Teil des sogenannten Wilden Feldes, das in der Antike (8./7. Jh. v. Chr.) von den iranischsprachigen Reitervölkern der Skythen und später von den ihnen nahestehenden Sarmaten, die im 4./3. Jh. v. Chr. die Skythen unterwarfen und assimilierten, bewohnt wurde.
Im Norden und Westen der heutigen Ukraine jedoch auch in Weißrussland befand sich die Sarubinzy-Kultur, die vom 3. Jh. v. Chr. bis zum 1. Jh. n. Chr. bestand, die Handel mit den Städten am Schwarzen Meer getrieben haben. Der Fund vieler Pflüge deutet darüber hinaus auf die hohe Bedeutung des Ackerbaus hin.
Die Dnjepr-Donez-Kultur
Ein Fenster in die neolithische und äneolithische Vergangenheit Osteuropas
Die Dnjepr-Donez-Kultur, die zwischen 5800 und 4200 v. Chr. in den Weiten der heutigen Ukraine und angrenzenden Regionen existierte, ist ein faszinierendes Beispiel für die komplexen gesellschaftlichen Strukturen und kulturellen Praktiken der Menschen, die in dieser Zeit lebten. Diese Kultur, die in zwei Hauptphasen unterteilt werden kann – die Dnjepr-Donez-I-Kultur und die Dnjepr-Donez-II-Kultur – bietet einen einzigartigen Einblick in die Übergänge von mesolithischen zu neolithischen Lebensweisen und die daraus resultierenden Veränderungen in der materiellen Kultur.
Dnjepr-Donez-I-Kultur:
Jäger und Sammler in der Übergangszeit
Die Dnjepr-Donez-I-Kultur, die von Anthony vorsichtig zwischen 5800 und 5200 v. Chr. datiert wird, war eine Jäger- und Sammler-Kultur, die gleichzeitig mit der Bug-Dnister-Kultur existierte. Die Menschen dieser Kultur lebten in einer Zeit des Wandels, in der die traditionellen Lebensweisen der Jäger und Sammler allmählich durch agrarische Praktiken ergänzt wurden. Die Keramik dieser Phase, die typischerweise spitzbodige Transportgefäße umfasst, zeigt Parallelen zu anderen mesolithischen Kulturen in der Peripherie neolithischer Gesellschaften, wie der Swifterbant-Kultur in den Niederlanden und der Ertebølle-Kultur in Norddeutschland. Diese Ähnlichkeiten deuten darauf hin, dass die Dnjepr-Donez-Kultur sowohl lokale Traditionen als auch Einflüsse benachbarter Kulturen aufnahm.
Die Lebensweise der Menschen in dieser Phase war stark von den natürlichen Ressourcen ihrer Umgebung abhängig. Die Jagd auf Wildtiere, das Fischen in den reichhaltigen Gewässern der Dnjepr- und Donez-Region und das Sammeln von Pflanzen bildeten die Grundlage ihrer Ernährung. Diese Praktiken sind nicht nur für das Überleben entscheidend, sondern auch für die Entwicklung sozialer Strukturen und Gemeinschaften.
Dnjepr-Donez-II-Kultur
Die Anfänge des Äneolithikums
Die Dnjepr-Donez-II-Kultur, die sich von etwa 5200/5000 bis 4400/ 4200 v. Chr. erstreckt, markiert den Übergang zur Kupferzeit, die in Osteuropa als Äneolithikum bezeichnet wird. In dieser Phase sind bedeutende Veränderungen in der Lebensweise und der materiellen Kultur der Menschen zu beobachten. Die Einführung von Kupferwerkzeugen und -schmuck deutet auf eine zunehmende Technologisierung und eine Diversifizierung der Produktionsmethoden hin. Die Menschen begannen, sich intensiver mit der Landwirtschaft zu beschäftigen, was zu einer sesshaften Lebensweise führte und die Gesellschaften komplexer werden ließ.
Die Bestattungspraktiken in der Dnjepr-Donez-II-Kultur sind besonders bemerkenswert. Die Toten wurden in gestreckter Rückenlage bestattet und häufig mit Ocker bestreut, was auf rituelle Praktiken und einen tiefen Glauben an das Jenseits hinweist. Neben individuellen Gräbern waren auch größere Gräber mit nacheinander eingebrachten Bestattungen üblich. Diese Bestattungsformen scheinen mesolithische Traditionen zu tradieren und verdeutlichen die kulturelle Kontinuität und den Wandel innerhalb der Gemeinschaften.
Keramik und materielle Kultur
Die Keramik der Dnjepr-Donez-Kultur ist ein zentrales Element, um die kulturellen Praktiken dieser Zeit zu verstehen. Die spitzbodigen Transportgefäße, die in der Dnjepr-Donez-I-Kultur vorherrschend waren, entwickelten sich in der Dnjepr-Donez-II-Kultur weiter und zeigen eine zunehmende Komplexität in der Formgebung und Dekoration. Diese Keramiken sind nicht nur funktionale Objekte, sondern auch kulturelle Ausdrucksformen, die soziale Identität und ästhetische Werte der Gemeinschaft widerspiegeln.
Die Ähnlichkeiten zwischen der Dnjepr-Donez-Kultur und anderen zeitgenössischen Kulturen, wie der Ertebølle-Kultur in Norddeutschland und den keramischen Traditionen in Belgien und Nordfrankreich, legen nahe, dass es einen intensiven Austausch zwischen diesen Gemeinschaften gab. Diese Interaktionen könnten durch Handelsbeziehungen, Wanderungen oder kulturelle Kontakte beeinflusst worden sein und trugen zur Entwicklung einer vielfältigen und dynamischen kulturellen Landschaft in der Region bei.
Die Dnjepr-Donez-Kultur stellt einen wichtigen Abschnitt in der Geschichte Osteuropas dar und bietet wertvolle Einblicke in die Lebensweise, die sozialen Strukturen und die kulturellen Praktiken der Menschen, die in dieser Region lebten. Durch die Analyse der materiellen Kultur, insbesondere der Keramik und der Bestattungspraktiken, wird deutlich, wie sich die Menschen an ihre Umwelt anpassten und gleichzeitig kulturelle Traditionen bewahrten und entwickelten. Die Dnjepr-Donez-Kultur ist somit nicht nur ein Zeugnis der Vergangenheit, sondern auch ein Schlüssel zum Verständnis der komplexen Wechselwirkungen zwischen Mensch und Umwelt in der prähistorischen Zeit.
Die Sredni-Stog-Kultur
Ein Fenster in die Frühgeschichte Osteuropas
Die Sredni-Stog-Kultur, benannt nach der archäologischen Stätte Sredni Stog II in der heutigen Ukraine, stellt eine bedeutende Phase in der prähistorischen Entwicklung Osteuropas dar. Diese Kultur, die sich zwischen etwa 5250 v. Chr. und 3500 v. Chr. erstreckte, wird oft als Übergangsphase zwischen dem Neolithikum und dem Äneolithikum (Chalkolithikum) betrachtet und ist ein Schlüssel zum Verständnis der sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Dynamiken, die in dieser Region herrschten.
Geographische Lage und Chronologie
Die Sredni-Stog-Kultur war vorwiegend im Gebiet nördlich des Asowschen Meeres verbreitet, von den Dnjepr-Stromschnellen im Westen bis zum Don im Osten. Diese Region, die heute Teile der Ukraine und Russlands umfasst, bot eine reiche natürliche Umgebung, die für die Entwicklung landwirtschaftlicher Praktiken und Viehzucht förderlich war. Die genauen Datierungen der Kultur variieren je nach Quelle, wobei Schätzungen von etwa 5250 v. Chr. bis 3500 v. Chr. reichen. Die Siedlung Sredni Stog II, die als Namensgeber der Kultur fungiert, befindet sich auf einer heute überfluteten Insel im Dnipro und ist eine der bedeutendsten Fundstätten dieser Zeit.
Lebensweise und Wirtschaft
Die Sredni-Stog-Kultur ist bekannt für ihre frühen Praktiken in der Viehzucht und Landwirtschaft. Einige Forscher, darunter die britische Archäologin Marsha Ann Levine, argumentieren, dass die Menschen von Sredni Stog II möglicherweise die ersten Pferdezüchter der Welt waren. Diese Pferde wurden jedoch in erster Linie als Fleischlieferanten genutzt, was durch die Analyse von Knochenfunden in Derijiwka, einer weiteren wichtigen Siedlung, belegt wird. Hier stammen etwa 60 % der gefundenen Knochen von Pferden, was auf eine intensive Nutzung dieser Tiere hinweist.
Die Sredni-Stog-Leute betrieben auch die Jagd und das Sammeln, um ihre Ernährung zu ergänzen. Die archäologischen Funde aus Derijiwka und anderen Siedlungen zeigen, dass die Menschen eine Vielzahl von Tieren jagten und Pflanzen sammelten, um ihre Nahrungsbedürfnisse zu decken. Die Kombination aus Viehzucht, Landwirtschaft und Jagd ermöglichte es den Menschen, sich in dieser Region niederzulassen und komplexere soziale Strukturen zu entwickeln.
Bestattungspraktiken und soziale Strukturen
Die Bestattungsriten der Sredni-Stog-Kultur sind ein weiteres faszinierendes Element, das Einblicke in die sozialen Strukturen und den Glauben der Menschen dieser Zeit bietet. Die Verstorbenen wurden typischerweise auf dem Rücken liegend mit angezogenen Beinen bestattet und häufig mit Ocker bestreut, was rituelle Praktiken und einen tiefen Glauben an das Jenseits reflektiert. Die Kurgane, die in dieser Kultur vorkommen, deuten auf eine gewisse soziale Hierarchie hin, in der bestimmte Individuen möglicherweise eine herausragende Stellung innerhalb der Gemeinschaft einnahmen.
Die schnurverzierte Tonware, die in dieser Kultur gefunden wurde, ist ein weiteres wichtiges Merkmal, das die kulturelle Identität der Sredni-Stog-Leute unterstreicht. Diese Keramiken zeigen nicht nur einen hohen Grad an handwerklichem Können, sondern auch die ästhetischen Werte und den sozialen Kontext, in dem sie hergestellt wurden. Die Endphase der Sredni-Stog-Kultur zeigt zudem eine zunehmende Verwendung von Steinaxtformen, die möglicherweise mit den Indogermanen in Verbindung stehen, die in der Folgezeit in die Region vordrangen.
Der Übergang zur Jamnaja-Kultur
Die Sredni-Stog-Kultur war nicht isoliert, sondern stellte einen Übergang zu späteren kulturellen Entwicklungen dar, insbesondere zur Jamnaja-Kultur, die folgte. Die Jamnaja-Kultur, die sich etwa um 3500 v. Chr. etablierte, übernahm viele Elemente der Sredni-Stog-Kultur, während sie gleichzeitig neue Praktiken und Technologien einführte. Diese kulturelle Kontinuität und der Austausch zwischen verschiedenen Gemeinschaften in der Region sind entscheidend für das Verständnis der Entwicklung von Gesellschaften in Osteuropa.
Die Sredni-Stog-Kultur ist ein besonderes Kapitel in der Geschichte der Menschheit, das wertvolle Einblicke in die Lebensweise, die sozialen Strukturen und die kulturellen Praktiken der Menschen in der Region bietet. Durch ihre Kombination aus Viehzucht, Landwirtschaft und Jagd legten die Sredni-Stog-Leute den Grundstein für die Entwicklung komplexerer Gesellschaften und die spätere kulturelle Evolution in Osteuropa. Ihre Bestattungsriten, keramischen Traditionen und der Übergang zur Jamnaja-Kultur verdeutlichen die dynamischen Wechselwirkungen zwischen Mensch und Umwelt und die kulturellen Prozesse, die die prähistorische Landschaft dieser Region prägten. Die Erforschung der Sredni-Stog-Kultur bleibt somit ein spannendes Forschungsfeld, das weiterhin neue Erkenntnisse über die Entwicklung der menschlichen Zivilisation liefert.
Die Kurgankultur:
Ein Schlüssel zur indogermanischen Urheimat
Die Kurgankultur, benannt nach dem russischen Wort „kurgán“, das „Grabhügel“ bedeutet, stellt einen bedeutenden Bestandteil der prähistorischen Archäologie in Osteuropa und darüber hinaus dar. Diese Kultur, die zwischen etwa 4500 v. Chr. und 2500 v. Chr. existierte, wird oft mit der Ausbreitung der indogermanischen Völker und ihrer Sprachen in Verbindung gebracht. Die von Marija Gimbutas entwickelte Kurgan-Hypothese hat einen wesentlichen Einfluss auf das Verständnis der indogermanischen Urheimat und die sozialen Strukturen dieser Kulturen ausgeübt.
Ursprung und Merkmale der Kurgankultur
Die Kurgankultur wird typischerweise in den weiten Steppenregionen der Pontischen Steppe verortet, die sich vom heutigen Ukraine bis nach Südrussland erstrecken. Die Kultur ist bekannt für ihre charakteristischen Bestattungspraktiken, die sich in großen Grabhügeln, den sogenannten Kurganen, manifestieren. Diese Grabhügel, die oft mehrere Meter hoch sind, enthalten reichhaltige Beigaben, die auf den sozialen Status der Verstorbenen hinweisen. Die Bestattungen unter Kurganen sind ein zentrales Merkmal, das die Kurgankultur von anderen zeitgenössischen Kulturen unterscheidet.
Die materiellen Überreste, die mit der Kurgankultur in Verbindung gebracht werden, umfassen eine Vielzahl von Artefakten wie Keramiken, Werkzeuge, Schmuck und Waffen. Diese Funde deuten auf eine nomadische Lebensweise hin, die stark von Viehzucht und Jagd geprägt war. Die Kurgan-Leute waren wahrscheinlich Pferdezüchter, was ihnen eine erhöhte Mobilität und die Fähigkeit verlieh, große Gebiete zu durchstreifen. Diese Mobilität könnte auch zur Verbreitung ihrer Kultur und Sprache in benachbarte Regionen beigetragen haben.
Die Kurgan-Hypothese und ihre Entwicklung
Die Kurgan-Hypothese wurde in den 1950er Jahren von der litauischen Archäologin Marija Gimbutas formuliert. Sie basierte auf den Arbeiten früherer Forscher und der Analyse archäologischer Funde und postulierte, dass die Kurgankultur die Wiege der indogermanischen Sprachfamilie darstellt. Gimbutas argumentierte, dass die indogermanischen Völker, die in der Pontischen Steppe lebten, durch ihre nomadische Lebensweise und ihre Kurgan-Bestattungen eine ethnische Einheitlichkeit aufwiesen. Diese Einheitlichkeit sei mit der Einführung patriarchaler Strukturen in Europa verbunden, die die bestehenden matriarchalen Gesellschaftsformen verdrängten.
Die Kurgan-Hypothese war und ist umstritten. Kritiker argumentieren, dass die Beweislage nicht ausreicht, um eine direkte Verbindung zwischen der Kurgankultur und der indogermanischen Sprachfamilie herzustellen. Dennoch hat die Hypothese wichtige Impulse für die Forschung zur indogermanischen Urheimat und die Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Kulturen in Europa gegeben. Die Kurgankultur wird heute als ein zentraler Bestandteil der Diskussion über die Indogermanisierung Europas angesehen.
Die Rolle der Kurgankultur in der indogermanischen Sprachverbreitung
Die Kurgankultur wird oft als eine der Hauptquellen für die Verbreitung der indogermanischen Sprachen in Europa betrachtet. Linguisten und Archäologen haben versucht, die geografische Verbreitung der indogermanischen Sprachen mit den Bewegungen der Kurgan-Leute in Verbindung zu bringen. Die Hypothese postuliert, dass die Expansion der Kurgankultur in Europa zur Entwicklung und Verbreitung der indogermanischen Sprachen führte, die sich von der Pontischen Steppe bis nach Westeuropa ausbreiteten.
Die Kurgan-Hypothese steht im Gegensatz zu anderen Theorien, die die indogermanische Urheimat in Mittel- oder Nordeuropa ansiedeln. Diese konkurrierenden Theorien basieren häufig auf linguistischen, archäologischen und historischen Analysen, die jedoch nicht die gleiche Unterstützung wie die Kurgan-Hypothese erhalten haben. Die Kurgankultur bietet durch ihre materiellen Überreste und Bestattungspraktiken einen konkreten Ansatz zur Untersuchung der sozialen und kulturellen Dynamiken, die zur Entstehung der indogermanischen Sprachfamilie führten.
Matriarchale und patriarchale Strukturen
Ein zentrales Thema in der Diskussion um die Kurgankultur ist der Übergang von matriarchalen zu patriarchalen Strukturen in den Gesellschaften Europas. Marija Gimbutas argumentierte, dass die matriarchalen Fruchtbarkeitskulte, die in Europa vor der Ankunft der indogermanischen Völker vorherrschten, durch die patriarchalen Strukturen der Kurgan-Leute verdrängt wurden. Diese Theorie hat in der feministischen Archäologie und der vergleichenden Religionswissenschaft breite Resonanz gefunden, da sie die Rolle der Geschlechterverhältnisse in der prähistorischen Gesellschaft beleuchtet.
Die Bestattungspraktiken der Kurgankultur, die oft männliche Krieger und Anführer in Ehrenpositionen zeigten, scheinen diese patriarchalen Strukturen zu bestätigen. Die Kurgane sind oft mit Kriegergräbern assoziiert, was darauf hindeutet, dass der soziale Status und die Rolle der Geschlechter in diesen Gesellschaften eng miteinander verknüpft waren. Diese Entwicklungen könnten auch die kulturellen und religiösen Praktiken der indogermanischen Völker beeinflusst haben, die sich in den späteren Kulturen Europas manifestierten.
Die Kurgankultur ist ein entscheidendes Element in der Erforschung der indogermanischen Urheimat und der kulturellen Entwicklungen in Europa. Ihre Bestattungspraktiken, materielle Kultur und die damit verbundenen sozialen Strukturen bieten wertvolle Einblicke in die Lebensweise der Menschen, die in der Pontischen Steppe lebten. Die von Marija Gimbutas formulierte Kurgan-Hypothese hat die Diskussion über die indogermanische Sprachverbreitung und die Wechselwirkungen zwischen matriarchalen und patriarchalen Strukturen angestoßen und bleibt ein zentraler Punkt in der Archäologie und Linguistik.
Obwohl die Kurgan-Hypothese umstritten ist, hat sie den Weg für eine tiefere Auseinandersetzung mit den komplexen sozialen und kulturellen Dynamiken geebnet, die die Entwicklung der indogermanischen Völker geprägt haben. Die Kurgankultur bleibt somit ein Forschungsfeld, das weiterhin neue Erkenntnisse über die Wurzeln der indogermanischen Sprachen und Kulturen liefert.
Aufstieg, Wandel und Einfluss auf Europa
Die Kurgankultur, die sich zwischen dem 5. und 3. Jahrtausend v. Chr. in den Steppenregionen Südrusslands entwickelte, stellt einen entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte der Menschheit dar. Sie wird oft in Verbindung mit den indogermanischen Völkern gebracht und hat weitreichende Auswirkungen auf die gesellschaftlichen Strukturen und kulturellen Praktiken in Europa. Die archäologische Forschung, insbesondere die Arbeiten von Marija Gimbutas, haben entscheidend zur Erkenntnis beigetragen, dass die Kurgankultur eine Schlüsselrolle bei der Indoeuropäisierung des Kontinents spielte.
Entstehung und geographische Verbreitung
Die Kurgankultur entstand in einer Zeit, in der die Steppengebiete Südrusslands, die sich zwischen den Flüssen Dnepr, Siwerskyj Donez, Don und Wolga erstreckten, durch klimatische Veränderungen austrockneten. Diese Trockenperioden führten zu Hungersnöten, die die Träger der Kurgankultur zu Wanderungen in westlichere, regenreichere Gebiete zwangen. Ab etwa 4500 v. Chr. begannen die Kurganvölker, die nördlich des Schwarzen Meeres lebten, ihre Umgebung zu unterwerfen und ihre Lebensweise in neuen Regionen zu etablieren.
Die Kurgankultur wird in drei Hauptphasen unterteilt: Kurgan I, Kurgan II und Kurgan III, wobei jede Phase durch spezifische Wanderungsbewegungen und kulturelle Entwicklungen gekennzeichnet ist. Die Kurgan-I-Gruppe wanderte aus der Wolgasteppe nach Westen und besiedelte Gebiete in der heutigen Ukraine und den Mündungen der Flüsse Dnister und Donau. Die Kurgan-II-Völker, die kulturell höher entwickelt waren, folgten rund 1000 Jahre später und breiteten sich über die gesamte Balkanhalbinsel bis nach Mitteleuropa aus. Die Kurgan-III-Phase, die um 3000 v. Chr. begann, führte zu einer weiteren Expansion der indoeuropäischen Gruppen bis nach Skandinavien und in den Kaukasus.
Lebensweise und soziale Struktur
Die Kurgankultur zeichnete sich durch eine mobile Lebensweise aus, die auf der Domestizierung von Pferden und der Haltung von Vieh, insbesondere Rindern, Schafen und Ziegen, basierte. Diese Mobilität erlaubte es den Kurganvölkern, in zeitlich wechselnden Siedlungen zu leben, während sie ihre Viehherden durch die Steppen führten. In festen Siedlungen betrieben sie saisonalen Ackerbau, der jedoch in geringerem Maße ausgeführt wurde. Die Bestattungspraktiken der Kurgankultur, die sich durch die Errichtung von Grabhügeln – den sogenannten Kurganen – auszeichneten, zeigen die Bedeutung von Kriegern und Anführern in der Gesellschaft. Die Toten wurden in Erdgruben mit zelt- oder hüttenartigen Kammern bestattet und häufig mit ihren Waffen und anderen Grabbeigaben in das Jenseits begleitet.
Im Gegensatz zur Gesellschaft des sogenannten Alteuropas, die als friedfertig, sesshaft und matriarchal beschrieben wird, war die Kurgankultur durch eine patriarchale und kriegerische Struktur geprägt. Diese Hierarchien manifestierten sich in der sozialen Organisation, die von einem König oder Fürsten und einem Adelsrat dominiert wurde. Die Kurganvölker waren somit nicht nur Eroberer, sondern auch die Träger eines neuen Weltbildes, das sich durch Militarismus und soziale Ungleichheit auszeichnete.
Wanderungen in Wellen
Gimbutas beschrieb die Wanderungen der Kurganvölker als ein komplexes Phänomen, das in mehreren Wellen stattfand. Diese Wanderungen waren nicht nur das Ergebnis von klimatischen Veränderungen, sondern auch von gesellschaftlichen Umbrüchen und dem Drang, neue Weideflächen zu erschließen. Die erste Phase um 4400– 4300 v. Chr. war durch die Ausbreitung der Kurgan-I-Gruppe gekennzeichnet, gefolgt von der Kurgan-II-Gruppe, die um 3500 v. Chr. nach Westen und Südwesten in die Balkanregion und nach Mitteleuropa zog. Die dritte Phase um 3000 v. Chr. führte zu einer verstärkten Migration in die Ägäis und die Gebiete südlich des Kaukasus.
Diese Wanderungsbewegungen führten zu einer gravierenden Überschichtung der alteingesessenen neolithischen Bevölkerung, die sich in veränderten Bestattungssitten und kulturellen Praktiken widerspiegelte. Die Kollektivbestattung in Megalithgräbern wurde durch Einzelbestattungen ersetzt, und die Grabbeigaben umfassten nun Waffen und andere materielle Güter, die auf eine kriegerische Gesellschaft hindeuteten.
Wirtschaftsweise und Gesellschaftlicher Umbruch
Die Mobilität der Kurganvölker basierte nicht nur auf der Domestizierung des Pferdes, sondern auch auf einer wirtschaftlichen Praxis, die Weidewirtschaft und Viehzucht umfasste. Diese wirtschaftlichen Veränderungen führten zu einem grundlegenden Umbruch in den Gesellschaftsstrukturen Europas. Die Kurgankultur brachte eine Kollision zwischen matriarchalen und patriarchalen Gesellschaftssystemen mit sich, die zu einer tiefgreifenden Transformation der kulturellen Grundfesten führte.
Archäologische Funde belegen, dass die Kurganvölker nicht nur die materielle Kultur beeinflussten, sondern auch die religiösen und mythologischen Vorstellungen der alteuropäischen Bevölkerung. So zeigt sich in den Bestattungspraktiken eine Verehrung des Pferdes als heiligem Tier und die Praxis der Opferung von Frauen oder Gefährtinnen eines Stammeshäuptlings, was auf eine tief verwurzelte patriarchale Ideologie hinweist.
Die Kurgankultur stellt einen entscheidenden Faktor in der Entwicklung der europäischen Vorgeschichte dar. Durch ihre Wanderungen und die damit verbundenen kulturellen Einflüsse führten die Kurganvölker zu einer grundlegenden Veränderung der sozialen Strukturen, der Wirtschaftsweisen und der Bestattungssitten in den von ihnen besiedelten Gebieten. Die Arbeiten von Marija Gimbutas haben dazu beigetragen, die Kurgankultur als Schlüssel zur Indoeuropäisierung Europas zu verstehen und die komplexen Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Kulturen und Gesellschaftssystemen zu beleuchten.
Die Kurgankultur bleibt ein faszinierendes Forschungsfeld, das weiterhin neue Erkenntnisse über die Wurzeln der indogermanischen Sprachen und die kulturellen Entwicklungen in Europa liefert. Ihre Bedeutung erstreckt sich über die prähistorische Zeit hinaus und beeinflusst bis heute unser Verständnis von Identität, Kultur und Geschichte in Europa.
Die Jamnaja-Kultur
Ein Schlüssel zur Entstehung der indogermanischen Gesellschaften
Die Jamnaja-Kultur, oft als „Grubengrab- oder Ockergrab-Kultur“ bezeichnet, ist eine bedeutende archäologische Kultur, die sich zwischen 3600 und 2500 v. Chr. in der pontischen Steppe, insbesondere im Gebiet um die Flüsse Dnister, Bug und Ural, entwickelte. Diese Kultur zählt zur späten Kupferzeit und frühen Bronzezeit und wird häufig als Teil des größeren Komplexes der Kurgan-Kultur betrachtet. Die Jamnaja-Kultur stellt einen entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte Eurasiens dar, da sie sowohl soziale als auch kulturelle Veränderungen einleitete, die zur Entstehung der indogermanischen Völker führten.
Etymologie und Bezeichnung
Die Bezeichnung „Jamnaja-Kultur“ leitet sich von dem russischen Wort „Я́ мная“ ab, was „Grube“ oder „Grab“ bedeutet. Dies ist eine Anspielung auf die charakteristischen Grabstrukturen dieser Kultur, die in Form von Grubengräbern, auch als „Pit graves“ bekannt, ausgeführt wurden. Diese Gräber sind ein zentrales Merkmal der Jamnaja-Kultur und heben sich von den Bestattungspraktiken früherer Kulturen ab. Die Verwendung des Begriffs „Jamnaja“ hat sich in der archäologischen Literatur zunehmend durchgesetzt, um die kulturellen und geographischen Aspekte der Jamnaja-Kultur einzuordnen.
Entstehung und Vorläufer
Die Jamnaja-Kultur entwickelte sich aus verschiedenen regionalen Gruppen der Kupferzeit, wobei die Dnepr-Don-Kultur (5000–4000 v. Chr.) und der Repin-Hvalynsk-Komplex im mittleren Wolga-Gebiet als direkte Vorläufer angesehen werden. Diese Kulturen brachten bedeutende Innovationen in der Viehzucht, der Landwirtschaft und der Werkzeugherstellung hervor, die in die Jamnaja-Kultur integriert wurden. Hermann Parzinger und andere Forscher argumentieren, dass die Jamnaja-Kultur eine Synthese aus diesen unterschiedlichen kulturellen Einflüssen darstellt und somit eine komplexe soziale und wirtschaftliche Struktur aufweist.
Lebensweise und Wirtschaft
Die Menschen der Jamnaja-Kultur lebten in einer nomadischen oder semi-nomadischen Gesellschaft, die stark von der Viehzucht geprägt war. Die Domestizierung von Pferden spielte eine zentrale Rolle in ihrer Lebensweise und ermöglichte eine erhöhte Mobilität sowie den Austausch mit benachbarten Kulturen. Die Jamnaja-Leute hielten Rinder, Schafe und Ziegen, was ihre Ernährung und ihren Lebensstil wesentlich bestimmte.
Zusätzlich zur Viehzucht betrieben die Menschen der Jamnaja-Kultur auch Ackerbau. Die landwirtschaftlichen Praktiken umfassten den Anbau von Getreide, das in den fruchtbaren Böden der pontischen Steppe gut gedeihen konnte. Diese Kombination aus Viehzucht und Landwirtschaft führte zu einer steigenden Population und der Bildung komplexerer sozialer Strukturen.
Bestattungspraktiken und soziale Organisation
Die Bestattungspraktiken der Jamnaja-Kultur sind besonders aufschlussreich für das Verständnis ihrer sozialen Organisation. Die Grubengräber, die oft mit reichhaltigen Grabbeigaben ausgestattet sind, deuten auf eine soziale Hierarchie innerhalb der Gemeinschaft hin. In diesen Gräbern fanden sich häufig Waffen, Schmuck und andere materielle Güter, die den Status der Verstorbenen widerspiegeln. Diese Beigaben legen nahe, dass Krieger und Anführer eine herausragende Rolle in der Gesellschaft einnahmen.
Die Bestattungen waren oft individuell, was im Gegensatz zu den Kollektivbestattungen früherer Kulturen steht. Diese Praxis könnte auf den Aufstieg von Individualismus und sozialen Differenzierungen innerhalb der Gemeinschaft hindeuten. Auch die Verwendung von Ocker, der in vielen Gräbern als rituelles Element auftaucht, spielt auf eine tiefere spirituelle oder religiöse Bedeutung hin, die mit den Bestattungsriten verbunden war.
Kulturelle Einflüsse und Expansion
Die Jamnaja-Kultur wird oft als ein entscheidender Faktor in der Verbreitung der indogermanischen Sprachen und Kulturen betrachtet. Ihre Expansion in benachbarte Regionen, wie den Balkan, Mitteleuropa und bis hin zur Ägäis, trug zur Indoeuropäisierung Europas bei. Die Kurgan-Hypothese, die von Marija Gimbutas formuliert wurde, stellt die Jamnaja-Kultur als Teil des größeren Kurgan-Komplexes dar, der die indogermanischen Völker und deren kulturelle Praktiken prägte.
Die Wechselwirkungen zwischen der Jamnaja-Kultur und anderen zeitgenössischen Kulturen, wie der TRB-Kultur (Trichterbecherkultur) in Mitteleuropa, führten zu einem kulturellen Austausch, der sowohl materielle als auch immaterielle Aspekte umfasste. Diese Interaktionen trugen zur Entwicklung neuer Technologien, wie der Metallverarbeitung, und zur Verbreitung von religiösen und sozialen Ideen bei.
Die Jamnaja-Kultur ist ein zentraler Bestandteil der prähistorischen Geschichte Osteuropas und hat weitreichende Auswirkungen auf die Entstehung der indogermanischen Völker und deren Kulturen. Ihre charakteristischen Bestattungspraktiken, die nomadische Lebensweise und die wirtschaftlichen Innovationen bieten wertvolle Einblicke in die sozialen Strukturen und kulturellen Dynamiken dieser Zeit.
Die Jamnaja-Kultur stellt somit nicht nur ein faszinierendes Forschungsfeld dar, sondern ist auch entscheidend für das Verständnis der Wurzeln der indogermanischen Sprachfamilie und der kulturellen Entwicklungen in Europa. Die fortlaufende archäologische Forschung wird weiterhin dazu beitragen, die komplexen Zusammenhänge dieser Kultur zu entschlüsseln und ihre Bedeutung in der europäischen Vorgeschichte zu beleuchten.
Die Katakombengrab-Kultur
Eine Bronzezeitliche Zivilisation an Dnepr und Wolga
Die Katakombengrab-Kultur, die zwischen 2700/2600 und 1900/1800 v. Chr. in den Steppen nördlich des Schwarzen Meeres existierte, stellt eine bedeutende Phase der bronzezeitlichen Archäologie dar. Sie folgt auf die Jamnaja-Kultur und wird von der Srubna-Kultur abgelöst. Diese Kultur ist nicht nur für ihre einzigartigen Bestattungssitten bekannt, sondern auch für ihre metallverarbeitenden Fähigkeiten und die komplexen sozialen Strukturen, die sie in ihrer Zeit prägten.