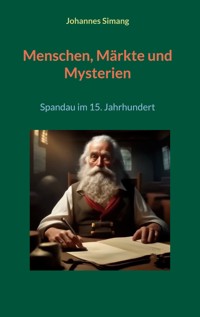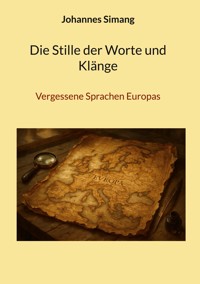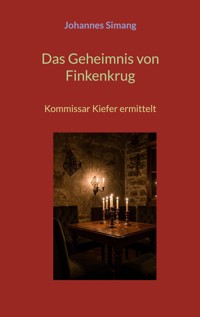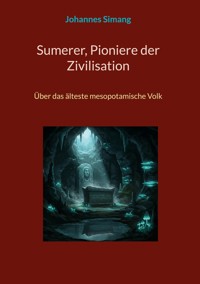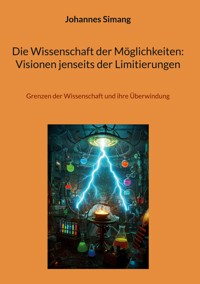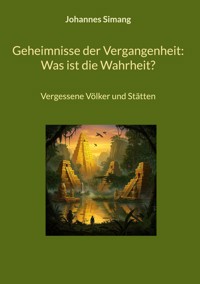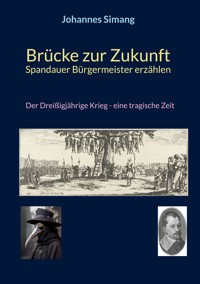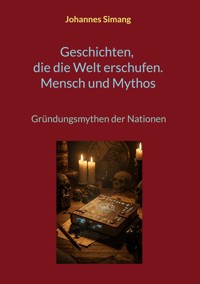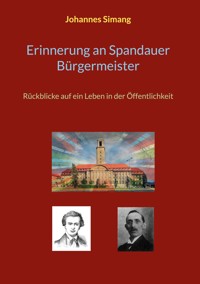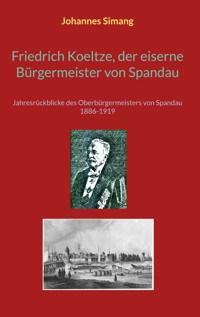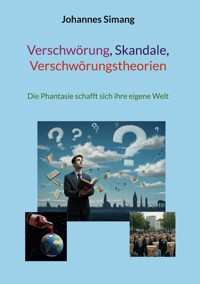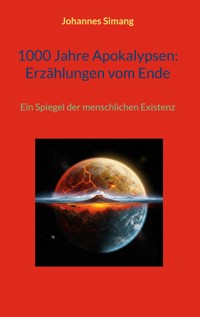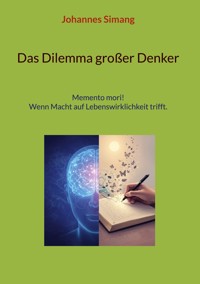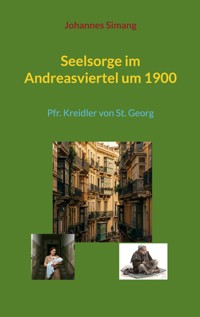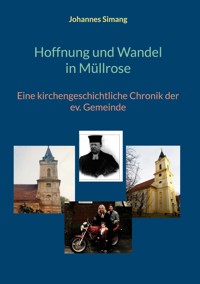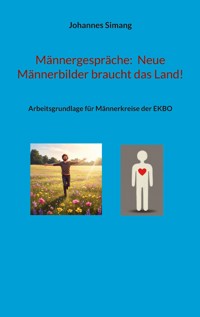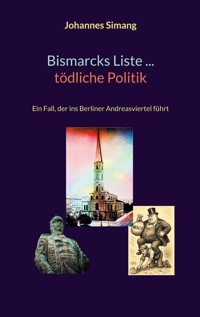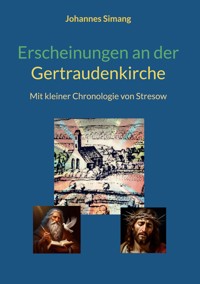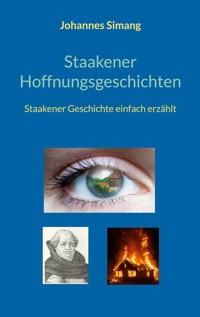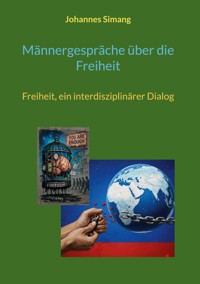Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Entdecken Sie die faszinierende Geschichte der Arbeiterbewegung in unserer neuen Chronik Kampf für die Zukunft. Dieses Buch nimmt Sie mit auf eine spannende Reise durch die Jahrhunderte, in der mutige Arbeiterinnen und Arbeiter für ihre Rechte und soziale Gerechtigkeit kämpften. Von den ersten Streiks über die Gründung von Gewerkschaften bis hin zu den entscheidenden politischen Veränderungen. Jede Seite ist ein Zeugnis von Solidarität, Widerstand und dem unaufhörlichen Streben nach einer besseren Zukunft. Mit den Erzählungen, den Hinweisen auf historische Dokumente und Ereignisse und der Analyse der Geschehnisse bietet diese Chronik nicht nur einen umfassenden Überblick, sondern inspiriert auch dazu, die Lehren der Vergangenheit in die Gegenwart zu tragen. Lassen Sie sich von den Geschichten derjenigen berühren, die für eine gerechtere Welt gekämpft haben. Kampf für die Zukunft, ein unverzichtbares Werk für alle, die sich für soziale Gerechtigkeit und die Rechte der Arbeiter einsetzen!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 282
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gewidmet:
Allen Aktiven in den Gewerkschaften
Inhalt
Kap. I
1789-1917
1789 – Die Französische Revolution
1825 – Utopischer Sozialismus
27.-29.Juli 1830 - Juli-Revolution in Frankreich
1830er Jahre – Erste Gewerkschaften in London
27.Mai 1832 – Hambacher Fest
1834 – Bestimmungen des dt. Zollvereins u.a.
1840 – Thronbesteigung des Friedrich Wilhelm IV.
1848 – Revolution in Europa
1848 – Das Kommunistische Manifest
Ab 1860 – Organisation - Mobilisierung der Arbeiter
König Friedrich Wilhelm IV.
1864 – Gründung der ersten Internationalen
1871 – Pariser Kommune
Ab 1880 – Aufstieg der Gewerkschaften
1886 – Konflikte in Chicago
1889 - Gründung der Zweiten Internationalen
Otto Bismarck – Kanzler der Reichen
Die wichtigsten Schriften der Arbeiterbewegung
1900-1914: Politische Partizipation und Reformen
Zuchthausvorlage von Kaiser Wilhelm I.
1905 - Russische Revolution
1914-18 – Der Erste Weltkrieg
Nachkriegsschatten
1917 usw. – Die russische Revolution
Die Rolle der Frau durch den I. Weltkrieg
Das Frauenwahlrecht wird eingeführt
Kap. II
1919-1939
1919 – Gründung der Komintern
1923 – Inflation in Deutschland
1920-30 – Die ‚Wilden Zwanziger‘ – kritiklose Kunst
1929 – Weltwirtschaftskrise
Kap. III
1933
Die Machtergreifung der Nationalsozialisten
Kap. IV
1945-1989
1945 - Nachkriegszeit und Kalter Krieg
Kap. V
1949
Arbeiterbewegung in der BRD … bis zur Wende
Kap. VI
1949
Arbeiterbewegung in der DDR … bis zur Wende
Kap. VII
1968 … und danach
Studenten- und Arbeiteraufständen in vielen Ländern
1980 Gründung von Solidarność in Polen
Kap. VIII
1990 bis heute
Globalisierung und neue Herausforderungen
2010 – Aufleben des sozialen Aktivismus
Neue Gewerkschaftsstrukturen
Ausblick: Die Zukunft der Arbeiterbewegungen
Kap. IX
Klimagerechtigkeit und Solidarität
Lösungsmöglichkeiten für eine gerechte Klimapolitik
Digitalisierung
Kap. X
Neue Rechtsformen für flexible Arbeitsmodelle
Globale Vernetzung
Nachwort
– Chronik der Arbeiterbewegung
Anhang:
Chronik der amerikanischen Arbeiterbewegung
Vorwort
Die Geschichte der Arbeiterbewegung ist nicht nur die Geschichte der Arbeiterschaft; sie ist das Spiegelbild eines gesellschaftlichen Wandels, der tief in das Gefüge unserer modernen Zivilisation eingreift. In dieser Chronik der Arbeiterbewegung in Deutschland laden wir alle Interessierten ein, einen Blick auf die vielschichtige Entwicklung der Arbeiterbewegung zu werfen, die mit der Französischen Revolution ihren Anfang nimmt, bis in die Gegenwart reicht. Doch der Blick wird nicht auf die deutschen Grenzen beschränkt sein. Vielmehr gilt es, die Verbindungen und Wechselwirkungen herausarbeiten, die die Arbeiterbewegung auch über die Grenzen Deutschlands hinaus prägten und die in Europa und den USA ihren Ausdruck fanden.
Die Kämpfe der Arbeiterinnen und Arbeiter um bessere Arbeitsbedingungen, soziale Gerechtigkeit und politische Mitbestimmung sind das Ergebnis eines langen und oft mühsamen Prozesses. Diese Chronik dokumentiert nicht nur die Erfolge und Rückschläge der Bewegung, sondern auch die vielfältigen Strömungen, die sie bestimmt haben. Von den ersten Gewerkschaftsgründungen über die sozialistischen und kommunistischen Bewegungen bis hin zu den aktuellen Herausforderungen der Globalisierung und Digitalisierung – die Geschichte der Arbeiterbewegung ist eine Geschichte des Wandels und der Anpassung.
In einem europäischen und transatlantischen Kontext werden die Einflüsse und Inspirationen untersucht, die über nationale Grenzen hinweg wirkten. Der Austausch von Ideen, Strategien und Solidarität zwischen den verschiedenen Ländern hat die verschiedenen Strömungen der Arbeiterbewegung entscheidend geprägt. Die Kämpfe in Deutschland sind untrennbar mit den Kämpfen in anderen europäischen Ländern und den USA verbunden, wo ähnliche Herausforderungen und Errungenschaften zu verzeichnen sind.
Es verwundert kaum, dass die Arbeiterbewegung viele Bewegungen in Gang setzte, die ähnlichen Ungerechtigkeiten ausgesetzt war: die Frauenbewegung, die Demokratiebewegung, Bewegungen die sich gegen jede Form von Rassismus wandten und viele andere.
Diese Chronik ist nicht nur ein Rückblick auf die Vergangenheit, sondern auch ein Aufruf zur Reflexion über die aktuellen Herausforderungen, vor denen die Arbeiterbewegung heute steht. In Zeiten von prekären Arbeitsverhältnissen, Automatisierung und globaler Ungleichheit ist es wichtiger denn je, aus der Geschichte zu lernen, um eine gerechtere Zukunft zu gestalten.
Begeben Sie sich mit mir auf diese Reise durch die Geschichte der Arbeiterbewegung. Möge sie Inspiration und Verständnis bieten für die Herausforderungen, die vor uns liegen, und die Möglichkeiten, die in der Solidarität und im gemeinsamen Handeln liegen.
Johannes Simang
Kap. I
1789: Beginn der Französischen Revolution Ideen von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit verbreiten sich.
Die Auswirkungen der Französischen Revolution auf die städtischen Arbeiter
Die Französische Revolution von 1789 stellt einen der bedeutendsten Umbrüche in der europäischen Geschichte dar. Sie war nicht nur ein politisches Ereignis, sondern auch ein tiefgreifender sozialer Wandel, der die Lebensrealitäten vieler Menschen, insbesondere der städtischen Arbeiter, grundlegend veränderte. Die Revolution brachte die Ideen von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit in das kollektive Bewusstsein und legte den Grundstein für die moderne Gesellschaft.
Die soziale Lage der städtischen Arbeiter vor der Revolution
Vor der Revolution lebten viele Arbeiter in den Städten unter prekären Bedingungen. Die Industrialisierung hatte begonnen, jedoch war das Land noch stark agrarisch geprägt, und die städtische Arbeitswelt war von Unsicherheit und Armut geprägt. Die Arbeiter waren oft in langen Arbeitszeiten, niedrigen Löhnen und schlechten Arbeitsbedingungen gefangen. Die aufstrebende Bourgeoisie profitierte von der Arbeit der unteren Klassen, während die privilegierten Klassen, der Adel und der Klerus, von den bestehenden sozialen und wirtschaftlichen Strukturen profitierten. Diese Ungerechtigkeiten führten zu einer zunehmenden Unzufriedenheit unter den Arbeitern, die sich in verschiedenen Protestbewegungen und Aufständen äußerte.
Ideen der Revolution und deren Einfluss auf die Arbeiter
Mit dem Ausbruch der Revolution 1789 wurden die Ideen der Aufklärung, die in den vorhergehenden Jahrzehnten an Bedeutung gewonnen hatten, populär. Die Forderungen nach Freiheit und Gleichheit fanden besonders unter den städtischen Arbeitermassen Anklang. Die Revolutionäre propagierten die Vorstellung, dass alle Menschen gleiche Rechte besäßen, unabhängig von ihrer sozialen Herkunft. Diese Ideale inspirierten viele Arbeiter, die begannen, sich für ihre eigenen Rechte und für bessere Lebensbedingungen einzusetzen.
Die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789 stellte einen Wendepunkt dar. Sie proklamierte das Recht jedes Individuums auf Freiheit und Sicherheit und stellte die Idee der Volkssouveränität in den Vordergrund. Für die Arbeiter bedeutete dies eine neue Perspektive; sie begannen, ihre Stimme zu erheben und ihre Forderungen nach sozialen und wirtschaftlichen Rechten zu artikulieren. Die Revolution gab den Arbeitern das Gefühl, dass sie Teil eines größeren Kampfes um Gerechtigkeit und Gleichheit waren.
Herausforderungen und Repression
Trotz der verheißungsvollen Ideen, die die Revolution mit sich brachte, erlebten die städtischen Arbeiter auch erhebliche Herausforderungen. Der Verlauf der Revolution war von Gewalt und Instabilität geprägt. Die Schreckensherrschaft unter Robespierre führte dazu, dass viele, die für soziale Gerechtigkeit eintraten, verfolgt und hingerichtet wurden. Die radikalen Umwälzungen der Revolution führten zudem zu wirtschaftlicher Unsicherheit, was die Lebensbedingungen der Arbeiter weiter verschlechterte. Lebensmittelpreise stiegen, und viele Arbeiter litten unter Hunger und Not.
Die Revolution führte auch zur Bildung von politischen Clubs und Gruppen, in denen Arbeiter ihre Interessen vertreten konnten. Diese Organisationen waren jedoch oft von internen Konflikten geprägt und konnten sich nicht auf eine gemeinsame Strategie einigen. Die Repression gegen aufständische Bewegungen war brutal, und viele Arbeiter wurden für ihre politischen Aktivitäten bestraft. Trotz dieser Herausforderungen blieben die Ideen von Freiheit und Gleichheit in den Köpfen der Arbeiter lebendig und legten den Grundstein für zukünftige Kämpfe.
Nachwirkungen der Revolution
Die Französische Revolution hatte langfristige Auswirkungen auf die städtischen Arbeiter. Sie inspirierte ähnliche Bewegungen in anderen Ländern und führte zu einer verstärkten politischen Mobilisierung der Arbeiterklasse. Die Ideen von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit wurden zu zentralen Elementen der politischen Diskurse des 19. Jahrhunderts und beeinflussten die Entstehung von Gewerkschaften und sozialistischen Bewegungen.
Die Revolution zeigte den Arbeitern, dass sie nicht länger passive Empfänger ihrer Lebensumstände sein mussten. Sie hatten das Potenzial, ihre Rechte einzufordern und aktiv an der Gestaltung ihrer Gesellschaft teilzunehmen. Diese Erkenntnis war entscheidend für die Entwicklung der Arbeiterbewegung im 19. und 20. Jahrhundert.
Die Französische Revolution war ein entscheidender Moment in der Geschichte, der die städtischen Arbeiter in eine neue Ära des politischen und sozialen Bewusstseins führte. Die Ideale von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit ermutigten viele, für ihre Rechte und ein besseres Leben zu kämpfen. Trotz der Herausforderungen und Rückschläge, die die Revolution mit sich brachte, legte sie den Grundstein für die weitere Entwicklung der Arbeiterbewegung und die Suche nach sozialer Gerechtigkeit. Die Revolution war somit nicht nur ein politisches Ereignis, sondern auch ein Katalysator für den sozialen Wandel, der die Lebensrealitäten der Arbeiter nachhaltig beeinflusste.
1825
Der utopische Sozialismus in Deutschland
L.L. Gall, ein Vertreter des utopischen Sozialismus in Deutschland, formulierte 1825 seine Ideen zur wirtschaftlichen Reform in dem Werk „Was könnte helfen?“ Seine Forderung nach der Ausgabe von Kreditscheinen zeigt ein Interesse an alternativen Währungen und Finanzierungsmodellen, die über das traditionelle Geldsystem hinausgehen. Durch die Einführung von Kreditscheinen wollte er die Geldversorgung flexibler gestalten und möglicherweise die Abhängigkeit von Gold- oder Silberreserven verringern.
Darüber hinaus betont Gall die Bedeutung der Lagerung von Getreide, was auf eine erkennbare Verbindung zwischen Landwirtschaft und Wirtschaft hinweist. Indem er Getreide als wirtschaftliches Mittel neben Geld stellt, plädiert er für eine diversifizierte ökonomische Basis, die nicht nur auf monetären Transaktionen beruht. Dies könnte als Versuch gewertet werden, die Ernährungssicherheit zu gewährleisten und die Abhängigkeit von Finanzmärkten zu reduzieren.
Gall's Ideen stehen im Einklang mit den Prinzipien des utopischen Sozialismus, der nach einer gerechteren und egalitären Gesellschaft strebt. Er suchte nach Wegen, um soziale Ungleichheit zu verringern und den Lebensstandard der arbeitenden Bevölkerung zu verbessern. In diesem Kontext könnten seine Vorschläge als Teil eines größeren Plans zur Reform der Gesellschaft und der Wirtschaft betrachtet werden, um eine nachhaltigere und gerechtere Zukunft zu schaffen.
Der ‚Utopische Sozialismus‘
Die utopischen Sozialisten waren eine Gruppe von Denkern und Aktivisten im 19. Jh., die versuchten, eine gerechtere und egalitäre Gesellschaft zu schaffen. Ihre Ideen entwickelten sich vor allem zwischen den 1820er und 1850er Jahren und hatten einen erheblichen Einfluss auf die sozialistische Bewegung in Europa, insbesondere in Deutschland und Frankreich. Hier sind einige der Hauptziele, Organisationen und Merkmale der utopischen Sozialisten:
Ziele der utopischen Sozialisten
Soziale Gerechtigkeit: Utopische Sozialisten strebten eine Gesellschaft an, in der alle Menschen gleichbehandelt werden und Zugang zu den grundlegenden Lebensnotwendigkeiten wie Nahrung, Unterkunft und Bildung haben.
Sie forderten eine Reform des Wirtschaftssystems, um die Ausbeutung der Arbeiter zu beenden. Dazu gehörten Ideen wie die Schaffung von Genossenschaften, die Einführung von Gemeinschaftseigentum und alternative Währungen.
Viele utopische Sozialisten glaubten, dass eine gesellschaftliche Transformation auch eine moralische und ethische Erneuerung erfordere, um das individuelle und kollektive Wohlergehen zu fördern.
Die Förderung von Bildung und Erziehung war ein zentrales Anliegen, um das Bewusstsein der Menschen zu schärfen und sie zu aktiven Teilnehmern an der Gesellschaft zu machen.
Organisation und Bewegungen
Frühsozialistische Bewegungen: In Deutschland und Frankreich bildeten sich verschiedene Gruppen, die sich für sozialistische Ideen einsetzten. Zu den bekanntesten gehören die "Saint-Simonisten" in Frankreich, die Ideen von Claude Henri de Rouvroy, Comte de Saint-Simon, propagierten, sowie die "Fourieristen", die die Ideen von Charles Fourier verbreiteten.
Utopische Sozialisten förderten die Gründung von Arbeitergenossenschaften, in denen die Arbeiter gemeinsam die Produktionsmittel besaßen und die Gewinne untereinander teilten. Ein Beispiel ist die "Phalanstère"-Bewegung von Fourier, die eine ideale Gemeinschaft anstrebte.
Viele utopische Sozialisten veröffentlichten ihre Ideen in Form von Büchern (s. L. Gall), Artikeln und Pamphleten. Diese Schriften trugen dazu bei, die sozialistische Gedankenwelt zu verbreiten und Diskussionen über soziale Reformen anzuregen.
Utopische Sozialisten suchten oft den Austausch mit Gleichgesinnten in anderen Ländern und organisierten Konferenzen und Versammlungen, um ihre Ideen zu diskutieren und zu verbreiten. Sie beförderten eine internationale Vernetzung.
Einfluss auf die sozialistische Bewegung
Die utopischen Sozialisten hatten sowohl direkte als auch indirekte Auswirkungen auf die späteren sozialistischen Bewegungen. Ihre Ideen wurden von späteren Sozialisten, wie Karl Marx und Friedrich Engels, kritisiert, aber auch als Grundlage für die Entwicklung des Sozialismus genutzt. Während die utopischen Sozialisten oft von idealistischen Ansätzen geprägt waren, entwickelten Marx und Engels eine wissenschaftliche Analyse des Kapitalismus und forderten eine revolutionäre Umgestaltung der Gesellschaft.
Insgesamt spielten die utopischen Sozialisten eine wichtige Rolle in der Entwicklung der sozialistischen Ideen und Bewegungen des 19. Jahrhunderts, indem sie die Diskussion über soziale Gerechtigkeit und wirtschaftliche Reformen anregten und eine Vision für eine gerechtere Gesellschaft entwarfen.
27.-29.Juli 1830
Juli-Revolution in Frankreich
Die Julirevolution in Frankreich von 1830 war ein bedeutendes Ereignis, das zur Absetzung von König Karl X. und zur Errichtung der sogenannten ‚Julimonarchie‘ führte.
Vorgänge der Julirevolution
Nach der Niederlage Napoleons und der Restauration der Bourbonen im Jahr 1815 kehrte Karl X. 1824 an die Macht. Seine konservative Politik und die Rückkehr zu absolutistischen Prinzipien führte zu wachsender Unzufriedenheit unter Liberalen, Republikanern und der Mittelklasse.
Die wirtschaftliche Lage war angespannt, mit hoher Arbeitslosigkeit und steigenden Preisen, was die Unzufriedenheit verstärkte.
Es gab politische Repressionen. Die Regierung schränkte die Pressefreiheit ein und unterdrückte oppositionelle Stimmen, was die Spannungen weiter erhöhte.
Auslöser: Am 26. Juli 1830 erließ Karl X. eine Reihe von reaktionären Dekreten, die unter anderem die Pressefreiheit einschränkten und die Wahlen zu den Abgeordneten versetzten. Diese Maßnahmen führten zu landesweiten Protesten und Unruhen.
Revolutionärer Aufstand: Am 27. und 28. Juli 1830 brachen in Paris gewaltsame Aufstände aus. Bürger und Arbeiter ergriffen die Waffen, errichteten Barrikaden und kämpften gegen die königlichen Truppen. Der Aufstand weitete sich schnell aus, und die Revolutionäre gewannen die Oberhand über die Regierungstruppen.
Absetzung Karls X.: Am 30. Juli 1830 floh Karl X. aus Paris. Die Revolution führte zu seinem Sturz und zur Absetzung der Bourbonen.
Ziele der Julirevolution
Absetzung der Monarchie: Ein zentrales Ziel war die Absetzung von Karl X. und die Beendigung der absolutistischen Herrschaft.
Einführung einer konstitutionellen Monarchie: Die Revolutionäre strebten eine konstitutionelle Monarchie an, die mehr politische Freiheiten und eine repräsentative Regierung garantierte.
Stärkung der liberalen Kräfte: Die Julirevolution sollte die liberalen Kräfte in der Gesellschaft stärken und eine Regierung etablieren, die die Interessen der Bourgeoisie und der Mittelschicht vertrat.
Rädelsführer der Julirevolution
Lafayette: Der berühmte General und Revolutionär war eine prominente Figur, die die liberalen Kräfte unterstützte und während der Revolution eine führende Rolle spielte. Er wurde als Symbol für Freiheit und Bürgerrechte angesehen.
Adolphe Thiers: Ein einflussreicher Journalist und Politiker, der sich für die Interessen der Bourgeoisie einsetzte und ein wichtiger Unterstützer der Revolution war.
Louis-Philippe von Orléans: Er war ein Mitglied der Orléans-Dynastie und wurde nach der Revolution zum neuen König gewählt. Er wurde als ‚Bürgerkönig‘ bekannt und stellte sich als Vertreter der liberalen Bourgeoisie dar.
(Die Julirevolution führte zur Gründung der Julimonarchie unter Louis-Philippe, die jedoch nicht alle Erwartungen erfüllte und letztendlich zu weiterer Unzufriedenheit führte, die in die Februarrevolution von 1848 mündete. Die Julirevolution von 1830 bleibt jedoch ein bedeutendes Beispiel für den Kampf um Freiheit und politische Rechte im Frankreich des 19. Jahrhunderts.)
1830
Unruhen in deutschen Staaten
Die Unruhen und Aufstände in den deutschen Staaten zwischen Ende August 1830 und Januar 1831 waren Teil der sogenannten ‚Revolution von 1830‘, die von den Ereignissen in Frankreich inspiriert wurde. Diese Aufstände hatten unterschiedliche Ursachen und Ziele, und sie traten in verschiedenen Regionen Deutschlands auf. Einige der wichtigsten Orte, Ziele und regionalen Rädelsführer dieser Zeit waren:
Hamburg war einer der ersten Orte in Deutschland, an dem Unruhen ausbrachen.
Ziele: Die Protestierenden forderten politische Reformen, Pressefreiheit und eine konstitutionelle Regierung. Die Unzufriedenheit richtete sich gegen die autoritäre Regierung und die Einschränkung der Bürgerrechte.
Rädelsführer: Zu den prominenten Figuren gehörten liberale Politiker und Journalisten, die die Ideen der französischen Revolution propagierten.
In Hannover kam es zu bedeutenden Unruhen.
Ziele: Auch hier forderten die Menschen mehr politische Mitbestimmung, eine Verfassung und die Abschaffung der Zensur.
Rädelsführer: Der Abgeordnete und liberale Politiker Georg Ludwig von der Gabelentz war eine der führenden Figuren, die für Reformen eintraten.
In der Badischen Revolution, insbesondere in Städten wie Karlsruhe und Freiburg, gab es heftige Proteste.
Ziele: Die Bürger forderten eine Verfassung, die Einführung von Bürgerrechten und eine Reform des Wahlrechts.
Rädelsführer: Karl Friedrich von Weizsäcker und andere liberale Intellektuelle und Studenten spielten eine zentrale Rolle.
In Sachsens Städten wie Dresden und Leipzig kam es zu Unruhen. Ziele: Die Protestierenden forderten politische Reformen, insbesondere eine Verfassung und mehr Mitbestimmung für das Bürgertum.
Rädelsführer: Der sächsische Landtagsabgeordnete und Liberalist Wilhelm von Humboldt war ein prominenter Vertreter der reformistischen Bewegung.
In Preußen gab es Aufstände in Städten wie Berlin und Potsdam.
Ziele: Die Menschen forderten eine Verfassung, politische Freiheiten und eine Reform der Verwaltung.
Rädelsführer: Der Journalist und Politiker Heinrich von Gagern und andere liberale Führer mobilisierten die Bürger für Reformen.
In Westfalens Städten wie Dortmund und Münster kam es zu Unruhen.
Ziele: Die Ziele umfassten politische Reformen und die Verbesserung der Lebensbedingungen der Arbeiter und Bauern.
Rädelsführer: Arbeiterführer und lokale Intellektuelle schlossen sich zusammen, um die Interessen der Arbeiterklasse zu vertreten.
Hinzu kamen Unruhen und Aufstände in Braunschweig, Hannover, Hessen und Kurhessen.
Allgemeine Merkmale der Aufstände
Zusammenhang mit der französischen Revolution: Die Unruhen in Deutschland waren stark von den Ereignissen in Frankreich inspiriert, insbesondere von der Julirevolution von 1830.
Ein zentrales Anliegen in vielen Regionen war die Forderung nach einer schriftlichen Verfassung und der Einführung von Bürgerrechten.
Repression: Die meisten Aufstände wurden schnell von den Regierungen der deutschen Staaten niedergeschlagen, was zu einer verstärkten Repression und Zensur führte.
Diese Unruhen und Aufstände waren Teil eines größeren politischen Wandels in Deutschland, der letztendlich zur Entstehung der Revolution von 1848 führte. Sie zeigten das wachsende Bedürfnis nach politischen Reformen und die Mobilisierung der Bürger für ihre Rechte.
1830er Jahre: Erste Gewerkschaften in England.
Arbeitern verteidigen ihre Rechte.
In den 1830er Jahren begann in England die Bildung der ersten Gewerkschaften, die eine wichtige Rolle in der Geschichte der Arbeiterbewegung spielten. Diese frühen Gewerkschaften entstanden aus dem Bedürfnis der Arbeiter, sich gegen die oft ausbeuterischen Arbeitsbedingungen der industriellen Revolution zu organisieren und ihre Rechte zu verteidigen.
Die ersten Gewerkschaften und deren Entstehung
1. Der ‘Grand National Consolidated Trades Union’ (GNCTU).
Gründung: 1834
Gewerke: Der GNCTU war eine der ersten nationalen Gewerkschaften, die verschiedene Gewerke umfasste, einschließlich Handwerker, Fabrikarbeiter und Bergarbeiter.
Entstehung: Der GNCTU wurde als Antwort auf die wachsende Unzufriedenheit der Arbeiter mit den Arbeitsbedingungen und der Lohnpolitik gegründet. Er strebte an, die verschiedenen Gewerkschaften in England zu vereinen, um eine stärkere Stimme für die Arbeiter zu schaffen. Trotz seiner anfänglichen Erfolge konnte der GNCTU aufgrund interner Konflikte und der Repression durch die Regierung nicht lange bestehen und wurde 1835 aufgelöst.
2. Die ‚Friendly Societies‘
Gründung: Bereits im 18. Jahrhundert, aber in den 1830er Jahren blühten sie auf.
Gewerke: Diese Gesellschaften waren oft lokal organisiert und umfassten verschiedene Berufsgruppen, darunter Handwerker, Landwirte und Dienstboten.
Entstehung: Die Friendly Societies entstanden als Selbsthilfeorganisationen, die soziale und finanzielle Unterstützung für ihre Mitglieder boten. Sie halfen bei der Absicherung gegen Krankheit, Arbeitslosigkeit und Alter. Diese Gesellschaften legten den Grundstein für spätere Gewerkschaften, indem sie das Bewusstsein für die Notwendigkeit der Zusammenarbeit und gegenseitigen Unterstützung schärften.
3. Die "National Association for the Promotion of Social Science" (NAPSS)
Gründung: 1857 (aber ihre Wurzeln reichen in die 1830er Jahre zurück).
Gewerke: Diese Organisation war nicht auf ein bestimmtes Gewerbe beschränkt, sondern umfasste eine Vielzahl von Berufen.
Entstehung: Die NAPSS entstand aus dem Bedürfnis, soziale und wirtschaftliche Reformen zu fördern und das Bewusstsein für die Bedingungen der Arbeiterklasse zu schärfen. Sie war eine Plattform für die Diskussion von sozialen Fragen, aber sie trug auch zur Bildung von Gewerkschaften bei.
4. Die "Amalgamated Society of Engineers" (ASE)
Gründung: 1851 (wurde jedoch in den 1830er Jahren als eine der ersten Handwerksgewerkschaften gegründet).
Gewerke: Ingenieure und Mechaniker.
Entstehung: Die ASE entstand aus dem Bedürfnis der Ingenieure, sich gegen die schlechten Arbeitsbedingungen und die Löhne in der Maschinenbauindustrie zu organisieren. Die Gewerkschaft setzte sich für bessere Löhne und Arbeitsbedingungen ein und war eine der ersten, die erfolgreich Tarifverträge aushandelte.
5. Die "National Union of Gas Workers and General Labourers" (NUGWGL)
Gründung: 1889 (aber die Bewegung begann in den 1830er Jahren).
Gewerke: Gasarbeiter und allgemeine Arbeiter.
Entstehung: Diese Gewerkschaft entstand aus der Notwendigkeit, die Rechte der Gasarbeiter zu schützen, die oft unter gefährlichen Bedingungen arbeiteten. Die NUGWGL setzte sich für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen und die Einführung von Sicherheitsstandards ein.
Die Entstehung dieser frühen Gewerkschaften in England in den 1830er Jahren war ein bedeutender Schritt in der Geschichte der Arbeiterbewegung. Sie spiegelte das wachsende Bewusstsein der Arbeiter für ihre Rechte und die Notwendigkeit wider, sich zu organisieren, um gegen Ausbeutung und schlechte Arbeitsbedingungen zu kämpfen. Diese Gewerkschaften legten den Grundstein für die Entwicklung einer strukturierten und organisierten Arbeiterbewegung im 19. Jahrhundert und darüber hinaus. Trotz der Herausforderungen und der Repression, mit denen sie konfrontiert waren, trugen sie dazu bei, das Fundament für zukünftige Errungenschaften im Bereich der Arbeitsrechte und sozialen Gerechtigkeit zu schaffen.
27.Mai 1832
Hambacher Fest
Das Hambacher Fest, das am 27. Mai 1832 auf dem Hambacher Schloss in der Pfalz stattfand, war eine der bedeutendsten politischen Versammlungen der deutschen Geschichte im 19. Jahrhundert. Hier sind die wesentlichen Aspekte der Kundgebung:
Anlass
Das Hambacher Fest fand in einem Kontext wachsender politischer Unruhen und nationaler Bewegungen in Europa statt.
Die Revolutionen von 1830 in Frankreich und die damit verbundenen Forderungen nach nationaler Einheit, Demokratie und Freiheit inspirierten viele Deutsche. In Deutschland gab es eine zunehmende Unzufriedenheit mit den autoritären Regierungen der deutschen Staaten, die sich gegen die Forderungen nach Verfassungen und politischen Reformen sträubten.
Verlauf
Versammlung: Am 27. Mai 1832 versammelten sich schätzungsweise 20.000 bis 30.000 Menschen aus verschiedenen deutschen Staaten auf dem Hambacher Schloss. Die Teilnehmer kamen aus unterschiedlichen sozialen Schichten, darunter Studenten, Arbeiter, Handwerker und Landwirte.
Reden: Es wurden mehrere leidenschaftliche Reden gehalten, in denen die Teilnehmer ihre Forderungen nach Freiheit, Einheit und Demokratie zum Ausdruck brachten. Zu den Rednern gehörten prominente politische Figuren wie der Journalist und Politiker Friedrich Hecker und der Student und Nationalist Gustav von Struve.
Symbole: Die Teilnehmer trugen schwarz-rot-goldene Fahnen, die später zu Symbolen der deutschen Einheitsbewegung wurden. Diese Farben wurden als Zeichen für die nationale Einheit und den Kampf gegen die Unterdrückung verwendet.
Ziel
Das Hauptziel des Hambacher Festes war die Forderung nach nationaler Einheit und politischen Reformen in Deutschland. Die Teilnehmer strebten eine einheitliche deutsche Nation an, die auf demokratischen Prinzipien basierte. Sie forderten:
Die Schaffung einer deutschen Nationalversammlung.
Die Einführung von Verfassungen in den deutschen Staaten.
Die Gewährleistung von Bürgerrechten und polit. Freiheiten.
Die Abschaffung der Zensur - die Förderung der Pressefreiheit.
Teilnehmer
Die Teilnehmer des Hambacher Festes kamen aus verschiedenen Regionen und sozialen Schichten. Dazu gehörten:
Viele Studenten aus Universitäten, die sich für nationale und liberale Ideen engagierten, waren stark vertreten.
Politische Aktivisten, Intellektuelle und Journalisten, die für Reformen und nationale Einheit eintraten.
Vertreter der Arbeiterklasse, die soziale und wirtschaftliche Verbesserungen forderten.
Einige Frauen nahmen ebenfalls an der Kundgebung teil und forderten Gleichberechtigung und politische Mitbestimmung.
(Das Hambacher Fest hatte bedeutende politische und soziale Auswirkungen. Es stellte einen wichtigen Moment in der deutschen Nationalbewegung dar und verstärkte die Forderungen nach Einheit und Freiheit. Die Reaktionen der Regierungen waren jedoch repressiv, und die Teilnehmer wurden oft verfolgt. Dennoch blieb das Hambacher Fest ein Symbol für den Kampf um Demokratie und nationale Einheit in Deutschland und beeinflusste die späteren revolutionären Bewegungen, insbesondere die Revolution von 1848.)
1834
Bestimmungen des deutschen Zollvereins
Der Deutsche Zollverein, der 1834 gegründet wurde, hatte mehrere wichtige Bestimmungen:
Zollfreiheit: Der Zollverein schaffte Zölle auf den Handel zwischen den Mitgliedsstaaten ab, was den Austausch von Waren und Dienstleistungen erleichterte.
Gemeinsame Zollpolitik: Die Mitgliedsstaaten einigten sich auf eine einheitliche Zollpolitik gegenüber Nichtmitgliedstaaten, was die Erhebung von Außenzöllen regelte.
Wirtschaftliche Integration: Der Zollverein förderte die wirtschaftliche Zusammenarbeit und schuf einen einheitlichen Binnenmarkt, der die wirtschaftliche Entwicklung unterstützte.
Erweiterung: Der Verein begann mit 18 Mitgliedsstaaten und wuchs im Laufe der Zeit, was die wirtschaftliche Stärke Deutschlands erhöhte.
Bedeutung für die Arbeiterbewegung
Die Gründung des Zollvereins hatte mehrere Auswirkungen auf die Arbeiterbewegung:
Industrielles Wachstum: Der Zollverein förderte die industrielle Entwicklung, was zu einem Anstieg der Fabrikarbeit führte. Dies führte zu einer Urbanisierung und einem Anstieg der Arbeiterpopulation in den Städten.
Bessere Arbeitsbedingungen: Mit dem Wachstum der Industrie und der Arbeiterklasse entstand ein Bewusstsein für die schlechten Arbeitsbedingungen. Dies führte zur Organisierung der Arbeiter und zur Gründung von Gewerkschaften.
Politische Mobilisierung: Die wirtschaftlichen Veränderungen und die soziale Ungleichheit, die durch die Industrialisierung entstanden, trugen zur politischen Mobilisierung der Arbeiterklasse bei. Sie forderten politische Rechte und soziale Reformen.
Vereinigungsbewegung: Der Zollverein förderte auch das nationale Bewusstsein, was die Arbeiterbewegung beeinflusste, da viele Arbeiter die Notwendigkeit einer einheitlichen politischen und sozialen Bewegung erkannten.
Insgesamt trug der Zollverein zur Schaffung eines wirtschaftlichen Umfelds bei, das die Entstehung und das Wachstum der Arbeiterbewegung in Deutschland begünstigte.
Für Forscher sie auf den Frankfurter Wachensturm im April 1833 hingewiesen, im April 1834 die Konstituierung von Jugendgeheimbünden aus Deutschland, Italien, Polen Frankreich und der Schweiz in Bern. Im Sommer die Gründung des Bundes der Geächteten in Paris mit eigener Zeitung, sowie 1836-38 die Bildung des dt. geheimen Bundes der Geächteten. 1839 Aufstand der französischen blanquistischen Geheimorganisation ‚Gesellschaft der Jahreszeiten‘.
1838
Veröffentlichung der „Peoples Charter“
Die „People's Charter“, die 1838 in Großbritannien veröffentlicht wurde, war ein zentrales Dokument der Chartistenbewegung, die sich für politische Reformen und die Rechte der Arbeiter einsetzte. Die Charter forderte eine Reihe von politischen und sozialen Veränderungen, die die demokratische Mitbestimmung und die politischen Rechte des einfachen Volkes stärken sollten. Die wichtigsten Inhalte der People's Charter waren:
Allgemeines Wahlrecht: Die Charter forderte das Recht auf das Wahlrecht für alle Männer über 21 Jahre, unabhängig von ihrem sozialen oder wirtschaftlichen Status. Dies sollte sicherstellen, dass jeder Bürger ein Mitspracherecht in politischen Angelegenheiten hatte.
Geheime Wahlen: Um die Wähler vor Einschüchterung und Bestechung zu schützen, wurde ein geheimes Wahlverfahren gefordert.
Wahlkreisreform: Die Charter verlangte eine gerechte Verteilung der Wahlkreise, um sicherzustellen, dass die Bevölkerung angemessen vertreten war. Insbesondere sollte die Überrepräsentation ländlicher Gebiete abgebaut werden.
Abschaffung von Eigentumsvoraussetzungen: Die Forderung beinhaltete die Abschaffung der Eigentumsvoraussetzungen für Abgeordnete, sodass auch Personen ohne großen Besitz in das Parlament einziehen konnten.
Jährliche Parlamentswahlen: Die Chartisten forderten, dass die Wahlen zum Parlament jährlich stattfinden sollten, um die Rechenschaftspflicht der Abgeordneten gegenüber ihren Wählern zu erhöhen.
Vergütung für Abgeordnete: Ein weiterer Punkt war die Einführung einer Vergütung für Abgeordnete, um sicherzustellen, dass auch Arbeiter und Personen mit geringem Einkommen die Möglichkeit hatten, im Parlament zu sitzen.
Die People's Charter stellte somit einen bedeutenden Schritt in Richtung einer breiteren politischen Mitbestimmung dar und reflektierte die wachsenden Forderungen nach sozialer Gerechtigkeit und politischer Teilhabe im Kontext der industriellen Revolution und der damit verbundenen sozialen Veränderungen. Die Bewegung blieb zwar in vielen ihrer Forderungen unerfüllt, hatte jedoch langfristig einen Einfluss auf die Entwicklung der Demokratie in Großbritannien.
1839
Die 'Gesellschaft der Jahreszeiten'
Die 'Gesellschaft der Jahreszeiten' (Société des Saisons) war eine geheime Organisation, die im frühen 19. Jahrhundert in Frankreich aktiv war. Diese Gruppe, die sich aus radikalen Republikanern und Sozialisten zusammensetzte, wurde häufig mit dem politischen Aktivismus und dem Aufstand von 1839 in Verbindung gebracht. Um den Kontext und die Bedeutung dieser Organisation besser zu verstehen, ist es wichtig, die politischen und sozialen Umstände der Zeit, ihre Ideologie sowie die Ereignisse des Aufstands zu beleuchten.
Historischer Kontext
Frankreich befand sich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in einer Phase tiefgreifender politischer Umwälzungen. Nach der Revolution von 1789 und den nachfolgenden napoleonischen Kriegen erlebte das Land eine Reihe von Regierungen, die zwischen Monarchie und Republik schwankten. Die Julirevolution von 1830 führte zur Errichtung der Julimonarchie unter Louis-Philippe, die jedoch schnell in die Kritik geriet. Viele Bürger, insbesondere aus der Arbeiterklasse und den Intellektuellen, fühlten sich von der neuen Regierung, die als bourgeois und elitär wahrgenommen wurde, verraten. Diese Unzufriedenheit führte zu einem Anstieg radikaler Bewegungen und geheimen Organisationen, die nach einer grundlegenden Veränderung der politischen Verhältnisse strebten.
Ideologie der Gesellschaft der Jahreszeiten
Die 'Gesellschaft der Jahreszeiten' war geprägt von einer Mischung aus utopischen sozialistischen Ideen und republikanischen Idealen. Ihre Mitglieder strebten nach einer Gesellschaft, die auf Gleichheit, Freiheit und sozialer Gerechtigkeit basierte. Die Bezeichnung „Gesellschaft der Jahreszeiten" kann als Metapher für den Zyklus des Wandels verstanden werden, den die Mitglieder herbeiführen wollten. Sie glaubten, dass die politischen und sozialen Strukturen, die die Gesellschaft prägten, einem ständigen Wandel unterworfen sein sollten, ähnlich wie die Jahreszeiten.
Die Gruppe war auch von der Idee inspiriert, dass eine Revolution notwendig sei, um die bestehenden Verhältnisse zu ändern. Sie sahen sich selbst als Teil einer größeren Bewegung, die in ganz Europa für soziale und politische Reformen eintrat. Dabei waren sie von den Ideen von Karl Marx und anderen sozialistischen Denkern beeinflusst, die zur gleichen Zeit aufkamen.
Der Aufstand von 1839
Der Aufstand von 1839 war eine der bedeutendsten Aktionen der ‚Gesellschaft der Jahreszeiten'. Die Organisation plante einen bewaffneten Aufstand gegen die Julimonarchie, um ihre politischen Ziele durchzusetzen. Der Aufstand wurde jedoch im Keim erstickt. Die Regierung reagierte schnell und mit brutaler Gewalt, um die Rebellion niederzuschlagen. Viele Mitglieder der Gruppe wurden verhaftet, und die Führung wurde stark geschwächt.
Trotz des Scheiterns des Aufstands hatte die ‚Gesellschaft der Jahreszeiten' einen bleibenden Einfluss auf die politische Landschaft Frankreichs. Sie trugen zur Mobilisierung der Arbeiterbewegung bei und inspirierten spätere Generationen von Sozialisten und Kommunisten. Der Aufstand von 1839 kann als eine Vorstufe zu den größeren revolutionären Bewegungen betrachtet werden, die in den folgenden Jahrzehnten in Europa stattfanden, einschließlich der Revolution von 1848.
Die 'Gesellschaft der Jahreszeiten' war immerhin ein bedeutendes Beispiel für die radikalen politischen Strömungen des 19. Jahrhunderts in Frankreich. Sie verkörperte den Wunsch nach sozialer Gerechtigkeit und politischer Veränderung in einer Zeit des Umbruchs. Obwohl ihr direkter Einfluss begrenzt war, trugen die Ideen und Ideale der Organisation zur Entwicklung einer breiteren politischen Bewegung bei, die sich in den folgenden Jahrzehnten weiter entfalten sollte. Der Aufstand von 1839 bleibt ein wichtiges Kapitel in der Geschichte der sozialen Bewegungen in Frankreich und zeigt, wie tiefgreifend der Wunsch nach Veränderung in der Gesellschaft verwurzelt war.
7.Februar 1840
Gründung des Dt. Arbeiterbildungsvereins in London
Die Gründung des Deutschen Arbeiterbildungsvereins in London am 7. Februar 1840 war eine wichtige Entwicklung in der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung und der politischen Bildung. Die Ursachen und Ziele der Gründung zusammengefasst, sind:
Ursachen der Gründung
Industrielle Revolution: Die industrielle Revolution führte zu massiven sozialen Veränderungen, die viele Arbeiter in die Städte zogen. Diese Veränderungen schufen ein Bedürfnis nach Bildung und politischer Organisation unter den Arbeitern.
Politische Repression: Nach den revolutionären Bewegungen von 1830 und 1831 in Deutschland erlebten viele politische Aktivisten eine Repression. Viele von ihnen emigrierten nach England, wo sie einen sichereren Raum für ihre politischen Aktivitäten fanden.
Wachsende Arbeiterklasse: In der Diaspora lebten viele deutsche Arbeiter, die sich in England niedergelassen hatten.
Diese Gemeinschaften benötigten eine Plattform, um sich zu organisieren und ihre politischen und sozialen Rechte einzufordern.
Einfluss von Sozialisten und Kommunisten: Die Ideen von Sozialisten und Kommunisten, insbesondere die von Karl Marx und Friedrich Engels, beeinflussten die Gründung. Diese Ideen forderten eine bessere Organisation der Arbeiterklasse und eine stärkere politische Vertretung.
Ziele der Gründung
Bildung und Aufklärung: Der Verein hatte das Ziel, die politische und soziale Bildung der Arbeiter zu fördern. Dies sollte dazu beitragen, das Bewusstsein für ihre Rechte und die Notwendigkeit von Reformen zu schärfen.
Politische Organisation: Der Deutsche Arbeiterbildungsverein wollte eine Plattform schaffen, um die politischen Interessen der Arbeiter zu vertreten und sie in politischen Fragen zu mobilisieren.
Kultureller Austausch: Der Verein diente auch dem kulturellen Austausch und der Stärkung der deutschen Identität unter den im Ausland lebenden Deutschen, indem er Veranstaltungen und Vorträge organisierte.
Solidarität unter Arbeitern: Ein weiteres Ziel war die Förderung der Solidarität unter den Arbeitern, um eine gemeinsame Stimme für ihre Anliegen zu schaffen und die Interessen der Arbeiterklasse zu bündeln.
Die Gründung des Deutschen Arbeiterbildungsvereins in London war somit ein bedeutender Schritt in der Organisation und Mobilisierung der Arbeiterbewegung im 19. Jahrhundert, der die Grundlage für weitere Entwicklungen in der deutschen und internationalen Arbeiterbewegung legte.
7. Juni 1840
Die Thronbesteigung Friedrich Wilhelm IV.
Die Thronbesteigung Friedrich Wilhelms IV. von Preußen am 7. Juni 1840 weckte bei vielen Arbeitern und progressiven Kräften in Deutschland eine Reihe von Hoffnungen und Erwartungen. Die zentralen Hoffnungen, die mit seiner Thronbesteigung verbunden waren:
Politische Reformen: Viele Arbeiter und Bürger hofften, dass Friedrich Wilhelm IV. als ein aufgeklärter Monarch die notwendigen politischen Reformen einleiten würde. Es gab Erwartungen an eine Liberalisierung des politischen Systems, einschließlich der Einführung eines Verfassungsstaates und der Gewährung von mehr politischen Rechten und Freiheiten.
Soziale Verbesserungen: Die sozialen Missstände, die durch die industrielle Revolution und die damit verbundenen Veränderungen entstanden waren, führten zu einer großen Unzufriedenheit. Viele Arbeiter hofften auf Maßnahmen zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen, wie beispielsweise Reformen im Arbeitsrecht, die Einführung von Sozialgesetzen und Maßnahmen gegen Armut.
Nationales Bewusstsein: Friedrich Wilhelm IV. wurde als ein Monarch gesehen, der die nationale Einheit Deutschlands fördern könnte. Viele Menschen, einschließlich der Arbeiter, waren von der Idee einer nationalen Einheit und einem vereinigten Deutschland begeistert, was auch eine stärkere politische Vertretung der Arbeiterklasse implizieren könnte.
Religiöse Toleranz und Aufklärung: Der neue König war für seine protestantischen Überzeugungen bekannt, und viele hofften, dass er eine Politik der religiösen Toleranz und Aufklärung fördern würde, die die gesellschaftliche Spaltung zwischen verschiedenen Glaubensgemeinschaften überwinden könnte.
Zukunftsperspektiven: Die Thronbesteigung wurde als Chance für eine positive Wende in der Geschichte Preußens und Deutschlands insgesamt gesehen. Viele Menschen, einschließlich der Arbeiterbewegung, erhofften sich von Friedrich Wilhelm IV. eine progressive Wende, die zu einer stärkeren Berücksichtigung der Interessen der Arbeiter führen würde.
Diese Hoffnungen waren stark von den politischen und sozialen Bewegungen der Zeit geprägt, die auf Veränderungen drängten. Allerdings enttäuschte Friedrich Wilhelm IV. im Laufe seiner Herrschaft viele dieser Erwartungen, was letztlich zur Entstehung von Unruhen und revolutionären Bewegungen in der Folgezeit führte, insbesondere während der Revolution von 1848.
Es folgen viele Schriften, so durch Marx, der bis März 1843 bei der ‚Rheinischen Zeitung‘ schreibt, W. Weitling, H. Heine, A. Ruge und K. Marx geben die dt.-franz. Jahrbücher heraus. Im Juni gibt es den Aufstand der schlesischen Weber. Im August 1844 wechselt Marx zum „Vorwärts“. Es bildet sich ein handwerkerverein in Berlin. Es erscheint ‚Der wahre Sozialismus‘, ein kleinbürgerliches Pamphlet. 1845 gründet sich in Hamburg der Bildungsverein für Arbeiter. Frankreich weist Marx (auf Druck Preußens) aus, der nach Brüssel zieht. Versammlungen von Arbeitern gibt es in Elberfeld und Streiks der Köln-Mindener Eisenbahn. Engels gibt sein Werk „Die Lage der arbeitenden Klasse in England“ ein. 1846