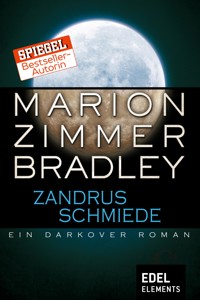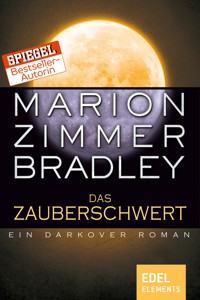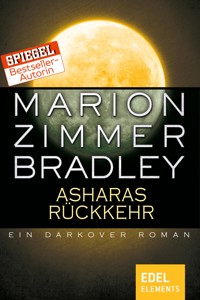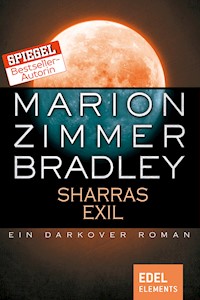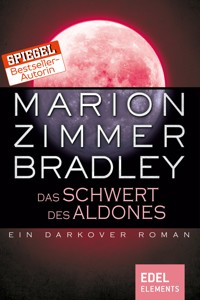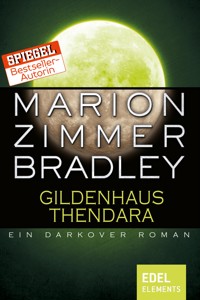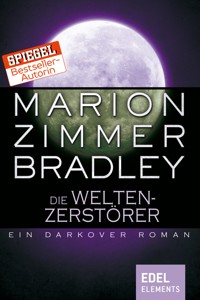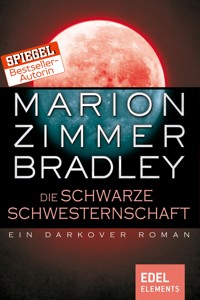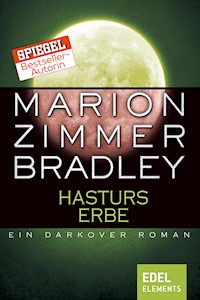
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Darkover-Zyklus
- Sprache: Deutsch
Bestsellerautorin Marion Zimmer Bradley ("Die Nebel von Avalon") hat mit dem opulenten Darkover-Zyklus eine einzigartige Romanreihe geschaffen: Die fesselnde Geschichte einer geheimnisvollen fremden Welt und ihrer Bewohner ist Kult! Seit Jahrhunderten regiert das Geschlecht der Hastur den Planeten Darkover. Regis Hastur, der letzte Spross einer der großen Comyn-Familien, will jedoch das schwere Erbe nicht antreten. Dann aber spürt er die geheimnisvolle Kraft, die nur den Hasturs zu Eigen ist, in sich reifen. Und als eine gefährliche Matrix-Waffe aus dem Zeitalter des Chaos die gesamte Zivilisation mit Tod und Vernichtung bedroht, weiß Regis, dass er handeln muss...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 751
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Marion Zimmer Bradley – Der “Darkover”-Romanzyklus bei EdeleBooks:
Copyright dieser Ausgabe © 2014 by Edel eBooks, einem Verlag der Edel Germany GmbH, Hamburg. Copyright © 1975 by Marion Zimmer Bradley Copyright First german Edition © 2000 by Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf., München. Die Originalausgabe erschien 1979 unter dem Titel "The Heritage of Hastur" Ins Deutsche übertragen von Annette von Charpentier
Covergestaltung: Agentur bürosüd°, München
Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-95530-602-1
edel.comfacebook.com/edel.ebooks
Ein Darkover-Roman
»Weit entfernt in der Galaxisund ungefähr 4000 Jahre in der Zukunftgibt es einen Planetenmit einer großen roten Sonneund vier Monden.Willst Du nicht mitkommenund ihn mit mir erforschen?«
Marion Zimmer Bradley
1
Als die Reiter über den Pass kamen, der hinab nach Thendara führte, konnten sie über die alte Stadt hinweg bis zum Terranischen Raumhafen blicken. Wie ein fremdartiges Gewächs erstreckte sich die riesige Fläche dort hässlich und für ihre Augen ungewohnt aus. Den Raumhafen umringten wie Schorf die eng aneinander gedrängten Gebäude des Handelsstützpunktes, der sich zwischen dem alten Thendara und dem neuen Terranischen Hauptquartier entwickelt hatte.
Regis Hastur ritt langsam inmitten seiner Eskorte. Er fand den Komplex nicht so hässlich, wie man ihn ihm in Nevarsin geschildert hatte. Er besaß eine eigene Schönheit, eine strenge Schönheit mit Stahltürmen und blendend weißen Gebäuden, ein jedes einem fremdartigen, unbekannten Zweck zugedacht. Er war kein Krebsgeschwür auf der Oberfläche Darkovers, sondern wie eine eigenartige, aber nicht unschöne Verzierung.
Dass der Zentralturm des neuen Hauptquartiers direkt gegenüber von Schloss Comyn auf der anderen Seite des Tales stand, rief einen unglückseligen Eindruck hervor. Regis schien es, als hätten sich der Wolkenkratzer und das alte Steinschloss voneinander abgesondert und stünden sich wie zwei kampfbereite Riesen gegenüber.
Doch er wusste, dass dieser Eindruck lächerlich war. Sein ganzes Leben lang hatte zwischen dem Terranischen Imperium und den Domänen Friede geherrscht. Dafür sorgten schon die Hasturs.
Dieser Gedanke besaß jedoch wenig Tröstliches. Regis hielt sich nicht für einen typischen Hastur, doch er war der Letzte seines Geschlechts. Man würde ihn so akzeptieren, wie er war, wenn er auch, wie jeder wusste, einen schlechten Ersatz für seinen Vater bildete. Nicht eine Minute lang ließ man ihn das vergessen.
Regis’ Vater war vor fünfzehn Jahren gestorben, einen Monat vor der Geburt seines Sohnes. Rafael Hastur hatte bereits im Alter von fünfunddreißig Jahren Eigenschaften eines starken Staatsmannes und bedeutenden Führers aufgewiesen. Sein Volk liebte ihn zutiefst, und selbst die Terraner respektierten ihn. Und es hatte ihn in den Kilghardbergen in Stücke zerrissen. Er wurde von geschmuggelten Waffen aus dem Terranischen Imperium getötet. Der Welt in den besten und hoffnungsvollsten Jahren entrissen, hatte er lediglich eine elfjährige Tochter und eine zerbrechliche, schwangere Frau hinterlassen. Alanna Elhalyn-Hastur war bei der Nachricht seines Todes fast gestorben. Doch dann hatte sie sich fast panisch an das Leben geklammert, weil sie wusste, dass sie den letzten Hastur in sich trug, den lang ersehnten Sohn von Rafael. Zerfressen von Kummer, hatte sie gerade lange genug gelebt, um Regis das Licht der Welt erblicken zu lassen, und dann fast erleichtert den Geist aufgegeben.
Nach dem Verlust des Vaters, nach allem, was seine Mutter durchgemacht hatte, dachte Regis, war er nicht der Sohn, den sich seine Eltern gewünscht hatten. Er war kräftig gebaut, sah auch gut aus, war jedoch für einen Sohn der telepathischen Kaste der Domänen, den Comyns, seltsam behindert: ein Nichttelepath. Wenn er diese Kraft ererbt hätte, hätte sie sich im Alter von fünfzehn Jahren zeigen müssen.
Hinter ihm hörte er seine Leibwächter leise miteinander reden.
»Das Hauptquartier ist also inzwischen fertig gestellt. Ein verfluchter Platz, den sie sich da ausgesucht haben. Nur einen Steinwurf von Schloss Comyn entfernt.«
»Erst haben sie angefangen, es in Caer Donn, in den Hellers, zu bauen. Der alte Istvan Hastur hat sie dann zu Zeiten meines Großvaters überredet, den Raumhafen nach Thendara zu verlegen. Er wird schon seine Gründe dafür gehabt haben.«
»Hätten ihn dort lassen sollen. Weit weg von anständigen Leuten!«
»Oh, die Terraner sind nicht so schlecht. Mein Bruder hat einen Laden in der Handelsstadt. Würdest du denn die Terraner da oben in den Bergen haben wollen, wo sich die Bergräuber und die verdammten Aldarans hinter unserem Rücken mit ihnen verbinden?«
»Verdammte Wilde«, sagte der zweite Mann. »Sie halten nicht einmal das Abkommen ein. Man kann sie überall in den Hellers mit den schmutzigen Waffen dieser Feiglinge herumlaufen sehen.«
»Was erwartest du denn von den Aldarans?« Sie senkten die Stimme, und Regis seufzte. Er war es gewohnt. Jeder fühlte sich in seiner Gegenwart unter Druck, einfach dadurch, dass er war, was er war: ein Comyn und Hastur. Wahrscheinlich dachten sie, er könne Gedanken lesen. Die meisten Comyns konnten es.
»Lord Regis«, sagte eine seiner Wachen, »da kommt eine Reitertruppe mit Fahnen von der nördlichen Straße herab. Es muss die Abordnung aus Armida mit Lord Alton sein. Sollen wir auf sie warten und zusammen weiterreiten?«
Regis hatte kein besonderes Verlangen nach einer weiteren Truppe von Comyn-Lords, doch es wäre ein undenkbarer Bruch der Etikette gewesen, wenn er dies laut gesagt hätte. Wenn der Rat tagte, trafen sich alle Domänenherren in Thendara. Generationen alten Brauchtums forderten von Regis, sie wie Verwandte und Brüder zu behandeln. Und die Altons waren seine Stammesbrüder!
Sie ritten langsamer und warteten auf die anderen Reiter.
Noch immer befanden sie sich ziemlich hoch am Berghang und konnten über Thendara hinweg auf den Raumhafen sehen. Ein lautes, fernes Getöse wie von einem Wasserfall ließ den Boden erdröhnen und erzittern, auch dort, wo sie standen. Weit hinten auf dem Raumhafen begann sich ein kleiner, spielzeughafter Gegenstand zu bewegen, erst langsam, dann schneller und schneller. Das Geräusch stieg an zu einem fernen Kreischen. Der Gegenstand verschwamm zu einem Streifen, verkleinerte sich zu einem Punkt und war verschwunden.
Regis atmete auf. Ein Raumschiff des Imperiums auf dem Weg zu fernen Welten, fremden Sonnen … Regis merkte, dass er die Fäuste so fest um die Zügel gekrampft hatte, dass sein Pferd den Kopf herumwarf und protestierte. Er gab nach und klopfte dem Tier abwesend den Hals. Seine Augen fixierten immer noch den Fleck am Himmel, wo das Raumschiff verschwunden war.
Auf dem Weg nach draußen, frei für die unermesslichen Größen des Raumes, flog das Schiff auf Welten zu, deren Wunder er, der hier unten angekettet war, nur erahnen konnte. Er spürte einen Kloß in der Kehle und wünschte sich, er wäre so jung, dass er weinen könnte, doch der Erbe der Hasturs konnte nicht in aller Öffentlichkeit eine so unmännliche Reaktion zeigen. Er fragte sich, warum dieser Anblick ihn so aufregte, und wusste auch die Antwort: Das Schiff war auf dem Weg zu Orten, an die er nie gelangen würde.
Die Reiter vom Pass kamen nun näher. Regis erkannte einige von ihnen. Neben dem Bannerträger ritt Kennard, Lord Alton, ein gebeugter, untersetzter Mann mit rotem Haar, das allmählich ergraute. Neben Danvan Hastur, dem Regenten der Comyn, war Kennard wahrscheinlich der mächtigste Mann in den Domänen. Regis kannte Kennard schon seit seiner Geburt. Als Kind hatte er ihn Onkel genannt. Hinter ihm sah er, nach einer Gruppe von Stammesangehörigen, Dienern, Leibwächtern und armen Verwandten, das Banner der Domäne Ardais, also musste auch Lord Dyan bei ihnen sein.
Einer von Regis’ Leibwächtern sagte leise: »Ich sehe, der alte Bussard hat seine beiden Bastarde dabei. Wie kann er das wagen?«
»Der alte Kennard kann alles, und Hastur wird es dulden«, gab der andere so leise zurück, als unterhalte man sich auf einem Gefängnishof. »Übrigens ist der junge Lew kein Bastard. Kennard hat ihn legitimiert, damit er im Arilinn-Turm arbeiten kann. Der jüngere …« Der Wächter merkte, wie Regis in seine Richtung blickte und nahm sich zusammen. Seine Miene wurde glatt, als habe man mit einem Schwamm darüber gewischt.
Verdammt, dachte Regis irritiert, ich kann eure Gedanken nicht lesen, Mann, ich habe einfach normal gute Ohren. Jedenfalls hatte er eine ungehörige Bemerkung über einen Lord der Comyn gehört, und dem Wächter war dies peinlich. Es gab ein altes Sprichwort: Aus ihrem Loch heraus kann sich die Maus die Katze ruhig ansehen, doch klugerweise quietscht sie nicht dabei.
Regis kannte natürlich die alte Geschichte. Kennard hatte eine schockierende, ja eine schamlose Tat begangen: Er hatte eine halbterranische Frau in offizieller Ehe zu sich genommen, die außerdem noch mit der Renegatendomäne der Aldarans verwandt war. Der Rat der Comyn hatte die Ehe niemals anerkannt und auch nicht die daraus hervorgegangenen Söhne. Nicht einmal um Kennards willen.
Kennard ritt auf Regis zu. »Seid gegrüßt, Lord Regis. Reitet Ihr zum Rat?« Er benutzte die förmliche Anrede, obwohl es ihm als dem älteren Verwandten auch erlaubt war, Regis zu duzen.
Regis geriet beinahe außer sich über die Überflüssigkeit dieser Frage. Wohin sonst sollte er wohl auf dieser Straße zu dieser Jahreszeit reiten? Dann merkte er, dass man ihn mit dieser formellen Frage als einen Erwachsenen anerkannte. Mit entsprechender Höflichkeit antwortete er: »Jawohl, Oheim, mein Großvater wünscht, dass ich in diesem Jahr am Rat teilnehme.«
»Seid Ihr das ganze Jahr über im Kloster von Nevarsin gewesen, Neffe?«
Kennard wusste sehr wohl, wo er gewesen war, dachte Regis; als seinem Großvater nichts anderes eingefallen war, ihn loszuwerden, hatte er ihn nach Sankt-Valentin-im-Schnee verfrachtet. Doch es wäre ein fürchterlicher Bruch der Etikette gewesen, hätte er dies erwähnt, so sagte er lediglich: »Ja, er hat meine Erziehung den Cristofores anvertraut. Ich bin seit drei Jahren dort.«
»Das ist aber eine verdammte Art und Weise, einen Erben der Hasturs zu behandeln«, sagte eine raue, melodiöse Stimme. Regis blickte auf und erkannte Lord Dyan Ardais, einen blassen, großen, hakennasigen Mann, den er auf kurzen Besuchen im Kloster gesehen hatte. Regis verbeugte sich und grüßte ihn: »Lord Dyan!«
Dyans Augen, scharf und fast farblos – es hieß, die Ardais hätten Chieri-Blut –, ruhten auf Regis. »Ich habe Hastur gesagt, er sei ein Riesendummkopf, einen Jungen zur Erziehung an einen solchen Ort zu schicken. Aber ich habe mitbekommen, dass er viel mit Staatsgeschäften belastet ist, zum Beispiel mit all den Problemen, die die Terraner in unsere Welt gebracht haben. Ich habe ihm angeboten, Euch nach Ardais zu bringen. Meine Schwester Elorie hat keine Kinder und hätte gern einen Verwandten aufgenommen und erzogen. Aber Euer Großvater, denke ich, hielt mich für keinen guten Paten für einen Jungen Eures Alters.« Er lächelte leicht sarkastisch. »Nun, Ihr scheint die drei Jahre in den Händen der Cristofores gut überstanden zu haben. Wie war es in Nevarsin, Regis?«
»Kalt.« Regis hoffte, damit das Thema abgetan zu haben.
»Daran erinnere ich mich gut«, sagte Dyan lachend. »Auch ich bin bei den Brüdern groß geworden, wie Ihr wisst. Mein Vater war da noch bei Verstand – oder genügend bei Verstand, um mich bei seinen verschiedensten Exzessen von sich fern zu halten. Ich habe die ganzen fünf Jahre dort gezittert.«
Kennard hob eine graue Braue. »Ich kann mich nicht erinnern, dass es so kalt war.«
»Aber du hattest es im Gästehaus auch warm«, sagte Dyan mit einem Lächeln. »Dort brennen das ganze Jahr über Feuer, und man kann sich jemanden mitnehmen, der einem das Bett wärmt, wenn man will. Der Schülerschlafsaal in Nevarsin – das meine ich ganz ernst – ist der kälteste Ort auf ganz Darkover. Hast du nicht gesehen, wie die armen Jungen zitternd durch die Räume liefen? Haben sie einen Cristoforo aus Euch gemacht, Regis?«
Regis sagte kurz: »Nein, ich diene dem Herrn des Lichts, wie es sich für einen Sohn der Hasturs gehört.«
Kennard wies auf zwei Burschen in den Alton-Farben, und sie ritten ein Stück nach vorn. »Lord Regis«, sagte er förmlich, »gestattet mir, Euch meine Söhne vorzustellen: Lewis-Kennard Montray-Alton, Marius Montray-Lanart.«
Regis fühlte sich kurz verunsichert. Kennards Söhne waren durch den Rat nicht anerkannt, doch wenn Regis sie als Verwandte und Gleichgestellte begrüßte, würde er ihnen die Anerkennung der Hasturs zollen. Wenn nicht, würde er seinen Verwandten beleidigen. Er war wütend auf Kennard, dass er ihm diese Wahl aufzwang, besonders deshalb, weil es keinen Punkt der Comyn-Etikette und Diplomatie gab, den Kennard nicht kannte.
Lew Alton war ein kräftiger junger Mann, fünf oder sechs Jahre älter als Regis. Er sagte mit schiefem Lächeln: »Ist schon gut, Lord Regis. Ich wurde vor ein paar Jahren legitimiert und formell als Erbe bestätigt. Es ist also in Ordnung, wenn Ihr mich begrüßt.«
Regis fühlte, wie er vor Verlegenheit heftig errötete. Er sagte: »Großvater hat es mir geschrieben. Ich hatte es vergessen. Seid gegrüßt, Vetter. Seid Ihr schon lange unterwegs?«
»Ein paar Tage«, antwortete Lew. »Die Straßen waren ruhig, wenn auch mein Bruder, glaube ich, der Meinung ist, dass es ein langer Ritt war. Er ist sehr jung für eine solche Reise. Ihr erinnert Euch doch an Marius, oder?«
Erleichtert bemerkte Regis, dass Marius, Montray-Lanart statt Alton genannt, weil er noch nicht als legitimer Sohn anerkannt war, erst zwölf Jahre alt war – in jedem Fall zu jung für eine offizielle Begrüßung. Diese Frage konnte man umgehen, indem man ihn wie ein Kind behandelte. Er sagte: »Du bist gewachsen, seit ich dich das letzte Mal gesehen habe. Ich glaube, du erinnerst dich nicht mehr an mich. Immerhin bist du alt genug, um zu reiten. Hast du noch das kleine Pony, auf dem du immer in Armida geritten bist?«
Marius antwortete höflich. »Ja, aber es ist auf der Weide. Es ist alt und lahm, zu alt für eine solche Reise.«
Kennard sah verärgert aus. Das war Diplomatie! Sein Großvater wäre stolz auf ihn gewesen, dachte Regis, selbst wenn er selbst nicht stolz auf diese Doppelzüngigkeit war. Glücklicherweise war Marius zu jung, um zu erkennen, dass man ihn gedemütigt hatte.
Regis dachte, wie lächerlich es doch sei, dass sich Jungen gleichen Alters so förmlich anredeten. Lew und er waren gute Freunde gewesen. In den Jahren auf Armida, bevor Regis in das Kloster übersiedelte, hatten sie sich so nahe wie Brüder gestanden. Und nun nannte Lew ihn Lord Regis! Es war albern!
Kennard blickte zum Himmel. »Sollen wir weiterreiten? Die Sonne wird bald untergehen, und es wird sicher regnen. Es wäre ärgerlich, wenn wir anhalten und die Banner verstauen müssten. Und Euer Großvater wartet sicher auf Euch, Regis.«
»Meinem Großvater wurde meine Gegenwart drei Jahre lang erspart«, sagte Regis trocken. »Ich bin sicher, er hält es noch eine weitere Stunde aus. Doch es wäre schon besser, wenn wir nicht in die Dunkelheit kämen.«
Das Protokoll besagte, dass Regis neben Kennard und Lord Dyan reiten müsse, doch er blieb zurück und lenkte sein Pferd neben Lew Alton. Marius ritt neben einem Jungen von Regis’ Alter, der so vertraut aussah, dass Regis die Stirn runzelte und überlegte, woher er ihn kannte.
Während sich die Truppe formierte, schickte Regis seinen Bannerträger an die Spitze der Kolonne zu denen von Ardais und Alton. Er sah, wie der Mann mit dem blausilbernen Baumemblem der Hasturs und dem Motto der Kaste Permanedál nach vorn ritt. Ich werde bleiben, übersetzte er es sich verdrossen, ja, ich werde alle Zeit hier bleiben und ein Hastur sein, ob ich will oder nicht.
Dann ergriff ihn wieder Aufsässigkeit. Kennard war nicht geblieben. Er war auf Terra selber groß geworden, nach dem Willen des Rates. Vielleicht gab es auch für Regis Hoffnung, ob er nun ein Hastur war oder nicht.
Er fühlte sich merkwürdig einsam. Kennards Manöver, dass Regis seine Söhne ordentlich begrüßte, hatte ihn verärgert, doch auch berührt. Er fragte sich, ob er ebenso einsam wäre, wenn sein Vater noch lebte. Hätte auch er Pläne verfolgt und Intrigen veranstaltet, damit sich sein Sohn nicht so unterlegen gefühlt hätte?
Lews Miene war grimmig, abgekehrt und verschlossen. Regis konnte nicht sagen, ob er sich gedemütigt, schlecht behandelt oder einfach einsam fühlte, weil er anders war.
Lew sagte: »Kommt Ihr, Euren Sitz im Rat einzunehmen, Lord Regis?«
Die Förmlichkeit irritierte Regis. War es eine Zurechtweisung als Gegenleistung für die, die er Marius erteilt hatte? Plötzlich wurde er es überdrüssig. »Du hast mich sonst Vetter genannt, Lew. Sind wir nun zu alt, um Freunde zu sein?«
Ein rasches Lächeln überzog Lews Gesicht. Ohne den verschlossenen, mürrischen Ausdruck sah er gut aus. »Natürlich nicht, Vetter. Doch man hat mir bei den Kadetten und überall eingebläut, dass du Regis-Rafael Lord Hastur bist, und ich bin … nun, ich bin ein Nedestro-Erbe der Altons. Sie haben mich nur akzeptiert, weil mein Vater keine richtigen Darkover-Söhne hat. Ich dachte mir, dass es an dir liegt, ob du auf der Verwandtschaft bestehst oder nicht.«
Regis’ Mund verzog sich zu einer Grimasse. Er zuckte die Achseln. »Nun, vielleicht müssen sie auch mich akzeptieren, doch ich könnte genauso gut ein Bastard sein. Ich habe kein Laran geerbt.«
Lew sah schockiert aus. »Aber sicher hast du … ich war sicher …« Er brach ab. »Wie dem auch sei, du wirst im Rat einen Sitz haben, Vetter. Es gibt keinen anderen Hastur-Erben.«
»Das ist mir nur zu sehr bewusst. Seit dem Tag meiner Geburt habe ich nichts anderes gehört«, sagte Regis. »Allerdings hat Javanne Gabriel Lanart geheiratet und bekommt Söhne wie die Kaninchen. Einer von denen könnte mich eines Tages verdrängen.«
»Immerhin bist du in der direkten Abstammungslinie. Die Gabe des Larans überspringt von Zeit zu Zeit eine Generation. Alle deine Söhne können es erben.«
Regis sagte mit plötzlicher Bitterkeit: »Glaubst du, das nützt – zu wissen, dass ich für mich genommen wertlos bin – wertvoll allein wegen der Söhne, die ich zeugen werde?«
Ein dünner Nieselregen setzte ein. Lew zog die Kapuze über die Schultern, und auf seinem Umhang erkannte man die Abzeichen der Stadtgarde. Er leistete also den regulären Dienst eines Comyn-Erben, dachte Regis. Vielleicht ist er ein Bastard, aber vielleicht ist er nützlicher als ich.
Lew sagte, als könne er seine Gedanken lesen: »Ich rechne damit, dass du in diesem Jahr in das Kadettenkorps der Garde eintrittst. Oder sind die Hasturs davon ausgenommen?«
»Man hat alles für uns vorgeplant, stimmt’s, Lew? Mit zehn Jahren Feuerwache. Mit dreizehn oder vierzehn das Kadettenkorps. Dann ist die Reihe an der Offizierslaufbahn. Nimm deinen Sitz im Rat ein, heirate die richtige Frau, wenn sie eine aus einer Familie finden können, die alteingesessen und wichtig genug ist und, darauf kommt es an, die Laran hat. Zeuge jede Menge Söhne und eine Menge Töchter, damit andere Comyn-Söhne sie heiraten können. Bei allen ist das Leben vorgeplant, und alles, was uns zu tun bleibt, ist, hindurchzukommen und den richtigen Weg zu beschreiten, ob wir wollen oder nicht.«
Lew sah unsicher aus und gab keine Antwort. Gehorsam wie ein richtiger Prinz ritt Regis ein Stück voraus, um durch die Stadttore hindurch auf seinem angemessenen Platz neben Kennard und Lord Dyan zu reiten. Sein Kopf wurde nass, doch war es seine Pflicht, dachte er säuerlich, sich sehen zu lassen, sich zur Schau zu stellen. Ein wenig Feuchtigkeit machte einem Hastur doch nichts aus.
Er zwang sich zu einem Lächeln und winkte anmutig den Menschenmengen am Straßenrand zu. Doch von weit her konnte er durch den Boden wieder jene dumpfe Vibration spüren wie von einem Wasserfall. Die Raumschiffe waren noch da, sagte er zu sich, und die Sterne auch noch. Es spielt keine Rolle, wie stark sie meinen Weg vorzeichnen. Ich werde eine Möglichkeit finden, eines Tages auszubrechen. Eines Tages.
2
(Lewis-Kennard Montray-Altons Erzählung)
Dieses Jahr wollte ich nicht am Rat teilnehmen. Genauer gesagt, wollte ich überhaupt niemals daran teilnehmen. Das ist noch vornehm ausgedrückt. Bei denen, die meinem Vater in den Sieben Domänen ebenbürtig sind, bin ich nicht sehr beliebt.
In Armida habe ich meine Ruhe. Die Leute im Haus wissen, wer ich bin, und den Pferden ist es egal. Und auf dem Arilinn fragt einen niemand nach seiner Familie, dem Stammbaum oder der Legitimität. Das einzig Wichtige dort ist deine Fähigkeit, die Matrix zu manipulieren, in Energonringe zu verschlüsseln und Bildschirme zu schalten. Wenn man gut ist, kümmert sich niemand darum, ob man nun zwischen seidenen Laken in einem großen Haus aufgewachsen ist oder in einem Straßengraben, und wenn man unfähig ist, kommt man gar nicht dorthin.
Man könnte fragen, wenn ich das Anwesen in Armida gut verwaltet habe und bei den Matrix-Relais im Arilinn mehr als gut war, warum Vater sich in den Kopf gesetzt hatte, mich in den Rat zu zwingen. Man könnte dies fragen, aber man müsste jemand anders fragen, denn ich habe keine Ahnung.
Was auch immer seine Gründe waren, es war ihm gelungen, mich als seinen Erben in den Rat zu zwingen. Sie wollten es nicht, aber sie mussten mir die legitimen Privilegien eines Comyn-Erben samt den damit verbundenen Pflichten verleihen. Was bedeutete, dass ich als Vierzehnjähriger zu den Kadetten ging und nach meiner Zeit als Jungoffizier Kapitän der Stadtgarde wurde. Es war ein Privileg, ohne das ich ebenso gut ausgekommen wäre. Man konnte die Ratsherren vielleicht zwingen, mich zu akzeptieren. Doch ihre jüngeren Söhne, die vom niederen Adel und so weiter, die bei den Kadetten dienten, dazu bringen – das war eine andere Sache!
Ein Bastard zu sein ist natürlich kein großer Makel. Viele der Comyn-Lords haben davon ein halbes Dutzend. Wenn einer von ihnen zufällig Laran hat – worauf jede Frau hofft, die ein Kind eines Comyn-Lords trägt –, dann ist nichts leichter, als das Kind anzuerkennen und ihm irgendwo in den Domänen Rechte und Privilegien zu beschaffen. Doch einen von ihnen zum Erben einer Domäne zu machen, das hatte es noch nie gegeben, und jeder illegitime Sohn aus irgendwelchen Nebenlinien ließ mich fühlen, wie wenig ich diese Auszeichnung verdiente.
Ich konnte nicht umhin zu erkennen, warum sie so fühlten. Ich hatte das, was sie alle wollten, und jeder fühlte sich dazu ebenso berechtigt. Es muss angenehm sein, nie zu erfahren, warum man nicht gemocht wird. Vielleicht kann man dann glauben, dass man es nicht verdient.
Doch ich sorgte dafür, dass sich niemand über mich beklagen konnte. Ich habe von allem ein bisschen getan, wie es von Comyn-Erben bei den Kadetten erwartet wird: Ich habe die Straßenpatrouillen überwacht und alles organisiert, von der Futterversorgung bis zu den Packpferden als Eskorte für Comyn-Ladys; ich habe dem Waffenmeister geholfen und mich vergewissert, dass der Mann, der die Kaserne putzte, seine Sache richtig tat. Ich mochte den Dienst bei den Kadetten nicht und hatte auch keinen Spaß, bei der Wache ein Kommando zu führen. Doch was wollte ich tun? Es war wie ein Berg, den ich weder überqueren noch umrunden konnte. Vater brauchte mich und wollte mich, und ich konnte ihn nicht allein lassen.
Als ich neben Regis Hastur ritt, fragte ich mich, ob es ein Zeichen von Freundschaft war, dass er zu mir gekommen war, oder ein listiger Versuch, sich mit meinem Vater gut zu stellen. Vor drei Jahren hätte ich mit Sicherheit »Freundschaft« geantwortet. Doch in drei Jahren ändern sich Jungen, und Regis hatte sich stärker als die anderen verändert.
Er hatte ein paar Winter auf Armida verbracht, bevor er in das Kloster ging und ich zum Arilinn. Ich habe bei ihm nie daran gedacht, dass er der Erbe der Hasturs ist. Man sagte, seine Gesundheit sei nicht die stabilste, und der alte Hastur hatte gemeint, das Landleben und Gesellschaft würden ihm gut tun. Meistens war es mir überlassen, auf ihn Acht zu geben. Ich habe ihn mit zum Reiten und auf die Falkenjagd genommen, und er ist mit mir hinauf auf die weiten Hochplateaus geritten, als man die großen Herden von Wildpferden einfing und zum Einreiten hinabbrachte. Ich erinnere mich an ihn als an einen etwas klein geratenen Jungen, der mir überallhin folgte, meine abgetragenen Reithosen und Hemden trug, weil seine eigenen ihm zu klein geworden waren. Er spielte mit den jungen Hunden und neugeborenen Fohlen, beugte sich ernsthaft und unbeholfen über die Näherei von Falkenhauben, als man ihm diese Arbeit beibrachte. Er lernte von Vater, mit dem Schwert umzugehen, und er übte mit mir. Während jenes schrecklichen Frühlings, als er zwölf Jahre alt war, als die Kilghardberge in Feuer aufgingen und jeder kräftige Mann zwischen zehn und achtzig zur Feuerbekämpfung abkommandiert wurde, haben wir am Tag Seite an Seite gearbeitet, haben aus einer Schüssel gegessen und in der Nacht die Wolldecke geteilt. Wir hatten Angst, auch Armida würde in Flammen aufgehen. Einige der Gebäude am Rand hatten sich entzündet. Wir standen uns näher als Brüder. Als er nach Nevarsin ging, habe ich ihn schrecklich vermisst. Es war schwierig, meine Erinnerungen an diesen Fast-Bruder mit jenem selbstbewussten, ernsten jungen Prinzen in Einklang zu bringen. Vielleicht hatte er in der Zwischenzeit gelernt, dass die Freundschaft mit Kennards Nedestro doch nicht das Richtige für einen Hastur-Erben war.
Ich hätte es herausfinden können, sicher, und er hätte es nie erfahren. Aber für einen Telepathen ist dies keine Versuchung mehr nach den ersten Monaten. Man lernt, nicht in anderen Köpfen herumzuschnüffeln.
Aber er gab sich nicht unfreundlich und fragte mich sogleich, warum ich ihn nicht mit seinem Namen angeredet habe. Da mich diese offene Frage völlig überraschte, gab ich ihm eine freie Antwort anstatt einer diplomatischen, und alles war wieder beim Alten.
Als wir die Tore passiert hatten, war es nicht mehr weit bis zum Schloss, doch es reichte, um völlig durchnässt zu werden. Ich wusste, dass es Vater in der feuchten Kälte schlecht ging – er ist lahm, seit ich denken kann, doch in den letzten paar Wintern ist es schlimmer geworden – und dass auch Marius sich nass und unangenehm fühlte. Als wir in den Vorhof des Schlosses gelangten, war es schon dunkel, und wenn Nachtregen in dieser Jahreszeit auch selten in Schnee übergeht, so waren doch scharfe Hagelkörner darunter. Ich glitt vom Pferd und ging schnell zu Vater, um ihm beim Absitzen behilflich zu sein, doch Lord Dyan hatte ihm schon herabgeholfen und ihm seinen Arm angeboten.
Ich zog mich zurück. Seit den ersten Jahren bei den Kadetten habe ich mir zur Gewohnheit gemacht, Lord Dyan nicht näher zu treten als unbedingt notwendig. Am liebsten ging ich ihm ganz aus dem Weg.
Bei der Wache gibt es für Kadetten des ersten Jahres einen Brauch. Wir werden im waffenlosen Kampf ausgebildet und sollen die Gewohnheit entwickeln, allzeit vorsichtig und aufmerksam zu sein; daher ist es im ersten Jahr in Wachraum und Rüstkammer jedem der Höherstehenden erlaubt, uns zu überraschen, wenn er kann, und uns anzugreifen. Es ist ein gutes Training. Nach ein paar Wochen, in denen man ständig unerwartet von hinten angegriffen wird, entwickelt man so etwas wie Augen im Hinterkopf. Normalerweise läuft es gutmütig ab, und wenn es auch ein raues Spiel ist und man eine Menge Prellungen zurückbehält, so hat doch niemand etwas dagegen.
Doch Dyan, darin waren wir uns alle einig, hatte zu viel Spaß daran. Er war ein ausgezeichneter Ringer und hätte gewinnen können, ohne jemandem Schaden zuzufügen, doch er war unglaublich grob und versäumte niemals eine Gelegenheit, jemanden zu verletzen. Mich besonders. Einmal gelang es ihm, mir den Ellenbogen auszurenken, den ich dann für den Rest des Jahres in einer Schlinge tragen musste. Er sagte, es sei ein Unfall gewesen, doch ich bin Telepath, und er scherte sich nicht einmal darum zu verbergen, wie sehr er es genossen hatte. Ich war nicht der einzige Kadett mit einer solchen Erfahrung. Es gibt Zeiten bei der Ausbildung, da beginnt man alle Offiziere zu hassen. Doch Dyan war der Einzige, vor dem wir richtige Angst gehabt haben.
Ich überließ ihm Vater und ging zurück zu Regis. »Jemand sucht dich«, sagte ich ihm und zeigte auf einen Mann in Hastur-Livree, der im Toreingang Schutz gesucht hatte und nass und elend aussah, als habe er einige Zeit wartend im Regen gestanden. Regis ging rasch auf ihn zu, um die Nachricht entgegenzunehmen.
»Die Ehrerbietung des Regenten, Lord Regis. Er wurde dringend in die Stadt berufen. Er bittet Euch, es Euch bequem zu machen und ihn am Morgen aufzusuchen.«
Regis antwortete förmlich und wandte sich mir mit einem steifen Lächeln zu. »Das war die herzliche Begrüßung meines Großvaters.«
Ein verdammtes Willkommen, dachte ich bei mir. Niemand konnte vom Regenten der Comyn erwarten, dass er im Regen auf jemanden wartete, doch er hätte etwas mehr als nur eine Botschaft durch einen Diener schicken können! Schnell sagte ich: »Du kommst natürlich zu uns. Schicke dem Diener deines Großvaters eine Botschaft, und dann kommst du mit uns, ziehst dir etwas Trockenes an und isst mit uns zu Abend.«
Regis nickte wortlos. Seine Lippen waren blau vor Kälte, und das Haar hing ihm strähnig und nass in die Stirn. Er erteilte entsprechende Anweisungen, und ich machte mich an meine Aufgabe: Ich sorgte dafür, dass alle von Vaters Tross – Diener, Leibwächter, Wachleute, Bannerträger und arme Verwandte – ihren Weg zu den ihnen angewiesenen Orten fanden.
Allmählich war alles geregelt. Die Wachleute zogen in ihre Quartiere. Die Diener wussten größtenteils, was zu tun sei. Jemand hatte schon vorher veranlasst, dass Feuer angezündet und die Räume für unsere Ankunft vorbereitet wurden. Die anderen suchten sich ihren Weg durch das Labyrinth von Hallen und Gängen zu den vorbereiteten Quartieren, die seit Generationen den Alton-Lords zustanden. Innerhalb kurzer Zeit standen in der großen Eingangshalle nur noch Vater, Marius und ich, Regis, Lord Dyan, unsere persönlichen Bediensteten und ein halbes Dutzend andere. Regis stand vor dem Feuer und wärmte sich die Hände. Ich erinnerte mich an den Abend, als Vater uns die Neuigkeit mitteilte, dass Regis uns verlassen und die nächsten drei Jahre auf Nevarsin verbringen würde. Er und ich hatten in der großen Halle auf Armida vor dem Feuer gesessen, hatten Nüsse geknackt und die Schalen ins Feuer geworfen. Nachdem Vater geendet hatte, war Regis zum Feuer gegangen und dort so stehen geblieben wie gerade jetzt: gequält und zitternd, mit abgewandtem Gesicht!
Der verdammte alte Mann! Gab es keinen Freund, keine Verwandte, die er hätte schicken können, Regis daheim zu begrüßen?
Vater ging zum Feuer. Er humpelte stark. Er sah Marius’ Reitgefährten an und sagte: »Danilo, ich habe deine Sachen direkt an die Quartiere der Kadetten schicken lassen. Soll ich jemanden rufen, der dir den Weg zeigt, oder findest du es allein?«
»Ihr braucht niemanden zu schicken, Lord Alton.« Danilo Syrtis kam vom Feuer und verbeugte sich höflich. Er war ein schlanker Junge von vierzehn Jahren mit leuchtenden Augen. Er trug schäbige Kleider, die, wie ich mich vage erinnerte, mir oder meinem Bruder gehört hatten, bevor wir aus ihnen herauswuchsen. Das sah Vater ähnlich; er sorgte dafür, dass jeder seiner Protegés mit der ordentlichen Ausrüstung eines Kadetten begann. Vater legte ihm die Hand auf die Schulter. »Bist du sicher? Nun, dann lauf, mein Junge. Möge das Glück mit dir sein.«
Danilo murmelte höflich ein paar Förmlichkeiten und zog sich zurück. Dyan Ardais, der sich die Hände am Feuer wärmte, sah ihm mit hochgezogenen Augenbrauen nach. »Sieht gut aus, der Junge. Noch einer von deinen Nedestro-Söhnen, Kennard?«
»Dani? Zandrus Hölle, nein! Ich wäre schon stolz, ihn anzuerkennen, aber er ist bestimmt nicht von mir. Die Familie hat Comyn-Blut seit ein paar Generationen, ist aber arm wie die Kirchenmäuse. Der Alte, Dom Felix, konnte ihm nicht viel fürs Leben mitgeben, so habe ich ihm eine Kadettenstelle besorgt.«
Regis wandte sich vom Feuer ab und sagte: »Danilo! Ich weiß, ich hätte ihn erkennen müssen. Er war ein Jahr lang im Kloster. Ich konnte mich wirklich an seinen Namen nicht erinnern, Onkel. Ich hätte ihn begrüßen sollen!«
Das Wort, das er für Onkel benutzte, war der Casta-Ausdruck, der etwas vertrauter als Oheim war. Ich wusste, dass er meinen Vater angeredet hatte, doch Dyan tat so, als fühle er sich angesprochen. »Ihr werdet ihn sicher bei den Kadetten treffen. Und ich habe Euch auch noch nicht anständig begrüßt.« Er ging auf Regis zu, umarmte ihn wie unter Verwandten üblich und drückte seine Wange an die von Regis, was dieser sich ein wenig überrascht gefallen ließ. Dann hielt er ihn mit ausgestreckten Armen vor sich und betrachtete ihn eingehend. »Hasst dich deine Schwester, Regis, weil du die Schönheit der Familie bist?«
Regis blickte erstaunt und leicht verlegen drein. Er antwortete mit einem nervösen Lachen. »Nicht dass ich wüsste. Ich glaube, Javanne denkt, ich solle noch in Kinderkleidern herumlaufen.«
»Was beweist, was ich immer schon gesagt habe, dass Frauen Schönheit nicht beurteilen können.« Mein Vater schenkte Dyan ein missmutiges Stirnrunzeln und sagte: »Verdammt, Dyan, nimm ihn nicht auf den Arm.«
Dyan wollte noch mehr sagen – verdammt sei dieser Mann, fing er doch wieder an nach all den Problemen im vergangenen Jahr –, doch ein Diener in Hastur-Livree kam eilig herein und sagte: »Lord Alton, eine Botschaft vom Regenten.«
Vater riss den Brief auf und begann kräftig in drei Sprachen zu fluchen. Er befahl dem Boten zu warten, während er sich etwas Trockenes anziehen würde, verschwand in seinem Zimmer, und dann hörte man ihn nach Andres rufen. Bald kam er wieder heraus, stopfte ein trockenes Hemd in trockene Hosen und sah wütend aus.
»Vater, was ist los?«
»Das Übliche«, sagte er grimmig. »Aufruhr in der Stadt. Hastur hat jeden erreichbaren Älteren des Rates zusammengerufen und zwei Extrapatrouillen ausgeschickt. Offensichtlich eine Krise.«
Verdammt, dachte ich. Ihn nach diesem langen Ritt von Armida in der Nässe mitten in der Nacht hinauszurufen … »Wirst du mich brauchen, Vater?«
Er schüttelte den Kopf. »Nein. Nicht nötig, Sohn. Warte auch nicht auf mich. Ich werde vermutlich die ganze Nacht fortbleiben.« Als er hinausging, sagte Dyan: »Ich denke, ein ähnlicher Ruf wartet in meinem Zimmer auf mich. Ich gehe besser hinauf und sehe nach. Gute Nacht, Jungen. Ich beneide euch um euren Schlaf.« Mit einem Nicken zu Regis fügte er hinzu: »Diese anderen hier werden ein anständiges Bett nicht so sehr zu schätzen wissen. Nur wir, die wir auf Stein geschlafen haben, wissen das.« Es gelang ihm, vor Regis eine tiefe formelle Verbeugung zu machen und mich gleichzeitig vollständig zu ignorieren – was nicht leicht war, da wir nebeneinander standen –, und er ging fort.
Ich blickte mich um, um zu sehen, was noch erledigt werden müsse. Ich schickte Marius, sich umzuziehen – zu alt für eine Kinderfrau und zu jung für einen Adjutanten, war er mir fast die ganze Zeit überlassen. Dann sorgte ich dafür, dass für Regis ein Zimmer vorbereitet wurde. »Hast du einen Mann, der dir beim Umkleiden hilft, Regis? Oder soll Vaters persönlicher Diener dir heute Abend behilflich sein?«
»Ich habe in Nevarsin gelernt, allein fertig zu werden«, sagte Regis. Er sah jetzt besser aus, nicht mehr so angespannt. »Wenn der Regent nach dem ganzen Rat schickt, dann wird es wohl ernst sein und nicht so, dass mich Großvater wieder einmal vergessen hat. Daher geht es mir besser.«
Nun konnte ich endlich meine nassen Sachen loswerden. »Wenn du dich umgezogen hast, Regis, werden wir hier vor dem Feuer zu Abend essen. Ich habe bis morgen früh keinen offiziellen Dienst.«
Ich ging fort und zog mir rasch Haussachen an, glitt in pelzverbrämte Knöchelstiefel und sah kurz nach Marius. Ich fand ihn im Bett, eine heiße Suppe löffelnd und schon halb im Schlaf. Es war ein langer Ritt für Jungen seines Alters. Ich fragte mich wieder, warum Vater ihn dem unterworfen hatte.
Die Diener hatten vor dem Feuer bei den alten Steinbänken ein warmes Abendessen aufgetragen. Die Lichter in unserem Teil des Schlosses sind alt: leuchtende Felsen aus tiefen Höhlen, die sich tagsüber mit Licht aufladen und es nachts als sanftes Glühen abgeben. Es reicht nicht für Handarbeiten oder Lesen, doch wohl für ein ruhiges Essen und ein ausgiebiges Gespräch am Feuer. Regis kam in trockenen Kleidern und Hausstiefeln zurück, und ich bedeutete dem alten Diener zu gehen. »Mach dich an dein eigenes Abendessen. Lord Regis und ich können uns selber bedienen.«
Ich nahm die Hauben von den Schüsseln. Sie hatten ein gebratenes Wildhuhn und Gemüse geschickt. Ich füllte ihm auf und sagte: »Nicht sehr festlich, doch wahrscheinlich das Beste, was sie in so kurzer Zeit zu Stande bringen konnten.«
»Es ist besser als das, was wir beim Feuerlöschen bekommen haben«, sagte Regis, und ich grinste. »Dann hast du das auch nicht vergessen.«
»Wie könnte ich das vergessen? Armida war mir wie ein Zuhause. Reitet Kennard immer noch seine Pferde selber zu, Lew?«
»Nein, dazu ist er zu steif«, sagte ich und fragte mich wieder, wie Vater im nächsten Jahr wohl zurechtkommen würde. Selbstsüchtig hoffte ich, er würde den Oberbefehl weiter behalten. Er ist für die Altons erblich, und ich war der Nächste in der Reihe. Sie hatten gelernt, mich als seinen Stellvertreter mit einem Kapitänsrang zu dulden. Als Kommandeur würde ich alle Schlachten noch einmal kämpfen müssen.
Wir redeten eine Weile über Armida, über Pferde und Falken, während Regis sein Gemüse aß. Er nahm einen Apfel und ging zum Feuer, wo ein paar antike Schwerter, wie man sie heute nur noch beim Schwerttanz benutzt, über dem Sims hingen. Er berührte den Griff des einen, und ich fragte: »Hast du im Kloster deine Fechterei ganz vergessen?«
»Nein, es gab ein paar, die nicht Mönche werden wollten, so ließ uns der Vater jeden Tag eine Stunde üben, und ein Waffenmeister erteilte uns den Unterricht.«
Über dem Wein diskutierten wir den Zustand der Straßen von Nevarsin.
»Du bist doch sicher nicht in einem Tag vom Kloster hergeritten?«
»O nein. Ich habe die Reise in Edelweiß unterbrochen.«
Das war auf Alton-Gebiet. Als Javanne Hastur vor nunmehr zehn Jahren Gabriel Lanart heiratete, hatte mein Vater ihnen dieses Anwesen verpachtet. »Deiner Schwester geht es gut, hoffe ich?«
»Ziemlich gut, aber ziemlich schwanger zurzeit«, sagte Regis, »und Javanne hat etwas Lächerliches gemacht. Es war richtig, ihren ersten Sohn Rafael zu nennen, nach ihrem Vater und meinem. Und den zweiten natürlich Gabriel, den Jüngeren. Aber als sie den dritten Michael nannte, wurde das Ganze absurd. Ich glaube, dieses Mal bittet sie inständig um eine Tochter.«
Ich lachte. Nach allem, was man so hörte, sollte man die »Lanart-Engel« eher nach den Erzfeinden, nicht nach den Erzengeln nennen, und warum sollte eine Hastur Namen aus der Cristoforo-Mythologie wählen? »Nun, sie und Gabriel haben genug Söhne.«
»Sicher. Ich glaube, mein Großvater ist verärgert, dass sie so viele Söhne hat und er ihnen nicht das Domänenrecht der Hasturs erteilen kann. Ich hätte es Kennard noch sagen sollen. Ihr Mann wird in ein paar Tagen hier sein, um seinen Platz in der Wache anzutreten. Er wäre mit mir geritten, doch Javannes Zeit steht kurz bevor. Er darf bei ihr bleiben bis zur Geburt.«
Ich nickte. Natürlich würde er bleiben. Gabriel Lanart war niederen Adels aus der Alton-Domäne, ein Verwandter und ein Telepath. Natürlich würde er dem Brauch der Domäne folgen, mit der Kindsmutter den Ritus der Geburt feiern und mit ihr in Kontakt bleiben, bis das Kind geboren und alles in Ordnung war. Nun, ein paar Tage konnten wir ihn schon entbehren. Ein guter Mann, Gabriel.
»Dyan schien davon auszugehen, dass du dieses Jahr bei den Kadetten sein wirst«, sagte ich.
»Ich weiß nicht, ob ich es mir aussuchen kann. Hast du es gekonnt?«
»Natürlich nicht.« Doch dass von allen anderen der Erbe von Hastur dies in Frage stellte – das verschaffte mir Unbehagen.
Regis saß auf der Steinbank und scharrte unruhig mit den Filzstiefeln über den Boden. »Lew, du bist sowohl Terraner als auch Comyn. Fühlst du dich zu uns gehörig? Oder zu den Terranern?«
Eine verwirrende Frage, eine ungeheure Frage und dazu eine, die ich mir selber zu stellen nie gewagt hatte. Ich verspürte Wut, weil er mich das gefragt hatte, als wolle er mich für das, was ich war, verspotten. Ich war ein Fremder unter den Terranern, ein Freak, ein Mutant, ein Telepath. Schließlich sagte ich bitter: »Ich habe niemals irgendwohin gehört, außer vielleicht nach Arilinn.«
Regis blickte mich an, und mich erstaunte die plötzliche Wut in seinem Gesicht. »Lew, wie ist es, Laran zu haben?«
Ich starrte ihn beunruhigt an. Diese Frage rührte eine andere Erinnerung an. In jenem Sommer in Armida, in seinem zwölften Jahr. Wegen seines Alters und weil es sonst niemanden gab, war es mir zugefallen, ihm Fragen zu beantworten, die man sonst Vätern oder älteren Brüdern überlässt, Fragen, die Jungen in diesem Alter so stellen. Er hatte diese Fragen mit der gleichen verlegenen Dringlichkeit herausgesprudelt, und ich fand es damals ebenso schwierig, sie zu beantworten. Es gibt Dinge, die man kaum mit jemand anderem diskutieren kann, der nicht die gleiche Erfahrung hat. Schließlich sagte ich langsam: »Ich weiß kaum, was ich antworten soll. Ich habe es schon so lange, dass es mir schwerer fiele, mir vorzustellen, wie es ohne Laran sein würde.«
»Bist du damit geboren?«
»Nein, natürlich nicht. Doch als ich zehn war oder elf, begann ich zu merken, was die Leute dachten. Oder fühlten. Später fand mein Vater es heraus und bewies, dass ich die Gabe der Altons geerbt hatte, und das ist selbst – ich presste die Zähne zusammen – bei legitimen Söhnen selten. Danach konnten sie mir die Comyn-Rechte nicht mehr verweigern.«
»Kommt es immer so früh? Mit zehn oder elf?«
»Hat man dich denn nie geprüft? Ich war aber fast sicher …« Ich fühlte mich leicht verwirrt. Mindestens einmal während der gemeinsamen Angst in jenem letzten Jahr bei der Feuerbekämpfung war ich zu seinen Gedanken vorgedrungen, hatte gespürt, dass er die Gabe unserer Kaste besaß. Doch er war noch sehr jung gewesen. Und die Alton-Gabe ist erzwingbarer Kontakt, auch bei Nichttelepathen.
»Einmal«, sagte Regis, »vor drei Jahren. Die Leronis sagte, so weit sie es beurteilen könne, hätte ich diese Gabe, doch sie konnte mich nicht erreichen.«
Ich fragte mich, ob der Regent ihn deshalb nach Nevarsin geschickt hatte, in der Hoffnung, dass Disziplin, Stille und Isolierung das Laran entwickeln würden, was manchmal geschah, oder ob er die Enttäuschung über den Erben verbergen wollte.
»Du bist zugelassener Matrix-Mechaniker, Lew, nicht wahr? Was ist das genau?«
Dies konnte ich beantworten. »Du weißt, was eine Matrix ist: Ein Edelstein, der Gehirnströmungen verstärkt und Psi-Kräfte in Energie umwandelt. Wenn größere Kräfte erforderlich sind, brauchen wir eine Gruppe von normalerweise in einem Turmzirkel miteinander verbundenen Gehirnen.«
»Ich weiß, was eine Matrix ist«, sagte Regis. »Sie haben mir bei dem Test eine gegeben.« Er zeigte sie mir. Sie hing ihm, wie bei den meisten von uns, in einem kleinen Seidenbeutel um den Hals. »Ich habe sie nie benutzt oder auch nur angesehen. In den alten Zeiten schafften sie diese Gehirnverbindungen durch Bewahrerinnen. Es gibt heute keine Bewahrerinnen mehr, oder?«
»Nicht im alten Sinn«, sagte ich, »wenn man auch die Frau, die in der Mitte des Matrix-Zirkels arbeitet, immer noch Bewahrerin nennt. Zu Zeiten meines Vaters entdeckte man, dass diese Bewahrerinnen, außer auf der obersten Ebene, auch ohne die alten Tabus und das schreckliche Training, die Opfer, die Isolation und die besonderen Einsperrungen zu ihrer Arbeit fähig waren. Seine Pflegeschwester Cleindori hat als Erste mit der Tradition gebrochen, und nun werden die Bewahrerinnen nicht mehr nach dem alten Brauch ausgebildet. Es ist zu schwierig und zu gefährlich, und es ist nicht recht, zu verlangen, sein ganzes Leben dafür aufzugeben. Nun verbringt jeder drei Jahre oder weniger auf dem Arilinn und dann die gleiche Zeit draußen, so dass man ein normales Leben zu führen lernen kann.«
Ich schwieg und dachte an meinen Zirkel in Arilinn, der nun wieder auf die einzelnen Häuser und Anwesen verstreut war. Ich war dort glücklich gewesen, nützlich, akzeptiert. Fähig. Eines Tages würde ich zu dieser Arbeit zurückkehren, zu den Schaltungen.
»Wie es ist«, fuhr ich fort, »es ist … geheimnisvoll. Du bist für die anderen Mitglieder des Zirkels völlig offen. Deine Gedanken, deine Gefühle betreffen auch sie, und du bist den ihren vollständig ausgesetzt. Es ist stärker als die Blutsnähe von Verwandten. Es ist auch nicht richtige Liebe. Kein sexuelles Bedürfnis. Es ist, wie wenn man ohne Haut lebt. Man ist doppelt so empfindlich. Es ist anders als alles andere.«
Regis’ Augen blickten fasziniert. Rau sagte ich: »Romantisiere es aber nicht. Es kann wundervoll sein, jawohl. Aber es kann auch zur reinen Hölle werden. Oder beides auf einmal. Man lernt, die Distanz zu halten, einfach um zu überleben.«
Durch den Nebel seiner Gefühle spürte ich nur das Fragment eines Gedankens. Ich versuchte, meine Wahrnehmung von ihm so gering wie möglich zu halten. Er war einfach zu verletzlich. Er fühlte sich verlassen, zurückgewiesen und allein. Ich konnte nicht umhin, dies aufzunehmen. Doch ein Junge seines Alters würde es für Schnüffelei halten.
»Lew, die Gabe der Altons ist die Fähigkeit, eine Verbindung zu erzwingen. Wenn ich nun Laran habe, kannst du es herbeirufen, es zum Funktionieren bringen?«
Ich sah ihn wütend an. »Dummkopf. Weißt du nicht, dass ich dich so umbringen könnte?«
»Ohne Laran zählt mein Leben nur wenig.« Er war so angespannt wie ein Bogen. Ich konnte versuchen, was ich wollte, aber ich konnte mich diesem schrecklichen Hunger in ihm nicht verschließen, dass er Teil der einzigen Welt sein wollte, die er kannte, und nicht auf so verzweifelte Weise von seinem Erbe abgeschnitten.
Dies war auch mein dringliches Verlangen. Ich hatte es, wie mir schien, zeit meines Lebens gefühlt. Doch neun Monate vor meiner Geburt hatte mein Vater es für mich unmöglich gemacht, dass ich gänzlich zu seiner Welt und mir selber gehörte.
Mit dieser quälenden Erkenntnis hasste ich meinen Vater, wenn ich ihn auch gleichzeitig zutiefst liebte. Hasste ihn, weil er mich zum Bastard gemacht hatte, gemischtrassig, fremd, nirgendwo zugehörig. Ich ballte die Fäuste und wandte den Blick von Regis ab. Er hatte, was ich niemals haben würde. Er gehörte voll zu den Comyn, durch Blut und Gesetz, legitimiert …
Und dennoch litt er ebenso wie ich. Würde ich Laran aufgeben, um legitim, akzeptiert, zugehörig zu werden?
»Lew, versuche es doch wenigstens!«
»Regis, wenn ich dich umbringe, werde ich des Mordes schuldig sein.« Sein Gesicht wurde weiß. »Angst? Gut. Es ist eine wahnsinnige Idee. Gib es auf, Regis. Nur ein Katalysatortelepath kann es sicher bewerkstelligen, und das bin ich nicht. Soweit ich weiß, gibt es heutzutage keine Katalysatortelepathen mehr. Lass es doch sein.«
Regis schüttelte den Kopf. Er zwang die Worte über die trockenen Lippen. »Lew, als ich zwölf Jahre alt war, hast du mich Bredu genannt. Es gibt niemand anderen, den ich darum bitten könnte. Es ist mir gleich, ob es mich tötet. Ich habe gehört …« – er schluckte schwer – »… dass Bredin einander verpflichtet sind. War es nur ein Wort, Lew?«
»Es war kein bloßes Wort, Bredu«, murmelte ich, und sein Schmerz quälte mich. »Aber da waren wir Kinder. Und das hier ist kein Kinderspiel, Regis, es geht um dein Leben.«
»Glaubst du etwa, das wüsste ich nicht?« Er stammelte. »Es ist mein Leben. Immerhin kann es einen Unterschied bringen zu dem Leben, das ich nun führe.« Seine Stimme brach. »Bredu …« sagte er wieder und schwieg dann, und ich wusste, dass er nicht weiterreden konnte, ohne zu weinen.
Dieser Appell machte mich hilflos. Ich konnte tun, was ich wollte, jenes hilflose, erstickte »Bredu …« hatte meinen letzten Widerstand gebrochen. Ich wusste, dass ich tun würde, was er wollte. »Ich kann nicht das tun, was mit mir getan wurde«, sagte ich ihm. »Das ist ein spezieller Test für die Alton-Gabe – die erzwingbare Verbindung –, und nur ein richtiger Alton kann ihn überstehen. Mein Vater hat es einmal versucht, in vollem Wissen, dass es mich töten könnte, und auch nur dreißig Sekunden lang. Wenn ich die Gabe nicht voll geerbt hätte, wäre ich gestorben. Die Tatsache, dass ich nicht starb, war der einzige Beweis für den Rat, mich nicht länger zurückweisen zu können.« Meine Stimme zitterte. Selbst noch nach zehn Jahren dachte ich nicht gerne daran. »Dein Blut, deine Legitimation wird nicht in Frage gestellt. Du brauchst dieses Risiko nicht auf dich zu nehmen.«
»Du hast es aber doch auch gewollt.«
Das stimmte. Die Zeit glitt vorbei, und wieder stand ich vor meinem Vater. Er berührte meine Schläfen. Wieder die Erinnerung an das Entsetzen, an den zerreißenden Schmerz. Ich hatte zugestimmt, weil ich den Zorn meines Vaters teilte, das schreckliche Bedürfnis in ihm zu wissen, ob ich sein wahrer Sohn sei, zu wissen, dass, wenn er den Rat nicht zwingen konnte, mich als seinen Sohn zu akzeptieren, das Leben allein nichts mehr wert sein würde. Ich wäre lieber gestorben zu jenem Zeitpunkt, als mit dem Gefühl des Scheiterns weiterzuleben.
Die Erinnerung verschwand. Ich blickte in Regis’ Augen.
»Ich werde tun, was ich kann. Ich kann dich testen, wie man mich in Arilinn testete. Aber erwarte nicht zu viel. Ich bin keine Leronis, nur ein Techniker.«
Er fingerte an dem Band herum, das seinen Hals umschloss, rollte den Stein auf die Handfläche und reichte ihn mir. Das sagte mir alles, was ich brauchte. Das Licht des kleinen Edelsteins war matt, inaktiv. Wenn er es drei Jahre lang getragen hatte und sein Laran aktiv war, dann hätte er ihn zumindest unbewusst verschlüsselt haben müssen. Der erste Test hatte also versagt.
Zuletzt legte ich mit sorgfältigster Vorsicht eine Fingerspitze auf den Stein. Regis zuckte nicht zusammen. Ich bedeutete ihm, den Stein fortzustecken und löste das Band an meinem Hals. Ich legte meine Matrix, immer noch von der schützenden Seide umhüllt, auf meine Hand und enthüllte sie dann vorsichtig.
»Sieh hinein. Nein, nicht berühren«, warnte ich ihn mit angehaltenem Atem. »Berühre niemals eine verschlüsselte Matrix. Du könntest mir einen Schock versetzen. Sieh sie dir einfach an.«
Regis beugte sich vor und konzentrierte sich mit regloser Intensität auf die winzigen Lichtwellen im Inneren des Steins. Schließlich blickte er weg. Noch ein schlechtes Zeichen. Selbst ein latenter Telepath sollte genügend Energonraster in seinem Gehirn spüren, um zumindest eine Reaktion zu zeigen, Übelkeit, Ekel, grundlose Euphorie. Ich fragte ihn vorsichtig, ohne etwas zu verraten: »Wie fühlst du dich?«
»Ich bin nicht sicher«, sagte er unbehaglich. »Meine Augen taten weh.«
Dann hatte er zumindest latent Laran. Es zu aktivieren, dachte ich, würde ein schmerzhafter und schwieriger Prozess werden. Vielleicht hätte ein Katalysatortelepath es schaffen können. Man hatte sie für diese Aufgabe vorbereitet in jenen Tagen, als die Comyn mit höheren Matrix-Steinen komplexe, Leben zerstörende Arbeit leisteten. Ich habe niemals einen Katalysator kennen gelernt. Vielleicht waren diese Gene ausgestorben.
Doch immerhin konnte man bei ihm als einem Latenten weitere Tests machen. Ich wusste, dass er das Potenzial hatte. Ich hatte es erkannt, als er zwölf Jahre alt war.
»Hat die Leronis dich mit Kirian getestet?«
»Sie gab mir ein bisschen, nur wenige Tropfen.«
»Was ist passiert?«
»Mir wurde schlecht«, sagte Regis. »Schwindlig. Blitzende Farben vor den Augen. Sie meinte, ich sei möglicherweise zu jung für eine solche Reaktion und dass sich Laran bei einigen Menschen später entwickelte.«
Ich dachte nach. Kirian benutzte man, um den Widerstand gegen telepathischen Kontakt herabzusetzen. Man nimmt es, wenn man Emphaten und andere Psi-Techniker behandelt, die selber kaum telepathische Gaben haben, aber direkt mit anderen Telepathen zusammenarbeiten müssen. Es kann manchmal Angst oder bewussten Widerstand gegenüber telepathischen Kontakten herabsetzen. Man kann es auch mit großer Vorsicht bei Schwellenkrankheit anwenden, diesem merkwürdigen psychischen Ausbruch, der junge Telepathen in der Adoleszenz befällt.
Regis wirkte jung für sein Alter. Vielleicht entwickelte er die Fähigkeit einfach später. Doch nur selten kam es so spät, verdammt. Ich war sicher gewesen. Hatte irgendein Ereignis in Nevarsin, irgendein emotionaler Schock die Wahrnehmung versperrt?
»Ich könnte es noch einmal versuchen«, sagte ich vorsichtig. Kirian könnte vielleicht seine latente Telepathie hervorrufen. Vielleicht konnte ich auch unter diesem Einfluss zu seinen Gedanken vorstoßen, ohne ihm allzu sehr wehzutun und herausfinden, was nun wirklich seine Wahrnehmung blockierte. Manchmal klappte es.
Ich mochte den Einsatz von Kirian nicht. Doch eine kleine Dosis konnte ihm kaum mehr schaden, als dass ihm übel wurde oder er einen gehörigen Kater bekam. Und ich hatte das unbestimmte, nicht sonderlich angenehme Gefühl, wenn ich ihm jetzt die Hoffnung raubte, würde er etwas Verzweifeltes unternehmen. Ich mochte nicht, wie er mich ansah, gespannt wie ein Bogen. Er zitterte, kaum merklich, doch von Kopf bis Fuß. Seine Stimme klang ein wenig brüchig, als er sagte: »Ich werde es versuchen.« Nur zu deutlich hörte ich daraus: Ich werde alles versuchen.
Ich ging in mein Zimmer, um es zu holen und machte mir bereits Vorwürfe, mich auf ein solch wahnsinniges Experiment eingelassen zu haben. Es bedeutete einfach zu viel für ihn. Ich erwog die Möglichkeit, ihm eine beruhigende Dosis zu geben, eine, die ihn sicher bis zum Morgen betäuben oder schläfrig machen würde. Doch die Wirkung von Kirian kann man nicht so genau voraussagen. Die Dosis, die die eine Person zum Schlafen bringt wie ein Murmeltier, verwandelt die andere in einen rasenden Berserker mit Tobsuchtsanfällen und Halluzinationen. Immerhin, ich hatte es versprochen. Ich würde ihn nun nicht enttäuschen. Doch würde ich sichergehen und ihm nur die Minimaldosis geben, wie wir es mit fremden Technikern auf Arilinn gemacht hatten. Kirian in so kleiner Menge konnte ihm nicht schaden.
Ich maß ihm ein paar Tropfen in ein Weinglas ab. Er schluckte es, zog eine Grimasse und setzte sich dann auf eine der Steinbänke. Nach einer Minute bedeckte er die Augen. Ich beobachtete ihn aufmerksam. Eines der ersten Anzeichen war die Öffnung der Pupillen. Nach ein paar Minuten begann er zu zittern. Er lehnte sich gegen die Steinbank, als fürchte er umzufallen. Seine Hände waren kalt. Ich nahm seine Handgelenke leicht zwischen die Finger. Normalerweise hasse ich es, Menschen zu berühren. Das ist immer so bei Telepathen, außer bei großer Intimität. Bei der Berührung öffnete er die Augen und flüsterte: »Warum bist du wütend, Lew?«
Wütend? Interpretierte er meine Angst um ihn als Wut? Ich sagte: »Nicht wütend, nur besorgt um dich. Mit Kirian spielt man nicht. Ich versuche nun, dich zu erreichen. Kämpfe nicht dagegen an, wenn es geht.«
Sanft versuchte ich, mit seinen Gedanken in Kontakt zu treten. Dazu wollte ich die Matrix nicht einsetzen. Unter Kirian könnte ich es zu heftig versuchen und ihm Schaden zufügen. Zuerst spürte ich Übelkeit und Verwirrung – das war die Droge –, dann eine tödliche Erschöpfung und körperliche Spannung, wahrscheinlich von dem langen Ritt, und schließlich ein überwältigendes Gefühl von Einsamkeit und Verlassenheit, worauf ich mich verzweifelt abwenden wollte. Zögernd riskierte ich einen intensiveren Kontakt …
… und traf auf eine perfekte, feste Verteidigung, eine leere Wand. Nach einem Augenblick versuchte ich es stärker. Die Gabe der Altons war erzwingbare Verbindung, selbst mit Nichttelepathen. Er wollte es, und wenn ich es ihm geben konnte, könnte er möglicherweise Schmerz aushalten. Er stöhnte, und etwas rührte sich in seinem Kopf, als schmerze ihn etwas. Möglicherweise war ich es. Die Gefühle verwischten immer noch alles andere. Jawohl, er hatte das Laran-Potenzial. Doch er hatte es blockiert. Vollständig blockiert.
Ich wartete einen Moment und dachte nach. Es war nicht sonderlich ungewöhnlich. Manche Telepathen verbringen ihr ganzes Leben so. Es gibt keinen Einwand dagegen. Telepathie war, wie ich ihm gesagt hatte, kein reiner Segen. Doch gelegentlich löste es sich langsam und sicher auf. Ich wich in die äußeren Sphären seines Bewusstseins zurück und fragte, nicht mit Worten: Vor welchem Wissen hast du Angst, Regis? Wehre es nicht ab. Versuche, dich zu erinnern, welches Wissen du nicht ertragen kannst. Es gab eine Zeit, als du dies bewusst konntest. Versuche dich zu erinnern …
Es war das Falsche. Er hatte meinen Gedanken empfangen. Ich fühlte die Antwort – eine Muschel, die zuschnappte, eine empfindliche Pflanze, die sich um den Blütenkelch schließt. Er rang die Hände aus meinen Fingern, bedeckte wieder die Augen und murmelte: »Mein Kopf tut weh. Mir ist übel. Mir ist so übel …«
Ich musste mich zurückziehen. Er hatte mich wirksam ausgestoßen. Möglicherweise hätte eine gut ausgebildete Bewahrerin ihren Weg durch den Widerstand erzwingen können, ohne ihn zu töten. Doch ich konnte es nicht. Ich hätte die Barriere niederreißen und ihn zwingen können, dem entgegenzutreten, was er dort versteckt hatte, doch dabei hätte er auch gänzlich zerbrechen können, und ob man ihn jemals wieder hätte zusammenflicken können, war zweifelhaft.
Ich fragte mich, ob er einsah, dass er sich dies selber angetan hatte. Einem solchen Wissen entgegenzutreten war ein schmerzhafter Prozess. Zu jenem Zeitpunkt war die Errichtung der Barriere wohl die einzige Möglichkeit gewesen, seinen Verstand zu retten, selbst wenn es den Wahnsinnspreis erforderte, sein gesamtes Psi-Potenzial damit abzublocken. Meine eigene Bewahrerin hatte es mir am Beispiel der Kreatur erklärt, die hilflos in der Falle sitzt, sich die gefangene Pfote abnagt und Lahmheit dem Tod vorzieht. Manchmal gab es viele Schichten bei einer solchen Barriere.
Die Barriere oder Hemmung konnte sich eines Tages von selbst auflösen und sein Potenzial freigeben. Zeit und Reife halfen da eine Menge. Es konnte auch sein, dass er sich eines Tages in tiefer Intimität und Liebe frei davon finden würde. Oder – auch das erwog ich – diese Barriere war für sein weiteres Leben bei Verstand absolut notwendig, was bedeutete, dass sie bleiben würde, und wenn man sie zerbräche, bliebe ihm nicht genug, um weiter leben zu können.
Ein Katalysatortelepath hätte ihn möglicherweise erreichen können. Doch in diesen Tagen wurden die verschiedenen Psi-Kräfte der Comyn auf Grund von Inzucht, wahllosen Heiraten mit Nichttelepathen und des Verschwindens der alten Möglichkeiten, solche Anlagen zu stimulieren, nicht mehr richtig vererbt. Ich war zwar der lebende Beweis, dass die Gabe der Altons manchmal noch in Reinform erschien. Doch allgemeiner gesehen konnte niemand das Netz von Talenten sortieren. Die Gabe der Hasturs – niemand wusste, was es war, selbst auf Arilinn haben sie es mir nicht gesagt – kann ebenso in den Aillard- oder Elhalyn-Domänen auftauchen. Bei den Ardais hatte es einst Katalysatortelepathen gegeben. Dyan war sicherlich keiner! So weit mir bekannt war, gab es keinen lebenden mehr.
Lange Zeit später, so schien es mir, rührte sich Regis, rieb sich die Stirn, öffnete die Augen und blickte immer noch mit diesem schrecklich suchenden Ausdruck. Die Droge wirkte noch in ihm – dieser Zustand würde noch Stunden andauern –, doch begann er nun, kurze, bewusste Intervalle zu erleben. Seine unausgesprochene Frage war völlig klar. Ich musste bedauernd den Kopf schütteln.
»Tut mir Leid, Regis.«
Ich hoffe, niemals wieder werde ich derartige Verzweiflung in einem jungen Gesicht sehen. Wenn er zwölf Jahre alt gewesen wäre, hätte ich ihn in den Arm genommen und versucht, ihn zu trösten. Doch er war kein Kind mehr, und ich war es ebenso wenig. Sein verschlossenes, verzweifeltes Gesicht hielt mich auf Abstand.
»Regis, hör mir zu«, sagte ich ruhig. »Wenn es dir nützt – das Laran ist da. Du hast das Potenzial, was zumindest bedeutet, dass deine Kinder es haben werden.« Ich zögerte, weil ich ihn nicht noch mehr verletzen wollte, indem ich ihm sagte, dass er sich die Barriere selbst zugefügt habe. Warum sollte ich ihm wehtun?
Ich sagte: »Ich habe mein Bestes getan, Bredu. Aber ich konnte es nicht erreichen. Die Barrieren waren zu stark. Bredu, sieh mich nicht so an«, flehte ich ihn an. »Ich kann es nicht ertragen, wenn du mich so ansiehst.«
Seine Stimme war kaum vernehmbar. »Ich weiß. Du tatest dein Bestes.«
Hatte ich das wirklich? Zweifel überfielen mich. Ich fühlte mich übel durch die Intensität seines Elends. Ich versuchte, wieder seine Hand zu ergreifen, zwang mich, seinen Schmerz im Kopf mitzufühlen, nicht vor ihm zurückzuweichen. Doch er entzog sich mir, und ich ließ ihn los.
»Regis, hör mir zu. Es spielt keine Rolle. Vielleicht war es zu Zeiten der Bewahrerinnen eine schreckliche Tragödie für einen Hastur, wenn er kein Laran hatte. Aber die Welt verändert sich. Die Comyn verändern sich auch. Du wirst woanders Stärke finden.«
Ich spürte beim Aussprechen die Nutzlosigkeit meiner Worte. Wie war es bloß, ohne Laran? War es wie ohne Augenlicht, ohne hören zu können …? Doch wenn man es nie gekannt hat, konnte man doch nicht unter dem Mangel leiden!
»Regis, du hast so viele andere Dinge zu bieten. Deiner Familie, der Domäne, der Welt. Und deine Kinder werden es erben …« Wieder nahm ich seine Hände und versuchte ihn zu trösten, doch er zuckte zurück.