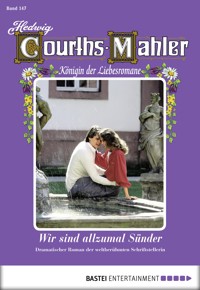
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Hedwig Courths-Mahler
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
In der Zeit der Wirtschaftskrise wird Rudolf Werder um sein ganzes Vermögen gebracht und verliert darüber hinaus auch noch seine geliebte Frau. Von Verzweiflung und schierer Not getrieben, beginnt er, sich auf verbrecherische Weise den Lebensunterhalt zu verschaffen: Er begeht Raubüberfälle, die ihm schon bald zur Leidenschaft werden. Jahrelang führt Rudolf Werder ein Doppelleben, doch dann beschließt er, um seiner Tochter Joan willen, mit den Verbrechen Schluss zu machen. Einmal nur gibt er seiner Abenteuerlust noch nach und ahnt nicht, dass ihm dieses eine Mal zum Verhängnis wird, seiner Tochter aber zum Glück verhilft ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 167
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Wir sind allzumal Sünder
Vorschau
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
© 2015 by Bastei Lübbe AG, Köln
Verlagsleiter Romanhefte: Dr. Florian Marzin
Verantwortlich für den Inhalt
Titelbild: Bastei Verlag/Eigenproduktion
E-Book-Produktion: César Satz & Grafik GmbH, Köln
ISBN 978-3-7325-2178-4
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
www.bastei.de
Wir sind allzumal Sünder
Roman um eine junge Frau und ihren ungewöhnlichen Weg ins Glück
Die Uhr verkündete schon die mitternächtliche Stunde. Und immer noch saß Rudolf Werder, der bekannte Grundstücks- und Börsenmakler, vor seinem Schreibtisch über seine Bücher gebeugt. Er stützte den Kopf in die Hände. Er hatte seinen Jahresabschluss gemacht, verzeichnete gewissenhaft alle seine Einnahmen, die Einkünfte aus seinen Besitztümern, Zinsen sowie die letzten Gewinne an der Börse. Das alles trug er in ein Buch ein, an dessen Umfang man ohne weiteres erkennen konnte, dass die Geschäfte Rudolf Werders sehr umfangreich waren.
Aber da war noch ein anderes Buch, auf dessen Seiten sich ebenfalls Zahlenkolonnen reihten; es waren nicht die Börsengewinne, keine Einnahmen aus Rudolf Werders ausgeübter Tätigkeit. Kein Mensch ahnte etwas von dem, was Werder trieb, wenn er nicht der Finanzmann, nicht der freundliche, etwas kränkliche Privatmann war.
Vor Jahren hatte Rudolf Werder einmal vor dem Nichts gestanden; auch ihm war die Inflationszeit verhängnisvoll geworden, hatte Notzeiten heraufbeschworen. In jener Zeit hatte Rudolf Werder auch seine Frau verloren, die für ihn das Höchste auf Erden gewesen war. – Das Schicksal hatte sie davor bewahrt, den Zusammenbruch mitzuerleben.
Seine Tochter, das einzige Kind seiner glücklichen Ehe, der Abgott des Vaters nach der Mutter jähem Tod, hatte er damals in ein Pensionat gegeben. Sie sollte nicht berührt werden von den Schwierigkeiten, denn mit dem Rest seines Vermögens hatte er ihren Aufenthalt im Voraus bezahlt. Schwer war ihm die Trennung von seinem Kind geworden, aber es hatte sein müssen. Nicht nur, weil er vorerst in Not leben würde, auch weil er einen dunklen Weg beschreiten wollte, um wieder zu Vermögen und Besitz zu kommen. Und von diesem Schritt, den der Vater nach dem verlorenen Besitz tun wollte, sollte sein Kind nichts erfahren.
Rudolf Werder zog die Bilanz seines Lebens. Mit dem ersten Geld, das er unrechtmäßig erworben, hatte er an der Börse ein großes Geschäft gemacht und mit dem erlangten Gewinn seine neue ehrliche Tätigkeit begonnen. Weiterhin hatte er zu unterscheiden gewusst zwischen Recht und Unrecht; den Erwerb aus seinen rechtlichen Geschäften sammelte er auf einem Konto, das er als Erbe für seine Tochter Joan bestimmte. Und seine dunklen, unrechtmäßigen Einkünfte? Er zahlte sie auf ein besonderes Konto auf einer anderen Bank ein, sparte sie auf, aber gebrauchte sie nicht!
Warum nicht? Warum unterschied Rudolf Werder zwischen rechtmäßigem Gut und seinem Raubgut? Warum schrieb er auf die erste Seite des geheimnisvollen, niemand bekannten Kontobuches die merkwürdigen Worte: Zur Verwendung laut meiner testamentarischen Bestimmung!
Rudolf Werder hätte wahrscheinlich selber keine klare Antwort auf all diese Fragen geben können. Genauso wenig hätte er erklären können, welche geheimnisvolle Macht ihn zwang, den Weg des Abenteuers, den er einmal eingeschlagen hatte, immer wieder zu betreten. Nein, er wollte nicht mehr, er wollte glücklich sein mit seinem Kind, wollte sein Kind frei halten von dem Unrecht, das er begangen. Aber dann packte es ihn mit Gewalt, trieb ihn in neue – Verbrechen.
Seit seine Tochter siebzehn Jahre alt geworden war, hatte er sie wieder bei sich. Sie zählte jetzt einundzwanzig Jahre, Vater und Tochter hingen mit inniger Liebe aneinander. Der Vater tat alles, was er seiner Tochter an den Augen absehen konnte, und Joan, die diesen Namen von einer Patin, einer englischen Freundin ihrer Mutter, erhalten hatte, hing mit hingebender Zärtlichkeit an ihrem Vater.
Ging dieser seinen heimlichen Abenteuern nach, war Joan des Glaubens gewesen, er befinde sich auf Geschäftsreisen. Sie fand dabei nichts Auffallendes, bedauerte nur immer, dass sie sich auf Wochen von ihm trennen musste, und freute sich, wenn er endlich wiederkam.
Damit sie in solchen Zeiten nicht allein war, hatte Rudolf Werder eine ältere Dame verpflichtet, die seinem Haushalt vorstand und Joan eine mütterliche Gesellschafterin sein sollte. Frau Melanie Reichert war als kinderlose Witwe froh, diesen guten Posten erhalten zu haben.
So ging in Rudolf Werders Haus auch heute noch alles glatt und harmonisch zu, und er konnte Joan getrost unter Frau Reicherts Schutz zurücklassen, zumal auch noch zwei Hausmädchen und Stübke, der Gärtner, Portier und Chauffeur in einer Person war, im Haus wohnten.
Joan hatte einige junge Freundinnen, mit denen sie oft zusammenkam. Aber sonst kam selten ein Besucher. Angeblich war Rudolf Werder zu leidend, um Geselligkeit in seinem Haus pflegen zu können.
Welches Leiden er hatte, wusste niemand genau, er wehrte selbst seine Tochter ab, wenn sie liebevoll besorgt danach fragen wollte. Er hatte ihr gesagt, dass seine Gesundheit nicht die beste sei, er sich Schonung auferlegen müsse. Vor allen Dingen sei sein Herz nicht ganz gesund, und wenn er sich nicht vorsehe, könne er eines Tages einen Herzschlag bekommen. Damit wollte er Joan an den Gedanken gewöhnen, dass er ihr einmal schnell genommen werden könnte – auf einer seiner Abenteuerreisen konnte das sehr wohl geschehen –, und dann sollte sie gewappnet sein.
Aber im Grunde war er ein Mann von eisenfester Gesundheit. Niemand ahnte das, wenn er, auf einen Stock gestützt, eine blaue Schutzbrille vor den Augen, langsam durch sein Haus schritt. Jetzt, allein, hatte er die Brille abgelegt, sie lag vor ihm auf dem Schreibtisch. Kein Mensch im Haus außer seiner Tochter kannte ihn ohne diese. Sein Haar hatte eine matte, graue Farbe; niemand merkte, dass er dieses Grau künstlich herbeiführte, und sich nur an seinen Schläfen einige graue Haare befanden.
Die Uhr auf seinem Schreibtisch kündete mit leisem, silbernem Ton die erste Morgenstunde an. Er schrak aus seinem Brüten und erhob sich, reckte seine Glieder und machte einige gymnastische Übungen, die auf große Körperkräfte schließen ließen.
Als er fertig war, warf er schnell seine Jacke wieder über. Sorgfältig schloss er seine beiden Kontobücher in ein in die Wand eingebautes Stahlfach. Dort hinein hatte er auch Wertpapiere und Banknoten gelegt. Die Schlüssel steckte er zu sich. Dann schritt er auf die Tür zu, hinter der sich sein Schlafzimmer befand.
Morgen war, Silvester-Jahresende. Sein Vermögensabschluss. Sein Vermögensabschluss hätte ihm gestattet, sich zur Ruhe zu setzen. Sein abenteuerliches Leben konnte, wenn er nur wollte, beendet sein. Aber er wusste leider zu gut, dass es keinen Zweck hatte, wenn er sich vornahm, wirklich mit ihm Schluss zu machen. Kurze Zeit hielt er das aus und sonnte sich behaglich in der Liebe seiner Tochter. Aber dann packte es ihn wieder; er brauchte nur etwas zu hören oder zu lesen, was ihn reizte, wieder einmal die für ihn köstliche Aufregung drohender Gefahr zu fühlen, dann hatte der Teufel ihn sofort wieder in den Krallen.
Und doch musste ein Schlussstrich unter alles Gewesene gezogen werden. Er selber wollte es; aber wenigstens ein letztes Mal sich den dunklen Gewalten überlassen, die Macht über ihn hatten. Mit diesem Vorsatz schlief er ein.
Am anderen Morgen erwachte er erst, als er im Badezimmer das Wasser rauschen hörte. Da wusste er, dass das Hausmädchen sein Morgenbad bereitete. Nun musste er aufstehen, schnell seine allmorgendlichen gymnastischen Übungen machen, baden und sich ankleiden. Sonst kam er zu spät zum Frühstück. Und Joan war nicht zu bewegen, zu frühstücken, bevor der Vater erschien.
In der großen Frühstücksdiele war der Frühstückstisch gedeckt. An diesem stand eine schlanke junge Dame in einem weißen Kleid aus weichem Wollstoff, das reizvoll die schöne Gestalt umschmiegte.
Rasch ging Joan hinüber zu der Treppe, die der Vater herabkam, und begrüßte ihn mit einem Kuss und einer herzlichen Umarmung. Dann bot sie ihm den Arm, damit er sich darauf stützen könnte. Er streichelte aber nur zärtlich über diesen Arm und nickte ihr zu.
„Du sollst mich doch nicht so verwöhnen, Joan. Soviel Kraft habe ich schon noch, dass ich mich nicht auf dich zu stützen brauche.“
„Ich tue es aber doch gern, Vater! Hast du gut geschlafen?“
„Ausgezeichnet, Joan. Du selbstverständlich auch, du siehst frisch und munter aus.“
„Bin ich auch! Aber du warst lange wach, Vater, ich hörte dich noch, als ich einmal nach zwölf aufwachte.“
„Ich habe dich hoffentlich nicht gestört?“
„Nein, nein, ich bin gleich wieder eingeschlafen.“
„Nun ja, ausnahmsweise habe ich etwas länger gearbeitet, weil ich meinen Jahresabschluss fertig machen wollte.“ Er küsste sie zärtlich auf die Wange. „Bitte, lass das Frühstück kommen.“
„Es wird gleich da sein; Frau Reichert ist gleich in die Küche gegangen, als wir deine Tür oben hörten.“
Bald darauf erschien das Hausmädchen und trug alles auf, was zum Frühstück gehörte. Zierlich ordnete sie es auf dem Tisch; auch Frau Reichert kam an den Tisch.
Joan hatte ihrem Vater den Stock abgenommen, nachdem er sich gesetzt hatte. Gemütlich tranken die drei Kaffee, und wer Rudolf Werner jetzt neben seiner Tochter sah, hätte nicht vermutet, dass noch am Abend zuvor düstere Gedanken durch sein Hirn gejagt waren; dass er mit schweren Entschlüssen in seinem Inneren hatte ringen müssen. Heiter plauderte Joan von den Neuigkeiten und von den kommenden Winterfreuden.
„Im Januar fahren wir wieder einige Wochen nach St. Moritz oder in die bayerischen Berge, damit du wieder einmal Wintersport treiben kannst und in junge fröhliche Sportgesellschaft kommst“, unterbrach Rudolf Werder seine Tochter.
Joans Augen leuchteten. „Vater, oh, wie ich mich darauf freue. Wir fahren nach St. Moritz, bitte! Dir bekommt der Aufenthalt dort ausgezeichnet, und wir finden gewiss alte Bekannte, Sportfreunde und Kameradinnen aus früheren Jahren. Vater, das wird herrlich! Heute feiern wir zu Hause Silvester, unsere liebe Frau Reichert bäckt Pfannkuchen, und wir fühlen uns gemütlich in unserem schönen Heim.“ Joan lachte wie ein beschenktes Kind. Stolz und glücklich sah Rudolf Werder auf dieses prächtige Menschenkind, sein Kind, das Vermächtnis seiner toten, überaus geliebten Gattin. Aber dennoch mischte sich auf seinem Antlitz ein nachdenklicher Zug mit ein.
Besorgt sah Joan den Vater an. War seine Krankheit ernst? Sie nahm sich vor, ihn noch mehr als bisher zu umhegen.
„Jetzt habe ich statt Bild, ‚Bield‘ geschrieben! Kannst du dir so was denken, Guter? Die verflixte Schreibmaschine ist auch ein Objekt, dem die Tücke angeboren ist. Kein halbwegs vernünftiger Mensch würde darauf kommen, Bild mit ie zu schreiben, aber die Schreibmaschine bringt noch ganz andere Dinge fertig. Was gäbe ich darum, könnte ich sie zum Fenster hinauswerfen!“
„Tu es nicht, Gundi, sie könnte dabei kaputtgehen, klapprig genug ist sie ohnedies“, sagte Gunter Bertram seufzend und strich der Schwester über das Haar.
Sie fasste seine Hand und lachte ihn an. „Ich bin ein undankbarer Kerl, Gunter. Meine liebe, gute Schreibmaschine! Schau – ich hege und pflege sie, damit sie sich einbilden kann, ein kostbares Ding zu sein. Das stärkt sie vielleicht ein bisschen und dann hält sie noch aus, bis wir das große Los in der Lotterie gewinnen. Aber mein Wort, heute, zu Silvester, lasse ich von meinem fürstlichen Honorar – vorausgesetzt, dass ich es gleich bekomme – einen großen Teil dafür springen, und dann hoffe ich, wenigstens hundert Mark zu gewinnen. Junge – da würde ich uns eine Silvesterfeier bereiten, die sich gewaschen hat. So mit saurem Hering, Wiener Würstchen, Pfannkuchen – hach! – sogar welche mit Ananasfüllung – mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen.“
Es zuckte um Gunter Bertrams Mund, er musste sich abwenden. Wieder einmal fühlte er sein Unvermögen, der Schwester ein besseres Leben zu schaffen. Gundi sah verstohlen zu ihm hinüber. Ach, sie wusste sehr gut, wie es in ihrem geliebten großen Bruder aussah. Energisch packte sie die von ihr getippten Schriftstücke ein, drückte die kleine Mütze schief auf den Kopf und rief dem Bruder noch schnell zu: „Adjüs, Gunter! Ich komme so schnell wie möglich wieder!“
Der Bruder schrak aus seinem Brüten auf. „Und sorg dich nicht, Gundi, wenn du kein Geld bekommst von deinem Auftraggeber. Pfannkuchen sollst du auch so bekommen. Ich selbst werde sie besorgen.“
Sie sah erstaunt zu ihm auf.
„Großer? Hast du vielleicht schon in der Lotterie gewonnen?“
„Nein, aber meine Uhr habe ich versetzt.“
Sie erschrak und wurde blass.
„Vaters Uhr? Ach, Gunter!“
„Lass nur – ich werde sie morgen wieder einlösen können. Morgen müssen wir Miete zahlen – und Kohlen brauchen wir auch, damit wir wenigstens eines von unseren Prachtgemächern heizen können. Also, nun geh, Gundi, ich richte schon alles zur Silvesterfeier.“
Sie nickte, nahm ihr Paket und streichelte ganz leise über seine Hand. „Auf Wiedersehen, Gunter!“
Und gleich nach Gundi verließ auch Gunter die Wohnung, die Frau Plüschke gehörte und von der sie zwei kleine Zimmer gemietet hatten. Er zog den dünnen Mantel, den er trug, fest um seinen schlanken Körper, denn mit einem leeren Magen friert man leicht.
Joan Werder fuhr mit ihrem eleganten Sportwagen durch die Straßen Berlins. Es war Silvester, und sie wollte noch einiges für die daheim geplante gemütliche Feier kaufen. Vor einer Buchhandlung, gleich neben einem großen Bankgebäude in einer sehr belebten Straße, hielt sie an, um in dieser ein von ihrem Vater bestelltes Werk abzuholen.
Sie öffnete den Wagen und stieg mit der ihr eigenen sportlichen Geschmeidigkeit und Eleganz aus. Die Wagentüre klappte zu und sie schritt auf den Buchladen zu. Doch da stockte ihr Schritt, sie fühlte ihr Blut in den Adern erstarren.
Aus dem nebenanliegenden Bankgebäude drang ein heftiges Schreien und Schimpfen, Rufe wurden laut: „Haltet ihn! Hilfe, Polizei!“ Und schon öffnete sich die große Doppeltür, mit hastenden, verzweifelten Sprüngen setzte ein Mann hinaus, schwang sich auf ein Kraftrad und raste, ehe die aufgeregt hinter ihm her eilenden Verfolger aus dem Bankhaus oder einer der verblüfft und untätig zuschauenden Passanten ihn daran hindern konnten, mit Vollgas davon. In Bruchteilen von Sekunden war er in dem starken Verkehr verschwunden.
Joan fühlte ihre Knie zittern. Alles drehte sich vor ihren Augen. Wie aus weiter Ferne drangen die aufgeregten, wirr durcheinander klingenden Rufe der Umstehenden an ihr Ohr. Joan war einer Ohnmacht nahe. Der Mann, der dort aus dem Portal des Bankhauses geflohen war, einen Revolver in der Hand, hatte Ähnlichkeit mit ihrem Vater. Joan stand wie erstarrt. Wohin ihre Blicke fielen, laut redende oder gar schreiende Menschen.
Ein Dutzend oder mehr Leute umdrängten einen kleinen, heftig gestikulierenden Mann. – Wohl ein Angestellter des Bankhauses. Joan hörte und sah von dem allen so gut wie nichts; wie rasend jagten die Gedanken hinter ihrer Stirn. Unablässig stand das Bild des Fliehenden ihr vor Augen.
Und doch, es konnte nicht wahr sein; nein! Das durfte nicht sein!, schrie alles in ihr. Und ihre Gedanken umkrampften verzweifelt das Bild des Vaters, das Bild eines leidenden, älteren Mannes. Nein, er konnte es unmöglich gewesen sein. Was hatte ihr Vater mit einem Bankräuber gemein? Seit wann hätte er so kraftvoll und schnell gehen und laufen können? Seit wann fuhr ihr Vater mit einem Motorrad? Ach, Unsinn war das alles! Ein Hirngespinst. Sie war nur nervös geworden; der plötzliche Anblick des Fliehenden hatte sie erschreckt. Doch die Zweifel blieben.
Plötzlich fühlte Joan sich von ungeheurer Müdigkeit überfallen. Sie wandte sich ihrem Wagen zu, wollte nach Hause, musste den Vater sehen, sich vergewissern, dass dies alles nicht wahr war. Schon stand sie wenige Schritte von ihrem Wagen, da versagten ihre Füße plötzlich den Dienst, wieder kreiste es wirr vor ihren Augen.
Joan wäre hingestürzt, hätte nicht Gunter Bertram, rasch hinzuspringend, sie in seinen Armen aufgefangen.
Gunter war auf seinem Gang zu der Konditorei, wo er die seiner Schwester versprochenen Pfannkuchen mit seinem so bitter erworbenen Geld kaufen wollte, auch an dem Ort des abenteuerlichen Vorfalls vorbeigekommen, dessen Zeuge Joan gewesen war. Weniger das Gerede und aufgeregte Gestikulieren der Leute hatte ihn für Minuten hier gebannt: es war die Erscheinung Joans, die ihn seinen Schritt verhalten hieß. So hatte er das plötzliche Erbleichen und Taumeln bemerkt und war rechtzeitig hingesprungen, um sie vor dem Sturz auf die Straße zu bewahren.
Nun hielt er sie in seinen Armen. Für Sekunden schien sein Herz stillzustehen. Die Nähe dieses reizenden, ihm überirdisch schön erscheinenden Geschöpfes berauschte ihn, und er presste sie wohl etwas fester an sich, als es notwendig gewesen wäre. Dann schaute er, wohin er die Ohnmächtige tragen sollte.
Doch in diesem Augenblick öffnete Joan wieder die Augen. Röte schoss ihr ins Gesicht, als sie in die besorgten Züge dieses jungen Mannes sah. Sie machte sich von ihm frei, und Gunter stellte sie behutsam, wie ein überaus kostbares Wesen, wieder auf die Füße.
Infolge der lebhaften Diskussionen, was sich in dem Bankhaus zugetragen, hatte kein Mensch den kleinen Vorfall bemerkt.
Joan hatte sich inzwischen wieder gefasst. „Ich danke Ihnen für Ihre freundliche Hilfsbereitschaft. Es war nur der plötzliche Schreck über diesen Vorfall da“, sie wies mit dem Finger auf das Bankhaus hin, „nun ist schon alles wieder gut. Ich danke Ihnen jedenfalls herzlich …“ Sie nestelte an ihrem Handtäschchen, als wollte sie Gunter mit einem Trinkgeld entlohnen, denn aus dem Gesicht des jungen Mannes hatte sie gelesen, was Not und Entbehrung in diese markanten Züge geschrieben hatte.
Gunter musste wohl fühlen, dass die junge Dame diese Absicht hatte, denn er richtete sich plötzlich straff empor und Röte stieg in sein Gesicht. Joan erschrak. Nein, diesem jungen Mann durfte man kein Trinkgeld anbieten, trotz seines abgetragenen Anzugs. Etwas in seinen Augen sagte ihr, dass er jede Entlohnung für den kleinen Ritterdienst entschieden zurückweisen würde. So sagte sie nur noch mit einem freundlichen, lieben Lächeln:
„Ich danke Ihnen herzlich, mein Herr!“
Seine Augen strahlten auf, und sich verneigend, trat er zurück. Joan Werder bestieg ihren Wagen, und als sie die Tür hinter sich schloss, blickte sie noch einmal zurück! Sie sah Gunter Bertram, der gebannt auf derselben Stelle stand und ihr mit großen Augen nachblickte, als sei ihm etwas begegnet, das ihn bis in sein tiefstes Innere aufwühlte. Auch Joan spürte eine seltsame Beklemmung unter dem Blick seiner Augen, und ihr Herz klopfte. Ihr war, als sei diese flüchtige Begegnung mit dem hoch gewachsenen jungen Mann von bleibender Bedeutung für ihr Leben.
Der Unbekannte sah allerdings so aus, als sei er mit Glücksgütern nicht gesegnet, aber trotzdem machte er den Eindruck einer Persönlichkeit. Gunter hatte ihr sein Gesicht voll zugewandt. Er wagte es nicht zu grüßen, aber in seinen Augen lag etwas, das sie nie mehr vergessen konnte – eine so schmerzliche, entsagungsvolle Sehnsucht, dass es ihr ans Herz griff. Als ihr Wagen anfuhr, neigte sie ein wenig den Kopf zum Gruß. Da strahlten seine Augen auf in Freude.
Er zog den Hut und verneigte sich ehrerbietig. Wie gebannt stand er da und sah dem Wagen nach, bis er seinen Blicken entschwunden war.
Dann fuhr er auf, wie aus einem Traum, ging in die Konditorei und erstand, sich im Geheimen sehr leichtsinnig scheltend, vier gefüllte Pfannkuchen, zwei davon sogar mit Ananasfüllung.
Wie einen Schatz trug er seinen Einkauf vor sich her. Und weil er noch ganz unter dem Einfluss der Begegnung mit der entzückenden jungen Dame stand, kaufte er für seine Schwester bei einer Straßenverkäuferin auch noch einen Strauß Christrosen. Dann ging er weiter.
Er war tief in Gedanken versunken.
Jahrelang hatte er sich mit verbissener Energie darum bemüht, mit seinem Studium fertig zu werden.
Opferwillig hatte seine Schwester ihm in jener Zeit durchgeholfen, und er hinwiederum gehofft, ihr alles reichlich vergelten zu können, wenn er nach bestandenem Examen eine gute Stellung erhalten würde.
Um nur das für den Lebensunterhalt unbedingt Nötige zu verdienen, hatte er jede Art von Arbeit angenommen, hatte schließlich Zeitungen an den Straßenecken verkauft und später in der Weihnachtswoche aushilfsweise Pakete an die Kundschaft eines großen Warenhauses ausgetragen. Das hatte über die Festwoche hinweggeholfen, und er war wenigstens imstande gewesen, die Dezembermiete für sich und die Schwester zu bezahlen.
Dann aber war er wieder blank gewesen, und schließlich hatte er sein letztes Wertstück, die von seinem Vater ererbte goldene Uhr, versetzen müssen.
Ob er sie jemals würde wieder einlösen können?





























