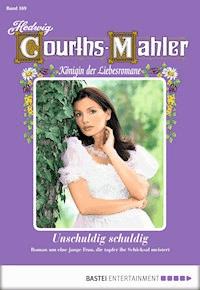
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Hedwig Courths-Mahler
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Mit Augen, aus denen jeder Glanz gewichen war, starrte Maria Laßberg auf Kranz und Schleier, die sie einst auf dem Weg ins Glück begleitet hatten. Doch was war aus diesem Glück geworden? Zerronnen war es wie das Geld, das ihr Mann an den Spieltischen verloren hatte. Und nun, da sie ihm nichts mehr zu geben hatte, fügte er ihr auch noch das Schlimmste zu: Er verlangte die Scheidung, weil eine andere Frau wichtiger für ihn war - und reicher...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 198
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Unschuldig schuldig
Vorschau
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
© 2015 by Bastei Lübbe AG, Köln
Verlagsleiter Romanhefte: Dr. Florian Marzin
Verantwortlich für den Inhalt
Titelbild: Anne von Sarosdy/Bastei Verlag
E-Book-Produktion: César Satz & Grafik GmbH, Köln
ISBN 978-3-7325-2200-2
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
www.bastei.de
Unschuldig schuldig
Roman um eine junge Frau, die tapfer ihr Schicksal meistert
Frau Maria Laßberg war damit beschäftigt, einen Schrank aufzuräumen, in dem sie allerlei Kleinigkeiten aufbewahrte. Andenken an eine bessere, glücklichere Zeit. Dabei fielen ihr auch ihr Brautschleier und ihr Brautkranz in die Hände.
Marias Gesicht bekam plötzlich einen herben, fast harten Ausdruck, und ihre Augen wurden dunkel. Sie nahm den zarten Schleier empor, ihre Hände krampften sich hinein mit einem jähen Griff, so dass er zerriss. Mit einem bitteren Lächeln sah sie auf den Riss.
„Warum soll der Schleier nicht zerreißen – mein törichter Wahn von Glück ist ja auch zerrissen.“
Sie war so versunken in wehe, schmerzliche Gedanken, dass sie nicht hörte, wie sich schnelle Schritte draußen näherten. Erst als die Tür geöffnet wurde, schrak sie empor. Ihr Gatte stand vor ihr. Sie sah mit glanzlosen Augen in sein schönes, aber übernächtigtes und nervöses Gesicht.
„Was willst du hier in meinem Zimmer?“
Leiser Spott zuckte in seinen Augen auf. „Verzeih, dass ich diesen geheiligten Raum ohne deine besondere Erlaubnis betreten habe, aber ich muss dich sprechen, sogleich.“
„In welcher Angelegenheit?“, fragte sie förmlich.
Er zögerte eine Weile, biss sich auf die Lippen und warf dann den Kopf zurück. „Geld!“ Schroff und hart kam das Wort über seine Lippen.
„Du weißt, dass ich von Vater nur das Nötigste für den Haushalt bekomme.“
Er machte eine abwehrende Bewegung. „Von dem bisschen rede ich nicht.“
„Ich besitze aber nicht mehr, und von Vater kann ich auch nichts bekommen, jetzt in dieser furchtbaren Zeit, das weißt du.“
Er zögerte einen Moment. Vielleicht war doch ein letzter Rest von Schamgefühl in ihm. Aber dann warf er den Kopf zurück. „Du hast deinen Schmuck. Ich muss deinen Schmuck haben, alles, wenn ich diese Schuld einlösen will. Ich habe verdammtes Pech gehabt. Ein andermal mache ich das wett. Aber jetzt muss ich deinen Schmuck haben. Gib ihn mir!“
Sie war bleich bis in die Lippen, und ein Ekel vor diesem Mann schüttelte sie. „Und wenn ich ihn dir nicht gebe?“, fragte sie leise.
Er trat an die Wand heran, in die Marias kleiner Tresor eingemauert war, und hielt einen Schlüsselbund empor. „Du siehst, ich habe deine Schlüssel schon mit herübergebracht, um dich nicht zu bemühen. Ich als dein Gatte habe ohne weiteres das Recht, über dein Eigentum zu verfügen.“
Sie sah ihn mit so tiefer Verachtung an, dass er ihren Blick nicht aushalten konnte. Als er sich dem Tresor zuwandte, trat sie mit einem entschlossenen Ausdruck neben ihn und entriss ihm die Schlüssel. Es geschah so plötzlich, dass sie schon in ihren Händen waren, ehe er sie festhalten konnte.
„Gib die Schlüssel her!“, gebot er.
Sie sah ihn von oben bis unten an. Dann sagte sie hart und laut: „Ich will mich nicht noch tiefer schämen müssen, dass ich deine Frau geworden bin; du sollst mich wenigstens nicht direkt bestehlen.“
Schnell schloss sie den Tresor auf, nahm ihre Schmucktruhe mit einem harten Griff heraus und stellte sie vor ihn hin.
„Da, nimm. Ich gebe ihn dir, damit du ihn nicht stehlen musst.“
Er achtete kaum auf sie. Mit gierigem Ausdruck, der sein schönes Gesicht entstellte, schlug er den Deckel der Truhe zurück und fasste hinein, ergriff eines der Etuis nach dem anderen und steckte sie in seine Taschen. Dann schlug er den Deckel der Truhe wieder zu.
„Du brauchst keine Angst zu haben – ein einziger glücklicher Abend am Spieltisch, und ich bringe dir alles zurück und zur Entschädigung noch mehr. Jetzt muss ich eilen. Adieu, Maria.“ Mit einem gönnerhaften Lächeln nickte er ihr zu und ging davon.
Sie sah ihm mit starren Augen nach. Ein zitternder Atemzug hob ihre Brust. Sie wusste, dass sie ihren Schmuck nie wiedersehen würde. Aber das kümmerte sie am wenigsten. Dass sie ihren Mann, den sie so sehr geliebt hatte, in dem sie ihr Ideal gesehen hatte, tief verachten musste, tat viel, viel weher.
Mit zusammengepressten Lippen nahm sie die Truhe auf und verschloss sie wieder im Tresor. Niemand durfte wissen, dass die Truhe leer war, vor allem ihr Vater nicht – ihr armer Vater.
Wochen waren vergangen. Immer häufiger sank Maria wie vernichtet in einen Sessel. Sie war wie aller Kraft beraubt. Wie sollte sie diese Schmach weiter tragen? Ihre Augen füllten sich mit Tränen. Sie weinte, wie oft schon, über das Unglück ihrer Ehe. So jung sie noch war, sie trug schwer an ihrem tiefen Leid.
Als ihr nach einer Weile ihr Vater gemeldet wurde, trocknete sie hastig die Tränen und zwang sich zu einem ruhigen Lächeln; aber dem Vater entgingen die Tränenspuren nicht. Besorgt sah er seine Tochter an.
„Du bist wieder allein, Maria?“
„Ja, Vater, Herbert ist ausgegangen.“
Er hob ihren Kopf zu sich empor. „Du hast wieder geweint“, sagte er bedrückt.
Sie versuchte zu lächeln. „Lass nur, Vater, ich bin eine Törin – mir kommen so leicht die Tränen.“
Mit einer unbeschreiblich liebevollen Gebärde nahm Georg Tornau den Kopf seiner Tochter in beide Hände und sah ihr traurig in die schönen samtbraunen Augen.
„Du eine Törin? Mein liebes Kind, ich kenne keine Frau, die diesen Namen weniger verdient als du. Wenn du weinst, hat es einen tiefen und gewichtigen Grund, das weiß ich. Und ich weiß auch, weshalb du wieder geweint hast. Aber ich will davon nicht reden, weil ich weiß, dass dein Stolz darunter leidet. Ich sollte wohl überhaupt stillschweigen zu alledem, um dich zu schonen; aber manchmal geht es mit mir durch, und ein tiefer Groll erfüllt mich gegen den Mann, der mir einst hoch und heilig schwor, dich auf den Händen zu tragen.“
„Mache dir nicht auch noch Sorgen um mich, lieber Vater, du hast ohnehin genug Schweres zu tragen. Sei überzeugt, dass ich vertrauensvoll zu dir kommen werde, wenn – wenn mir unerträglich wird, was mir auferlegt wurde. Jetzt lass uns lieber nicht mehr davon sprechen, sondern berichte mir von deinen Sorgen.“
Die Stirn des alten Herrn zog sich in düstere Falten. „Die Inflation, dieses gefräßige Ungeheuer, will mir, wie es scheint, auch noch das Letzte aus den Händen nehmen, was von meinem Besitz übrig blieb. Die Früchte eines Lebens voll Arbeit und Mühe verfliegen wie Spreu im Wind. Was ich auch beginne, um wieder festen Boden unter die Füße zu bekommen, alles ist vergeblich – wenn man nicht skrupellos in der Wahl seiner Mittel ist. Und wenn man sein ganzes Leben nur auf strenge Rechtlichkeit aufgebaut hat – dann lernt man es in meinem Alter nicht mehr, Gesetze zu übertreten, so unsinnig sie auch sein mögen.“
Mit warmem Druck fasste Maria seine Hände. „Gottlob, dass du nicht dazu imstande bist! Ich würde viel unglücklicher darüber sein, wenn mein Vater aufhörte, ein Ehrenmann zu sein, als über den Verlust unseres Vermögens.“
„Da bist du anderer Ansicht als dein Mann. Er machte mir, erst versteckt und dann immer deutlicher, den Vorwurf, dass ich es nicht verstanden habe, wie so mancher andere, mein Vermögen festzuhalten. Er meint, man dürfe nicht ängstlich sein in der Wahl seiner Mittel, und lässt deutlich durchblicken, dass er unzufrieden mit mir ist, weil ich nicht mehr mit vollen Händen geben und jede seiner Launen befriedigen kann.“
Maria war zusammengezuckt und sie war sehr bleich geworden. „Das – das hat er dir gesagt – das hat er gewagt?“
„Mehr als einmal und in noch härterer Form, als ich es dir berichte. Je mehr mein Vermögen zusammenschrumpfte, je mehr ich eure Zulage beschränken muss, desto deutlicher lässt er mich fühlen, dass ich nach seiner Ansicht ein Idiot bin.“
Sie fasste bei seinen letzten Worten, die sich bitter über seine Lippen rangen, nach seiner Hand. Bleich bis in die Lippen sah sie ihn an.
„Dass ich dir das nicht habe ersparen können!“, sagte sie mit verhaltener Empörung. „Dass er das gewagt hat!“
„Er nennt mich einen schlechten Vater. Gott weiß, Maria, dass ich dich über alles liebe und dass ich dich vor aller Not und Sorge schützen möchte. Aber ich kann keinen anderen Weg gehen als den des Rechtes, ich kann nicht gewissenlos die Gesetze überspringen, um zu halten, was zerfließt. Das Grauen packt mich zuweilen. Was soll werden, wenn ich euch nichts mehr geben kann? Ich selbst schränke mich nach Möglichkeit ein. Von gestern bis heute ist die Mark um fast das Doppelte gefallen. Wer weiß, wie lange ich für euch diese Wohnung noch halten kann. Ich bin ganz ratlos, Maria – nie in meinem Leben bin ich so ratlos gewesen. Ich mache mir jetzt bittere Vorwürfe, dass ich nach Kriegsschluss meine Fabrik verkaufte. Freilich tat ich es nur, weil sie kaum noch zu halten war. Aber ich hätte sie doch vielleicht noch einmal emporbringen können. Alles andere gab ich auch nach und nach hin, der Not gehorchend, um Geld zu schaffen. Was soll nun werden, Maria? Was soll vor allen Dingen aus dir werden?“
Mit tiefer Bekümmernis hatte Maria diese bittere Klage ihres Vaters angehört. Liebevoll umfasste sie ihn und sah ihn tapfer an, obwohl ihr Herz gar nicht so tapfer war.
„Sorge dich nicht um mich, Vater, ich bin jung und gesund und kann und will arbeiten. Vor allen Dingen gibst du deine Wohnung auf; es quält mich ohnedies, dass du so viel bescheidener hausen musst als wir. Du ziehst zu uns, dann kann ich dich pflegen, wenn du nicht wohl bist. Wir sparen deine Ausgaben für die Miete, und wenn du deine Mahlzeiten bei uns einnimmst, kostet das nicht viel mehr, als wenn wir allein essen. Auch werde ich die Dienerschaft entlassen bis auf ein Mädchen. Zur Not behelfen wir uns auch ohne Dienstboten. Und einmal muss ja die Inflation ein Ende nehmen.“
Er streichelte über ihr Haar. „Meine tapfere Maria, wie wohl tut es mir, dass du so unverzagt bist. Aber wie wird sich dein Mann in diese Verhältnisse schicken? Gewiss könnten wir auf diese Weise viel sparen, aber er wird nicht einwilligen.“
In Marias Augen flammte es plötzlich auf. „Du bist der wahre Herr in dieser Wohnung, du bezahlst alles, sorgst für alles. Wenn es Herbert nicht passt, dass wir uns einschränken müssen, so mag er doch endlich einmal daran denken, zu arbeiten, zu verdienen, sich nicht von dir erhalten zu lassen.“
Der alte Herr zuckte zusammen. In diesem Ton hatte seine Tochter noch nie von ihrem Mann gesprochen. „Maria!“, rief er erschrocken.
Sie presste die Lippen fest aufeinander, warf den Kopf zurück und sah mit zürnenden Augen vor sich hin. „Es ist das erste Mal, Vater, dass ich davon höre, dass Herbert dir für all deine großen Opfer mit Vorwürfen dankt, weil du nicht mehr mit vollen Händen geben kannst. Das durfte er nicht tun. Oh, er dürfte manches nicht tun. Glaube mir, Vater, wenn ich bisher auch zu allem geschwiegen habe – ich sehe Herbert schon lange mit ganz anderen Augen an als damals, da ich ihm mein Jawort gab. Ich war noch ein halbes Kind, sah in törichter Schwärmerei mein Ideal in ihm. Und ich wurde seine Frau – mit achtzehn Jahren –, er hatte mich ja überzeugt, dass nur ich ihm das Leben lebenswert machen könne. Kurze Zeit war ich glücklich in dem Bewusstsein, dass mir das gelungen sei. Ich ahnte ja nicht, dass nur mein Geld ihm das Leben lebenswert machen sollte.“
Tief erschüttert von diesem Bekenntnis der jungen Frau sah der Vater sein Kind an.
„Ich will dir offen sagen, Maria, dass ich an dein Glück schon seit Monaten nicht mehr glaubte. Ich sah so oft Tränenspuren in deinen Augen, meinte aber, du littest darunter, dass Herbert dich vernachlässige, und auch unter den veränderten pekuniären Verhältnissen. Ich habe mit Herbert einmal darüber gesprochen und ihn gefragt, was dich bedrücke. Da sagte er mir, du seiest unglücklich, weil du dir so viele Entbehrungen auferlegen müsstest. Und das hat mir das Herz natürlich sehr schwer gemacht.“
Sie warf sich aufschluchzend in seine Arme. „O lieber, lieber Vater, wie konnte er dein gütiges, liebevolles Herz so betrüben. Ich habe über das alles geschwiegen, du solltest nicht erfahren, wie grausam ich getäuscht worden bin. Aber da ich heute von dir hörte, dass er dich mit solchen Vorwürfen peinigt, musstest du alles wissen. Ich musste dir jetzt sagen, dass du mich nicht mehr triffst, wenn du ihn härter anfasst und ihm zeigst, dass du durchaus nicht verpflichtet bist, ihn zu erhalten. Lass dich nicht mehr von ihm quälen, lieber Vater, das darf nicht sein!“
Der alte Herr streichelte immer wieder in tiefem Erbarmen die Hände seiner Tochter. „Mein armes Kind – mein armes, liebes Kind!“
„Lass nur, Vater, es tut schon kaum mehr weh. Nur mein Stolz leidet noch immer darunter, wird immer darunter leiden, dass ich dieses Mannes Gattin wurde. Ich bin froh, dass ich ihn so wenig sehe. Den halben Tag verschläft er, die Nächte verbringt er außer Hause. Und es berührt mich kaum, dass eine andere Frau in seinem Leben eine Rolle spielt.“
„Ist das gewiss?“
„Ja, ich fand heute eine Karte, die er achtlos fallen ließ; ich werde sie dir zeigen. Die Frau muss eine Ausländerin sein – Engländerin oder Amerikanerin.“
Sie entnahm ihrem Schreibtisch eine Karte und reichte sie dem Vater. Er las:
Geliebter Freund! Ich wollen mit Ihnen besuchen heute Abend die Oper. Holen Sie mir ab in Adlon. Dort wir wollen nach die Oper zusammen speisen, wir zwei allein. Good bye!
Ihre Gladys
Die Karte bebte leise in der Hand des alten Herrn. „Dieser Schurke!“, stieß er heiser hervor.
Sie fasste seine Hand. „Nicht aufregen, lieber Vater, es trifft mich nicht mehr ins Herz.“
„Du kennst diese Gladys nicht?“
„Nein, ich weiß nur, dass sein Freund ihn vor einigen Wochen mit einer Gesellschaft von Amerikanern bekannt gemacht hat. Mir erklärte er, er hoffe, durch diese Amerikaner zu einer gesicherten Existenz zu kommen. Damit begründet er es auch, dass er so viel ausgeht. Dass er mich belogen hat, beweist diese Karte, die durchaus nicht nach geschäftlichen Verbindungen aussieht. Aber rege dich deshalb nicht auf, es trifft mich nicht mehr.“
Eine Weile herrschte Schweigen zwischen Vater und Tochter. Endlich richtete sich der alte Herr aus seiner Versunkenheit auf. „Nach alledem, was du mir gesagt hast, Maria, muss ich dich fragen, ob es nicht richtiger wäre, wenn du dich von ihm scheiden ließest.“
„Glaube mir, es hat mich zuweilen gelockt, mich durch eine Scheidung von ihm frei zu machen. Aber – ich bin deine Tochter, Vater, und habe gelernt, mein Wort zu halten, zumal ich es mit einem Schwur vor dem Altar bekräftigt habe. Nur weil ich erfahren musste, dass Herbert mich absolut nicht liebt und nur aus Berechnung heiratete, habe ich mich von ihm zurückgezogen. Aber mein Wort, mein Gelübde brechen – nein, das kann ich nicht. Wenn er sich von mir scheiden lassen will, werde ich mich nicht dagegen wehren, ich würde es sogar als eine Erleichterung betrachten. Aber selbst das Band zerschneiden, das uns fesselt, das geht gegen mein Empfinden. Dazu steht mir das Sakrament der Ehe zu hoch.“
Der Vater sah sie bekümmert an. „Du bist so jung, noch nicht einmal dreiundzwanzig Jahre alt – und das soll dein Schicksal sein?“
„Es ist mein Schicksal, Vater, und ich muss es tragen. Und da ich dir gebeichtet habe, wird es mir leichter werden.“
Er seufzte tief auf. „Wenn ich nur nicht so arm geworden wäre, wenn ich dir das Leben sonst wenigstens leichter machen könnte!“
„Quäle dich doch nicht damit. Was kommt, tragen wir nun wieder gemeinsam. Wie froh macht es mich, dass du nun hierher kommen wirst, dass ich dich immer bei mir haben werde!“
Er atmete auf. „Das ist ein Trost. Aber ein größerer Trost ist mir, dass ich dich immer reich mit Schmuck beschenkt habe, dass du diese Wertgegenstände noch besitzest, für den Notfall.“
Sie wurde totenbleich. „Mein Schmuck? Ach, lieber Vater …“
Er war umhergegangen, um sich zu beruhigen. Nun blieb er vor ihr stehen und sah sie unruhig an. „Maria! Was ist mit dem Schmuck? Es fällt mir jetzt auf, dass ich schon lange kein Schmuckstück an dir gesehen habe, außer dem Ring von deiner Mutter.“
Sie ließ kraftlos die Hände herabsinken. „Vater – der Schmuck ist fort.“
Er zuckte zusammen wie unter einem Schlag. „Fort?“
„Ja, schon lange – ich gab ihn Herbert auf seine dringende Bitte, er wollte ihn nur verpfänden und wieder einlösen, sobald er Geld beschaffen könne. Es ist nicht dazu gekommen er hatte eine Spielschuld, eine Ehrenschuld. Ach Vater, so erbärmlich kam er mir vor, dass ich es nicht mehr ertragen konnte, weil ich mich für ihn schämte. Da gab ich ihm meinen Schmuck. Ich habe ihn nicht mehr zurückbekommen – Herbert sagte mir endlich, dass er ihn nicht verpfändet, sondern verkauft habe. Das Geld ist ihm so schnell wie alles andere durch die Finger gelaufen. Später wollte er auch diesen Ring noch von mir haben, aber davon konnte ich mich nicht trennen, obwohl er mich auch darum tagelang quälte. Ach, mein lieber Vater, wie schwer hat mir das auf der Seele gelegen – immer fürchtete ich mich davor, es dir zu gestehen.“
Der alte Herr war sehr bleich geworden. Die edlen Züge seines Gesichts waren schlaff und fahl. Aber er brachte kein Wort des Vorwurfs hervor, er sagte nur heiser vor Erregung: „Das war mein letzter Trost – dass der Schmuck dich vor dem Schlimmsten bewahren könnte.“
Maria schluchzte auf. „Verzeihe mir, Vater – ich konnte nicht anders.“
„Dir verzeihen? Mein armes Kind, dir habe ich nichts zu verzeihen. Dein Gatte aber – das muss ich sagen – macht gründliche Arbeit. Er wetteifert mit der Inflation, uns an den Bettelstab zu bringen.“
Angstvoll sah Maria in des Vaters Gesicht. Dann trat sie zu ihm und legte ihm die Arme um den Hals.
„Ich bin sehr froh, dass nun alles, was ich verheimlichen musste, vom Herzen herunter ist. Mir ist, als habe ich mich selbst befreit mit dieser Beichte. Und du ziehst jetzt so schnell wie möglich zu uns, wir haben genug Platz.“
„Dagegen wird Herbert natürlich protestieren, aber wenn du mich brauchst, komme ich nur zu gern. Da werde ich auch auf Herberts Wünsche keine Rücksicht mehr nehmen.“
Sie küsste ihn und atmete auf. In ihre Augen kam ein hellerer Schein. „Und jetzt essen wir zusammen zu Abend, lieber Vater, ich freue mich darauf. Wir werden jetzt allein sein; Herbert wird mit jener Gladys in die Oper gehen und dann mit ihr bei Adlon soupieren. Woher er das Geld dazu nimmt, ist mir rätselhaft.“
Sie sagte das in einem so bitteren, verächtlichen Ton, dass es dem Vater ins Herz schnitt.
Während Maria in die Küche ging, um Anordnungen für das Abendessen zu geben, sagte Tornau vor sich hin: „Hotel Adlon also? Ich werde mir jedenfalls Gewissheit holen und mir diese Gladys einmal genau ansehen. Und dann werde ich mit meinem Herrn Schwiegersohn ein ernstes Wort reden.“
***
Laßberg saß im Vestibül des Hotels Adlon und wartete auf Gladys Boverley, die in diesem Hotel ein elegantes Appartement bewohnte. Sie hatte ihm sagen lassen, als er sich bei ihr melden ließ, dass sie noch beim Ankleiden sei. Dies musste sehr lange Zeit in Anspruch nehmen, denn Herbert Laßberg musste ziemlich lange warten.
Endlich belebte sich sein Blick, denn aus dem Fahrstuhl trat Mistress Boverley in einer so raffiniert eleganten Toilette heraus, dass aller Augen sich auf sie richteten. Flüchtig betrachtet, war sie noch immer eine glänzende, schöne Erscheinung. Man musste sie sehr genau ansehen, wenn man die leisen Spuren des beginnenden Verblühens bemerken wollte. Herbert Laßberg hatte sie kennen gelernt durch die amerikanischen Bekannten seines Freundes. Diese waren bereits wieder abgereist, aber Mistress Boverley war zurückgeblieben – weil sie Feuer gefangen hatte. Herbert Laßberg, der schöne elegante Nichtstuer, hatte ihre leicht erregbaren Sinne entflammt. Er kannte die Frauen und wusste genau, wie man es anfangen musste, sie zu fesseln und zu bezaubern. Während er ganz kalt blieb, konnte er in Frauenherzen die gefährlichsten Feuer entzünden.
Als er erfahren hatte, dass Gladys Boverley die Witwe und Alleinerbin eines Dollarmillionärs war, wurde sie sofort ein gewichtiger Faktor im Rechenexempel dieses kaltblütigen, berechnenden Mannes. Zunächst geschah das nur in der Absicht, die lebenslustige Witwe auszunutzen. Er war nie sehr wählerisch gewesen in den Mitteln, sich Einkünfte zu schaffen, hatte immer verstanden, sich pekuniäre Vorteile durch seinen Einfluss auf die Frauen zu verschaffen.
So hatte er sich auch mit kalter Berechnung in das Herz Maria Tornaus eingeschlichen, weil sie damals eine reiche Erbin war. Allerdings war Maria die einzige Frau gewesen, die ihm bisher etwas wie Zuneigung eingeflößt hatte, doch nur auf einige Zeit. Seit ihr reiches Erbe durch die Inflation und mancherlei geschäftliche Fehlschläge seines Schwiegervaters bedenklich zusammengeschmolzen war, hatte sie allen Reiz für ihn verloren. Er empfand die Ehe mit ihr nur noch als eine Last, die ihn hinderte, weiter Kapital aus seiner Persönlichkeit den Frauen gegenüber zu schlagen, und machte sich Vorwürfe, dass er sich an sie gefesselt hatte.
Diese Vorwürfe steigerten sich, seit er merkte, dass Mistress Boverley sich in ihn verliebt hatte. Er erzählte ihr, dass er sich im jugendlichen Unverstand an eine Frau hatte fesseln lassen, die er nicht liebte, die unbedeutend und reizlos sei und ihn unbefriedigt aus dem Hause treibe. Seine Gutmütigkeit habe ihn dazu gedrängt, diese Frau, die sich an ihn geklammert habe, zu heiraten, und nun sei ihm diese Ehe eine drückende Fessel geworden – seit er Gladys Boverley kennen gelernt habe.
Fast täglich war Herbert Laßberg mit Gladys Boverley zusammen, und während er berechnend in der leidenschaftlichen Frau das Feuer schürte, das er entfesselt hatte, während er sich den Anschein gab, als leide er qualvoll darunter, dass er nicht frei war, um sie sich erobern zu können, blieb er selbst im Innern eiskalt und beobachtete kritisch die Wirkung seines Verhaltens.
Während nun Herbert Laßberg aufsprang und die Hand der reichen Witwe inbrünstig an seine Lippen zog, sah sie ihn mit einem koketten Lächeln an.
„Haben ich Ihnen sehr lange warten lassen, meine liebe Freund?“, fragte sie.
„Die Zeit ist mir nicht lang geworden, Mistress Gladys, ich habe sie mir damit vertrieben, an Sie zu denken.“
Sie lächelte ihm geschmeichelt zu. „Jetzt nehmen wir erst zusammen den Tee, ehe wir fahren in die Oper, wir haben noch Zeit.“
Er geleitete sie in den Teeraum, und während sie dort saßen, flüsterte er ihr immer wieder allerlei schmeichlerische Komplimente und Zärtlichkeiten zu. Er gab sich den Anschein, rasend verliebt zu sein, und spielte ihr meisterlich eine glühende Leidenschaft vor, die er durchaus nicht empfand, die aber Gladys Boverley immer heftiger in ihn verliebt machte.
„I love you – I love you“, sang sie leise vor sich hin.
„Sie spielen mit mir, Gladys, Sie sind grausam!“, klagte er anscheinend verzweifelt.
Von unten herauf sah sie ihn an. „Was kann ich tun? Da Sie doch haben eine Frau, was kann ich anders tun als spielen? Ich – oh, ich machen auch lieber Ernst aus diese Spiel. Aber Ihre Frau? Ich kann meine Herz nicht schenken eine verheiratete Mann.“
Wieder haschte er nach ihrer Hand. „So habe ich jetzt nur noch einen Wunsch: mich frei zu machen, frei für Sie, Gladys. Darf ich dann hoffen? Darf ich glauben, dass ich mit Ihnen gehen darf für immer? Aber nein, ich Unglücklicher kann es mir ja nicht einmal vergönnen, mit Ihnen zu gehen; ich bin leider so arm geworden durch die Inflation, so arm.“
Dieses Märchen erzählte Herbert Laßberg jedem, der es hören wollte, erzählte es so oft, dass er es fast selber glaubte. Auch Gladys Boverley hatte er es aufgetischt. Dass er seit seiner Verheiratung auf Kosten seines Schwiegervaters lebte, hatte er ihr verschwiegen – wie er alles verschwieg, was nicht in seinen Plan passte.
Sie schnippte mit den Fingern: „Lassen Sie die dumme Geld! Wenn Sie werden frei sein und mit mich gehen – dann brauchen Sie keine Geld, das sein dann meine Sache.“





























