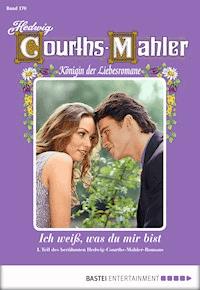
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Hedwig Courths-Mahler
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Monatelang hat der junge Freiherr Helmut von Waldeck eine Stellung gesucht, vergeblich. In seiner Not nimmt er das Angebot des reichen Emporkömmlings Römhild an, ihn als Diener auf einer Weltreise zu begleiten. Kurz vor der Abfahrt lernt Helmut die reizende Regina Darland kennen, die einen unauslöschlichen Eindruck auf ihn macht. Doch der Zufall enthüllt ihm, dass Regina die Braut Römhilds ist. Helmut kann es kaum begreifen: die schöne, zarte Regina und der grobschlächtige Römhild? Die beiden passen doch gar nicht zusammen! Aber dann erfährt er, dass Römhild die Existenz und die Ehre von Reginas Vater in den Händen hält ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 167
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Ich weiß, was du mir bist
Vorschau
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
© 2015 by Bastei Lübbe AG, Köln
Verlagsleiter Romanhefte: Dr. Florian Marzin
Verantwortlich für den Inhalt
Titelbild: Anne von Sarosdy/Bastei Verlag
E-Book-Produktion: César Satz & Grafik GmbH, Köln
ISBN 978-3-7325-2201-9
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
www.bastei.de
Ich weiß, was du mir bist
Ergreifender Roman um die Seelenqualen eines jungen Mädchens
Helmut von Waldeck stand, nur mit einem Pyjama bekleidet, am Fenster seines nach dem düsteren Hof hinaus gelegenen Zimmerchens. Mit finsteren Blicken betrachtete er den einzigen Anzug, der ihm geblieben war. Mit einer Bürste bearbeitete er ihn sorgsam, dass kein Stäubchen daran blieb. Dann reinigte er mit derselben Sorgfalt sein einziges Paar Schuhe und prüfte bekümmert die Festigkeit der Sohlen, die schon recht abgelaufen waren.
Es klopfte an seine Tür, und auf seinen Zuruf trat seine Wirtin ein, auf einem Tablett das mehr als bescheidene Frühstück tragend. Sie setzte es auf den kleinen, wackeligen Tisch und rückte unwirsch daran herum.
„Guten Morgen, Frau Haller!“, sagte Helmut artig.
Sie sah ihn halb verdrießlich, halb mitleidig an.
„Guten Morgen! Na wie ist es denn, Herr Waldeck, kriege ich endlich mein Geld? Heute ist der Erste, und nun sind Sie mir schon die Miete von zwei Monaten schuldig!“
In Helmuts Stirn stieg brennende Röte. Er zog ein abgegriffenes Portmonee aus der Tasche seiner Hose und öffnete es. Den Inhalt schüttete er auf den Tisch. Es waren vier Mark und einiges Kleingeld.
„Das ist alles, was ich habe, Frau Haller.“
Sie schnippte verächtlich das Geld fort.
„Was soll ich denn damit anfangen? Haben Sie wirklich nicht mehr zusammengekriegt? Geht denn der Handel mit Seife so schlecht?“
Er fuhr sich verzweifelt durchs Haar.
„Er geht so gut wie gar nicht, Frau Haller. Gestern Abend habe ich mit der Seifenfirma abgerechnet – und das ist alles, was mir geblieben ist.“
„Lieber Gott! Und dafür haben Sie acht Tage gearbeitet?“
„So ist es. Ich werde auch diesen Seifenhandel aufgeben müssen.“
„Wenn er nicht mehr einbringt, selbstverständlich. Aber wie komme ich nur zu meinem Geld? Ich will Sie wahrhaftig nicht drängen, weil es mir Vergnügen macht, aber ich muss doch meine Miete auch bezahlen!“
„Das verstehe ich schon, Frau Haller, und es ist mein innigster Wunsch, Geld zu beschaffen. Ich habe doch alles versucht, das wissen Sie.“
„Na ja! Und wenn Sie auch ein Freiherr sind – das habe ich doch auf den Briefen gelesen, die Sie früher gekriegt haben –, Sie haben wirklich wie ein Tagelöhner gelebt und mir alles abgegeben, was Sie verdient haben. Wenn ich es nur selber nicht so nötig brauchte!“
„Sie sind eine gute Seele, Frau Haller. Haben Sie noch ein Weilchen Geduld, vielleicht hilft der Himmel doch! Würden Sie mir Ihre Zeitung noch mal leihen? Ich will versuchen, eine andere Stellung zu bekommen.“
Sie sah ihm mitleidig in das schmal gewordene Gesicht. Dass er sich kaum die nötigste Nahrung verschaffen konnte, wusste sie. Er tat ihr Leid, er war ein so feiner Mensch – aber sie musste ja auch die Miete bezahlen.
Doch sie brachte ihm die Zeitung, und das wenige Geld ließ sie ihm auch.
Als Helmut von Waldeck wieder allein war, sah er starr vor sich hin. Wie sollte er bloß die Miete für zwei Monate beschaffen? Ganz ausgeschlossen, wenn nicht ein Wunder geschah! Er hängte seinen gereinigten Anzug in den schmalen Kleiderschrank, zu Hause behalf er sich mit dem Pyjama, damit er den Anzug schonte. Im Schrank hing nur noch ein dünner Paletot. Er schob ihn beiseite, weil er nicht richtig aushängen konnte und deshalb Falten bekam, denn unten im Schrank stand ein kleiner Handkoffer. Er sah darauf nieder. Vielleicht fand er darin doch noch etwas, das er zu Geld machen konnte. Hastig nahm er ihn heraus. Dieser Handkoffer hatte einst bessere Tage gesehen, das merkte man. Helmut schaute ihn kritisch an. Ob er ihn verkaufen konnte? Es war ein Lederkoffer, und er war noch gut erhalten. Aber viel bekam er sicher nicht dafür.
Er schloss ihn auf und legte ihn auf sein Bett. Die eine Hälfte war leer, darin hatte er seine wenigen Habseligkeiten verpackt, als er diese Zufluchtsstätte vor einigen Monaten bezog. In der anderen Hälfte verwahrte er den letzten Rest von dem, was seine Mutter, die Gräfin Reichenau, bei ihrem Tod hinterlassen hatte. Sie war in zweiter Ehe mit einem Grafen Reichenau verheiratet gewesen, denn sein Vater war schon gestorben, als er kaum zehn Jahre gezählt hatte. Graf Reichenau hatte als Kammerherr bei einem der königlichen Prinzen Dienst getan, seine Stellung aber beim Sturze der Dynastie verloren. Mit einer sehr knappen Pension hatte er sich fortan behelfen müssen, aber noch sehr viel knapper war die, die seine Mutter nach seinem Tod bezog. Sie hatte nicht mehr gereicht, Helmut die Möglichkeit zu gewähren, sein Studium zu beenden. Er hatte Ingenieur werden wollen. Im dritten Jahre studierte er, als sein Stiefvater starb und er das Studium aufgeben musste. Drei Jahre danach starb auch seine Mutter. Sie hatte nur eine kleine Amtswohnung innegehabt, und kein Stück darin gehörte ihr.
Nach dem Tod der Mutter verlor er dieses Heim, denn die Amtswohnung ging nun in andere Hände über. Selbstverständlich erlosch auch die Pension der Mutter. Helmut konnte die gesamte Hinterlassenschaft der Mutter in die eine Hälfte des Koffers packen, nachdem er ihre Garderobe verkauft hatte. Der Erlös dieser Habseligkeiten verschwand wie Schnee an der Sonne, denn man stand im letzten Inflationsjahr. Und dann hatte er versucht, eine wenn auch noch so bescheidene Existenz zu gründen. Alles schlug ihm fehl. Wer sollte auch einem kaum halb fertigen Ingenieur anstellen, wo so viele fertige Ingenieure keine Stellung bekamen?
Immer bescheidener wurden seine Ansprüche, immer mehr kam er herunter, obwohl er keine Arbeit scheute. Aber nun war er am Ende.
Er biss die Zähne zusammen und kramte im Nachlass der Mutter. Da waren Papiere und Briefe, die ihm wohl ein Andenken bedeuteten, aber keinen Wert hatten, eine Fotografie der Mutter und eine seines Stiefvaters, verschiedenes Briefpapier von Mutter und Stiefvater, mit der Grafenkrone geschmückt, darunter einige Bogen, die leer waren bis auf die Unterschrift seiner Mutter. Er hatte für sie zuweilen Briefe schreiben müssen, weil ihre Augen geschont werden mussten, und da hatte sie immer auf Vorrat einige Bogen unterschrieben.
Nora, Gräfin Reichenau!
Er starrte auf die Unterschrift hinab. Und da kam ihm plötzlich wie ein Blitz ein verlockender Gedanke. Überall, wo er sich um eine Stellung beworben hatte, hatte man ihn nach Zeugnissen gefragt, und dass er keine vorweisen konnte, machte stets eine Anstellung unmöglich. Wie nun, wenn er ein Zeugnis der Gräfin Reichenau vorweisen würde? Niemand ahnte, dass dies seine Mutter war. Er brauchte nur oberhalb ihrer Unterschrift ein Zeugnis für sich niederzuschreiben, dann hatte er, was er brauchte.
Erschrocken über sich selbst schob er die Bogen rasch wieder ganz zu unterst in den Koffer. Und dabei stach er sich an einem spitzen Gegenstand. Er sah nach, was es gewesen war, und fand eine goldene Schmucknadel mit einer kleinen Perle in der Mitte. Seufzend betrachtete er das Schmuckstück. Was diese Nadel wohl wert war – was er wohl dafür bekommen würde? Ob er davon vielleicht wenigstens einen Teil der Miete bezahlen konnte? Bisher hatte er sich von diesem Andenken an die Mutter nicht trennen mögen. Nun aber musste es sein, er musste Frau Haller bezahlen, sonst kündigte sie ihm das Zimmer. Und was dann?
Er legte alles andere wieder in den Koffer, die Nadel ließ er draußen. Nachdem er den Koffer in den Schrank gestellt hatte, hüllte er die Nadel in Papier und steckte sie in die Brusttasche seines Anzugs.
Und dann begann er mit dem Studium der Zeitung. Stellengesuche in großer Menge, aber keine Stellenangebote, wenigstens keine, die für ihn in Frage kamen, weil er von vornherein wusste, dass er die nötigen Kenntnisse nicht hatte. Chauffeure? Die wurden gesucht, aber er besaß leider keinen Führerschein, der kostete ja Geld.
Er sah langsam die Spalten der Stellenangebote durch. Nichts – nichts, was für ihn in Frage kam. Aber plötzlich, als er die Hoffnung schon fast aufgegeben hatte, blieben seine Augen auf einem fett gedruckten Inserat ruhen:
Herrschaftlicher Diener gesucht! Zur Begleitung auf einer Weltreise wird ein erstklassiger Diener gesucht, der möglichst Kenntnis der englischen Sprache besitzt. Verlangt wird repräsentable Persönlichkeit mit guten Umgangsformen, sicher in allen Dingen, die nötig sind zur perfekten Bedienung eines Herrn. Bewerber mit nur erstklassigen Zeugnissen wollen sich melden Mittwoch, zwischen 10 und 12 Uhr, Villa Römhild, Grunewald am Hertasee.
Mit brennenden Augen blickte Helmut auf diese Worte nieder. Herrschaftlicher Diener? Nun, was ein solcher wissen musste, das würde er leisten können. Wenn er auch noch keinen Herrn bedient hatte, so war er doch bedient worden. Und: auf einer Weltreise? Herrgott! Das konnte ihn reizen!
Aber – erstklassige Zeugnisse wurden verlangt, und die besaß er nicht. Doch da flog sein Blick wie magnetisch angezogen nach dem Kleiderschrank hinüber. Dort drinnen stand der Koffer, in dem sich die von seiner Mutter unterschriebenen Briefbogen befanden. Wenn er nun für sich ein Zeugnis schrieb?
Wie von einer inneren Macht getrieben, erhob er sich und nahm den Koffer aus dem Schrank. Er schloss ihn auf und holte die Briefbogen hervor. Unschlüssig sah er darauf nieder. Nein, es ging doch nicht, wenn er das Zeugnis mit eigener Hand schrieb, das konnte herauskommen, er konnte eventuell in die Notwendigkeit versetzt werden, etwas schreiben zu müssen.
Aber es gab ja Schreibmaschinen! Selbstverständlich konnte man das nicht von einer fremden Person schreiben lassen. Doch er selbst hatte früher zuweilen für seinen Stiefvater auf dessen Schreibmaschine geschrieben und – richtig, da nebenan wohnte doch eine Mieterin, die eine Schreibmaschine besaß! Wenn er an die Schreibmaschine heran könnte?
Aber erst mal ein Zeugnis aufsetzen. Er überlegte, und dann floss es ihm ganz leicht aus der Feder.
Ja, so ging es, das klang gut, vertrauenerweckend und enthielt nicht einmal falsche Angaben über ihn, außer, dass er eben nie als Diener im Haus der Gräfin Reichenau engagiert gewesen war. Als er fertig war, rief er seine Wirtin.
Sie kam sogleich.
„Frau Haller, ich habe da in der Zeitung ein Stellenangebot gefunden, aber es wird verlangt, dass man Offerten einreichen muss, die mit der Schreibmaschine geschrieben sind. Meinen Sie, dass ich es wagen dürfte, bei meiner Zimmernachbarin diese Offerte auf deren Maschine zu schreiben?“
Frau Haller sah ihn unschlüssig an.
„Ja, können Sie denn auf der Maschine schreiben?“
„O ja!“
„Hm, na, weil Sie es sind – dann meinetwegen. Soll es denn gleich sein?“
„Es wäre mir das liebste.“
„Na, dann kommen Sie mal!“
Helmut nahm sein Konzept und einen von seiner Mutter unterschriebenen Briefbogen. So gingen sie beide ins Nebenzimmer, in dem auf einem kleinen Tisch die Maschine stand.
Schon hatte Helmut den Überzug herabgezogen und setzte sich vor die Maschine. Gewandt spannte er den Bogen ein und begann, sein Konzept abzuschreiben. Dann faltete er den Bogen zusammen.
„Ich bin fertig, Frau Haller, und danke Ihnen sehr. Vielleicht habe ich diesmal Glück. Und nun will ich mich schnell anziehen und zum Goldschmied gehen, ich habe da in meinem Koffer noch eine goldene Nadel von meiner Mutter gefunden; ich will sehen, was ich dafür bekomme. Vielleicht kann ich Ihnen dann wenigstens einen Teil meiner Schuld bezahlen.“
Als Helmut wieder in seinem Zimmer war, las er das von ihm verfasste Zeugnis noch einmal durch. Es klang sehr überzeugend. Morgen war Mittwoch, da wollte er sich also zur vorgeschriebenen Zeit in der Villa Römhild melden.
Jetzt kleidete er sich an und machte sich zum Ausgehen fertig. Und er sah in seinem sorglich behüteten Anzug noch sehr anständig aus. Dass er eine sympathische Erscheinung war, energische Gesichtszüge hatte, einen ausdrucksvollen, und schmallippigen Mund, kluge graue Augen und elegante Bewegungen, das fiel ihm allerdings selbst nicht auf. Er war absolut nicht eitel. Aber als er dann durch die belebten Straßen ging, folgte ihm mancher Blick aus Frauenaugen. Er war unstreitig eine interessante Persönlichkeit und kein Mensch hätte ihm angesehen, dass ihm der Magen knurrte und dass er seiner Wirtin zwei Monate Miete schuldig war.
Nach einigem Zögern trat er in einer stillen Seitenstraße in den Laden eines Goldschmieds. Dieser kam ihm erwartungsvoll entgegen, blickte aber dann enttäuscht, als der vermeintliche Käufer etwas verkaufen wollte. Lange sah er auf die Nadel herab, betrachtete sie durch die Lupe und wog sie ab. Endlich, ahnungslos, welche Nervenmarter er Helmut auferlegte, sagte er:
„Mehr als hundert Mark kann ich Ihnen nicht zahlen, das Gold zählt ja kaum, und wenn die Perle auch tadellos ist, so ist sie doch nicht sehr groß. Wie gesagt – hundert Mark.“
Helmut hätte fast aufgejuchzt. Hundert Mark. So viel hatte er nicht erwartet!
Seine Nerven versagten fast, bis er die hundert Mark in den Händen hatte. Und dann verließ er den Laden, sich zu einer Ruhe zwingend, die er nicht besaß. Jetzt konnte er doch wenigstens seine Miete bezahlen!
***
Am nächsten Morgen stand Helmut schon fünfzehn Minuten vor zehn Uhr am Gartentor der Villa Römhild. Mit brennenden Augen schaute er hinüber zu dem vornehmen Sandsteingebäude, das inmitten eines parkähnlichen Gartens lag.
Punkt zehn Uhr klingelte er an der Torglocke. Das Gartentor öffnete sich, wie von unsichtbaren Händen dirigiert, und Helmut schritt schnell auf die Villa zu, wo ein Diener an der breiten Steintreppe stand.
„Ich komme als Bewerber für die ausgeschriebene Stelle eines Dieners“, sagte Helmut ruhig.
Der Diener sah ihn verblüfft an. Dann antwortete er:
„Ah, so! Bitte, folgen Sie mir!“
Helmut ging hinter ihm her in das elegante Vestibül, einen langen Gang hinab, durch teppichbelegte Räume, bis vor einer hohen Flügeltür Halt gemacht wurde.
„Bitte, warten Sie!“, sagte der Diener, dann verschwand er hinter der Flügeltür.
Helmut hatte gerade Zeit, sich ein wenig umzusehen und zu konstatieren, dass hier sehr reiche Leute wohnen mussten, als auch schon der Diener zurückkam und ihn mit einer Handbewegung aufforderte, einzutreten.
Das tat Helmut, äußerlich ruhig, aber mit rebellischem Herzklopfen. Er befand sich in einem großen Gemach, dessen Ausstattung andeuten sollte, dass es ein Arbeitszimmer war, da ein Schreibtisch und Bücherregale darin untergebracht waren. Die tiefen Klubsessel aber, der breite, mit Kissen bedeckte Diwan, die weichen Teppiche und – die Haltung des Herrn, der in diesem Raum saß, eine Zigarette rauchend, straften diese Andeutungen Lügen.
Ohne seine bequeme Lage zu ändern, sagte der Herr:
„Treten Sie näher!“
Helmut stieg bei dem Ton, in dem das gesagt wurde, das Blut in die Stirn, aber er sagte sich, dass er hier keine Empfindlichkeit zeigen dürfe, er war ja hier, um eine Stelle als Diener zu suchen.
Ruhig trat er näher heran und blieb in geziemender Entfernung vor dem Klubsessel stehen, in dem der Herr mehr lag als saß.
Und nun erst war der Herr imstande, Helmuts ganze Persönlichkeit mit einem Blick zu umfassen, und unwillkürlich richtete er sich auf.
„Sie wollen sich um die Stelle eines Dieners bei mir bewerben?“
„Ja, mein Herr.“
Alfred Römhild lachte ein wenig, halb verlegen, halb belustigt. Er war ein Mann in der zweiten Hälfte der Dreißig, hatte harte, feste Züge und einen brutalen Mund. Seine braunen Augen und das braune Lippenbärtchen harmonierten zusammen. Er hatte eine frische Gesichtsfarbe und machte den Eindruck großer Akkuratesse in seinem Äußeren. Aber in den Augen lag ein Ausdruck, der Helmut verriet, dass dieser Mann über Leichen gehen würde, um ein gestecktes Ziel zu erreichen.
„Hm! Sie sehen wahrhaftig nicht aus, als bemühten Sie sich um die Stelle eines Dieners.“
Helmut biss einen Moment die Zähne zusammen, dann sagte er, anscheinend ruhig.
„Sie verlangten in Ihrem Inserat eine repräsentable Persönlichkeit. Ein erstklassiger Diener muss so aussehen, dass er seine Herrschaft angemessen repräsentiert. Ich hoffe bestimmt, Sie in dieser und jeder anderen Beziehung zufrieden zu stellen, falls Sie mich engagieren sollten.“
Mit einem eigenartigen Blick musterte Alfred Römhild den Bewerber. In diesem Blick lagen ein wenig Bewunderung, ein wenig Neid auf das vornehme Aussehen dieses Menschen, ein wenig Stolz auf die eigene Bedeutung und den selbst erworbenen Reichtum und bereits ein wenig der Wunsch, sich diese „Kraft“ zu sichern.
„Wie ist es mit Ihren Sprachkenntnissen?“
„Ich spreche perfekt Englisch und Französisch.“
Wieder traf Helmut der sonderbare Blick.
„Also Englisch und Französisch. Und perfekt, das ist mir wichtig. Wie ist Ihr Name?“
„Helmut Waldeck.“
„Und wo waren Sie zuletzt in Stellung?“
„Im Hause des Grafen Reichenau.“
„Ah?“ Es blitzte befriedigt in Herrn Römhilds Augen auf. Ein Diener, der vor ihm einen Grafen Reichenau bedient hatte – das konnte ihm gefallen. Forschend sah er Helmut wieder an.
„Wo waren Sie sonst noch in Stellung?“
„Nirgends weiter, gnädiger Herr, ich war vier Jahre im Hause des Grafen Reichenau, und vorher hatte ich es nicht nötig, eine Stellung anzunehmen. Wir – wir sind erst durch die Inflation verarmt.“
So, das entsprach wenigstens der Wahrheit!
„Haben Sie Zeugnisse?“
Nur einen kurzen Moment zögerte Helmut, ehe er das Zeugnis aus seiner Brusttasche nahm.
„Nur das über meine Tätigkeit im Hause des Grafen Reichenau. Nach dem Tode des Grafen blieb ich noch zwei Jahre im gräflichen Haushalt, weil mich die Frau Gräfin nicht gern entbehren wollte. Aber dann sah ich ein, dass ich dort zu wenig Beschäftigung hatte, und bat um meine Entlassung. Bald darauf ist auch die Gräfin Reichenau gestorben.“
Damit übergab Helmut mit klopfendem Herzen, aber scheinbar ruhig das Zeugnis.
Herr Römhild betrachtete erst mit einem geheimen Wohlgefühl den vornehmen Briefbogen mit der Grafenkrone. Dann las er das Zeugnis und nickte vor sich hin. „Nun, daraufhin kann ich es wohl mit Ihnen wagen, wenn wir sonst einig werden. Ich muss aber gleich bemerken, dass Sie sich für die ganze Dauer meiner Weltreise verpflichten müssen. Zwei Jahre wollen wir dafür annehmen, bis dahin bin ich bestimmt zurück. Würden Sie damit einverstanden sein, zwei Jahre mit mir auf Reisen zu gehen?“
„Sehr gern, gnädiger Herr.“
„Nun, das klingt ja ganz vergnügt. Sie lassen da wohl nichts Liebes zurück?“, fragte Herr Römhild mit einem etwas faunischen Lächeln, das Helmut sehr missfiel.
„Nein“, sagte er nur kurz.
„Na, umso besser für Sie, da bin ich etwas schlimmer dran. Ich lasse etwas Liebes zurück – aber ehe ich mich verheirate, will ich mir die Welt ansehen. Die Hochzeit hat Zeit, bis ich nach zwei Jahren zurückkomme. Aber das nur nebenbei. Sie sind doch gleich abkömmlich? Ich will schon in der übernächsten Woche abreisen.“
„Ich stehe sofort zur Verfügung.“
„Was haben Sie beim Grafen Reichenau an Gehalt bekommen?“
Das war eine Frage, auf die Helmut nicht vorbereitet war. Was sollte er sagen? Es fiel ihm zum Glück ein, dass der Diener seines Stiefvaters monatlich hundert Mark bei freier Station bekommen hatte. Aber er sagte sich, dass er als „erstklassiger Diener“ mehr fordern müsse.
„Ich bekam hundertfünfzig Mark im Monat bei freier Station und freier Dienstkleidung – außer kleinen Nebeneinnahmen.“
„Ah, Sie bekamen also wohl viele Trinkgelder?“
Heiß stieg die Röte in Helmuts Stirn. Aber er brachte es doch fertig, ruhig zu bleiben.
„Allerdings, gnädiger Herr!“
„Nun, bei mir werden die Trinkgelder ausfallen, da wir ja unterwegs sind und ich kaum Gastereien veranstalten werde, bei denen Sie auf Ihre Rechnung kommen.“
Gott sei Dank, dachte Helmut, verneigte sich aber nur stumm, um keine Dummheit zu machen. Der Gedanke, Trinkgelder nehmen zu müssen, peinigte ihn.
Alfred Römhild lachte.
„Na, da müsste ich Sie also für die ausgefallenen Trinkgelder entschädigen. Ich werde Ihnen also monatlich zweihundert Mark zahlen, selbstverständlich bei freier Station. Für anständige Unterkunft und Verpflegung in den Hotels garantiere ich Ihnen. Ich will nicht, dass Sie schlecht gehalten werden. Es wirft immer ein schlechtes Licht auf die Herrschaft, wenn die Bedienung schlecht gehalten wird. Da brauchen Sie also keine Angst zu haben. Die Dienstkleidung, wie Sie es nennen, also die Livree, wird Ihnen ebenfalls frei geliefert. Und dann müssen Sie sich selbstverständlich gehörig für die Reise ausstatten, wir werden ja auch in die Tropen kommen. Und einen Kabinenkoffer für die Dampferfahrt brauchen Sie auch, und sonst noch allerlei.“
Helmuts Gesicht wurde lang. Beklemmend fiel ihm aufs Herz, dass sich daran das Engagement, auf das er schon zu hoffen gewagt hatte, zerschlagen könnte. Schon wollte er erwidern, dass er dazu nicht in der Lage sei, als Herr Römhild lachend sagte:
„Nein, nein, Sie brauchen keine Angst zu haben. Ausstattung für die Reise geht ebenfalls auf meine Kosten. Ich wünsche, dass Sie anständig auftreten in jeder Beziehung.“





























