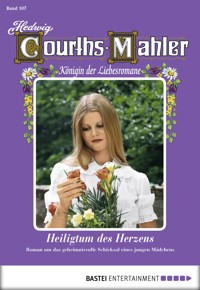1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Hedwig Courths-Mahler
- Sprache: Deutsch
Bereits in früher Kindheit hat Martina Dornberg viele bittere Erfahrungen hinnehmen müssen. Im Alter von elf Jahren verliert sie den Vater, und drei Jahre später stirbt mit ihrer Mutter der einzige Mensch, von dem die junge Martina je Liebe erfahren hat. Fortan lebt sie in Rainau schutzlos dem Hass der Verwandten ausgesetzt, die ihrer Mutter nie verziehen haben, dass sie kein großes Vermögen in die Ehe eingebracht hat. Ihr Dasein scheint trostlos, doch dann tritt eines Tages der Bruder ihrer Mutter in ihr Leben und nimmt sie mit nach Sumatra. Auf der paradiesisch schönen Insel verbringt Martina nun eine sorglose und glückliche Jugend, bis ihr eines Tages erneut großes Leid widerfährt...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 182
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Die Sonne von Lahori
Vorschau
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
© 2015 by Bastei Lübbe AG, Köln
Verlagsleiter Romanhefte: Dr. Florian Marzin
Verantwortlich für den Inhalt
Titelbild: Anne von Sarosdy/Bastei Verlag
E-Book-Produktion: César Satz & Grafik GmbH, Köln
ISBN 978-3-7325-2208-8
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
www.bastei.de
Die Sonne von Lahori
Einer der schönsten Romane von Hedwig Courths-Mahler
Martina saß in ihrem schwarzen Kleidchen ganz zusammengesunken in einem Sessel, der dicht am Kamin in einer Ecke stand. Sie zog fröstelnd die Schultern hoch und starrte in die verglimmende Glut des Kaminfeuers.
Aus dem Nebenzimmer klangen nun Stimmen zu ihr herüber. Wie aus einer weiten Ferne, fast unwirklich, tönten sie an Martinas Ohr. Keine von diesen Stimmen hatte etwas Warmes, Tröstliches für die arme Waise, deren Mutter man vor einer Stunde hinausgetragen hatte auf dem letzten Weg ins dunkle Nichts. Die Mutter schlief jetzt in der abgelegenen Parkecke unter den Kastanien, die weit ihre Äste breiteten über dieses kleine geweihte Erdenfleckchen, wo die Rainauer Bewohner ihre Toten bestatten durften, auf einer Art privatem Friedhof. Dort war auch schon Martinas Vater begraben worden, nach einem selbst gewollten Ende, das man milde als einen „Jagdunfall“ bezeichnete. Der Tod der Mutter aber war der Schlussstrich unter ein leidvolles, quälendes Dasein gewesen.
Immer musste Martina daran denken, was die Mutter ihr kurz vor ihrem Tod gesagt hatte: „Weine nicht um mich, wenn ich gestorben bin, mein liebes Kind. Mir wird wohl, so wohl sein. Aller Schmerzen, aller Not bin ich dann ledig; niemand kann mich mehr quälen. Nur um dich selbst wirst du weinen müssen, mein armes, liebes Kind. Aber wenn Gott mein Gebet erhört, wird er dich vor einem kummervollen Dasein bewahren, wie ich es führte.“
Und dann hatte sie ihr ein versiegeltes Kuvert übergeben, in dem sich ein Buch befand, und gesagt: „Dieses Buch sollst du Onkel Georg, meinem lieben Bruder, geben, wenn du ihn eines Tages wiedersiehst. Hoffentlich ist dieser Tag nicht weit. Onkel Georg soll es durchlesen, es ist mein Tagebuch, und er soll es für dich bewahren, bis du achtzehn Jahre alt bist. Dann sollst auch du es lesen und daraus lernen, dass der Mensch nur ein Spielball ist für Schicksalsmächte. Verwahre es gut, dieses Buch.“
Und Martina hatte dieses Buch in dem versiegelten Kuvert sorgfältig unter ihren wenigen Habseligkeiten droben in ihrem ärmlichen Giebelzimmer versteckt. Sie wusste, warum die Mutter die kalten, mitleidlosen Augen ihrer angeheirateten Verwandten nicht auf ihren Tagebuchblättern ruhen lassen wollte.
Und wieder schauerte sie fröstelnd zusammen und lauschte in dumpfer, stumpfer Angst hinüber ins Nebenzimmer. Da waren alle ihre Verwandten väterlicherseits versammelt, um über ihr Schicksal zu beraten. Die Mutter hatte nur einen einzigen Verwandten hinterlassen, ihren Bruder Georg. Aber der weilte in fernen Landen und ahnte wohl nicht einmal, dass seine einzige, geliebte Schwester, kaum fünfunddreißig Jahre alt, ihr Dasein beendet hatte.
Matt und erschöpft von vielen Nachtwachen am Bett der kranken Mutter und vom vielen Weinen, ließ Martina ihr Haupt immer tiefer auf die Brust sinken. Sie war zum Sterben müde und hätte sich am liebsten mit der toten Mutter hinaustragen lassen. Man hatte dem kaum vierzehnjährigen Mädchen die schwere Krankenpflege ganz allein überlassen. Niemand hatte in diesem Haus Zeit für die blasse, stille Frau Maria und ihr Töchterchen Martina. Diese beiden Menschen waren allen anderen Hausbewohnern lästig – man hätte sie gern hinausgestoßen aus dem Haus, wenn man sich nicht vor dem Gerede der Menschen gefürchtet hätte.
Aber hinauf in das Dachgeschoss hatte man sie verbannt, in die beiden schmalen Giebelzimmer. Da hinauf schickte man ihnen die karge Kost, seit Frau Maria bettlägerig war. Was lag an dem Wohl und Wehe dieser beiden Menschen?
Und doch war Martinas Mutter vor fünfzehn Jahren als strahlend glückliche Braut in Rainau eingezogen. Damals hatte die ganze Familie Dornberg sich nicht genug tun können, sie zu umschmeicheln. Herr Theodor Dornberg, Martinas Großvater, hatte ihr mit schmeichlerischen Worten die Hände geküsst und sie „mein geliebtes Töchterchen“ genannt. Die Großmutter hatte ihre Hände gestreichelt und sie immer wieder in die Arme gezogen, und Frau Marias beide Schwägerinnen, Melanie und Helene, hatten ihr versichert, sie müsse ihre geliebte Freundin werden. Frau Marias Gatte aber, Rupert Dornberg, hatte seine schöne junge Frau über die Schwelle des Hauses getragen und ihr süße Kosenamen ins Ohr geflüstert.
Und das alles war nur geschehen, weil man in Maria die reiche Erbin sah, welche die Schuldenlast von Rainau nehmen und für all diese Menschen eine sorglose Zeit herbeizaubern sollte. Man erwartete von ihr einen reichen Goldsegen, denn sie war die Tochter des reichen Bankiers Feldner, und sie besaß nur einen einzigen Bruder, mit dem sie einst das reiche Erbe zu teilen haben würde.
So umschwärmte man sie wie eine Erlöserin aus der Misere eines sorgenvollen Daseins. Aber es war dann betrüblich schnell ganz anders gekommen.
Verlobung und Hochzeit folgten kurz aufeinander, und alles schien eitel Glanz und Wonne. Aber schon bald verdichtete sich Marias Verdacht, dass Rupert sie nur aus berechnenden Gründen zu seiner Frau gemacht hatte.
Die Gewissheit über diese Frage sollte ihr sehr bald in erschreckender Weise kommen. Eines Tages kam die Kunde nach Rainau, der Bankier Feldner habe sich erschossen, weil er durch eine missglückte Riesenspekulation ruiniert sei. Es herrsche eine heillose Verwirrung im Bankhaus Feldner, alles sei verloren.
Maria war wie versteinert, als sie diese Kunde vernahm, aber das Entsetzen lähmte sie vollends, als nun alle Familienmitglieder über sie herfielen mit hässlichen, grausamen Anschuldigungen. Auch ihrem Gatten fiel in dieser Stunde die Maske vom Gesicht, und sie sah ihn in seiner ganzen erbärmlichen Niedrigkeit. Er ließ es zu, dass man sie die Tochter eines Betrügers nannte, die, selbst eine Betrügerin, sich in eine ehrenwerte Familie eingeschlichen habe. Und ihr Gatte machte gemeinsame Sache mit seiner Familie, sagte ihr in kalten, dürren Worten, dass er mit ihr betrogen worden sei. Er habe gehofft, mit ihr eine reiche Partie zu machen, und sei gar nicht imstande gewesen, eine vermögenslose Frau zu heiraten.
Maria, dieses feine, zarte Wesen, stand diesen Schmähungen wehrlos gegenüber. Eine verzweiflungsvolle Starrheit war über sie gekommen. Sie konnte ja nicht einmal fliehen vor diesen geifernden Menschen, denn sie fühle sich Mutter und war dadurch auf ewig an sie gebunden. Nicht ein Wort vermochte sie auf diese Schmähungen zu erwidern, solcher Niedrigkeit war sie nicht gewachsen.
Die arme junge Frau führte von nun an ein Höllenleben in Rainau. Niemand hatte ein liebes, gutes Wort für sie, niemand stand ihr bei. Ihr Gatte vernachlässigte sie in beleidigender Weise, und sie hätte wohl finsteren Mächten Gehör gegeben, die sie in den Tod lockten, wenn der Gedanke an ihr Kind sie nicht davon abgehalten hätte.
Nach einigen Monaten kam Georg Feldner eines Tages nach Rainau, um von seiner Schwester Abschied zu nehmen. Er sagte ihr, dass er erreicht habe, was sein sehnlichster Wunsch gewesen wäre, er habe alle Verpflichtungen seines Vaters decken können. Das Bankhaus Feldner sei in andere Hände übergeben. Er habe jedoch alles verkaufen und zu Geld machen müssen, damit alle Forderungen gedeckt werden konnten.
„Aber für uns beide ist nichts geblieben, Maria, nichts. Ich habe mein Pferd, meine Bücher und was sonst mein persönlicher Besitz war, verkauft, um mir Reisegeld zu schaffen, denn in Deutschland kann ich nicht bleiben. Ich gehe nach Sumatra, zu meinem Freund Jan van Kossum.“
Maria hatte ihn mit einem seltsamen Blick angesehen. „Zu Jan van Kossum?“
„Ja, Maria, du weißt, dass sein Vater eine Handelsniederlassung und großen Länderbesitz auf Sumatra hat. Jan ist nach Sumatra übergesiedelt, um dort die Geschäfte zu führen. Er hat mich so oft gebeten, ihn zu besuchen. Und nun, als er von dem Zusammenbruch unseres Hauses gehört hat, depeschierte er mir: Komm, ich helfe dir.“
Marias Augen wurden feucht. „Der Gute! Das sieht ihm ähnlich.“
„Ja, Maria, er ist ein edler, vornehmer Mensch, wenn er auch kein schönes Gesicht hat.“
Sie presste die Hand vor die Augen. „Ich weiß, Georg, was du damit sagen willst. Er war der Edelstein, den ich achtlos von mir warf – ich hob einen glitzernden Glassplitter auf.“
„Meine arme Maria.“
Sie wehrte ab.
Nachdem Georg abgereist war, wurden Maria nur noch von einer Seite Liebe und Erbarmen zuteil. Elisabeth Volmar, die älteste Schwester Ruperts, die schon seit Jahren verheiratet und Mutter eines zehnjährigen Knaben war, stand Maria teilnahmsvoll gegenüber. Leider war sie immer nur besuchsweise in Rainau, denn ihr Gatte war als Hauptmann in der nahen Stadt garnisoniert. Sie hatte Maria schon gekannt, ehe diese sich mit ihrem Bruder verlobte. Sie allein stellte sich nun liebevoll auf Marias Seite, und auch ihr Gatte brach zuweilen eine Lanze für die arme Maria.
Auch als die kleine Martina geboren wurde, kam Elisabeth sofort nach Rainau und pflegte Mutter und Kind in liebevoller Hingabe.
Einige Monate nach Martinas Geburt erhielt Maria Dornberg den ersten Brief von ihrem Bruder Georg. Er berichtete ihr, dass er wohlbehalten in Sumatra angekommen sei und Jan van Kossum ihm die Verwaltung eines Teiles seiner Besitzungen übertragen habe. Sein Lohn sei höher, als er für die eigenen Bedürfnisse benötige, und so könne er gut noch einige liebe Menschen mit ernähren. Und da er um Marias unglückliche Ehe wusste, schrieb er ihr eines Tages: Maria, komm zu mir. Nimm dein Kind und verlass dieses Haus, wo man dich noch zu Tode quält. Du bist einer so lieblosen Behandlung nicht gewachsen, du gehst zugrunde. Komm zu mir.
Da hatte sie ihm traurig zurückgeschrieben: Selbst wenn ich wollte, Georg, ich darf nicht, denn Rupert würde mir das Kind nehmen, um mich zu strafen. Und ich habe auch nicht den Mut davonzulaufen – bin auch zu stolz dazu, mich ins Unrecht zu setzen. Er kann mir antun, was er will – nur mein Kind lasse ich mir nicht nehmen.
Da wusste er, dass ihr nicht zu helfen war.
Und es kamen noch schwerere Jahre für Maria. Ruperts Vater war nun an den Füßen ganz gelähmt, saß den ganzen Tag im Rollstuhl und fand Vergnügen daran, Maria zu quälen mit seinen hämischen Worten, mit ungerechten Vorwürfen. Sie war in seinen Augen an allem schuld – auch an seiner Krankheit. Rupert hatte immer größere Mühe, Rainau zu halten – und schließlich trieb es ihn eines Tages an den Spieltisch. Er gewann am ersten Abend eine große Summe, die ihn befähigte, einige sehr drückende Schulden zu bezahlen, so dass er wieder einmal frei aufatmen konnte. Aber nun hatte ihn der Spielteufel gepackt. Sein Schicksal war besiegelt.
Als die kleine Martina elf Jahre war, brachte man ihren Vater eines Tages als Leiche nach Hause. Angeblich war er auf einem Pirschgang gestürzt, und das Gewehr hatte sich entladen. Er war mitten ins Herz getroffen worden. In Wahrheit hatte er sich selbst erschossen, weil er am Abend vorher eine ungeheure Summe auf Ehrenwort verspielt hatte. Dieses Ehrenwort blieb uneingelöst.
Nun kam eine furchtbare Zeit für Rainau. Die Gläubiger ließen es nur nicht zur Katastrophe kommen aus Mitleid mit dem gelähmten Besitzer, der nun einen Inspektor einstellen musste und vom Rollstuhl aus die Verwaltung übernahm. Die Frauen mussten alle schwer arbeiten und leisteten beinahe Unmögliches. Auch Maria setzte alle Kraft ein, um mitzuhelfen.
Jetzt hätte sie freilich Rainau verlassen und mit ihrem Kind nach Sumatra gehen können. Aber sie hatte nicht mehr die Kraft, einen solchen Entschluss zu fassen, und musste sich auch sagen, dass ihr geschwächter Körper einem Aufenthalt in den Tropen nicht gewachsen war.
Maria kränkelte lange, und endlich konnte sie sich nicht mehr von ihrem Krankenlager erheben. Sie fühlte, dass es mit ihr zu Ende ging. Und so raffte sie eines Tages ihre letzte Kraft zusammen und schrieb, von Todesahnungen erfüllt, einen Brief an ihren Bruder Georg. Martina musste ihn zur Post befördern, ohne dass sie wusste, was die Mutter geschrieben hatte.
Wenige Wochen später starb Maria. Martina war mit der Mutter allein gewesen. Es war mitten in der Nacht, als der letzte Seufzer Marias verklang. Martina hatte mit den kleinen Händen die Augen der Mutter zugedrückt.
Seufzend stand die kleine Martina jetzt auf und ging durch die Vorhalle in die Zimmerchen, die sie mit ihrer Mutter bewohnt hatte. Sie strich schmeichelnd über das Bett der Mutter, in dem diese gestorben war, presste ihre Wangen an ein Buch, das die Mutter zuletzt noch in der Hand gehalten hatte, und ließ sich dann in einen Stuhl fallen. Aufatmend zog sie einen Schlüssel hervor, den sie an einer Schnur um den Hals trug. Damit öffnete sie ein Schränkchen und entnahm ihm ein Kästchen.
Darin lag obenauf ein dickes Kuvert mit dem Tagebuch ihrer Mutter. Es war versiegelt und trug die Aufschrift: An meinen Bruder Georg Feldner.
Martina drückte einen Kuss auf das Kuvert und legte es beiseite. Das Kästchen enthielt allerlei kleine Andenken. Da war eine Halskette aus bunten Glasperlen. Die hatte ihr Gerd Volmar, der Sohn ihrer Tante Elisabeth, einmal mitgebracht, dann ein hübsches, von ihm gemaltes Buchzeichen, ein silberner Fingerhut, den ihr Tante Elisabeth geschenkt hatte, und eine hellblaue Schleife. Die nahm sie in die Hand und streichelte sie. Es war eine Zopfschleife, die Tante Elisabeth ihr einmal geschenkt hatte zu ihrem elften Geburtstag. Es waren natürlich zwei gewesen, und Martina hatte sie zur Feier ihres Geburtstages in die Zöpfe gebunden. An jenem Tag hatte sie Gerd das letzte Mal gesehen. Sie war auf der Parkwiese herumgetollt, und der angehende junge Leutnant hatte ein Menuett von Boccherini gepfiffen. Danach tanzte Martina in ihrer graziösen Art. Da hatte Gerd sie umarmt und geküsst und ihr eine der Zopfschleifen geraubt und gesagt: „Die trage ich auf meinem Herzen, bis du mal meine Frau wirst, Martina. Jeder Ritter muss die Farbe seiner Dame tragen.“
Sie war ein wenig böse gewesen, weil er ihr die schöne Zopfschleife genommen hatte, aber er hatte sie so bittend angesehen, dass sie nicht auf der Zurückgabe bestanden hatte.
Ach, wie lieb und gut Gerd doch immer zu ihr gewesen war. Wie froh hatte er sie immer gemacht, wenn er nach Rainau kam. Aber nun hatte sie ihn schon seit drei Jahren nicht wiedergesehen. Damals hatte er kurz nacheinander Vater und Mutter verloren.
So lange war er nicht mehr in Rainau gewesen, da er sich nie besonders mit seinen Verwandten in Rainau verstanden hatte.
Ob er wohl noch zuweilen an sie dachte? Und ob er das blaue Band noch besaß?
„Er wird mich wohl vergessen haben, und ich werde ihn vielleicht nie wiedersehen“, sagte sich Martina. Sie ahnte nicht, dass Gerd Volmar gerade jetzt in den Banden einer kleinen Liaison lag und darüber außer seinem Dienst so ziemlich alles vergaß. Freilich dachte er mitleidig an die kleine Martina, als er die Todesanzeige ihrer Mutter bekam. Aber helfen konnte er ihr so wenig wie ihrer Mutter, und Martina war noch ein Kind. In seiner jungen Leutnantswürde war ein so junges Cousinchen eine unwichtige Persönlichkeit.
Beim Gedenken an die vergangenen glücklichen Tage und Stunden mit Gerd seufzte Martina tief, und erst jetzt merkte sie, dass es darüber spät geworden war. Sie rollte die blaue Schleife zusammen und verbarg sie zusammen mit den anderen Andenken in dem Kästchen und verschloss ihre kleinen Kostbarkeiten im Schränkchen. Sie begab sich schnell zur Ruhe, denn morgen sollte sie ja in aller Frühe aufstehen. Noch im Einschlafen musste sie an Gerd denken und seufzte. „Oh, wenn doch wenigstens er einmal zu Besuch käme, Onkel Georg ist ja so weit weg!“ Der letzte Gedanke aber galt ihrer lieben Mutter, die draußen im Park ruhte. „Mutter, ich bitte dich, lass mich nicht so allein!“
***
Einige Monate waren vergangen seit Maria Dornbergs Tod. Es war ein warmer, sonniger Septembermorgen, Martina stand draußen auf der großen Gartenwiese und hing mit den Mägden die Wäsche auf die ausgespannten Leinen.
Tante Melanie war der Ansicht, dass Martina alles lernen müsse. Auch bei der Wäsche musste sie tüchtig zufassen. Martina war eine Arbeit so lieb wie die andere. Sie scheute sich auch vor dieser nicht und wäre froh und zufrieden gewesen, wenn man sie nur nicht so lieblos behandelt hätte.
Sie reckte ihre schlanke Gestalt eben hoch, um ein Wäschestück auf die Leine zu hängen, und war so vertieft in ihre Arbeit, dass sie nicht bemerkte, wie draußen am Gartenzaun ein stattlicher, braun gebrannter Herr stehen blieb. Er stutzte, als er Martina erblickte, und sah wie ungläubig zu ihr hinüber. Seine Augen weiteten sich, und als Martina ein anderes Wäschestück aus einem großen Korb aufnahm, rief er sie an.
„Martina!“
Sie schrak zusammen und sah mit ihren hell leuchtenden Augen, deren graue Farbe seltsam mit den dunklen Brauen und Wimpern kontrastierte, zu ihm hinüber. In ihrem blonden Haar spielte der Wind.
Wie gebannt stand sie und schaute den Fremden an, der auch sie mit grauen Augen anblickte, die hell aus dem gebräunten Gesicht leuchteten. Das Wäschestück, das sie hatte aufhängen wollen, war ihren Händen entglitten und fiel auf den Rasen.
In demselben Augenblick tauchte Tante Melanie auf und erhob ein großes Gezeter. „Kann ich dich etwas tun lassen? Nichtsnutzig bist du von früh bis spät. Da liegt das Laken im Rasen, und man muss es nun erst wieder waschen. Statt dass du uns Arbeit abnimmst, machst du welche. Es ist ein Kreuz mit dir. Du bist ein abscheulich unachtsames Geschöpf. Man hat nur Ärger mit dir. Schnell, hebe das Laken auf und wasche es gleich wieder aus, die Mägde haben dazu keine Zeit. Aber spute dich, die Wäsche muss auf die Leine, damit die Sonne sie noch trocknet.“
So kam es keifend über ihre Lippen. Den Fremden am Gartenzaun, der dies alles mit anhörte, sah sie nicht. Dieser zog die Stirn zusammen und sah zornig auf Tante Melanie. Als Martina sich jetzt, ohne ein Wort zu erwidern, nach dem Wäschestück bückte, sprang er mit einem Satz über den Gartenzaun und trat an Martinas Seite. Er nahm das Wäschestück aus ihrer Hand und warf es mit einem zornigen Ruck über die Leine.
„Dazu sind doch wohl Dienstboten in Rainau“ sagte er schroff.
Tante Melanie starrte ihn an. „Was fällt Ihnen ein? Was haben Sie hier zu suchen?“, fuhr sie ihn an.
Ohne auf sie zu achten, nahm er Martinas kleine, rot gearbeitete Hände in die seinen und sah darauf nieder. „Kleine Martina, du hast so arme, abgearbeitete Hände, wie deine arme Mutter sie hatte, als ich vor Jahren einmal zu Besuch war. Kennst du deinen Onkel Georg nicht mehr?“
Mit einem strahlend glücklichen Leuchten sah sie zu ihm auf. „Onkel Georg? Lieber Onkel Georg!“
Er zog sie in seine Arme. „Wie du deiner Mutter gleichst, mein liebes Kind. Willst du mich zu ihr führen?“
Ihre Augen feuchteten sich.
„Zu ihr kann ich dich leider nicht mehr führen – nur noch zu ihrem Grab. Meine Mutter ist nämlich vor einigen Monaten gestorben.“
Martina berichtete ihrem Onkel, wie sie als Einzige beim Sterben ihrer Mutter mitten in der Nacht zugegen war. Und auch Georg konnte sich jetzt der Tränen nicht mehr erwehren. Sie hatte also mit ihrer düsteren Vorahnung Recht behalten, der sie in einem Brief Ausdruck gegeben hatte, den er vor einigen Monaten erhalten hatte. Sie hatte ihm darin von ihrer Krankheit berichtet und ihn gebeten, sich um aller Heiligen willen um ihre Tochter zu kümmern, sollte sie selbst sterben. Georg hatte nicht lange gezögert. Er hatte sich mit Jan van Kossum besprochen und war dann sobald als möglich in die alte Heimat aufgebrochen, um endlich seine geliebte Schwester und deren Kind zu sich zu holen.
Wortlos nahm Georg Feldner Martina bei der Hand. Sprechen konnte er nicht. Wie ein Krampf saß es in seiner Kehle. So schritten sie nebeneinander durch den Park, der schon einige herbstliche Töne zeigte. Melanie starrte ihnen verwundert nach.
„Du musst mich zu Mutti führen, Martina“, sagte Georg heiser.
Dann sprachen sie kein Wort mehr, bis sie unter den Kastanien am Grabe Marias standen.
Georg Feldner starrte lange Zeit auf den Grabhügel, auf dem zwischen verwelkten Kränzen ein Strauß frischer Astern lag, den Martina ganz früh am Morgen hier hergetragen hatte. Martina stand schweigend mit umflorten Augen neben ihm.
Endlich richtete er sich auf aus seiner Versunkenheit. Er zog Martina mit sich auf eine schlichte Holzbank, die neben den beiden Gräbern am Stamm einer der Kastanien stand.
„Nun erzähle mir noch einmal ausführlich, Martina, wie deine liebe Mutter starb. Wir wollen hier niedersitzen – da wird sie bei uns sein“, sagte er, um Festigkeit ringend.
Sie begann zu erzählen – erst leise und stockend, dann immer freier und fließender. In scharfen Umrissen, mit eindrucksvoller Klarheit, zeichnete sie die Leidensgeschichte der Mutter, soweit sie dieselbe erfasst hatte. Und wie ein Quell, der, einmal hervorgebrochen, sich nicht mehr eindämmen lässt, so kam alles aus ihrem Inneren hervor, was sie so lange in sich verschlossen hatte die Qual und der Jammer um das Elend, das ihre arme Mutter zu tragen gehabt hatte.
Von sich selbst, was sie auch hatte erdulden und ertragen müssen, sprach sie nicht. Das erschien ihr nicht so wichtig. Nur das Unrecht, das man der Mutter zugefügt, alle Demütigungen, die man ihr angetan hatte, musste sie dem Onkel enthüllen. Und es sprach dabei eine Leidenschaftlichkeit aus dem jungen Geschöpf, die sie weit über ihre Jahre gereift erscheinen ließ.
Georg Feldner hörte schweigend zu. Mit keinem Wort unterbrach er sie, aber sein Atem kam schwer und gepresst aus der Brust.
Als sie endlich, von ihrem Gefühl übermannt, schwieg, weil die Tränen ihr im Hals aufstiegen, legte er seine Hand auf ihren Arm.
„Nun lass uns vorläufig schweigen, Martina, du wirst mir später noch mehr erzählen. Meine arme, kleine Martina, ich bin gekommen, um dich mit mir zu nehmen.“
In ihren eigenartig schönen, hell leuchtenden Augen strahlte es seltsam auf. Sie umklammerte seine Hand, und er fühlte, wie sie vor Erregung zitterte.
„Ist es wahr? Ich darf mit dir gehen – gleich jetzt – weit weg von Rainau?“
„Ja, Martina.“
Da warf sie sich mit krampfhaftem Schluchzen in seine Arme. „Onkel Georg, lieber Onkel Georg, wie soll ich dir danken, wie soll ich das fassen!“
Er streichelte ihr Haar. „Armes Kind, so sehr erschüttert es dich, dass du befreit werden sollst? Das zeigt mir erst, wie sehr du gelitten hast.“