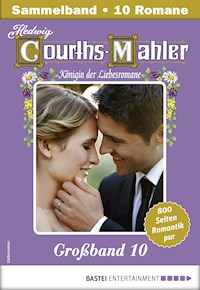
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Hedwig Courths-Mahler Großband
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
10 spannende Liebesromane lesen, nur 6 bezahlen!
Über 800 Seiten voller Romantik und Herzenswärme in einem Band!
Hedwig Courths-Mahlers "Märchen für Erwachsene", wie sie ihre Romane selbst nannte, sind ebenso zeitlose Klassiker wie die Themen, die sie behandeln: die Liebe, ihre Gefährdung und deren Überwindung, die Verwirrung der Gefühle und der Weg zum Glück.
Seit über 100 Jahren verzaubert sie ihre Leserinnen und Leser mit ihren wundervollen Geschichten immer wieder neu, und mit einer Gesamtauflage von über 80 Millionen Exemplaren gilt Hedwig Courths-Mahler heute als DIE Königin der Liebesromane.
Großband 10 enthält die Folgen 91 - 100.
Zehn Geschichten, zehn Schicksale, zehn Happy Ends - und pure Lesefreude!
Jetzt herunterladen und sofort eintauchen in eine heile Welt, in der die Liebe noch regiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1707
Ähnliche
Impressum
BASTEI ENTERTAINMENT Vollständige eBook-Ausgaben der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgaben Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG Für die Originalausgaben: Copyright © 2015 by Bastei Lübbe AG, Köln Programmleiterin Romanhefte: Ute Müller Verantwortlich für den Inhalt Für diese Ausgabe: Copyright © 2019 by Bastei Lübbe AG, Köln Covermotiv: iStockphoto/Urilux ISBN 978-3-7325-6945-8Hedwig Courths-mahler
Hedwig Courths-Mahler Großband 10 - Sammelband
Inhalt
Inhalt
Cover
Impressum
Flucht in den Frieden
Vorschau
Flucht in den Frieden
Bezaubernder Roman der weltberühmten Hedwig Courths-Mahler
Hanna Westmann stand am Fenster und sah hinaus in das Schneetreiben. Sie dachte an ihre Mutter, die draußen in der kalten Erde ruhte. So sehr hatte die Arme in ihrer Leidenszeit unter der Kälte gelitten, seit die Nachricht eingetroffen war, dass ihr Mann, Hannas geliebter Vater, einem Unfall zum Opfer gefallen war. Haltlos war sie zusammengebrochen, und seither lag sie bis zu ihrem Tod auf dem Krankenlager.
Es waren den beiden Frauen allerlei Widrigkeiten geschehen, sie mussten sich sehr bescheiden einrichten mit den knappen Mitteln, die ihnen geblieben waren.
Hanna gelang es schließlich, jeden Tag einige Stunden in einem Büro Arbeit und Verdienst zu finden, aber die Krankheit der Mutter zehrte alles auf. Und dann war ihr auch diese Stellung gekündigt worden. Es war kurz vor dem Tod der Mutter. Hanna hatte es der Mutter noch verschweigen können, aber nun stand sie vor dem Nichts. Die Begräbniskosten und mancherlei andere Ausgaben mussten gedeckt werden, und sie konnte jetzt nur noch den Rest ihrer Habe verkaufen und sehen, dass sie die Wohnung vermietete, damit sie ihr Leben in bescheidenster Weise noch eine Weile fristen konnte.
Was sollte man dann anfangen? Sie hatte den Brief geschrieben, der die kleine Wohnung kündigte, und hatte am Haustor eine Papptafel angebracht, auf der zu lesen stand, dass ihre Sachen zum Verkauf standen und am Sonntag besichtigt werden könnten, da sie ja noch einige Tage im Büro arbeiten musste.
Tief aufseufzend wandte sie sich vom Fenster ab und machte sich fertig, um ins Büro zu gehen.
Die Pförtnerin sah ihr mitleidig nach. So ein schönes Mädel und so unglücklich, die wird es schwer haben, dachte sie, und wandte sich ihrer Arbeit wieder zu.
Hanna erledigte ihre letzten Arbeitstage im Büro mit der ihr eigenen Gewissenhaftigkeit. Der Vorgesetzte sagte ihr einige anerkennende und tröstende Worte, als er sie verabschiedete, und bedauerte es, dass er sie hatte entlassen müssen.
Hanna brauchte alle Kraft, um ruhig zu scheinen.
Wieder dachte sie an ihre tote Mutter, die nun allem Leid entrückt war wie der Vater. Sie war allein und verlassen.
Ein trockenes Schluchzen schüttelte sie.
Ach, Mutter, wie gut, dass du alles dies nicht mehr zu erleben brauchst. Wie gut wäre es, Mutter, könnte ich bei dir liegen!
So dachte sie bei sich. Aber dann raffte sie sich auf. Nur nicht weich werden, nur die Zähne zusammenbeißen und ruhig bleiben!
Sie vermochte es. Ruhig verließ sie am Schluss das Büro, ruhig ging sie heim – aber dann sank sie kraftlos in einen Sessel und faltete die Hände im Schoß.
So saß sie lange da, ehe sie sich aufrichtete, um sich eine Tasse Tee zu bereiten und einen einfachen Imbiss zu sich zu nehmen. Dabei gewahrte sie einen Brief, der von der Tür zurückgeschoben auf dem Fußboden lag.
Es war wohl eine Beileidsbezeugung von irgendjemand.
Verwandte besaß Hanna nicht mehr, außer einer Schwester ihrer Mutter, die sich vor langen Jahren nach Chile verheiratet hatte. Dieser Tante Helena hatte sie den Tod der Mutter durch ein Telegramm mitgeteilt, sie wusste, die beiden Schwestern hatten sich sehr geliebt und standen dauernd in Briefwechsel.
Ein Blick auf die Adresse zeigte Hanna, dass der Brief an die Mutter adressiert war. Sicherlich hatte Tante Helena bei Aufgabe dieses Schreibens noch nicht gewusst, dass die Mutter gestorben war. Jetzt wusste sie es wohl – sie musste das Telegramm inzwischen erhalten haben.
Hanna öffnete den Umschlag; die Mutter hatte ihr alle Briefe der Tante zur Einsicht gegeben. Er würde nichts enthalten, was sie nicht wissen durfte.
Als sie das Schreiben entfaltet hatte, las sie:
Meine geliebte Schwester Martha!
Deinen lieben Brief habe ich erhalten und will ihn dir postwendend beantworten. Ich bedauere es aufrichtig, aus deinem Brief ersehen zu müssen, dass du schwer unter dem Verlust deines Gatten leidest und sehr krank bist. Du schreibst, immer noch könntest du den Tod deines Gatten nicht verwinden. Ach, nur zu wohl begreife ich das! Auch ich habe mich noch immer nicht von dem Schlag erholen können, dass auch ich meinen innig geliebten Mann verlieren musste. Meine Schwiegereltern, mein Schwager und meine Schwägerin tun alles Erdenkliche, mich zu trösten und aufzurichten und gottlob – ich habe Arbeit, die mich in willkommener Weise ablenkt. Aber als ich heute deinen lieben Brief erhielt, da habe ich wieder einmal weinen müssen. Du sprichst vom Sterben, meine geliebte Schwester. Wie weh mir das tut! Soll ich alles an den Tod verlieren, was mir lieb und teuer ist? Gott möge dich in seinen Schutz nehmen, mein Marthachen, da ich dich selbst nicht schützen kann. In solchen Fällen merkt man erst, wie weit man voneinander getrennt ist.
Aber nun zum Inhalt deines Briefes. Du bangst dich um deine Tochter Hanna, hast Angst, sie allein zu lassen auf der Welt. Wie gut kann ich dir dies nachfühlen, aber diese Sorge will und kann ich dir abnehmen. Wenn Hanna jemals im Leben allein stehen sollte, so kann sie jederzeit bei mir eine Heimat finden. Wir haben hier viel Platz, und wo so viele Menschen satt werden, wird einer mehr oder weniger gar nicht gezählt.
Was du mir von Hannas Kenntnissen und Fähigkeiten schreibst, kann auch bei uns Verwendung finden. Ich habe gleich mit meinem Schwiegervater gesprochen, er hat mich bei den Schultern genommen, mich geschüttelt und dann gesagt: Was fragst du erst lange, Helena, du weißt, dass wir hier immer junge, tüchtige Menschen brauchen können, ganz abgesehen davon, dass es dir gut tun wird, einen von deinen Leuten um dich zu haben. Deine Nichte soll uns jederzeit willkommen sein, die blonde Hanna, deren Bild wir ja kennen und die aussieht, als sei sie eine Tochter von dir. Du hast keine Kinder, Helena, dein kleiner Robert starb so früh – lass dir ruhig die Hanna kommen und nimm sie in dein Haus und an dein Herz!
So hat er zu mir gesagt, und ich wiederhole es dir, damit du weißt, hier ist allzeit Platz für deine Tochter, ein warmer, friedlicher Platz, sofern sie sich entschließen kann, in unserer Weltabgeschiedenheit zu leben.
Das sage ich dir aber nur zu deiner Beruhigung, denn ich hoffe sehr, dass du deiner Tochter noch recht lange erhalten bleibst. Grüße sie herzlich, wie immer, von ihrer Tante Helena und sage ihr, sie ist allzeit willkommen. Aus meinen Briefen an dich weiß sie längst, wie das Leben und Treiben hier bei uns in Chile ist.
Ob Hanna sich freilich einleben könnte, weiß ich nicht, ich denke aber, sie würde hier nicht viel mehr entbehren als Theater, Kinos und dergleichen Lustbarkeiten. Die genießen wir höchstens einmal im Jahr. Wenn wir uns etwas gönnen wollen, reisen wir nach Argentinien, nach dem schönen Buenos Aires.
In der weiteren Umgebung liegen noch mehrere große Ranchos, nicht ganz so umfangreich wie unsere, aber es braucht immer eine lange Autofahrt, wenn wir uns gegenseitig besuchen wollen. Ich verschweige dir absichtlich nicht, was Hanna vielleicht enttäuschen könnte, aber ein sorgloses, friedliches und naturverbundenes Leben garantiere ich ihr. Sag ihr also, ein Platz für sie ist immer offen – und damit wirf dein Sorgenbündel von dir, geliebte Schwester, und trachte danach, dich deiner Hanna noch recht lange zu erhalten, denn eine Mutter kann uns kein Mensch ersetzen!
Ich will jetzt schließen, um den Brief mit der nächsten Post befördern lassen zu können, es dauert leider stets recht lange, bis ein Schreiben von hier in deine Hände gelangt. Werde schnell wieder gesund, mein Marthachen – ich sorge mich sehr um dich. Du darfst nicht von uns gehen. Ich küsse dich herzlich in treuer Schwesternliebe, und Gruß und Kuss auch an meine herzlich geliebte Nichte Hanna. Lass bald wieder von dir hören!
Deine Schwester Helena
Als Hanna zu Ende gelesen hatte, seufzte sie tief auf. Tränen rannen ihr über die Wangen. Sie erfuhr erst durch diesen Brief, dass die Mutter ihren Tod geahnt und sich um Schutz und Hilfe für sie an die Tante gewandt hatte.
Hanna lehnte sich zurück und las den Brief noch einmal. Was er enthielt, erschien ihr wie ein Fingerzeig des Himmels.
Vielleicht durfte sie wirklich nach Chile reisen.
Ob sie es nicht schon auf diesen Brief hin würde tun können?
Hanna rechnete sich aus, wann Tante Helena wohl ihr Telegramm erhalten hatte. Vielleicht bekam sie auch auf telegrafischem Weg Antwort darauf?
Auf jeden Fall ließ sie der liebevolle Ton dieses Briefes erkennen, dass sie nicht ganz allein und hilflos in der Welt stand. Sie rechnete sich aus, wie viel Geld sie benötigen würde, wenn sie wirklich nach Chile reiste.
Morgen war Sonntag. Ob sich wohl schon ein Liebhaber finden würde für das, was sie verkaufen wollte? Das war jetzt eine wichtige Frage für sie. Viel würde sie freilich kaum erlösen können, denn Gebrauchtes wollte jeder billig erstehen. Es konnte nur ein Glücksumstand sein, sollte es ihr gelingen, alles zu einem leidlichen Preis zu verkaufen. Es war allerdings gut erhaltener Hausrat. Mutter hatte trotz ihrer Schwäche auf größte Ordnung gehalten, solange sie noch nicht bettlägerig war.
Kritisch sah Hanna sich alles an, kramte in den Schränken und fand hier und da noch ein gutes Stück.
Am nächsten Morgen erhob sie sich zeitig, um alles in der Wohnung instand zu setzen für den Fall, dass sich ein Käufer für die ausgeschriebenen Sachen einfände.
Gegen elf Uhr wurde draußen die Klingel gezogen, und vor Hanna stand ein junges Paar und sah sie etwas verlegen an.
Die junge Dame sprach zuerst: „Verzeihen Sie, unten an der Haustür hängt ein Plakat, dass hier Möbel und Wirtschaftsgegenstände zu verkaufen sind. Wenn wir uns das mal ansehen könnten? Wir wollen heiraten und haben deshalb auch nicht viel Geld. Ich weiß nicht, ob wir Ihnen genügend bieten können. Dürfen wir mal sehen?“
Die jungen Menschen gefielen Hanna. „Bitte treten Sie ein und sehen Sie sich alles an!“, sagte sie freundlich.
Die junge Dame machte verlangende Augen, als sie die gut erhaltenen Möbel und all den soliden Hausrat sah. Auch der junge Mann sah verlangend umher, aber er glaubte, alles werde zu teuer sein.
„Ach, das wäre ja alles für uns das Passende, Fritz – gefällt es dir auch?“
„Nun ja, aber es ist schon recht alt.“
„Aber sieh, Fritz, so gutes Holz und die Betten sind sehr schön erhalten. Und hier in den Schränken – alles ist vorhanden, wir würden kaum noch etwas dazukaufen müssen. Was würde denn das alles kosten?“
Hanna hatte sich bereits überlegt, was sie fordern wollte; sie nannte nun einen Preis von tausend Mark.
Das Paar sah sich einen Augenblick an, dann nickte der junge Mann. „Das könnten wir wohl aufbringen. Was meinst du, Erika?“
Die junge Dame hatte rote Wangen bekommen. „O ja, bitte, lass uns die Sachen kaufen!“, sagte sie eifrig. „Gehören die Gardinen und das Geschirr auch dazu?“, wandte sie sich an Hanna.
Diese nickte. „Bis auf meine Kleidung und einige kleine Andenken, die ich mitnehme, gehört alles dazu, was Sie in der Wohnung sehen.“
„O fein!“, rief die junge Dame ganz begeistert, und der junge Mann ergänzte: „Wir haben jetzt natürlich nicht so viel Geld dabei, ich könnte Ihnen aber zweihundert Mark anzahlen, den Rest bringe ich mit, wenn wir die Sachen abholen. Wären Sie damit einverstanden?“
Hanna bejahte. Sie besprachen dann noch, wann die Sachen abgeholt werden sollten, dann verabschiedete sich das Paar von Hanna, die sehr froh war, dass sich alles so gut geregelt hatte.
Als sie wieder allein war, überfiel sie freilich ihr Elend doch wieder, aber sie redete sich zu, vernünftig zu sein. Die tausend Mark würden ihr schon etwas voranhelfen. Und vielleicht – vielleicht konnte sie nach Chile reisen – dann war sie sogar imstande, das Reisegeld zu bezahlen.
Am nächsten Tag begab sie sich in ein Reisebüro und ließ sich sagen, was eine Reise nach Chile ungefähr kosten würde. Ihr wurde der Preis für erste, zweite und dritte Klasse genannt, und sie wurde sehr froh, als sie ausrechnete, dass sie sogar in der ersten Klasse reisen könnte. Das würde sie allerdings nicht tun, denn es war immerhin gut, wenn ihr noch etwas übrig blieb.
Als sie nach diesem Ausgang nach Hause kam, fand sie auf dem Fußboden eine durch den Türschlitz gesteckte Depesche.
Sie kam von Tante Helena und lautete:
Reise baldigst Valparaiso, erwarte dich dort, Geld angewiesen Deutsche Bank für dich – sehr traurig um Mutti. Drahtantwort wann. Helena.
Hanna sank zitternd in einen Sessel. „Gute Tante Helena, wie leicht machst du mir alles, wie danke ich dir!“, dachte sie erschüttert und weinte sich erst mal wieder aus.
Am anderen Morgen ging sie zur Deutschen Bank. Es war wirklich reichlich Geld für Hanna angewiesen. Sie erledigte ihre Passangelegenheiten und bestellte sich einen Platz auf dem nächsten Dampfer.
Dann depeschierte sie an Tante Helena, wann sie in Valparaiso eintreffen würde.
So hatte sie alles aufs Beste erledigt. Die Möbel übergab sie kurz vor der Abreise dem jungen Paar und erhielt auch prompt das restliche Geld. Sie besuchte das Grab ihrer Mutter noch einmal und gab Anweisung, dass es in Ordnung gehalten würde. Nun hielt sie nichts mehr zurück.
Sie fuhr nach Hamburg und begab sich sogleich an Bord des Dampfers. Aber als dieser sich am nächsten Morgen in Bewegung setzte, war ihr zumute, als würde ihr das Herz mitten durchgerissen.
Jetzt empfand sie bedrückend, dass sie die deutsche Heimat vielleicht für immer verließ. Wie würde es ihr ergehen, drüben in der fremden Welt, in den fremden Verhältnissen?
Aber bald hatte sie ihren Kleinmut niedergerungen.
Tante Helena war auch eines Tages allein hinausgezogen in die Ferne – allerdings hatte sie gewusst, dass drüben ein treues Herz für sie schlug, denn ihr Mann war zu Besuch in Deutschland gewesen und hatte seine Frau bei dieser Gelegenheit kennen gelernt. Er hatte vorausreisen müssen, um seine Angehörigen vorzubereiten, aber Tante Helena hatte immerhin gewusst, dass sie freudig erwartet wurde.
Je weiter die deutsche Küste im Dunst verschwand, umso zuversichtlicher wurde Hanna Westmann. Sehr frisch und munter fühlte sie sich. Eine Winterreise über den Ozean war freilich weniger angenehm als eine Sommerreise, aber als der Dampfer sich dem Äquator näherte, wurde es so warm, dass die Damen Sommersachen anlegen mussten. Auch Hanna hatte sich mit solchen versehen. Sie wurde nun sehr unruhig, je näher sie ihrem Ziel kam.
Endlich näherte sich der Dampfer der Küste und damit Hannas neuer Heimat. Und dann war Valparaiso erreicht.
Hanna hatte ihre Koffer gepackt und stand erwartungsvoll an der Reling.
Kaum dass der große Dampfer angelegt hatte, bahnte sich eine Dame in Begleitung eines jungen Herrn, der sie fast um Haupteslänge überragte, den Weg über das Fallreep. Sie ging mit ihrem Begleiter geradewegs auf den Kapitän zu. Die Dame konnte ihrem Aussehen nach sehr wohl Tante Helena sein – wer aber war der junge Herr in ihrer Begleitung?
Das sollte Hanna bald erfahren. Die Dame hatte den Kapitän gefragt: „Können Sie mich zu Fräulein Hanna Westmann führen lassen, Herr Kapitän? Diese junge Dame ist meine Nichte und wird von mir hier erwartet.“
Der Kapitän rief einen Steward herbei und gab ihm Auftrag, die Dame mit ihrem Begleiter zu Fräulein Westmann zu führen. Der Steward sah sich um, erblickte Hanna an der Reling und bat Frau Helena Curtius, ihm zu folgen.
Hanna hatte sich aufgerichtet und sah mit brennenden Augen der großen, schlanken Dame entgegen, deren braun gebranntes Gesicht ihr bekannt erschien. Sie vergaß dabei, auf den schlanken jungen Herrn zu achten, der ihr folgte.
Tante und Nichte erkannten sich, noch bevor der Steward der Dame Hannas Namen genannt hatte. Sie eilten aufeinander zu und sanken sich in die Arme.
„Hanna, kleine Hanna, wie bist du groß geworden!“, rief Frau Helena tief bewegt aus.
„Liebe Tante Helena, wie danke ich dir, dass du gekommen bist, um mich gleich hier an Bord in Empfang zu nehmen! Ich war in großer Sorge, wie und wo ich dich finden sollte.“
„Das war selbstverständlich, Hanna. Hier an Bord warst du am leichtesten zu finden. Gottlob, dass du diese Reise überstanden hast; ich hoffe, doch gut?“
„Sehr gut, Tante Helena. Ich habe mich erholt während der Seefahrt.“
Jetzt wandte Tante Helena sich nach dem jungen Herrn um. „Roby, komm her! Dies ist meine Nichte Hanna. – Und dieser junge Herr ist mein Neffe Robert Curtius. Er hat mich nicht allein nach Valparaiso reisen lassen, und sein Vater und Großvater fanden es ganz selbstverständlich, dass er mich begleitete. Roby ist dir zu deiner Unterstützung von der ganzen Familie Curtius entgegen gesandt worden. Und ich kann dir schon verraten, es reist sich gut unter seinem Schutz.“
Jetzt sah Hanna zu Roby Curtius auf, in sein gebräuntes, energisches Gesicht hinein, aus dem graue Augen hell und klug in die ihren blickten.
Und Hannas braune Augen, in denen immer ein Sonnenfunken zu leuchten schien, und die grauen Robys hingen eine Weile wie mit fragendem Forschen ineinander. Er verneigte sich artig und ergriff ihre Hand, die sie ihm etwas zaghaft reichte.
„Ich freue mich, Sie kennen zu lernen, Fräulein Westmann!“, sagte er in deutscher Sprache.
Tante Helena winkte lächelnd ab. „Aus dieser Begrüßung siehst du, liebe Hanna, dass Roby ein Weltmann ist. Aber bitte, vergesst beide nicht, dass ihr, wenn auch keine Blutsverwandten, durch mich immerhin Vetter und Base seid. Zur Erleichterung des Verkehrs zwischen euch schlage ich daher vor, das verwandtschaftliche Du in Gebrauch zu nehmen.“
Ein wenig errötend sah Hanna mit einem Lächeln zu Roby empor, das ihn wohlig berührte. Er fand, dass er noch keine Frau so reizend hatte lächeln sehen wie sie. Nur Tante Helena hatte zuweilen ein ähnliches Lächeln, und das hatte er stets besonders gern gesehen.
Hannas Lächeln schien ihm noch viel reizender.
Sie reichte ihm aufs Neue die Hand. „Wenn es Ihnen recht ist, Herr Curtius, mir kann es jedenfalls nur lieb sein, wenn ich hier im fremden Land nicht nur eine liebe Tante, sondern auch noch einen Vetter finde.“
„Du wirst eine ziemlich große Verwandtschaft haben, Hanna“, erwiderte Roby strahlend.
Sie plauderten eine Weile zusammen, und dabei sahen Hanna und Roby sich immer wieder in die Augen, als wollte eines im Herzen des anderen lesen. Hanna ging das „Du“ und „Roby“ nicht gleich ganz glatt über die Lippen. Sie stolperte ab und zu ein wenig darüber, aber Roby gelang es sehr schnell, sie „Du“ und „Hanna“ zu nennen. Er fand die junge deutsche Base jedenfalls entzückend und freute sich, dass sie künftighin in Cuyta leben würde.
Er lebte daheim, nachdem er seine landwirtschaftlichen Studien in fremden Ländern beendet hatte. Das Erlernte wollte er jetzt auf Cuyta verwerten.
Als man in das Hotel eintrat, sagte Tante Helena: „Heute und morgen werden wir dir Valparaiso zeigen, du kannst dann noch einmal Kultur genießen, später wird es für lange Zeit damit aus sein.“
Lächelnd sah Hanna zu ihr hinüber. „Mir scheint Cuyta doch nicht allzu weit von der Kultur entfernt zu sein, denn du und Roby, ihr seht aus wie recht zivilisierte Menschen und ihr seid nach der neuesten Mode gekleidet.“
Tante und Vetter lachten.
„Wir haben uns hier erst zur Feier deines Empfangs neu ausstaffiert, damit du vor uns Hinterweltlern nicht einen zu großen Schrecken bekommen solltest“, sagte Roby vergnügt.
Hanna sah ihn mit dem ihr eigenen lieben Lächeln an. „Ich brauche nur in eure Augen und eure Gesichter zu sehen, um zu wissen, dass ihr auch ohne die neueste Mode kultivierte Menschen seid.“
„Gott erhalte dir diesen Glauben, Hanna“, gab Roby zurück, und sie bemerkte, dass er außer anderen guten Gaben des Körpers und des Geistes auch Humor besaß. Sie war sich nun schon klar darüber, dass es sich auf Cuyta gut leben lassen würde, wenn dessen andere Bewohner nur annähernd so warmherzig sein würden.
Im Hotel war Hanna sehr gut untergebracht. Sie bewohnte ein Zimmer, das direkt neben dem Tante Helenas lag. Roby war auf derselben Etage, aber etwas weiter entfernt, einquartiert.
Nach Tisch wollte Tante Helena ein wenig ruhen, wozu weder Roby noch Hanna große Lust hatten.
„Ich schlage vor, Hanna, dass wir beide inzwischen mal die Straßen entlang bummeln. Da findest du in den Schaufenstern alles ausgebreitet, was an Luxus zu bieten ist.“
„Das wird Hanna kaum imponieren, sie dürfte dazu von Berlin her zu verwöhnt sein. Immerhin kannst du ihr inzwischen etwas von dieser Stadt zeigen. Wundere dich aber nicht, wenn sie das unsinnige Stilgemisch der überladenen Fassaden hässlich findet; auch in dem Punkt ist sie sicherlich verwöhnt“, meinte Tante Helena.
Roby lachte und zeigte dabei seine prachtvollen Zähne. „Ich werde mich nicht wundern, Tante Helena, denn auch ich finde dies hässlich genug, ohne dass ich mit Berlin Vergleiche anstellen kann.“
Hanna sah die unbekümmerten Menschen sinnend an. „Ich werde mich überraschen lassen.“
Die beiden jungen Herrschaften verabschiedeten sich von der Tante, die sich in ihr Zimmer zurückzog.
Langsam schlenderten sie die Straße entlang, die vom Hotel zur Prunkstraße der Stadt führte. Sie lag zwischen Palästen eingebettet, hatte aber zahlreiche vornehme Läden.
Hanna bewunderte eine Auslage mit herrlichen Früchten, und Roby ging schnell in das Geschäft hinein und erstand für Hanna etwas davon. Das überreichte er ihr mit einer Verbeugung.
Fast erschrocken sah sie ihn an. „Oh, Roby, du hast wohl sehr viel Geld dafür ausgegeben?“
„Du würdest nicht glauben, wie billig das ist, nachdem du mir sagtest, was solche Früchte in Berlin gekostet haben. Bitte, nimm diese Aufmerksamkeit ohne Bedenken von mir an, du kannst Tante Helena davon mitnaschen lassen. Du wirst übrigens ebenso schöne Früchte in Hülle und Fülle auf Cuyta finden, daran fehlt es bei uns nicht.“
„Also wächst so etwas auch auf eurem Rancho?“
„Das will ich meinen. Und wir sind immer darauf aus, noch edleres Obst zu züchten. Das senden wir dann nebst unseren anderen Erzeugnissen in die Städte.“
„Wie ist das alles interessant für mich! Bitte, erzähle mir ausführlicher von Cuyta!“
Er sah von der Seite auf sie herab und labte seine Augen an ihrem Anblick. Auch hier gab es schöne Frauen, aber keine, die sich mit Hannas Schönheit hätte messen können.
Da er nicht antwortete, sah Hanna fragend zu ihm auf, und er richtete sich mit einem Lächeln empor. „Also, was soll ich dir erzählen? Vielleicht die Entstehungsgeschichte von Cuyta? Mein Großvater war ein kleiner deutscher Landwirt mit wenig Geld, als er nach Chile kam, das ihm gerühmt worden war wegen seiner Fruchtbarkeit, hauptsächlich Mittel-Chile. Er durchstreifte die ganze Gegend, die jetzt zu Cuyta gehört und die damals noch zu haben war, und zwar sehr billig. Seine gesamten Ersparnisse legte er in Grundbesitz an, obwohl dieser Grundbesitz erst urbar gemacht werden musste. Ein Hektar Land kostete nicht mehr als sechs Pesos, also damals ungefähr drei Mark. Sein Besitz war bereits sehr umfangreich, als er Cuyta gründete, Auch das Vieh erstand er spottbillig. Schwierig war es nur, Arbeiter zu bekommen, und da er keine große Auswahl hatte, mietete er sich Indianer, hauptsächlich als Vaqueros, das heißt als Rinderhirten. Aber sie verrichteten auch andere Arbeiten und bauten für Großvater zum Beispiel eine große Blockhütte. Als diese fertig war, holte er Großmutter, die inzwischen in Santiago zurückgeblieben war. Sie waren ganz jung verheiratet. Heute ist Großvater hoch in den Siebzigern und Großmutter zählt nur fünf Jahre weniger. Aber beide sind noch frisch und rüstig, trotz der schweren Arbeit, die sie im Leben geleistet haben.
Großvater begann dann mit der Urbarmachung des Landes, und das war die schwerste Arbeit. Heute, nachdem er fünfzig Jahres seines Lebens geschafft und geschuftet hat, sieht alles ganz anders aus als damals. Großvater hat immer mehr Land hinzugekauft. Auch der Viehbestand hat sich enorm vermehrt, und unsere Herden zählen Tausende von Pferden und Rindern. Wir versorgen ganz Mittel-Chile und Argentinien mit Pferden und mit den Erzeugnissen unserer Arbeit. Aber – langweilt dich das nicht?“
„Nein, im Gegenteil! Oh, erzähle nur weiter!“
Er freute sich, dass sie an alledem Interesse hatte, denn er hing mit allen Fasern seines Herzens an Cuyta.
„Also Cuyta ist ein hübscher kleiner Staat geworden. Wir haben jetzt drei feste Wohnhäuser und unzählige Blockhütten für die Leute. Immer neue werden hinzugefügt, weil immer mehr Leute beschäftigt werden müssen. Sie sind billig und genügsam – und dabei alle froh und zufrieden.“
„Gibt es wilde Tiere bei euch? Oder gar Schlangen?“, fragte Hanna.
„Nein, keine Schlangen, nicht einmal Fiebermücken, die einem das Dasein verleiden können. Von Tieren hast du also nichts zu befürchten. Schlimm sind nur die giftigen Dornenbüsche, die wir nach Möglichkeit auszuroden versuchen. Mein Onkel, Tante Helenas Mann, fiel einem solchen Dornengebüsch zum Opfer. Onkel stürzte mit dem Pferd in ein solches Dornengebüsch. Er und sein Pferd mussten daran sterben. Davon kann Tante Helena jetzt noch nicht hören, sie hat schrecklich darunter gelitten, dass ihr geliebter Mann ihr auf solche Weise genommen wurde. Auch ihr einziges Söhnchen hat sie auf tragische Weise verloren – es stürzte beim Spielen in einen Fluss und wurde erst gefunden, als es schon tot war.“
„Oh, die arme Tante!“
„Ja, sie ist sehr zu bedauern. Und sie trägt alles sehr tapfer. Wir wissen trotzdem, wie sehr sie darunter leidet. Überhaupt – sie ist eine herrliche Frau, wir haben sie alle sehr lieb. Ich denke, dich werden wir auch alle sehr lieb haben, weil du ihr gleichst.“
Hanna wurde rot und versuchte zu lächeln. Dieses verlorene Lächeln erschien Roby überaus reizend; es hatte ganz und gar nichts gemein mit dem verlockenden Sirenenlächeln der chilenischen Frauen.
„Wenn deine Worte nur wahr würden, Roby! Ich habe seit meiner Mutter Tod keinen Menschen mehr auf der Welt, der mich liebt.“
Er sah mitleidig auf sie nieder. Und dann plauderte er weiter, erzählte von Cuyta und entwarf ein so anschauliches Bild vom Leben und Treiben dort, dass Hanna ihm wie gebannt lauschte.
Dann wurde es Zeit, ins Hotel zurückzukehren, wo Tante Helena schon auf die beiden jungen Menschen wartete, um gemeinsam mit ihnen Tee einzunehmen.
Es folgte eine sehr angeregte Stunde. Roby ließ durch einen Kellner Wasser bringen zum Abwaschen der eingekauften Früchte, und dieser brachte Fingerschalen mit. Behutsam wurden die herrlichen Früchte gewaschen und verzehrt. Hanna fand sie wundervoll, und auch die beiden anderen langten zu, da Hanna allein die große Portion nicht bewältigen konnte.
Nach dem Tee machte man eine Rundfahrt durch die Hafenstadt. Dann aß man zusammen im Hotel zu Abend. Gegen zehn Uhr zog man sich auf seine Zimmer zurück. Hanna hätte aber auch dann nicht gleich schlafen können, wenn nicht tausend aufregende Gedanken den Schlaf von ihren Lidern gescheucht hätten. Es war unglaublich laut in dieser Stadt. Sehr spät sank sie in einen tiefen Schlaf und wachte erst auf, als Tante Helena ihr leise über das Haar strich. Sie hatten die Verbindungstür zwischen ihren Zimmer offen gelassen, und nun hatte die Tante schon eine ganze Weile ihre reizende Nichte beobachtet, wie sie so friedlich, mit leicht geröteten Wangen, vor ihr lag.
Als Hanna aufwachte, sah sie ein wenig erschrocken auf die Tante. „Träume ich noch? Oder – nein, bist du wirklich da, Tante Helena!“
Diese setzte sich auf Hannas Bett und strich ihr das Haar aus der Stirn. „Du meinst wohl, dass du nur geträumt hast, in Chile zu sein?“
Hanna richtete sich empor und fasste die Hand der Tante. „Wäre es ein Wunder, wenn ich nur geträumt hätte? Aber – ich habe wirklich einige Stunden ganz fest geschlafen, nachdem ich glaubte, es würde überhaupt nicht gehen. Es war furchtbar laut draußen.“
Tante Helena lächelte. „Ja, Hanna, wenn wir hierher kommen, dann wissen wir schon, dass wir wenig Schlaf haben werden, noch schlimmer ist das in Buenos Aires. Aber lass dir sagen, dass nachts in Cuyta eine märchenhafte Stille herrscht. Straßenlärm wie hier kennen wir nicht. Nun, wir werden nur noch eine Nacht hier verbringen, dann reisen wir heim. Stunden um Stunden fahren wir mit der Bahn, Hanna, und man wird während dessen durch einen scheußlichen Staub belästigt. Aber wir haben darin schon einige Erfahrung und sorgen für jede mögliche Erleichterung. Also gar zu schlimm wird es nicht werden.“
„Ich fürchte mich auch nicht, Tante Helena, desto schöner wird es in Cuyta sein. Denke dir, Roby will mir sogar ein Pferd zureiten. Ob ich das annehmen darf?“
„Es wird dir wohl gar nichts anderes übrig bleiben. Wir reiten alle, sogar unsere hochbetagte Großmutter. Cuyta ohne Reitpferd ist kaum denkbar. Und auf Roby kannst du dich verlassen, er ist der zuverlässigste Mensch, den du dir denken kannst.“
Hanna stieg eine leichte Röte ins Gesicht, als sie erwiderte: „Das merkt man ihm gleich an. Alles an ihm scheint so vertrauenswürdig.“
„Es freut mich, dass du das gleich herausgefunden hast, er ist ein wenig mein Verzug; und ich male mir manchmal aus, dass mein kleiner Sohn auch ein solcher Mann geworden wäre und Roby ähnlich sein müsste.“
Hanna streichelte teilnehmend die Hände der Tante. „Arme Tante Helena, wie viel hast du verloren!“
Helena Curtius sah mit feuchten Augen vor sich nieder. „Du kannst nicht ahnen, wie viel ich verloren habe, mein Kind, mögest du es niemals ermessen können. Aber lass uns nie mehr davon sprechen, es reißt immer wieder alte Wunden auf. Und nun musst du aufstehen, Roby steigt schon unten auf der Terrasse herum und lechzt sicherlich nach dem Frühstück.“
„Oh, dann muss ich mich beeilen.“
„Nun, lass dir immerhin Zeit! Während du dich ankleidest, erzählst du mir, wie ihr über all das Schlimme hinweggekommen seid, das ihr drüben erlebt habt. Nach dem Frühstück wollen wir Einkäufe machen. Ich habe gesehen, dass deine Garderobe nicht sehr reichhaltig ist. Wir müssen sie vervollständigen, denn für ein Jahr muss es ausreichen. Liegt dir sehr viel daran, durch schwarze Kleider deiner Trauer Ausdruck zu geben? Es ist bei unserem Klima etwas beschwerlich – und ich denke mir, du trauerst in der Hauptsache im Herzen um deine liebe Mutter. Du siehst, ich habe auch keine Trauer angelegt. Und wenn du auch nicht schreiende Farben tragen wirst, ich denke, Weiß ist sehr angenehm und wird dich gut kleiden.“
Hanna küsste ihr die Hand. „Bestimme du, Tante Helena! Mutter wird es mir nicht anrechnen, wenn ich keine schwarzen Kleider trage.“
„Ganz gewiss nicht, dazu kannte ich deine Mutter viel zu gut. Ich habe sie sehr lieb gehabt, und ihr früher Tod hat mir außerordentlich wehgetan. Wie gern hätte ich sie zu mir gerufen, aber ich wagte ihr das nicht zuzumuten. Und – als ich einmal bei ihr anfragte, ob ich euch irgendwie helfen könne, hat sie mich gebeten, nie wieder danach zu fragen, ihr hättet euer Auskommen, wenn es auch bescheiden sei. Und damit musste ich mich abfinden.“
„Unser Einkommen reichte auch aus für unsere Bedürfnisse, Tante Helena, aber trotzdem war ich sehr froh, als du mich riefst. Zuletzt waren wir sehr knapp daran. Ich hatte gerade wieder meine Stellung verloren, und es wäre mir schwer geworden, eine andere zu finden.“
„Nun, du wirst jetzt keine mehr brauchen.“
„Aber ich hoffe, dass ich mich in Cuyta nützlich machen kann. Ich arbeite gern und will alles tun, was mir aufgetragen wird.“
„Keine Angst, Hanna, wir haben jeder irgendeine Aufgabe zu erfüllen, und du wirst auch eine finden.“
„Das macht mich froh.“
Tante Helena begab sich nun in ihr Zimmer zurück, um ihre eigene Toilette zu beenden. Hanna beeilte sich sehr, nahm in dem anstoßenden Badezimmer eine kalte Dusche, machte einige gymnastische Übungen und war dann schnell angekleidet, zeitig genug, um die Tante nicht warten lassen zu müssen. Sie gingen hinunter auf die Terrasse, wo Roby ihnen mit leuchtenden Augen entgegenkam.
„Ihr beiden wirkt wie Mutter und Tochter, und man weiß nicht, welche von beiden die Schönere ist“, sagte er, sie begrüßend.
Tante Helena sah ihn lächelnd an. „Für Hanna ist das kein Kompliment.“
Diese nickte Roby lächelnd zu. „Ich betrachte es als ein solches, Roby.“
„Dann bist du sehr vernünftig, Hanna, ich sehe nicht ein, warum eine voll erblühte Rose nicht ebenso schön sein soll wie eine halb entfaltete Knospe.“
„Roby, wo hast du gelernt, solche poetischen Komplimente zu machen?“
„Die kommen bei mir ganz von selbst, Tante Helena, du hast mir dergleichen nur noch nicht zugetraut.“
Sie nahmen am gedeckten Frühstückstisch Platz, und Roby versicherte, dass er einen Riesenhunger habe.
Nach dem Frühstück brachen die Damen zu ihren Einkäufen auf, Roby dagegen hatte Geschäftliches zu erledigen.
So trennte man sich.
Tante Helena stattete Hanna so ganz nach ihrem Herzen aus, als sei sie ihre Tochter. Diese wehrte immer wieder ab, es sei alles zu viel und zu schön für sie. Die Tante schüttelte jedoch lächelnd den Kopf.
„Lass mich nur, es macht mich froh, dich recht schön auszustatten. Ich habe doch für keinen Menschen zu sorgen. Bei meinem guten Einkommen kann ich mir schon die Freude machen.“
Als sie alle drei zur Mittagszeit im Hotel wieder zusammentrafen, berichtete Hanna Roby aufgeregt, dass Tante Helena sie wie eine Prinzessin ausgestattet habe.
Roby nickte sehr einverstanden. „So muss es sein, wir wollen uns an dir freuen. Wie ist es, habt ihr auch ein Reitkleid ausgesucht?“
„Selbstverständlich, Roby, denkst du, dass ich das vergessen könnte? Dreiviertel des Tages sitzen wir doch auf dem Pferderücken.“
Hanna machte große Augen. „So viel reitet ihr?“
„Freilich, Cuyta ist so umfangreich, dass wir nicht viele Wege zu Fuß zurücklegen können. Das wirst auch du bald einsehen lernen. Roby wird dir gleich nach unserer Heimkehr Reitunterricht geben, er versteht sich darauf.“
Roby und Hanna sahen sich an, und Hanna wurde wieder rot, was Roby mit Vergnügen feststellte.
Der Rest des Tages wurde dem Vergnügen gewidmet. Man besuchte ein Kino, machte eine Ausfahrt an den Hafen und speiste dann gemeinsam im Hotel. Sie gingen früh zur Ruhe, und Roby gab Hanna den Rat, sich möglichst wenig um den Lärm draußen zu kümmern, es werde weder jemand erschlagen noch geschähe sonst etwas Wichtiges. Man unterhalte sich nur in dieser Stadt mit Vorliebe des Nachts recht laut und ungeniert.
Sie versprach, es tun zu wollen, soweit es ihr möglich sein würde.
Er sah sie mahnend an. „Du musst unbedingt ruhen, Hanna, wir treten morgen eine sehr beschwerliche Reise an. Nach der Bahnfahrt haben wir noch eine achtstündige Autofahrt vor uns, die nicht über die besten Wege führt. Also ruhe dich aus! In Cuyta darfst du dann schlafen so lange du willst, bis du dich wieder völlig erholt hast.“
Sie lächelte ihm zu. „Du kannst mich nicht erschrecken – ich freue mich auf die Weiterreise.“
***
Hanna schlief wirklich, trotz des Lärms, viel besser als in der vorigen Nacht und war schon munter, als sie hörte, dass Tante Helena sich erhob, Schnell wurde das Bad genommen, der Anzug beendet, und dann die letzten Sachen in die Koffer gepackt, die zur Bahn geschafft wurden. Von der letzten Station nahe Cuyta sollte das gesamte Gepäck mit einem Lastauto abgeholt werden. Das wusste Hanna schon, und sie staunte immer mehr über den anscheinend großen Betrieb in Cuyta.
Die drei Verwandten frühstückten zusammen und fuhren dann zum Bahnhof, wo sie den Zug schon abfahrtbereit vorfanden.
Roby war wirklich ein ausgezeichneter Reisemarschall. Die Damen brauchten sich um nichts zu kümmern, fanden auch auf ihren Plätzen alles vor, was ihnen auf der Reise Unterhaltung und Behagen verschaffen konnte.
Hanna überstand die Reise viel besser, als ihre Begleiter angenommen hatten, und Roby sprach ihr seine Bewunderung über ihre Tapferkeit aus. Sie behauptete, nach seiner Beschreibung habe sie viel Schlimmeres erwartet. Die Belästigung durch den Staub abgerechnet, sei von einer Strapaze gar keine Rede gewesen, es hätten alle nur erdenklichen Bequemlichkeiten zur Verfügung gestanden.
Er sah sie lachend an. „Schließlich willst du mir noch einreden, dass du dich schon auf die nächste Reise etwa nach Valparaiso freust?“
Auch sie musste lachen und meinte schelmisch: „Vorläufig freue ich mich auf Cuyta und auf die versprochene ungestörte Nachtruhe.“
Das Auto, das die Reisenden nach dem Rancho bringen sollte, stand an der Station bereit. Der Chauffeur hatte den Wagen blank geputzt, er war gestern schon mit zwei Dienern hier angekommen, die den Herrschaften behilflich sein und dann mit dem Gepäck und dem Lastauto zurückfahren sollten. Alles funktionierte tadellos. Der Chauffeur war ein Deutscher, den Roby für Cuyta engagiert hatte.
Roby begrüßte ihn freundlich mit einem leichten Schlag auf die Schulter und verkehrte mit ihm ganz wie mit seinesgleichen.
Auch Tante Helena begrüßte ihn sehr freundlich. In Cuyta wurde jeder Mensch nach seinen Leistungen eingeschätzt, und Fritz Bernburg war ein tüchtiger Mensch, der nicht Vergangenem zwecklos nachgrübelte, sondern sich frisch und unverzagt hier im fremden Land eine neue Position geschaffen hatte, die ihn durchaus befriedigte.
Er begrüßte Hanna mit einer weltmännischen Verbeugung, und sie erwiderte seinen Gruß in derselben Weise wie Tante Helena.
Es war sehr früh am Morgen. Die Dämmerung wich langsam aus dem Tal, das ein breiter Fluss durchzog.
Als es heller wurde, sah Hanna zum ersten Mal die Häupter schneebedeckter Berge. „Was ist das?“
Roby sah sich nach ihr um. „Das sind Berge der Cordilleren, Hanna.“
„Mein Gott! Wie schön – wie seltsam – wie wundervoll!“
Ihre Ergriffenheit rührte ihn. Lächelnd sah er in der Tante Gesicht und dann wieder in Hannas begeisterte Augen. Er schaute nur zu gern in diese Augen hinein, in denen Sonnenfunken zu leuchten schienen. Schön war Hanna Westmann – das musste er zugestehen – und er tat es sehr gern. Freude stieg in ihm auf bei dem Gedanken, dass sie jetzt täglich in Cuyta sein würde.
Er hatte bisher keiner Frau sein Inneres erschlossen. Kleine Liebschaften hatte er, wie alle jungen gesunden Männer, aber darüber hinaus war ihm keine teuer geworden. Im Grunde seines Herzens hatte er sich immer gewünscht, einmal eine deutsche Frau zu finden, wie Tante Helena eine war. Als Junge hatte ihr seine erste Schwärmerei gegolten. Nun würde ihr verjüngtes und noch verschönertes Ebenbild in Cuyta seinen Einzug halten. War das nicht eine glückliche Fügung des Himmels? Und so lauter und rein erschien ihm Hanna, dass sie ganz seinem Ideal einer Frau entsprach.
Hier gebot er seinen Gedanken Halt. Er war kein stürmischer Draufgänger, der gleich auf das Ziel seiner Wünsche losstürmte. Die von seinen Vätern ererbte ruhige, bedächtige Art ließ ihn Zurückhaltung üben, auch wenn noch so heiße Gefühle in ihm aufflammten. Aber er wusste schon heute, dass Hanna Westmann, wenn sie sich gleich blieb und wenn sie ihm die gleichen Empfindungen entgegenbrachte wie er ihr, eines Tages seine Frau, die Herrin seines Hauses, die Mutter seiner Kinder sein würde.
Und dieser Gedanke erwärmte seine Seele und erfüllte ihn mit einer glückfrohen Erwartung.
Unterwegs wurde einmal Halt gemacht, um eine vom Chauffeur mitgebrachte Mahlzeit einzunehmen. Es gab selbstverständlich nur kalte Küche, aber im Handumdrehen war von Roby und dem Chauffeur ein Feuer angezündet, und aus dem Wagenkasten kam ein kleines Kochgeschirr zum Vorschein, in dem Tee bereitet wurde.
Hanna wollte helfen und trockenes Holz holen, aber Roby hielt sie am Arm fest. „Du fasst hier vorläufig nichts an. Sieh, da drüben ist so ein giftiger Dornbusch. Ein Stich von diesen Dornen kann dir eine Blutvergiftung einbringen.“
Er führte sie an die Dornen heran, so weit, dass sie diese nicht berühren konnte. „Sieh sie dir genau an, Hanna, diese Dornen musst du meiden, wo du sie auf deinem Weg antriffst. Auf Cuyta werden sie bald genug ausgerottet sein, aber hier in der Umgegend sind sie leider noch überall zu finden.“
„Mein Gott, wenn da ein Mensch ahnungslos vorübergeht, kann er den Tod finden?“
Beruhigend lächelte er ihr zu. „Wer in dieser Gegend lebt, kennt diesen Feind. Sei also ganz ruhig, auch du wirst ihm nun ausweichen.“
Sie gingen zum Auto zurück. Tante Helena hatte aus einem kleinen Etui vier zierliche Trinkbecher herausgenommen, die nun mit Tee gefüllt wurden. Der kalte Imbiss war auf mitgeführten Pappschalen schon vorher geordnet worden. Nun wurde gespeist. Der Chauffeur saß mitten zwischen ihnen, und er und Roby sorgten für gute Stimmung. Hanna fand das Leben wunderschön.
Sorglich wurden nach der eingenommenen Mahlzeit alle unbrauchbaren Reste ins Feuer geworfen.
Nun wurden die Wege breiter, Wälder und Wiesen zeigten die sorgfältigste Pflege. Dazwischen lagen Getreide- und Gemüsefelder, große Maisfelder und riesige Obstgärten. Es hingen halbreife Früchte an den Bäumen, und manche von diesen Früchten waren Hanna ganz unbekannt.
Roby staunte über ihre Aufnahmefähigkeit, über ihre Munterkeit. Die weite beschwerliche Reise schien ihr nichts anzuhaben. Tante Helena hatte schon einige Male ein Nickerchen gemacht. Aber Hanna wollte nichts auslassen von dem, was sich dem Auge darbot, alles wollte sie wissen und sehen. Nun fuhren sie am Ufer eines Flusses entlang, der von den Bergen herabfloss und Gletscherwasser mit sich führte. In diesem Fluss war Tante Helenas kleines Söhnchen ertrunken.
Jetzt machte der Fluss eine Biegung, und nun konnte man an seinen Ufern bis zu den Wohnhäusern hinfahren. Das dauerte aber immerhin noch eine Stunde. Dann tauchten von ferne die Wohnhäuser auf. Sie lagen so, dass das größte, in dem die Großeltern wohnten, auf einem Hügel in der Mitte stand, während die beiden ein wenig kleineren rechts und links davon etwas weiter unten erstellt waren. Es waren sehr stattliche Gebäude, und ihr Anstrich leuchtete hell in den Tag hinein. Der Chauffeur ließ die Autohupe nunmehr wahre Fanfarenschreie ausstoßen, und da sah Hanna, dass es in zwei von den Gebäuden, im größten und in dem rechts liegenden, lebendig wurde. Nur das links stehende lag mit verschlossenen Läden da – es war das Tante Helenas.
Aber auch hier wurden jetzt Läden und Fenster geöffnet.
Hannas Augen ruhten wie gebannt auf den drei Häusern. Roby hatte auf die Frage des Chauffeurs, wo er vorfahren solle, geantwortet: „Zuerst bei den Großeltern.“
So fuhr denn das Auto die Straße zum Hügel hinan. Unter dem Tor des großen Hauses standen zwei Menschen, aufrecht und stolz, ein Mann und eine Frau.
Der Mann war einen Kopf größer als die Frau. Ein weißer Vollbart umrahmte ein Gesicht mit durchfurchten, aber edlen Zügen.
Das war Großvater Curtius.
Und neben ihm stand die Großmutter. Sie trug ein Kleid von schwerer schwarzer Seide, das den Oberkörper knapp umhüllte und in bauschigen Falten vom Gürtel bis zu den Füßen herabfiel. Die beiden Menschen machten einen imponierenden Eindruck, so freundlich und gütig auch ihre Gesichter waren, in denen noch viel Frische lag.
Hanna war so stark beeindruckt durch den Anblick der beiden alten Leute, dass sie zu einer tiefen Verbeugung zusammensank und sich erst aufrichtete, als der Großvater sie mit altväterlicher Ritterlichkeit emporhob.
Helena Curtius war neben Hanna getreten und sagte mit ihrer schönen, klangvollen Stimme: „Vater, Mutter, hier bringe ich euch meine Nichte Hanna Westmann und übergebe sie vertrauensvoll eurem Schutz.“
Nun wagte Hanna aufzublicken und sah in die prüfenden, aber gütigen Augen der Großmutter Curtius hinein.
Die alte Frau streckte ihr die Rechte entgegen. „Sei willkommen, mein liebes Kind! Du gehörst nun zu uns, wir bilden hier alle eine Familie, und du passt in diese hinein, weil du unserer geliebten Helena Nichte bist. Lass dich umarmen, damit du weißt, wie lieb wir dich haben wollen.“
Sie zog Hanna herzlich in ihre Arme und küsste sie auf die Stirn. Großmutter Curtius küsste keinen jungen Menschen auf den Mund, nur auf Stirn und Wangen, weil sie der Ansicht war, ein alter Mund gehöre nicht auf einen jungen.
Hanna aber beugte sich rasch herab zum Handkuss. Dabei fiel eine Träne auf diese treu sorgende Mutterhand, und damit hatte sie das Herz der Großmutter gewonnen.
„Das soll die erste und die letzte Träne sein, die du in Cuyta vergießt, mein Kind.“
Und nun schob die Großmutter dem Großvater die tief bewegte Hanna zu. „Nimm sie an dein Herz, Großvater! Ich glaube, du wirst es nie bereuen, sie ist gut und recht, das lese ich in ihren Augen.“
Der alte Herr fasste Hanna bei den Schultern, sah ihr in die Augen und nickte. „Ja, Großmutter, mir scheint, die ist gut und recht. Sei willkommen in Cuyta, Hanna Westmann!“
Nun umarmte und begrüßte Roby seinen Großvater. „Sie bringt Jugend und Leben nach Cuyta, Großvater.“
Der Großvater klopfte Roby den Rücken. „Das wollen wir hoffen, Roby. Aber sieh, da kommen deine lieben Eltern, um unser neues Familienmitglied zu begrüßen.“
Vater und Mutter Robys, zwei aufrechte, stolze Gestalten, waren herbeigekommen und begrüßten zunächst den Sohn und Helena. Dann wandten sie sich zu Hanna, die ihnen in bescheidener Haltung gegenüberstand. Helena machte sie bekannt mit Schwager und Schwägerin, und auch diese beiden hatten für Hanna gute, liebe Worte.
Helena sprach mit Schwager und Schwägerin sehr herzlich. Sämtliche Familienmitglieder lebten in Frieden und Eintracht miteinander, das sah man auf den ersten Blick. Die Welt mit ihren Kämpfen und Bitternissen lag weit entfernt; hierher wagte sich kein Unfriede.
Die Großmutter bestimmte, dass Helena mit ihrer Nichte zunächst einmal hinübergehen solle in ihr Haus, damit sie ruhen und sich erfrischen könnten.
„Ihr werdet müde sein von der Reise. Wir lassen euch jetzt ungestört. Wenn ihr zur Teestunde hinlänglich erfrischt seid, erwarten wir euch bei uns. Dann werden wir plaudern und uns mit Hanna näher bekannt machen. Auf Wiedersehen, meine Lieben!“
Damit waren alle entlassen, und das alles geschah, als könne es nicht anders sein.
Gemeinsam mit Schwager und Schwägerin ging Helena den Weg vom Hügel hinunter.
Roby folgte mit Hanna. Er sah sie fragend an. „Nun, Hanna, wie war der erste Eindruck von Cuyta?“
Mit feuchten Augen sah sie zu ihm auf. „Könntest du mir ins Herze sehen, Roby! Mir ist, als hätte ich eine Weihe erhalten. Du musst sehr glücklich sein, Roby, dass du solche Eltern und Großeltern hast. Jetzt verstehe ich erst die Ausgeglichenheit deines Wesens. Auf diesem Boden kann man ja nicht anders emporwachsen als in schöner Seelenruhe! Wie beneidenswert! Wie märchenhaft!“
Er erfasste ihre Hand. „Ich freue mich, dass das dein erster Eindruck ist – und dass du nunmehr zu uns gehörst.“
Ihre Wangen röteten sich jäh, und es lag ein banges, unsicheres Fragen in ihren Augen. „Mir ist fast Angst, so gut seid ihr alle zu mir – ich muss mir das alles erst verdienen. Und – vielleicht überschätzt ihr mich“, sagte sie leise.
Fest drückte er ihre Hand. „Wir haben hier gute Augen für Menschenwert.“
Nun waren sie am Haus von Tante Helena angelangt, und die Eltern Robys verabschiedeten sich schon von Tante Helena.
Robys Mutter legte lächelnd den Arm um Hannas Schultern und sagte zu Helena: „Jetzt ist uns unversehens ein stiller Wunsch erfüllt, wir haben nun beide ein Töchterchen. Du musst es mir zuweilen leihen, Helena.“
Diese nickte lächelnd. „Auf Cuyta behält keiner so leicht etwas für sich allein. Ich habe es in Großmutters Augen gelesen, sie freut sich, dass wir nun auch ein Töchterchen haben. Allzeit hat sie immer nur Buben um sich gehabt.“
„Ei, sind wir ihr nicht beide gute Töchter gewesen, sind wir es nicht noch?“
„Hast schon Recht, Maria, ich hatte das nur vergessen. Trotzdem wird Großmutter auch zuweilen ihren Teil an Hanna haben wollen.“
„Dabei schließt nur uns Männer nicht aus, wir machen auch unsere Rechte an sie geltend“, sagte der Vater humorvoll und fasste zart, wie man es seiner kraftvollen Gestalt gar nicht zugetraut hätte, mit beiden Händen Hannas Kopf, sah ihr in die Augen und nickte ihr zu, als sei er vollkommen einverstanden mit dem, was er in ihren Augen las.
Roby stand dabei und freute sich, dass die Eltern so zu Hanna sprachen. Auch er verabschiedete sich nun von den beiden Damen und ging mit den Eltern davon.
Tante Helena nahm die Nichte bei der Hand und sagte herzlich: „Tritt ein, bring Glück herein!“
Dann legte sie den Arm um ihre schlanke Gestalt. Sie betraten eine große, rechteckige Diele, deren Wände mit Holz getäfelt waren und an denen sich eingebaute Bänke hinzogen, auf denen bunte Kissen lagen.
Zwei Indianerinnen, schlanke junge Gestalten, kamen herbei und halfen mit freundlichem Lächeln, aber ohne ein Wort zu sprechen, den Damen abzulegen.
Dann wurde Hanna von der Tante in die erste Etage hinaufgeführt. Zuerst auf eine breite Galerie, die die Diele in halber Höhe umgab, so dass man von überall her hinunterschauen konnte. Von dieser Galerie aus führte eine Anzahl von Türen in die umliegenden Zimmer.
Helena Curtius öffnete eine der Türen und ließ Hanna eintreten. „Da ist dein Schlafzimmer, Kind. Daneben das Bad und das Ankleidezimmer. Mein Schlafzimmer und die Nebenräume liegen gleich daneben, damit du nicht das Gefühl der Vereinsamung kennen lernst. Wir können, wenn du willst, die Verbindungstüren offen lassen. Oben im zweiten Stock liegen die Gastzimmer, die Wäschekammern und die Vorratsräume. Die Dienstboten schlafen nicht in einem Haus mit uns, sie wohnen in einem der Blockhäuser. Unten im Parterre liegen die Wohn- und Speisezimmer. Eine kleine Bibliothek, die dir zur Verfügung steht, ist auch vorhanden, ebenso ein Schreibzimmer und einige andere behagliche Räume; einer davon ist mit einem Flügel versehen. So, und jetzt lasse ich dich allein. Versuche ein wenig zu schlafen, damit du zur Teestunde frisch bist.“
„Ach, Tante Helena, wie gut ihr alle seid. Das ist doch wie ein Märchen für mich.“
Die Tante lächelte. „Ja, Kind, gut sind hier wirklich alle, aber unsere kleinen Fehler und Schrullen wirst du auch noch kennen lernen. Im Ganzen hast du bei allen sehr gut abgeschnitten und kannst zufrieden sein.“
„Ist das wirklich deine Meinung, Tante Helena?“
Diese sah sie ernst und ruhig an. „Wir alle hier befleißigen uns, immer möglichst bei der Wahrheit zu bleiben. Die Unwahrheit sagen wir höchstens, um uns gegenseitig einen Schmerz zu ersparen.“
Hanna umhalste die Tante. „Wie schön ist das, Tante Helena, es tut wohl, immer wahr sein zu dürfen.“
„Nicht wahr, es hätte hier gar keinen Zweck, unwahr zu sein. Ich glaube, wir würden das gleich bei jedem spüren. Wir verstehen einander sehr gut und wissen, dass wir mit der Wahrheit am weitesten kommen. Aber nun schnell zur Ruhe!“ Damit verschwand Tante Helena.
Hanna sah sich in dem reizenden, ganz hell gehaltenen Schlafzimmer um. An den Wänden waren eingebaute Schränke aller Art. Darin konnte man viel unterbringen.
Ihr großes Gepäck war noch nicht zur Stelle, das Lastauto brauchte längere Zeit für den Weg. Aber ein Handkoffer mit dem Nötigsten war schon im Personenauto mitgekommen, und mit Erstaunen sah Hanna, dass er schon ausgepackt war. Das einzige leichte Kleid, das er enthielt, hing auf einem Bügel an einem Ständer. Frische Wäsche und auch ein Bademantel lagen im Badezimmer bereit. Mit Vergnügen legte Hanna ihre verstaubten Kleider ab. Unter der Dusche seifte sie sich gründlich ab und begab sich dann, in den Bademantel gehüllt, ins Schlafzimmer.
Wohlig streckte sie sich auf dem Ruhebett aus. Kaum dass sie lag, schlief sie auch schon ein.
***
Sie erwachte durch einen leisen Zuruf. Am Fußende des Ruhelagers stand eines der jungen Indianermädchen und lächelte sie an.
Hanna sah sie eine Weile ziemlich verschlafen an. Dann sprang sie mit einem Satz empor und wurde sich klar, wo sie sich befand. Sie wusste allerdings nicht, in welcher Sprache sie mit der Indianerin reden sollte.
Sie versuchte es mit Englisch, aber das Mädchen schüttelte lächelnd den Kopf. Hanna überlegte. Sie hatte gemerkt, dass alle Familienmitglieder Deutsch sprachen. Aber die Indianerin würde die deutsche Sprache kaum verstehen. Hanna konnte es also nur noch mit Französisch versuchen. Aber auch das verstand das Mädchen nicht.
Da sagte Hanna auf Deutsch zu sich selbst. „Ja, da muss ich erst Tante Helena fragen, wie ich mich verständlich machen kann.“
Darauf sagte das Mädchen ruhig. „Jonia versteht.“
Hanna lachte. „Also Sie sprechen deutsch, Jonia?“
„Ein wenig.“
„Und in welcher Sprache sprechen Sie sonst noch?“
„Nur Indianisch.“
„Das verstehe ich nicht. Also behelfen wir uns mit Deutsch. Wollen Sie bitte das Badezimmer in Ordnung bringen?“
„Schon geschehen, Herrin.“
Hanna sah in den kleinen Raum. Wirklich, da war schon alles in Ordnung gebracht; die Kleider hingen gereinigt an einem Bügel.
Sie nickte Jonia freundlich zu. „Dann brauche ich Sie nicht mehr. Gleich werde ich fertig sein, bitte sagen Sie das Tante Helena.“
Jonia verstand und neigte das Haupt.
Schnell machte sich Hanna fertig und fühlte sich herrlich frisch und ausgeruht.
Als sie vor Tante Helena stand, sagte sie lachend: „Ich habe vorhin mein Badezimmer nicht selbst aufgeräumt, weil ich wirklich sehr müde war. Und als ich aufwachte, war schon alles in Ordnung gebracht. Jonia, die Dienerin, muss das vollkommen geräuschlos gemacht haben, ich habe nichts gehört. Mit Vergnügen habe ich nach einigem Sondieren in Erfahrung gebracht, dass Jonia ein ganz leidliches Deutsch spricht.“
„Ja, schon ihre Eltern, die auch in Cuyta leben, haben Deutsch gelernt, und die Kinder dieser indianischen Familien sprechen es nach. Verstehen wird Jonia und auch die andere Dienerschaft alles, sprechen nur wenig. Aber die Indianer sprechen überhaupt nur das Allernotwendigste. Sie sind nicht geschwätzig, zumal die Männer nicht. Es ist sehr gut, dass du dein Badezimmer nicht aufgeräumt hast – solche Arbeiten darf man nicht tun, wenn die indianische Dienerschaft einen nicht geringschätzig betrachten soll.“
„Aber ich kann mich nicht immer und immer bedienen lassen.“
Die Tante lachte über Hannas bestürztes Gesicht. „Wir werden schon Arbeit für dich finden, das überlasse nur Großvater, der versteht aus allen Menschen gerade das herauszuholen, was sie am besten leisten können.“
„Und was werde ich zu tun haben?“
„Er wird dir schon auf den Zahn fühlen. Ich bin zum Beispiel unter seiner Leitung eine tüchtige Gärtnerin geworden, kann Rosen und Obstbäume okulieren und leite außerdem noch die Mädchenschule, die die Kinder unserer Angestellten besuchen. Also zerbrich dir vorläufig nicht den Kopf. Großvater wird dich schon anstellen, denn er weiß aus eigener Erfahrung, dass nur der Arbeiter, der seinen Fähigkeiten entsprechend beschäftigt wird, etwas Tüchtiges leistet und Freude an seiner Arbeit hat.“
„Das leuchtet mir ein. Ich glaube, ich werde hier eine ganze Menge lernen können.“





























